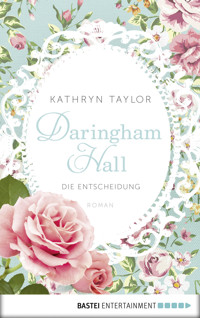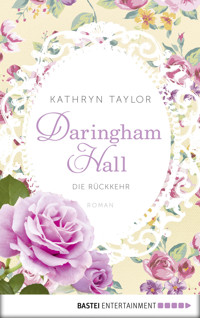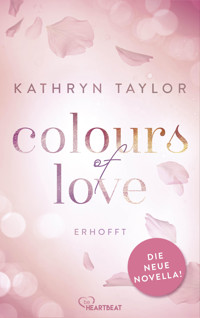9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Daringham Hall
- Sprache: Deutsch
Eine schicksalshafte Begegnung, ein lang verborgenes Geheimnis, ein verlorenes Erbe.
Die Familienverhältnisse auf Daringham Hall im malerischen East Anglia geraten durcheinander, als der IT-Unternehmer Ben Sterling auf dem Gut auftaucht. Denn Ben ist der eigentliche Erbe - und nun sinnt er auf Rache an der Familie, die seine Mutter so schlecht behandelte.
Doch dann verliert er durch einen Überfall das Gedächtnis und gewinnt einen ganz anderen Blick auf Daringham Hall und seine Bewohner. Als er sich auch noch leidenschaftlich in die Tierärztin Kate verliebt, weiß Ben nicht mehr, was er tun soll ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Titel
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Über die Autorin
Impressum
Kathryn Taylor
DaringhamHall
DAS ERBE
ROMAN
Für Rosemary und Bryan.Nirgendwo in East Anglia ist es schöner als bei euch.
Und für Martin. Immer für dich.
Prolog
Es war still im Zimmer, abgesehen von dem lauten Ticken der alten Standuhr in der Ecke, das Kate noch nervöser machte, als sie ohnehin schon war. So lange sie sich zurückerinnern konnte, hatte das wuchtige Möbelstück mit dem vergoldeten Zifferblatt und den schweren Gewichten schon hier in der Bibliothek in Daringham Hall gestanden, und wenn es ihr überhaupt aufgefallen war, dann hatte sie das monotone, verlässliche Geräusch eher beruhigend gefunden. Aber nicht heute. Denn mit jeder Bewegung des Minutenzeigers rückte der Moment näher, vor dem sie sich wirklich fürchtete.
»Ich sollte nicht hier sein.« Sie sprach noch einmal aus, was sie schon die ganze Zeit dachte, und hätte gerne dem Drang nachgegeben, sich vom Sofa zu erheben und wieder zu gehen. Aber so einfach war das nicht. Im Moment war gar nichts mehr einfach.
Unsicher blickte sie zu Ralph Camden hinüber, der in einem der Sessel saß und so in Gedanken versunken war, dass er schon seit einigen Minuten nichts mehr gesagt hatte. Für einen Moment glaubte sie schon, er hätte sie vielleicht nicht gehört, doch dann hob er den Kopf und sah sie an.
Mit seinen Anfang fünfzig hätte er ihr Vater sein können, und es hatte Zeiten in Kates Leben gegeben, in denen sie sich gewünscht hatte, er wäre es. Als Kind wollte sie unbedingt zu seiner Familie gehören und auch auf Daringham Hall wohnen, dem Ort, der für sie einem Zuhause immer am nächsten gekommen war. Hier war sie willkommen gewesen und nicht nur geduldet. Deshalb hatte sie die Camdens fest in ihr Herz geschlossen, fühlte sich ihnen zutiefst verbunden. Daran würde sich niemals etwas ändern.
Und genau das war das Problem.
Kate schluckte, denn Ralph antwortete nicht auf ihren Einwand, sondern musterte sie nur auf diese ruhige Art, die ihn so auszeichnete.
Früher hatte sie ihn gerade deshalb besonders gern gehabt. Er verhielt sich stets korrekt und brauste nicht auf, jedenfalls war sich Kate sehr sicher, dass sie ihn noch nie so laut hatte schreien und schimpfen hören wie ihre Tante Nancy. Nein, Ralph Camden blieb immer verlässlich freundlich – und das war eine Wohltat gewesen für ein Mädchen, das täglich zu spüren bekam, wie wenig es erwünscht war. Kein Wunder, dass er in Kates Fantasie damals oft die Rolle des idealen Vaters eingenommen hatte.
Aber das war er nicht, das wusste sie jetzt. Er war kein Held, und mit seiner ruhigen Art täuschte er über die Tatsache hinweg, dass es ihm an Stärke und Durchsetzungsvermögen fehlte. Hätte er beides besessen, dann wäre das, was sie alle in den vergangenen Wochen so aus der Bahn geworfen hatte und die Zukunft von Daringham Hall bedrohte, vielleicht niemals passiert. Und dann müsste sie jetzt nicht bei ihm sitzen, obwohl sie hier gar nichts verloren hatte.
»Ben wird es nicht gefallen, wenn ich dabei bin«, gab sie erneut zu bedenken und hob die Schultern in einer hilflosen Geste. »Und es geht mich auch eigentlich gar nichts an.« Verstand er das denn nicht?
Ralph seufzte, blieb aber bei seinem Standpunkt.
»Es betrifft dich auch, Kate. Es betrifft uns alle. Und außerdem …«, er zögerte, ehe er weitersprach, und seine Stimme zitterte leicht, »… kannst du Ben vielleicht eher überzeugen als ich.« Ein schwaches Lächeln huschte über sein blasses Gesicht. »Du stehst ihm von uns am nächsten, und ich glaube, du bedeutest ihm viel.«
Kate spürte, wie ihr die Kehle eng wurde, und für einen Moment wünschte sie, das wäre wahr. Doch wie wahrscheinlich war das nach den Ereignissen der letzten Tage?
»Das dachte ich auch. Aber er …« Sie brach ab, weil es an der Tür klopfte. Einen Augenblick später öffnete sie sich und Kirkby erschien im Türrahmen. Eigentlich füllte er ihn mit seinen breiten, leicht nach vorn geneigten Schultern sogar ganz aus, und der Stoff seines schwarzen Anzugs spannte über seinen muskulösen Oberarmen, die so gar nicht zu einem Butler zu passen schienen. Eher zu einem Preisboxer – was er früher angeblich auch mal gewesen war. Aber es gab viele Gerüchte über Kirkby, und Kate hatte sich abgewöhnt, jedes davon zu glauben. Sie mochte den großen Mann und verstand seine treue Ergebenheit den Camdens gegenüber. Das war etwas, das sie teilten.
»Mr Sterling ist da«, verkündete Kirkby, und Kate sog unwillkürlich die Luft ein, als er zur Seite trat, um den Weg für Ben freizugeben, der mit ernstem Gesicht den Raum betrat.
Er war einer der ganz wenigen Menschen, die neben Kirkby nicht klein wirkten, aber das war nicht der Grund, warum man ihn nicht übersehen konnte. Es lag an der selbstbewussten Art, wie er ging und wie er einen ansah mit diesen sturmgrauen Augen. Kate hatte nie eine Chance gehabt, ihnen auszuweichen, von Anfang an nicht, und auch jetzt betrog ihr Körper sie sofort wieder, denn sie spürte, wie ein Schauer sie durchlief und ihr Herzschlag sich beschleunigte.
Ben zögerte nur ganz kurz, als ihre Blicke sich trafen, und Kate sah die Überraschung auf seinem Gesicht. Er hatte sie hier nicht erwartet, und für eine Sekunde glaubte sie, dass er etwas sagen würde. Doch dann verschlossen seine Züge sich wieder und wurden zu der harten Maske, hinter die er niemanden blicken ließ. Schweigend kam er auf die Sitzgruppe in der Mitte des großen Raumes zu und blieb davor stehen, während Kate mit weichen Knien aufstand. Auch Ralph erhob sich.
»Ben.« Er sprach den Namen vorsichtig aus, so als sei er nicht ganz sicher, ob er ihn benutzen durfte.
Durfte er nicht. »Mr Sterling für Sie.« Bens tiefe Stimme klang kühl, aber Kate kannte sie gut genug, um die unterdrückte Wut zu hören, die darin mitschwang. »Dabei bleibt es.« Mit spöttisch erhobenen Augenbrauen blickte er sich im Zimmer um, dann fixierte er erneut Ralph. »Wo ist denn Ihr Bruder? Brauchen Sie heute keinen juristischen Beistand?«
»Nein.« In Ralphs Gesicht arbeitete es, und als er kurz zu Kate sah, erkannte sie die Sorge in seinem Blick. Dass er Timothy diesmal nicht hinzugezogen hatte, bedeutete ein Risiko, das wussten sie beide. Aber es war der einzige Weg, Ben vielleicht davon zu überzeugen, seine Meinung zu ändern.
Während Ralph angestrengt nach den richtigen Worten suchte, stellte Kate im Stillen erneut fest, wie wenig die beiden Männer einander ähnelten. Außer ihrem Haar, das den gleichen dunkelblonden Ton hatte, schienen sie nichts gemeinsam zu haben.
Ralph räusperte sich. »Ich … hätte da einen Vorschlag. Oder besser gesagt: eine Bitte«, erklärte er, und Kate versuchte, sich zu wappnen. Denn wenn Ben das Angebot ablehnte – und das hielt sie für sehr wahrscheinlich –, dann bedrohte er damit nicht nur Daringham Hall, sondern alles, was ihr wichtig war im Leben. Dann musste, nein, dann würde sie ihn hassen.
Und wenn er es annahm?
Kate schluckte schwer, während sie Ben betrachtete, und ihr wurde klar, dass sie dann wohl in noch viel größeren Schwierigkeiten steckte.
1
Vier Wochen zuvor
»Das ist hoffentlich nicht dein Ernst!«
Ben lächelte, als er das Entsetzen in Peters Stimme hörte, die etwas verzerrt aus der Freisprechanlage des gemieteten Jaguars klang. Draußen war gerade ein Sommergewitter aufgezogen und es regnete heftig, worunter der Empfang zu leiden schien. Aber immerhin stand die Leitung zum Büro von Sterling & Adams Networks im fernen New York, wo Peter jetzt ganz sicher vor dem Computer saß. Peter saß eigentlich immer vor einem Computer, und ihn dazu zu zwingen, dahinter hervorzukommen, bedurfte einer gewissen Überredungskunst. Oder man schaffte Fakten – was Ben grundsätzlich vorzog. Deshalb ließ er sich von Peters Reaktion nicht weiter beeindrucken, zumal er ohnehin schon damit gerechnet hatte.
»Jetzt mach kein Drama draus, Pete, okay? Es dauert eben noch ein bisschen länger als gedacht.«
»So war das aber, verdammt noch mal, nicht geplant!«, schimpfte Peter. »Du solltest drei Tage in England bleiben und nicht eine ganze Woche. Und jetzt, wo ich dachte, es ist endlich vorbei, hängst du schon wieder einen ganzen verfluchten Tag dran. Morgen eröffnest du mir wahrscheinlich, dass du beschlossen hast, für immer auf diese verregnete Insel zu ziehen.«
»Eher friert die Hölle zu«, erwiderte Ben grimmig und ärgerte sich gleich anschließend darüber, dass er das gesagt hatte. Wie sehr ihn der Aufenthalt hier aufwühlte, brauchte Peter nicht zu wissen. Der war jedoch immer noch so beschäftigt mit Bens Ankündigung, dass er gar nicht weiter darauf einging.
»Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du allerspätestens am Montagnachmittag wieder hier sein musst. Weil ich sonst nämlich gezwungen sein werde, das Meeting mit Stanford und seinen Leuten zu leiten. Und das willst du doch nicht wirklich, oder?«
Ben lachte. »Nicht, wenn es sich vermeiden lässt.« Peter war ein Computergenie, und es war vor allem seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten als Programmierer zu verdanken, dass sich ihre ehemals kleine Hinterhof-Garagen-Firma zu einem erfolgreichen und inzwischen auch international beachteten Software-Unternehmen entwickelt hatte. Doch so gut er mit Zahlen und Eingabecodes, Plattformen und Grafiken umgehen konnte, so schlecht war er mit Menschen. Deshalb hatten sie sich von Anfang an auf eine strikte Arbeitsteilung geeinigt: Ben war das Gesicht von Sterling & Adams Networks und vertrat die Firma nach außen, während Peter den gesamten technischen Bereich übernommen hatte. Das änderte allerdings nichts an der Tatsache, dass sie gleichberechtigte Geschäftsführer waren und Peter ihn deshalb, solange er sich hier in England aufhielt, in New York vertreten musste. Keine ideale Lösung, aber unvermeidlich. Denn Ben war nicht sicher, ob er übermorgen wirklich schon wieder in New York sein konnte. Das kam ganz darauf an, wie die nächsten Stunden verlaufen würden.
»Falls ich es trotzdem nicht schaffe, schickst du einfach Sienna hin. Sie übernimmt das ganz sicher gerne.«
Peter schnaubte. »Bestimmt. Ich weiß nur nicht, wie Stanford das finden wird, wenn wir ihn mit deiner Assistentin abspeisen. Du bist der Einzige, den er respektiert, das weißt du genau. Wir werden diesen Abschluss nicht kriegen, wenn du bei dem Termin fehlst.« Er machte eine Pause und schien darauf zu warten, dass Ben ihm versicherte, dass er da sein würde. Als das nicht passierte, seufzte er tief und unüberhörbar vorwurfsvoll. »Im Ernst, Ben, ich versteh’s nicht. Du hast ewig an diesem Deal gearbeitet, und jetzt, wo es darauf ankommt, bist du einfach nicht da?« In seiner Stimme schwang Ungläubigkeit mit. »So wichtig kann dein Privatkram da drüben doch nicht sein, oder?«
Ben verzog das Gesicht, weil er wusste, dass Peter recht hatte – er gefährdete das Geschäft mit Stanford, wenn er blieb. Aber diese Sache hier war dringender. Die musste er erst erledigen.
»Doch«, widersprach er seinem Freund deshalb. »Und ich weiß auch nicht genau, wie lange es noch dauert.«
Er hörte ein unwirsches Brummen am anderen Ende der Leitung, aber Peter hakte nicht nach, sondern legte nach einem gemurmelten »Dann beeil dich gefälligst« und einem knappen Abschiedsgruß auf – was genau das war, was Ben so an ihm gefiel. Wahrscheinlich war seine enge Freundschaft zu dem zehn Jahre älteren Amerikaner sogar nur deshalb entstanden. Peter hatte immer respektiert, dass Ben nicht zu den Menschen gehörte, die ihr Leben gerne vor anderen ausbreiteten – weil er in dieser Hinsicht ganz ähnlich gestrickt war. Und in diesem Fall war Ben besonders dankbar dafür, denn das hier ging wirklich nur ihn allein etwas an …
Eine Windböe erfasste den Jaguar und drückte mit so viel Kraft dagegen, dass Ben alle Mühe hatte, nicht von der schmalen Straße abzukommen. Als er den Wagen wieder unter Kontrolle hatte, blickte er überrascht zum Himmel. Erst jetzt begriff er, dass das Wetter dabei war, sich noch einmal drastisch zu verschlechtern. Die Wolkendecke, die zuvor schon dicht und drückend gewesen war, hatte eine bedrohliche Schwärze angenommen, und der Regen prasselte so heftig auf die Frontscheibe, dass die Wischerblätter kaum dagegen ankamen. Außerdem folgten Blitz und Donner in immer schnellerer Folge aufeinander – er fuhr offenbar direkt in einen Sommersturm hinein.
Ben umfasste das Steuer noch ein bisschen fester. Hatte es in dem Reiseführer, den er sich extra besorgt hatte, nicht geheißen, East Anglia sei die sonnigste Gegend Englands? Heute jedenfalls nicht, dachte er und stellte fest, dass ihm das eigentlich sogar ganz recht war. Das Wetter passte nämlich ausgesprochen gut zu seiner momentanen Gefühlslage, weil sich in ihm auch etwas zusammenbraute, je näher er seinem Ziel kam.
Weit konnte es jetzt nicht mehr sein, das bestätigte ihm der Wegweiser, den er gerade passiert hatte: noch zwei Meilen bis Salter’s End, dem Dorf ganz in der Nähe des alten Herrenhauses, zu dem er unterwegs war.
Die Leute in Daringham Hall saßen jetzt, am Samstagabend, vermutlich beim Dinner. Mit etwas Glück hatte sie der Brief seines New Yorker Anwalts schon erreicht, und vielleicht überlegten sie sich gerade, welche Konsequenzen das alles für sie haben würde. Sie würden wahrscheinlich zweifeln an dem, was er ihnen hatte mitteilen lassen, und bestimmt glauben, dass sie aus dieser Sache irgendwie wieder herauskamen. Ben lächelte grimmig. Aber da täuschten sie sich. Er hatte die letzten Tage damit verbracht, alles genau zu recherchieren, und mit dem Ergebnis würde er die feine Familie Camden konfrontieren. Persönlich. Von Angesicht zu Angesicht.
Das war so nicht geplant gewesen, eigentlich hatte das alles nur über seinen Anwalt laufen sollen. Ben wollte nicht in Erscheinung treten, sondern seinen Triumph aus der Ferne auskosten. Doch vorhin, als er schon am Flughafen gewesen war, um nach New York zurückzukehren, hatte das plötzlich nicht mehr gereicht. Da war auf einmal dieses drängende Bedürfnis in ihm gewesen, den Camdens selbst gegenüberzutreten. Er wollte ihnen in die Augen sehen, wenn sie erfuhren, wer er war und was er tun würde. Deshalb war er nicht zum Check-in gegangen, sondern zum Mietwagenschalter, wo er den teuersten Wagen genommen hatte, der noch zur Verfügung stand. Wenn schon, dann sollten diese Leute gleich wissen, mit wem sie es zu tun bekamen.
Das Bild seiner Mutter schob sich vor Bens inneres Auge, wie so häufig in den letzten Tagen. Er sah sie vor sich, wie sie blass und schwach auf dem Bett lag, vom Krebs gezeichnet und verzweifelt, weil sie ihren gerade zwölfjährigen Sohn nicht allein zurücklassen wollte. Ihr Sterben hatte sich so heiß und schmerzhaft in sein Gedächtnis eingebrannt, dass er vor der Erinnerung lange geflohen war. Doch die Vergangenheit hatte ihn nie losgelassen und so lange an seinem Unterbewusstsein genagt, dass er jetzt, mit vierunddreißig, endlich Gewissheit brauchte.
Deshalb hatte er eine Privatdetektei in London damit beauftragt, sich auf die Suche nach den Antworten zu machen, die seine Mutter ihm damals nicht gegeben hatte. Als bald danach die ersten Ergebnisse der Recherche kamen, war Ben so wütend gewesen, dass sein Anwalt in seinem Namen sofort einen Brief nach East Anglia auf den Weg gebracht hatte. Die Belege, die die Detektei ihm dann per Kurier nach New York geschickt hatte, waren ihm jedoch überraschend dürftig erschienen. Also war er kurzentschlossen selbst nach England geflogen, um sich um die Angelegenheit zu kümmern.
Ein Blitz zuckte über den Himmel, gefolgt von einem lauten Donner, und Ben konzentrierte sich mit einem unterdrückten Fluchen wieder auf die Straße. Das Gewitter schien jetzt direkt über ihm zu sein. Irgendwie hatte er langsam das Gefühl, dass sich dieses ganze verdammte Land gegen ihn verschworen hatte. Nicht nur, dass es anstrengend war, ständig daran zu denken, auf der falschen Straßenseite zu fahren, er bereute es mittlerweile auch, dass er sich ein so großes, breites Auto geliehen hatte. Den Jaguar über die südostenglischen Straßen zu manövrieren, die mit jeder Minute schmaler zu werden schienen, wäre wohl auch bei schönem Wetter kein wirkliches Vergnügen gewesen. Aber so war es echter Stress. Dazu kam noch, dass das Navi sich plötzlich nicht mehr auszukennen schien. Ben hatte keine Ahnung, ob es an der verlassenen Gegend lag, durch die er gerade fuhr, oder ob dieses dämliche Ding einfach kaputt war, aber der Bordcomputer zeigte schon seit ein paar Minuten »Offroad« an, und auf dem Bildschirm des Navis bewegte sich der Punkt, der der Jaguar sein sollte, über eine schwarze Fläche. Kein Signal mehr. Und natürlich gabelte sich ausgerechnet jetzt die Straße vor ihm.
Ben hielt den Wagen an und griff nach seinem Smartphone, um die Navi-App einzuschalten, die hoffentlich besser funktionierte. Tat sie jedoch nicht. Genau genommen tat das gesamte Handy gar nichts mehr, was auch nicht wirklich verwunderlich war, denn Ben fiel wieder ein, dass es vorhin bei dem Gespräch mit Peter schon eine sehr schwache Akkuleistung gemeldet hatte.
»Na, großartig«, murmelte er halblaut und warf es zurück auf den Sitz, dann starrte er frustriert durch den Regen auf die Straßengabelung. Er hatte keine Ahnung, welcher Weg der richtige war, aber da Geduld noch nie zu seinen Stärken gehört hatte, machte er das, was er in solchen Situationen immer tat: Er traf eine Entscheidung. Nach links. Dahin würde er fahren. Sollte sich das als falsch erweisen, konnte er schließlich immer noch umkehren.
Nach einer halben Meile wurde ihm jedoch klar, wie kompliziert selbst ein einfaches Wendemanöver sein würde. Die Straße mutierte nämlich immer mehr zu einer Art geteertem, von einer dichten Hecke eingefassten Feldweg. Es gab gerade genug Platz für ein Fahrzeug, und wenn ihm jetzt jemand entgegenkam, hätte er die ganze Strecke zurücksetzen müssen – eine Aussicht, die seine Laune nicht verbesserte. Dieses verfluchte Eng …
»Scheiße!« Er trat die Bremse voll durch, um den gelben Kleinwagen nicht zu rammen, der ganz plötzlich vor ihm auf dem Weg aufgetaucht war. Der Jaguar rutschte und schlingerte noch ein Stück, aber Ben schaffte es, ihn zum Stehen zu bringen, bevor er mit dem Heck des anderen Autos kollidierte.
Wie erstarrt saß er einen Moment lang am Steuer und wartete darauf, dass sein Herzschlag sich beruhigte. Dann sprang sein Gehirn wieder an, und ihm wurde klar, dass der andere Wagen nicht gefahren war, sondern stand. Deshalb war Ben ihm fast draufgefahren. Weil dieser Vollidiot hier offensichtlich parkte.
Ben war kurz davor, den Fahrer wissen zu lassen, was er von dieser Aktion hielt, als er im Licht der Scheinwerfer erkannte, dass hinten im Fond des anderen Wagens drei Leute saßen. Junge Frauen, wenn er das richtig sah, von denen eine auffällig lilafarbene Haare hatte. Alle drei blickten ihn durch die Scheibe an und redeten dann aufgeregt miteinander. Vielleicht standen sie hier, weil sie eine Panne hatten, und brauchten Hilfe?
Ben stieg aus dem Wagen, ohne sich die Mühe zu machen, sein Jackett wieder anzuziehen. Es regnete so heftig, dass sein Hemd sofort durchnässt war, und daran hätte auch eine Stofflage mehr nichts geändert. Mit wenigen Schritten war er an der Fahrertür des anderen Wagens.
»Hallo?« Er klopfte gegen die Scheibe, hinter der er die Fahrerin, eine junge Frau mit wasserstoffblonden Haaren, jetzt deutlich erkennen konnte. Zusammen mit der Schwarzhaarigen auf dem Beifahrersitz waren es also fünf, und sie waren alle blutjung, höchstens zwanzig, schätzte Ben. Aber hilfebedürftig wirkten sie nicht, eher genervt über sein Auftauchen, denn die Wasserstoffblonde starrte ihn feindselig an, bevor sie die Scheibe einen Spalt breit herunterkurbelte.
»Was willst du, Alter?« Ihre herausfordernde Frage wurde fast vom nächsten Donnergrollen verschluckt, deshalb beugte Ben sich nah zu ihr herunter – und runzelte die Stirn. Er war nicht ganz sicher, aber es sah aus, als hätte sie weiße Spuren um die Nase herum. Und sie wirkte auch irgendwie … aufgedreht. High.
Bens Miene verdunkelte sich, als ihm klar wurde, dass das der Grund sein musste, warum die Mädchen auf dieser abgelegenen Straße parkten. Sie hatten gekokst und wollten dabei nicht gestört werden. Wobei zweifelhaft war, ob sie geglaubt hatten, dass hier bei diesem Wetter niemand vorbeikommen würde – oder ob sie schon unter Drogeneinfluss gestanden hatten, als sie die Entscheidung trafen.
In jedem Fall war es keine gute Idee. Ben hatte selbst in seiner Jugend genug Fehler gemacht, um das zu wissen. Aber letztlich ging ihn das nichts an. Wichtig war nur eins.
»Würden Sie bitte weiterfahren? Sie versperren die Straße.«
»Ach ja? Und wenn ich das nicht tue?«
Die Wasserstoffblonde klang immer noch aggressiv, blickte ihn provozierend an, und Ben verlor langsam die Geduld. Nicht nur, dass er wegen dieser dämlichen GPS-Störung nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob er auf dem richtigen Weg war, jetzt war er auch noch nass bis auf die Knochen und durfte sich mit trotzigen, zugedröhnten Teenagern herumschlagen. Es reichte. Wirklich.
Er wischte sich den Regen aus dem Gesicht und legte den Arm auf das Autodach, beugte sich vor.
»Sie können auch gerne hier bleiben«, sagte er, ohne es höflich zu meinen, und begegnete dem Blick der Fahrerin mit eisiger Entschlossenheit. Normalerweise hätte er es mit Charme versucht, weil man bei Frauen mit einem Lächeln oft schneller ans Ziel kam. Aber er hatte einfach keine Lust mehr auf diese Situation, deshalb deutete er auf eine Feldeinfahrt, die er ein paar Meter weiter entdeckte. »Aber dann setzen Sie Ihren Wagen da rein und lassen mich vorbei. Ich habe es eilig.«
Seine Angestellten in New York hätten spätestens jetzt gemacht, was er sagte – weil sie ihn gut genug kannten, um zu wissen, wann der Bogen überspannt war. Die Wasserstoffblonde wirkte jedoch nicht beeindruckt. Sie drehte sich zu den anderen im Wagen um und sagte halblaut etwas, das Ben wegen des prasselnden Regens nicht hören konnte. Dann stieß sie mit Wucht die Autotür auf, sodass Ben schnell zur Seite ausweichen musste, um nicht getroffen zu werden, und stieg aus. Auch die Tür auf der anderen Seite öffnete sich, und einen Augenblick später standen alle fünf Mädchen vor ihm auf dem Weg.
»Kann man hier nicht mal in Ruhe einen durchziehen? Die Straße gehört doch nicht dir und deinem Luxusschlitten, du Penner!« Die Wasserstoffblonde machte einen Schritt auf Ben zu, doch Ben wich nicht zurück. Was glaubte die Kleine denn – dass er Angst vor ihr hatte?
»Ich möchte nur vorbei«, wiederholte er noch einmal und hielt dem Blick der jungen Frau stand, die sich jetzt direkt vor ihm aufbaute. Sie war genauso durchnässt wie er, doch sie schien das nicht mal zu bemerken, und auch ihre Freundinnen störten sich offensichtlich nicht daran, dass ihnen die Kleidung – durchweg billige, sehr knapp geschnittene Sachen – am Körper klebte. Stattdessen waren sie alle auf ihn konzentriert, und keine von ihnen lächelte.
Ben seufzte innerlich. Ehrlich, das wurde von Minute zu Minute besser.
»Hört zu, ich bin wirklich nicht auf Streit aus«, sagte er und gab sich trotz seiner Ungeduld Mühe, ruhig zu bleiben. Konnten diese Mädchen denn nicht einfach vernünftig sein und ihn vorbeilassen?
Die Wasserstoffblonde wandte sich zu ihren Freundinnen um, so als müsste sie sich noch einmal rückversichern. Dann blickte sie mit einem zufriedenen, fast triumphierenden Gesichtsausdruck zurück zu Ben.
»Du vielleicht nicht, Arschloch. Aber wir schon«, sagte sie und schlug ihm mit der geballten Faust so fest in den Magen, dass er überrascht aufkeuchte.
2
Toby hob den Kopf und knurrte leise und tief, so als hätte er draußen etwas gehört, was sein Misstrauen weckte, und Kate, die neben ihm kniete, musste unwillkürlich lächeln. Sie hatte keine Ahnung, was die Aufmerksamkeit des Airdale-Terriers erregt haben mochte – draußen tobte jetzt schon seit einer ganzen Weile ein heftiges Sommergewitter, und für Kates Ohren waren das Krachen des Donners und das Klappern der Fensterläden, an denen der Wind riss, viel zu laut, um etwas anderes wahrzunehmen. Aber dass Toby sich überhaupt geregt hatte, war ein gutes Zeichen.
»Seine Lebensgeister scheinen zurückzukehren.« Sie erhob sich von ihrem Platz neben der Hundedecke vor dem Kamin und lächelte Amanda Archer an, die in einem Sessel ganz in der Nähe saß. »Ich denke, er ist bald wieder fit.«
»Sind Sie sicher?« Die alte Dame schien das noch gar nicht wirklich glauben zu können, denn in ihrem Blick lag weiterhin Sorge. Kate verstand das, Toby war nämlich in einem erbarmungswürdigen Zustand gewesen, als sie vor ein paar Stunden hier angekommen war. Sie hatte sofort erkannt, dass er alle Anzeichen für eine Vergiftung zeigte und sie schnell handeln musste, um ihn zu retten. Zum Glück hatte die Therapie bei ihm sehr gut angeschlagen, und das Schlimmste war jetzt eindeutig überstanden.
»Ja, ich bin ganz sicher«, versprach sie und bückte sich noch mal, um den Terrier, der sich wieder auf der Decke ausgestreckt hatte, das lockige Fell zu kraulen. »Nicht wahr, mein Hübscher? Du kommst wieder ganz in Ordnung.«
Der große Hund wedelte verhalten mit dem Schwanz und versuchte, Kates Hand zu lecken, was sie als weiteres gutes Zeichen wertete. Und auch Amanda schien endlich glauben zu können, dass es noch mal gut gegangen war, denn sie strahlte jetzt. Allerdings nur für einen Moment. Dann kehrten ihre Selbstvorwürfe zurück.
»Ich hätte diesen neuen Dünger nicht kaufen dürfen«, sagte sie und schob sich in einer unbewussten Geste ihr grau-durchsträhntes Haar hinter das Ohr. »Aber wer ahnt denn schon, dass heutzutage sogar Hornspäne mit Chemie versetzt sind!«
»Das konnten Sie nicht wissen«, beruhigte Kate sie, während sie ihre Instrumente und die Medikamente zurück in ihre Tasche packte. »Und es ist ja auch noch mal gut gegangen.«
»Aber nur dank Ihnen!«, sagte die alte Dame ernst. »Wenn Sie nicht so schnell gekommen wären …« Tränen traten in ihre Augen, und Kate drückte tröstend ihre Hand.
»Das war doch selbstverständlich.«
»Nein, das war es nicht«, beharrte Amanda. »Heute ist Samstag, aber Sie sind trotzdem gekommen – das vergesse ich Ihnen nie. Es ist ein Segen, dass Sie wieder zurück nach Salter’s End gekommen sind. Ich wusste, dass Toby es schafft, wenn Sie ihn behandeln. Sie geben nie auf.«
Das Kompliment freute Kate, doch sie fand trotzdem nicht, dass sie etwas Außergewöhnliches geleistet hatte. Schließlich war sie genau dafür Tierärztin geworden. Was nicht ganz leicht gewesen war, weil sie ihr Studium gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Tante durchgesetzt hatte und auch ganz ohne Hilfe finanzieren musste. Aber an Tagen wie heute wusste sie, dass die Mühe sich gelohnt hatte.
Und was ihre Rückkehr anging, war ihr keine Entscheidung jemals so leichtgefallen. Auch wenn nicht alle Erinnerungen gut waren, die sie mit diesem Ort verband, hatte sie dennoch das Gefühl, hierher zu gehören. Das Land und die Menschen waren ihr ans Herz gewachsen und gaben ihr Sicherheit. Deshalb war sie nur ungern weggegangen, um zu studieren, und hatte sofort zugegriffen, als der alte Dorftierarzt ihr anbot, in seine Praxis einzusteigen.
Amanda standen immer noch Tränen in den Augen. »Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Ich habe doch nur noch Toby.«
Sie sprach nicht weiter, doch Kate las in ihrem Gesicht, wie wenig sie den Tod ihres Mannes bisher verkraftet hatte. John Archer, der lange Jahre als Wildhüter auf Daringham Hall gearbeitet hatte, war Anfang letzten Jahres ganz plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Seitdem lebte Amanda allein in diesem Haus, das von dem neuen Jagdaufseher nicht mehr genutzt wurde – er wollte lieber näher am Dorf wohnen. Bis jetzt hatte Kate sich nie Gedanken darüber gemacht, wie lange das mit der alten Dame hier draußen im Wald noch gut gehen konnte. Sie war mit ihren Anfang siebzig eigentlich noch sehr rüstig, aber sie litt an einer Arthritis in den Kniegelenken, die ihr das Gehen an manchen Tagen erschwerte. Deshalb würde sie über kurz oder lang sicher Unterstützung brauchen.
»Kann Ihre Tochter denn nicht kommen und Ihnen ein bisschen helfen?«
Amanda zuckte mit den Schultern. »Es ist ein weiter Weg von Kent bis hier rauf. Aber sie kommt mich mit meiner Enkelin besuchen, sooft sie kann.« Sie lächelte. »Jetzt schauen Sie nicht so, Kate. Noch bin ich keine hilflose alte Frau. Wirklich«, sagte sie, und Kate nickte.
Sie verstand Amandas Wunsch, in dem Haus zu bleiben, in dem sie so viele Jahre mit ihrem Mann gelebt hatte. Es steckte sicher voller Erinnerungen, die sie nicht aufgeben wollte. Und wenn der Tag kam, an dem es nicht mehr ging, konnte sie immer noch in eines der Häuser im Dorf ziehen. Den Camdens gehörten viele davon, und sie würden die Witwe ihres alten Jagdaufsehers bestimmt nicht im Stich lassen.
»Okay, dann sehe ich morgen früh noch mal nach Toby«, erklärte sie Amanda. »Nur für den Fall, dass …«
Ein Blitz zuckte draußen vor dem Fenster, direkt gefolgt von einem lauten Donner, der das ganze Haus erschütterte und die beiden Frauen zusammenzucken ließ.
»Ich glaube, Sie sollten da jetzt nicht rausgehen«, sagte Amanda atemlos. »Sie können gerne hierbleiben, bis das Gewitter vorbei ist.«
Kate sah auf die Uhr. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber das geht nicht. Ich muss noch in Daringham Hall vorbei.« Dringend sogar, denn die Stute von Ralph Camdens Nichte Anna war hochtragend, und Kate hätte eigentlich schon am Nachmittag noch mal nach ihr sehen sollen. Das hatte wegen Toby nicht geklappt, trotzdem wartete man dort bestimmt schon auf sie. »Aber ich helfe Ihnen noch schnell, die Läden zu schließen.«
»Das müssen Sie nicht. Ich lasse sie immer offen«, widersprach Amanda, und Kate runzelte die Stirn, weil sie das im Moment für keine gute Idee hielt.
»Es ist aber sicherer«, beharrte sie und meinte damit nicht nur das Wetter. In der letzten Zeit hatte es hier in der Gegend eine ganze Serie von Einbrüchen gegeben, bei denen die Häuser und Wohnungen vollkommen verwüstet zurückgelassen worden waren. Deshalb ging die Polizei bei dem oder den Tätern von einem sehr hohen Gewaltpotenzial aus. Bisher waren die Bewohner während der Überfälle zwar nie zu Hause gewesen, aber man konnte ja nie wissen.
Als wollte er ihre Befürchtungen bestätigen, hob Toby plötzlich erneut den Kopf und knurrte, diesmal länger und lauter, bevor er erschöpft zurück auf sein Kissen sank und die Augen wieder schloss. Kate war ziemlich sicher, dass er zur Tür gelaufen wäre, wenn er sich nicht so schlapp gefühlt hätte, und das bestärkte sie in ihrem Entschluss, das Haus so gut zu sichern wie möglich, bevor sie ging. Als Bewacher würde der Hund nämlich noch für eine Weile ausfallen.
Rasch ging sie deshalb in den Flur, zog sich Schuhe und Jacke an und war an der Tür, bevor Amanda sie aufhalten konnte.
Draußen regnete und stürmte es so heftig, dass Kate sich richtig gegen den Wind stemmen musste, um die Läden zu schließen, die alt und schwergängig waren. Doch irgendwann hatte sie auch den letzten zugeklappt und hörte erleichtert, wie Amanda ihn von innen verriegelte.
Schnell, um dem schlechten Wetter zu entkommen, bog sie um die Hausecke – und erstarrte, als sie die dunkle Gestalt sah, die im Licht der zuckenden Blitze gebückt auf das Cottage zuschlich.
***
Nur mühsam gelang es Ben, die Augen wieder zu öffnen. Er musste für einen Moment bewusstlos gewesen sein, denn als er sich stöhnend aufrichtete, stellte er fest, dass er im Gebüsch am Straßenrand lag. Und er war allein. Von den Mädchen fehlte jede Spur, und auch ihr Wagen war verschwunden – genauso wie der Jaguar, den sie ebenfalls mitgenommen hatten.
Der Schock über das, was passiert war, sank nur ganz langsam in sein Bewusstsein. Er konnte es einfach nicht fassen, mit welcher Kaltschnäuzigkeit und Brutalität diese jungen Frauen über ihn hergefallen waren. Unablässig waren plötzlich Schläge und Tritte von allen fünf gleichzeitig auf ihn eingeprasselt. Er konnte vermutlich von Glück sagen, dass ihn recht schnell irgendein Hieb so hart am Kopf getroffen hatte, dass er zu Boden gegangen war. Wer weiß, ob sie sonst überhaupt wieder von ihm abgelassen hätten. Er hatte keine Ahnung, was sie zur Flucht bewegt hatte, aber jetzt waren sie weg – und er ziemlich übel zugerichtet.
Vorsichtig berührte er seine aufgeplatzte, blutende Lippe und stöhnte auf, weil die Bewegung einen stechenden Schmerz in seiner Rippengegend verursachte. Am Oberkörper hatte er die meisten Schläge einstecken müssen, deshalb fiel ihm das Atmen ein bisschen schwer, als er sich aufrichtete. Und das linke Bein konnte er nicht richtig belasten, da stimmte etwas nicht mit seinem Knie.
Für einen Moment stand er einfach nur da, starrte durch den heftigen Regen auf die Felder und den Wald, die ihn umgaben. Dann fluchte er heftig, weil er seinem Frust darüber Luft machen musste, dass er tatsächlich mitten in einem extrem ungemütlichen Sommersturm irgendwo auf einer gottverdammten englischen Landstraße stand und kein Auto mehr hatte. Und das war nicht mal sein größtes Problem. Im Jaguar lagen seine ganzen Sachen: Koffer, Handy, Geld, Ausweise – und die Kopien der Unterlagen, die er den Camdens hatte zeigen wollen. Alles weg. Alles.
Was jetzt? Wütend auf sich selbst, weil er so überheblich gewesen war und die Gefahr völlig falsch eingeschätzt hatte, blickte Ben sich im Licht der schnell aufeinander folgenden Blitze um, die die Umgebung erhellten. Er hasste es, hilflos zu sein, und wollte diesen Zustand so schnell wie möglich ändern. Deshalb musste er das nächste Dorf oder wenigstens einen Bauernhof finden, von dem aus er die Polizei benachrichtigen konnte. Die Mädchen würden nicht weit kommen mit dem auffälligen Mietwagen – das war zumindest ein Trost.
Doch da war nichts außer Feldern auf der rechten Seite der Straße und einem Wald auf der linken. Oder …?
Ben kniff die Augen zusammen und starrte in die Dunkelheit, die nach den grellen Blitzen für einen Augenblick fast schwarz wirkte. Mitten in dem recht dicht bewachsenen Waldstück glaubte er, ein Licht zu sehen. Mit ein bisschen Glück waren das die beleuchteten Fenster eines Hauses, und allzu weit konnte es nicht entfernt sein.
Mit neuer Entschlossenheit verließ er die Straße und lief durch das Waldstück. Erst durch die Bewegung merkte er, wie angeschlagen er tatsächlich war, denn jeder Schritt schmerzte, und er musste ein wenig vornübergebeugt gehen, um überhaupt durchzuhalten. Das Wetter tat ein Übriges, denn unter dem Blätterdach regnete es zwar etwas weniger heftig, dafür ächzten die Bäume unter den starken Windböen, und Ben hatte Mühe, den teilweise auch größeren Ästen auszuweichen, die immer wieder auf den Waldboden fielen.
Er beeilte sich, so gut er konnte, und je näher er dem Licht kam, desto optimistischer war er, dass er tatsächlich auf ein Haus zuging. Irgendwann erkannte er es auch, es war ein kleines, zweistöckiges, von mehreren Schuppen umgebenes Cottage, das mitten auf einer Lichtung lag. Das Licht, das aus den Fenstern drang, war jetzt schwächer als zuvor, weil offenbar jemand die Läden geschlossen hatte, aber er konnte die Konturen trotzdem noch erkennen. Auf den letzten Metern stieß er außerdem auf einen gepflasterten Weg, der ihm das Laufen leichter machte.
Obwohl er nicht verstehen konnte, wie es jemand in dieser Einsamkeit aushielt, war ihm noch nie etwas einladender vorgekommen. Er humpelte an dem Land Rover vorbei, der vor dem Cottage geparkt war, und hielt auf die Haustür zu. Nur noch ein paar Schritte, und er konnte sich ausruhen. Offensichtlich hatte das Glück ihn also noch nicht ganz verlass …
»Stehenbleiben!«, rief plötzlich eine Stimme.
Überrascht fuhr Ben herum und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Im Halbdunkel des Sturms und dem Regen, der hier auf der Lichtung wieder unablässig auf ihn herunterströmte, konnte er die Gestalt zu seiner Rechten nicht richtig erkennen, deshalb machte einen Schritt auf sie zu, sah zu spät, dass sie einen Arm drohend erhoben hatte.
»Hey, was …?«
Etwas Hartes traf ihn seitlich am Kopf und ließ alles um ihn herum schwarz werden.
3
»Oh Gott!« Entsetzt ließ Kate den Scheit Kaminholz in ihrer Hand fallen und starrte auf den Mann hinunter, den sie damit niedergestreckt hatte. Er lag vor der Haustür, die Amanda in diesem Moment öffnete – wahrscheinlich weil sie das Poltern seines Falls gehört hatte.
»Kate, ist alles in … Oh!« Erschrocken blickte sie auf den bewusstlosen Mann zu ihren Füßen, und das riss Kate aus ihrem Schockzustand. Hastig ging sie neben dem Mann in die Hocke und nahm seinen Puls. Er lebte noch. Gott sei Dank.
»Hallo? Können Sie mich hören?« Vorsichtig rüttelte sie ihn an der Schulter, doch der Mann reagierte nicht, blieb bewusstlos. Was eigentlich kein Wunder war, schließlich hatte sie ihn ziemlich heftig erwischt. Blut sickerte an der Stelle in sein dunkelblondes Haar, und Kate spürte, wie Panik in ihr aufstieg.
»Wer ist das?«, fragte Amanda, immer noch sichtlich geschockt, und Kate blickte zu der alten Dame auf.
»Ich dachte, er wäre ein Einbrecher«, stieß sie unglücklich hervor, denn jetzt, wo das Licht aus dem Flur auf die Stufen fiel, erkannte sie deutlich, dass sie völlig falsch gelegen hatte. Der Mann war unbewaffnet und wirkte auch sonst überhaupt nicht wie jemand, der einen Überfall plante. Sein Hemd war völlig durchnässt, seine dunkle Hose schlammverschmiert, und eine Jacke schien er gar nicht dabeizuhaben. Er hatte überhaupt nichts dabei außer den Sachen, die er am Leib trug, und die Hälfte seines Gesichts, die Kate erkennen konnte, war unterhalb des Auges und am Kinn angeschwollen – so als hätten ihn dort Faustschläge getroffen. Dafür sprach auch, dass seine Lippe an einer Stelle aufgeplatzt war und blutete. Und das konnte eigentlich nur eins bedeuten: Er war nicht hergekommen, um Amanda zu schaden, sondern um sie um Hilfe zu bitten. Deswegen war er auch so gebückt gegangen. Weil er verletzt war, nicht weil er sich anschleichen wollte.
Verzweifelt biss Kate sich auf die Lippe. Aber das hatte sie doch nicht ahnen können! Sie hatte ihm gesagt, dass er stehen bleiben soll, und er war auf sie zugekommen. Es war ein Reflex gewesen, ihn niederzuschlagen, eine instinktive Reaktion auf eine vermeintliche Bedrohung. Sie hatte nur Amanda beschützen wollen – und stattdessen einen Unschuldigen schwer verletzt. Er konnte Hirnblutungen haben. Oder einen Schädelbruch. Er starb vielleicht …
Für einen Moment drohte die Furcht sie zu überwältigen, doch dann riss sie sich zusammen und erinnerte sich daran, dass jetzt definitiv nicht der richtige Zeitpunkt für Selbstvorwürfe war. Hastig tastete sie in ihren Taschen nach ihrem Handy und stöhnte auf, als ihr wieder einfiel, dass es noch im Land Rover lag.
»Rufen Sie den Notarzt«, wies sie Amanda an und folgte der alten Dame ins Haus, um ihre Arzttasche zu holen. Dann ging sie zurück zu dem Mann und untersuchte ihn noch mal gründlicher. Der Puls war kräftig, die Atmung normal, und die Pupillen reagierten auf Licht, was grundsätzlich ein gutes Zeichen war. Doch er war nach wie vor bewusstlos und reagierte nicht auf Ansprache, und das machte ihr wirklich Sorgen.
»Sie kommen im Moment nicht durch!« Amanda stand wieder in der Tür, und man konnte ihr ansehen, wie sehr diese Nachricht sie bestürzte. »Durch das Unwetter sind offenbar mehrere Zufahrtsstraßen blockiert, und die Rettungskräfte befinden sich im Dauereinsatz. Aber sie versuchen, so schnell wie möglich hier zu sein.«
Wieder krachte über ihnen ein lauter Donner, und erst jetzt wurde Kate bewusst, dass sie die Lage total unterschätzt hatte. Das war kein harmloses Sommergewitter, sondern ein ernstzunehmender Sturm. Rettungshubschrauber konnten bei dem Wetter bestimmt nicht fliegen, und selbst wenn, gab es hier im Wald keinen Landeplatz. Also musste der Krankenwagen kommen, und der brauchte für die Strecke von King’s Lynn bis hierher schon unter normalen Umständen mindestens eine halbe Stunde. Es würde also noch dauern, bis Hilfe kam, und deshalb blieb ihnen nur eine Wahl.
»Wir müssen ihn reinbringen.« Sie wusste, dass es ein Risiko barg, einen Patienten mit Kopfverletzungen zu bewegen. Aber was war die Alternative? Der Mann konnte unmöglich hier draußen im Regen liegen bleiben, bis die Sanitäter eintrafen. »Helfen Sie mir mal«, wies sie Amanda an und erklärte ihr, wie sie den Kopf des Mannes festhalten musste, damit er keine zu heftigen Bewegungen machte. Vorsichtig drehten sie ihn um, doch als er auf dem Rücken lag, blieb Amandas Blick skeptisch.
»Wie sollen wir ihn denn ins Haus kriegen?«
Das war eine berechtigte Frage, denn einfach würde das nicht werden. Der Mann war groß, Kate schätzte ihn auf gut einen Meter neunzig. Außerdem hatte er breite Schultern, und unter seinem nassen Hemd zeichnete sich ein muskulöser Oberkörper ab. Also nicht unbedingt jemand, den eine zierliche Person wie sie problemlos heben konnte. Aber es half nichts – sie musste es zumindest versuchen.
»Ich kriege das schon hin«, sagte sie, auch um sich selbst Mut zu machen. Schließlich brachten die Kühe und Pferde, mit denen sie es sonst zu tun hatte, noch viel mehr auf die Waage als dieser Mann. Entschlossen schob sie deshalb die Hände unter seinen Achseln hindurch und verschränkte die Finger über seiner Brust. Dann holte sie tief Luft und zog.
Er war schwer, viel schwerer, als sie gedacht hatte, aber die Angst schien Kate Flügel zu verleihen, und irgendwie schaffte sie es, ihn in den Hausflur zu schleppen.
»Können wir ihn irgendwo hinlegen?« Sie dachte an das Sofa im Wohnzimmer, doch Amanda hatte einen besseren Vorschlag.
»Bringen wir ihn doch in das Zimmer meiner Enkelin. Die Kleine hat die letzten Ferien hier verbracht, und ich habe ihr das alte Arbeitszimmer hergerichtet. Es steht ein Bett drin.«
Kate zögerte nicht, sondern folgte Amanda mit ihrer schweren Last in das Zimmer am Ende des Flurs, das mit geblümten Vorhängen und einer Tagesdecke in Rosa- und Weißtönen sehr mädchenhaft eingerichtet war. Ihre Kräfte verließen sie rapide und ihr Rücken protestierte schmerzhaft, aber es gelang ihr, den Mann bis zum Bett zu ziehen. Ihn hineinzulegen, war eine weitere Herausforderung, doch es ging, indem sie sich einfach mit ihm auf die Matratze sinken ließ und sich dann vorsichtig unter ihm wegrollte und seine Füße hinaufhievte.
Völlig außer Atem brachte sie ihn in die richtige Lage und prüfte dann erneut seine Vitalzeichen, die unverändert gut waren. Aber vielleicht übersehe ich etwas, dachte sie beklommen und versuchte ruhig zu bleiben, während sie die Kopfwunde genauer untersuchte. Die Beule, die sich unter der Haut gebildet hatte, war deutlich zu spüren, aber die Wunde selbst zum Glück nicht tief. Sie begann bereits zu verschorfen, deshalb reinigte Kate sie nur vorsichtig und verzichtete auf einen Verband.
»Er muss aus den nassen Sachen raus«, stellte sie dann fest und knöpfte ihm das Hemd auf. Doch als sie es zur Seite schob, hielt sie erschrocken inne.
Der Oberkörper des Mannes wies zahlreiche großflächige Hämatome auf. Entweder war er irgendwo übel gestürzt – oder tatsächlich verprügelt worden. Letzteres hielt Kate für wahrscheinlicher und spürte, wie sie eine neue Welle der Schuldgefühle erfasste. Mein Gott, wieso hatte sie gleich zugeschlagen, anstatt ihn zu fragen, was er wollte? Aber als er so unvermittelt aufgetaucht war, hatte er wahnsinnig bedrohlich gewirkt. Sie hatte einfach Angst gehabt, dass sie und Amanda nicht mit ihm fertigwerden würden.
Vorsichtig, um ihm möglichst wenig Schmerzen zu bereiten, befreite sie ihn von dem nassen Hemd. Die Hose war schwieriger, doch sie schaffte es irgendwie und zog ihm auch Schuhe und Socken aus. Den Slip ließ sie ihm an, weil er nicht besonders nass geworden war – und weil sie es einfach nicht über sich brachte. Es fühlte sich auch so schon komisch an, einen fremden Mann zu entkleiden, und es gab einfach Grenzen. Hastig und ein bisschen peinlich berührt breitete sie schließlich die Decke über ihm aus, die Amanda ihr reichte.
Weil sie mehr im Moment nicht tun konnte, sank sie zurück auf die Bettkante und merkte erst jetzt, wie heftig ihre Hände zitterten. Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals, und sie kämpfte gegen das überwältigende Bedürfnis zu weinen. Doch sie durfte jetzt nicht zusammenbrechen, schon wegen Amanda. Deshalb drängte sie die Tränen energisch zurück.
»Ich bleibe, bis der Krankenwagen hier ist«, sagte sie und konnte den Blick nicht von den unbewegten Zügen des Fremden lösen, betrachtete ihn zum ersten Mal näher.
Sie schätzte ihn auf Anfang bis Mitte dreißig, und er sah gut aus, selbst in seinem angeschlagenen Zustand. Aber sein Gesicht wirkte auch irgendwie hart, vielleicht weil es so kantig war, mit dem ausgeprägten Kinn und den hohen Wangenknochen. Sein dunkelblondes Haar war voll und etwas länger, und da sie ihn gerade eben fast nackt gesehen hatte, wusste sie, dass er tatsächlich durchtrainiert und an den richtigen Stellen muskulös war. Körperliche Arbeit verrichtete er aber vermutlich nicht, dafür waren sein Hemd und seine Hose zu fein. Kate tippte eher auf einen Geschäftsmann, der regelmäßig Sport trieb und sich fit hielt. Eigentlich wirkt er überhaupt nicht wie jemand, der sich verprügeln lässt, überlegte sie, während sie die Decke noch einmal zurechtrückte.
»Kennen Sie den Mann?«, fragte Amanda unvermittelt in die Stille und riss Kate aus ihren Gedanken. Sie schüttelte den Kopf. Irgendetwas an ihm kam ihr zwar vage bekannt vor, aber sie war ganz sicher, dass sie ihm noch nicht begegnet war. Daran hätte sie sich erinnert.
»Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er hier aus der Gegend ist«, meinte die alte Dame und schwieg dann für einen Moment wieder nachdenklich. »Kann ich noch irgendetwas tun?«
»Nein.« Kate seufzte. »Wir können nur warten und hoffen, dass der Krankenwagen bald hier ist.«
Der Sturm schien jedoch eher noch an Stärke zuzunehmen und rüttelte weiter unvermindert wild an den jetzt geschlossenen Fensterläden, deshalb glaubte sie nicht daran. Ein weiteres Mal griff sie nach der Hand des Mannes, um seinen Puls zu nehmen. Sie fühlte sich einfach besser, wenn sie etwas tun konnte, und Amanda schien es ähnlich zu gehen.
»Dann koche ich uns erst mal eine Tasse Tee«, verkündete sie und verschwand in die Küche.
Kate seufzte und ließ das Handgelenk des Mannes wieder los, nachdem sie festgestellt hatte, dass sein Herz immer noch beruhigend gleichmäßig schlug. Dann beugte sie sich vor und strich ihm gedankenverloren über das nasse Haar – bis sie merkte, was sie da tat, und ihre Hand erschrocken wieder zurückzog. Es war eine unbewusste Handlung gewesen, über die sie nicht nachgedacht hatte – schließlich beruhigte sie ihre vierbeinigen Patienten sonst auch oft mit Streicheln.
Nur, dass der hier kein Hund ist, erinnerte sie sich und lächelte ein bisschen schief. Vielleicht hatte das Leben als alleinstehende Tierärztin inzwischen doch Auswirkungen auf ihr Sozialverhalten. Ihre Freundin Ivy hielt ihr das immer vor und behauptete, sie würde sich lieber mit Tieren umgeben als mit Menschen. Und ein bisschen stimmte das wohl auch, denn ihr kleines Häuschen in Salter’s End war inzwischen zu einer Art lokalem Tierheim geworden. Jeder, der irgendwo einen Streuner auflas – Hund oder Katze, selbst verletzte Wildtiere, ganz egal –, brachte ihn zu Kate, weil alle wussten, dass sie nicht Nein sagen konnte, wenn ein Tier Hilfe brauchte. Sie kümmerte sich gerne um ihre Pflegefälle, für die sie oft auch noch ein neues Zuhause suchen musste, und das kostete eben Zeit, die sie für andere Dinge nicht hatte. Das machte ihr nichts aus, aber die Tatsache, dass sie gerade das Bedürfnis gehabt hatte, einen wildfremden Mann zu kraulen, war tatsächlich bedenklich. Kate konnte sich jedenfalls lebhaft vorstellen, was Ivy sagen würde, wenn sie es ihr erzählte.
Andererseits … Kate legte den Kopf ein bisschen schief. Schaden konnte es wahrscheinlich nicht, wenn der Mann spürte, dass jemand bei ihm war. Vielleicht half ihm das aus der Bewusstlosigkeit. Deshalb streckte sie erneut die Hand aus und schob ihm das Haar aus der Stirn, strich über seine Wange, die sich ein kleines bisschen rau anfühlte.
»Wer immer du bist, du musst wieder aufwachen, hörst du?«, sagte sie leise und streichelte ihn weiter sanft, während sie überlegte, zu wem er unterwegs gewesen sein mochte, bevor er bei Amanda gelandet war. Der Gedanke, dass da draußen jetzt vielleicht irgendjemand auf ihn wartete und sie dafür gesorgt hatte, dass er nicht kam, ließ ihre Schuldgefühle wieder aufflammen. Aber es half nichts, das konnten sie alles erst klären, wenn er wieder zu sich kam.
4
»Benedict Sterling?« David Camden blickte überrascht von dem Brief der Anwaltskanzlei aus New York auf, den sein Vater Ralph ihm vor einigen Minuten kommentarlos in die Hand gedrückt hatte. Er konnte immer noch nicht recht fassen, was darin stand. »Wer ist das? Und wie kommt er dazu, solche Forderungen zu stellen?«
Sein Vater stand mit dem Rücken zu ihm am Fenster und antwortete ihm nicht, deshalb blickte David zu Timothy, der am Kaminsims lehnte. Doch auch sein Onkel schwieg, schien darauf zu warten, dass sein älterer Bruder das Reden übernahm, der sich jetzt endlich wieder zu ihnen umdrehte.
»Das ist eine lange Geschichte«, erklärte Ralph, und David erschrak darüber, wie aufgewühlt er aussah. »Aber es könnte sein, dass es stimmt.«
»Nein! Das ist absurd!«, mischte sich Lady Eliza ein. Der Blaue Salon, in dem sie sich gerade befanden, war so etwas wie ihr privates Wohnzimmer, und sie saß wie immer auf dem kleinen Sofa vor dem Kamin. Ihr Rücken war durchgebogen und ihr schlohweißes Haar im Nacken zu einem festen Knoten gebunden; beides ließ sie sehr streng wirken. Und dieser Eindruck täuschte nicht; Lady Eliza war bei den Bewohnern von Daringham Hall zu Recht gefürchtet. »Der Kerl ist ein Hochstapler. Ein Niemand. Wir werden dieses Schreiben einfach ignorieren. So weit kommt es noch, dass die Familie Camden sich einem hergelaufenen Amerikaner gegenüber rechtfertigen muss.«
Sie reckte ihr faltiges Kinn, und auf ihrem Gesicht erschien dieser arrogante, herablassende Ausdruck, den David nur zu gut kannte. Er liebte seine Großmutter, doch die Dünkel, die sie wegen ihrer adligen Abstammung oft herauskehrte, nervten ihn, weil er sie ziemlich unzeitgemäß und total überflüssig fand.
»Aber der Name«, widersprach Ralph. »Wenn er wirklich der Sohn von Jane Sterling ist, dann …«