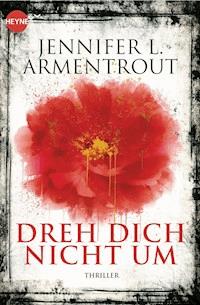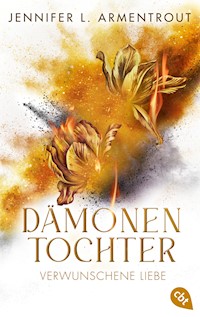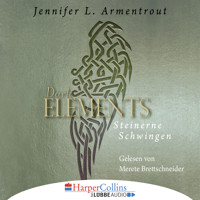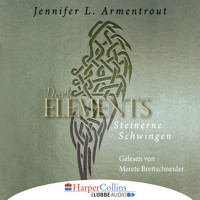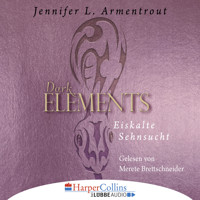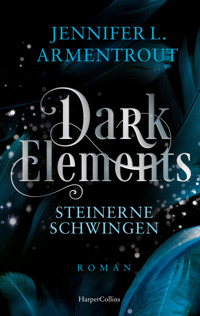
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dragonfly
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dark Elements
- Sprache: Deutsch
Nichts wünscht Layla sich sehnlicher, als ein ganz normaler Teenager zu sein. Aber während ihre Freundinnen sich Gedanken um Jungs und erste Küsse machen, hat sie ganz andere Sorgen: Layla gehört zu den Wächtern, die sich nachts in Gargoyles verwandeln und Dämonen jagen. Doch in ihr fließt auch dämonisches Blut - und mit einem Kuss kann sie einem Menschen die Seele rauben. Deshalb sind Dates für sie streng tabu, erst recht mit ihrem heimlichen Schwarm Zayne, dem Sohn ihrer Wächter-Ersatzfamilie. Plötzlich wird sie auf einem ihrer Streifzüge von dem höllisch gut aussehenden Dämon Roth gerettet … und er offenbart ihr das schockierende Geheimnis ihrer Herkunft!
"Dark Elements: Steinerne Schwingen ist einer dieser Wahnsinnsromane, die man in einer Nacht verschlingt"
buchjournal TEENS
"Eine Liebesgeschichte mit Suchtpotenzial, mitten im Kampf zwischen Gut und Böse"
börsenblatt
"Armentrout in Bestform … mit umwerfenden Jungs und einer Wendung, die keiner kommen sieht."
Abbi Glines, New York Times-Bestsellerautorin
"Die perfekte Mischung aus Action und Liebe, verfeinert mit Roths frechen Bemerkungen und Laylas ironischen Kommentaren."
Kirkus Book Reviews
"Auf ihre einzigartige Weise mischt Jennifer L. Armentrout Humor und Romantik und schenkt uns ein rasantes Lesevergnügen, das die herzen der Leser höherschlagen lässt - und zwar in vielerlei Hinsicht."
Romantic Times Book Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jennifer L. Armentrout
Dark Elements – Steinerne Schwingen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ralph Sander
HarperCollins YA! ©
HarperCollins YA! © Bücher
erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright dieses eBooks © 2015 by HarperCollins YA!
in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
White Hot Kiss
Copyright © 2014 by Jennifer L. Armentrout
erschienen bei: Harlequin TEEN, Toronto
Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Cover: Formlabor, Hamburg
Redaktion: Daniela Peter
Titelabbildung: istockphoto.com; shutterstock.com
Autorenfoto: © Vania Stoyanova
ISBN eBook 978-3-95967-003-6
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder
auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
1. KAPITEL
Ein Dämon trieb sich bei McDonald’s herum.
Ein Dämon mit einer besonderen Vorliebe für Big Macs. Die meiste Zeit über liebte ich den Job, dem ich nach Schulschluss nachging. Die Seelenlosen und die Verdammten zu markieren, bescherte mir jedes Mal ein verrücktes, wohliges Kribbeln. Aus Langeweile hatte ich mir sogar eine Quote vorgegeben, am heutigen Abend allerdings sah das alles ganz anders aus.
Für den Englisch-Unterricht musste ich noch ein Referat erarbeiten.
„Isst du die Pommes eigentlich noch?“, fragte Sam, während er schon eine Handvoll Fritten von meinem Tablett klaute. Sein lockiges braunes Haar fiel ihm bis über den Rand seiner Nickelbrille. „Danke.“
„Lass bloß ihren Eistee in Ruhe.“ Warnend schlug Stacey ihm auf die Hand, und ein paar Pommes landeten auf dem Fußboden. „Sonst bist du den ganzen Arm los.“
Ich hörte auf, mit dem Fuß auf den Boden zu tippen, ließ den Eindringling aber nicht aus den Augen. Keine Ahnung, wieso Dämonen einen solchen Narren an McDoof gefressen hatten, doch sie konnten sich einfach nicht von dem Laden losreißen. „Ha-ha.“
„Wen starrst du so an, Layla?“ Stacey drehte sich auf ihrer Bank herum, damit sie sich im Lokal umsehen konnte. „Irgendein scharfer Typ? Falls ja, solltest du … oh, wow. Wer traut sich denn so angezogen vor die Haustür?“
„Was ist denn?“ Sam wandte sich ebenfalls um. „Ach, komm schon, Stacey. Wen stört das? Kann ja nicht jeder wie du in Prada-Imitaten rumrennen.“
Der Dämon hatte das Aussehen einer harmlosen Frau mittleren Alters, die in Sachen Mode unter schwerer Geschmacksverirrung litt. Sie trug eine grüne Jogginghose aus Samtimitat, dazu pinkfarbene Sneakers. Ihr mattbraunes Haar war mit altmodischen violetten Schmetterlingsclips aufgesteckt, die Krönung allerdings bildete ihr Sweater. Jemand hatte auf die Vorderseite einen gestrickten Basset genäht, dessen große Triefaugen aus braunem Garn gestickt waren.
Aufmachung hin oder her, diese Frau war kein Mensch.
Nicht dass ausgerechnet ich ihr das hätte vorwerfen können.
Sie war ein Blender-Dämon, ein Wesen, das leicht an seinem maßlosen Appetit zu erkennen war. Blender-Dämonen pflegten während einer einzigen Mahlzeit solche Massen zu verschlingen, dass davon eine kleine Nation satt werden könnte.
Blender konnten zwar Aussehen und Verhalten eines Menschen übernehmen, dennoch wäre dieser Dämon da problemlos dazu fähig gewesen, dem Gast am Nebentisch den Kopf vom Leib zu reißen. Jedoch ging die Bedrohung nicht so sehr von der übermenschlichen Kraft aus, sondern von den Zähnen und dem infektiösen Speichel.
Blender waren Beißer.
Ein leichter Biss genügte, um die Dämonenversion der Tollwut auf einen Menschen zu übertragen. Ein Gegenmittel existierte nicht, und nach spätestens drei Tagen sah der menschliche Kauknochen aus, als wäre er einem Film von George A. Romero entsprungen, einschließlich der kannibalistischen Neigungen.
Blender waren ein echtes Problem, außer natürlich für Leute, für die es nichts Unterhaltsameres als eine Zombie-Apokalypse gab. Das einzig Gute an Blendern war, dass nur wenige existierten und sich ihre Lebensspanne mit jedem Biss verkürzte. Üblicherweise konnten sie ungefähr siebenmal zubeißen, bevor sie „Ploff“ machten. Ein bisschen so wie eine Biene mit ihrem Stachel, nur waren Blender viel dümmer.
Sie konnten jedes beliebige Erscheinungsbild annehmen, deshalb war es mir ein Rätsel, wieso dieser Dämon da drüben ausgerechnet so aussehen wollte.
Stacey verzog das Gesicht, als die Blenderin sich dem dritten Burger widmete. Dass wir sie beobachteten, bemerkte sie nicht, aber diese Dämonen taten sich auch nicht durch eine besonders ausgeprägte Beobachtungsgabe hervor, vor allem dann nicht, wenn sie auf einer Köstlichkeit mit Spezialsauce herumkauten.
„Ist ja ekelhaft.“ Stacey wandte sich schüttelnd ab.
„Der Sweater ist doch total heiß“, erklärte Sam mit vollem Mund und grinste, während er weiterkaute. „Sag mal, Layla, meinst du, Zayne lässt sich von mir für die Schülerzeitung interviewen?“
Ich hob die Augenbrauen. „Warum willst du ihn denn interviewen?“
Er warf mir einen Blick zu. „Weil ich ihn fragen will, wie es ist, als Wächter in D. C. auf Schurkenjagd zu gehen, damit sie ihre gerechte Strafe kriegen.“
„Du sagst das, als wären Wächter irgendwelche Superhelden.“ Stacey kicherte.
Sam zuckte mit seinen knochigen Schultern. „Na ja, irgendwie sind sie das ja auch. Ich meine, du hast sie doch selbst erlebt, Stacey.“
„Sie sind keine Superhelden“, widersprach ich und setzte zu meiner Standardrede an, die ich immer wieder halten musste, seit die Wächter vor zehn Jahren an die Öffentlichkeit gegangen waren. Der plötzliche astronomische Anstieg der Kriminalitätsrate damals hatte nichts mit der weltweiten wirtschaftlichen Abwärtsbewegung zu tun gehabt. Es war vielmehr ein Gruß aus der Hölle. Die Ankündigung, dass man sich dort nicht länger an die Spielregeln halten wollte. Deshalb hatten die Alphas den Wächtern befohlen, sich zu erkennen zu geben. Den Menschen war es vorgekommen, als hätten die Wächter ihre steinerne Hülle abgelegt und wären zum Leben erwacht. Das war sogar nachvollziehbar, schließlich waren die steinernen Wasserspeier an vielen Kirchen und anderen alten Gebäuden einigermaßen dem wahren Aussehen der Wächter nachempfunden.
Es tummelten sich jedenfalls irre viele Dämonen auf der Erde, und die Wächter hatten immer größere Mühe, ihre Arbeit zu erledigen, ohne dass jemand auf ihre Existenz aufmerksam wurde. „Das sind ganz normale Leute so wie du auch, nur dass …“
„Ist mir doch bekannt.“ Sam hielt beide Hände hoch, um mich zu unterbrechen. „Ich bin wirklich keiner von diesen Fanatikern, die sie für böse halten oder irgendeinen anderen Blödsinn glauben. Ich finde nur, so ein Interview wär’ cool. Und für die Zeitung ein echt toller Artikel. Also, was meinst du? Würde Zayne so was machen?“
Ich fühlte mich unbehaglich bei der Sache. Weil ich mit den Wächtern zusammenlebte, wurde ich von anderen entweder als Anlaufstelle angesehen, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen, oder man hielt mich für einen Freak. Und alles nur, weil jeder – auch meine beiden besten Freunde – davon überzeugt war, dass ich genauso war wie sie selbst. Menschlich. „Ich weiß nicht, Sam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie scharf drauf sind, dass man über sie schreibt.“
Er sah enttäuscht aus. „Würdest du ihn wenigstens fragen?“
„Klar.“ Ich spielte mit meinem Strohhalm. „Aber mach dir keine großen Hoffnungen.“
Zufrieden ließ Sam sich gegen die harte Rückenlehne der Sitzbank sinken. „Wusstet ihr schon?“
„Was denn?“, meinte Stacey seufzend und warf mir einen traurigen Blick zu. „Mit welchem gefährlichen Halbwissen willst du uns denn jetzt wieder begeistern?“
„Wusstet ihr, dass man mit einer tiefgefrorenen Banane einen Nagel in die Wand schlagen kann? Sie muss nur hart genug werden.“
Ich stellte meinen Becher ab. „Wieso weißt du solche Sachen?“
Sam aß meine letzten Fritten auf. „Ist halt so.“
„Er verbringt ja auch sein ganzes Leben vor dem Computer.“ Stacey strich sich die dichten schwarzen Stirnfransen aus dem Gesicht. Ich konnte nicht verstehen, warum sie sich die Haare nicht einfach abschnitt, wenn sie ihr doch ständig im Weg zu sein schienen. „Bestimmt sucht er nach diesem Mist, weil er nichts Besseres zu tun hat.“
„Genau das mache ich, wenn ich zu Hause bin.“ Sam knüllte seine Serviette zusammen. „Ich suche nach Fakten, die kaum jemand kennt. Daran seht ihr, wie cool ich bin.“ Dann warf er Stacey die Serviette ins Gesicht.
„Übersetzt heißt das“, fuhr sie unbeeindruckt fort, „du bist die ganze Nacht auf der Suche nach Pornoseiten.“
Sams Wangen glühten, und er rückte seine Brille zurecht. „Wenn du meinst. So, seid ihr bald fertig? Wir müssen für Englisch noch das Referat vorbereiten.“
Stacey stöhnte auf. „Ich begreife nicht, warum Mr Leto dagegen ist, dass wir über Twilight schreiben. Wir sollen doch schließlich über einen Klassiker schreiben, und Twilight ist ganz eindeutig ein Klassiker.“
Ich musste lachen und vergaß für einen Moment meinen Auftrag, den ich zu erledigen hatte. „Twilight ist kein Klassiker, Stacey.“
„Für mich ist Edward aber nun mal ein Klassiker“, beharrte sie und zog ein Haarband aus der Tasche. „Außerdem ist Twilight viel interessanter als Im Westen nichts Neues.“
Sam schüttelte den Kopf. „Ich fasse es nicht, dass du gerade Twilight und Im Westen nichts Neues in einem Atemzug genannt hast.“
Sie überging die Bemerkung und schaute auf mein Tablett. „Layla, du hast ja noch nicht mal von deinem Burger abgebissen.“
Vielleicht hatte ich ja instinktiv geahnt, dass ich einen Vorwand brauchen würde, um etwas länger zu bleiben. Stöhnend holte ich Luft. „Geht ihr schon mal vor. Ich komme in ein paar Minuten nach.“
„Echt?“, fragte Sam und stand auf.
„Ja, echt.“ Ich nahm den Burger in die Hand. „Ein paar Minuten, dann bin ich wieder bei euch.“
Misstrauisch musterte Stacey mich. „Du wirst uns doch nicht wieder versetzen so wie sonst immer, oder?“
Mein schlechtes Gewissen sorgte dafür, dass ich einen roten Kopf kriegte. Ich hatte längst aufgehört zu zählen, wie oft genau das schon passiert war. „Nein, ich schwör’s. Ich esse nur noch auf, dann komme ich nach.“
„Los“, sagte Sam zu Stacey und legte einen Arm um ihre Schultern, um sie in Richtung der Abfalltonne zu lotsen. „Layla wäre längst fertig mit ihrem Essen, wenn du nicht die ganze Zeit auf sie eingeredet hättest.“
„Ja, ja, gib ruhig mir die Schuld.“ Stacey schmiss den Abfall weg und winkte mir zu, als sie das Lokal verließen.
Ich legte den Burger wieder hin und sah ungeduldig hinüber zu Lady Blenderin. Brötchenkrümel und Fleischbrocken fielen ihr aus dem Mund und verteilten sich auf dem Tablett, während sie ihren Burger in sich hineinstopfte. Innerhalb von Sekunden hatte sich mein Appetit verabschiedet, auch wenn das eigentlich ganz egal war. Essen linderte den Schmerz nur, der an meinem Inneren nagte, aber es brachte ihn nie zum Verstummen.
Lady Blenderin war mit ihrem Fettfraß endlich fertig, und ich folgte ihr, während sie zur Tür stürmte. Auf dem Weg nach draußen rannte sie einen älteren Mann um und schleuderte ihn zu Boden, gerade als der das Lokal betreten wollte. Wow, das war ja ein richtiges Goldstück.
Ihr gehässiges Gackern hallte im Restaurant wider, obwohl es dort ziemlich laut zuging. Zum Glück war schon jemand zu dem älteren Mann gegangen und half ihm hoch, wobei er mit der Faust dem weitereilenden Dämon drohte.
Seufzend schmiss ich meinen Burger weg und folgte ihr hinaus in den Spätseptemberwind.
Überall waren Seelen in unterschiedlichen Farbgebungen zu sehen, die wie elektrische Felder den jeweiligen Körper umgaben. Ein Pärchen, das Hand in Hand unterwegs war, zog Spuren in Blassrosa und Grünblau hinter sich her. Beide hatten sie unschuldige, allerdings keine reinen Seelen.
Jeder Mensch, ob gut oder schlecht, besaß eine Seele, eine Art Essenz ihres Wesens, während Dämonen damit nicht aufwarten konnten. Da die meisten Dämonen auf der Erdoberfläche wenigstens auf den ersten Blick wie Menschen aussahen, machte es mir das Fehlen einer Seele leicht, sie ausfindig zu machen und zu markieren. Von der Seelenlosigkeit abgesehen unterschieden sie sich von Menschen nur durch die seltsame Art, wie ihre Augen das Licht reflektierten, ungefähr so wie bei einer Katze.
Lady Blenderin schlurfte die Straße entlang und humpelte ein wenig. Bei Tageslicht sah sie gar nicht so gesund aus. Vermutlich hatte sie bereits ein paar Leute gebissen, was bedeutete, dass sie umgehend markiert und aus dem Verkehr gezogen werden musste.
Im Vorbeigehen bemerkte ich einen Flyer an einem grünen Laternenpfahl. Ich wurde wütend, und mein Beschützerinstinkt regte sich, als ich den Zettel las: „Erwachet! Wächter sind keine Kinder Gottes. Bereut eure Sünden, denn das Ende ist nah!“
Unter diesen Zeilen fand sich eine krakelige Zeichnung, die wohl zeigen sollte, was dabei herauskam, wenn sich ein tollwütiger Kojote mit einem Chupacabra paarte.
„Mit freundlicher Unterstützung der Kirche der Kinder Gottes“, murmelte ich und verdrehte die Augen.
Richtig nett. Ich wusste, warum ich Fanatiker hasste.
An einem Diner einen Block weiter waren alle Fenster mit diesen Flyern beklebt, und auf seinem Schild wurde darauf hingewiesen, dass Wächter dort nicht bedient wurden.
Die Wut breitete sich wie ein außer Kontrolle geratener Waldbrand in mir aus. Diese Idioten begriffen überhaupt nicht, dass sich die Wächter für sie opferten. Ich atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Jetzt zählte nur, dass ich mich auf die Blenderin konzentrierte, anstatt mit einer geistigen Faust zornig auf einen geistigen Tisch zu hauen.
Lady Blenderin bog um eine Häuserecke, dabei warf sie einen Blick über die Schulter und sah mich kurz mit ihren glasigen Augen an, wandte sich jedoch gleich wieder ab. Der Dämon in ihr hatte nichts Unnormales an mir feststellen können.
Der Dämon in mir wollte das Ganze so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Vor allem jetzt, nachdem mein Handy sich meldete und auf meinem Oberschenkel vibrierte. Bestimmt war das Stacey, die wissen wollte, wann zum Teufel ich denn endlich auftauchen würde. Ohne nachzudenken, hob ich den Arm und berührte meine Halskette. Der alte Ring an der silbernen Kette fühlte sich in meiner Hand heiß und schwer an.
Als ich eine Gruppe Jugendlicher passierte, die alle ungefähr in meinem Alter waren, musterten sie mich von oben bis unten. Natürlich starrten sie mich an. Jeder tat das.
Ich trug meine Haare lang, was nicht weiter ungewöhnlich wäre. Allerdings waren meine Haare so hellblond, dass sie fast weiß wirkten. Ich hasste es, wenn Leute mich anstarrten. Dann kam ich mir vor wie ein Albino. Vor allem erregten allerdings meine Augen immer Aufmerksamkeit, weil sie so hellgrau waren, dass sie beinahe farblos waren.
Zayne meinte, ich würde wie die bisher verschollene Schwester des Elben in Herr der Ringe aussehen. Na, wenn so eine Bemerkung nicht dazu führte, dass man vor Selbstbewusstsein strotzte …
Die Dämmerung legte sich allmählich über die Hauptstadt der Nation, als ich in die Rhode Island Avenue einbog und abrupt stehen blieb. Alles um mich herum verschwand schlagartig. Im schwachen Schein der Straßenlampen erkannte ich eine Seele.
Sie sah aus, als hätte jemand einen Pinsel in rote Farbe getaucht, um ihn dann über einer schwarzen Leinwand auszuschütteln. Dieser Kerl hatte eine richtig üble Seele. Er stand nicht unter dem Einfluss irgendeines Dämons, sondern war einfach nur unglaublich bösartig. Der dumpfe Schmerz in meiner Magengegend erwachte zum Leben. Passanten drängten sich an mir vorbei und blickten mich verärgert an. Ein paar von ihnen murmelten irgendwelche Beschimpfungen, aber das kümmerte mich nicht. Genauso wenig interessierte ich mich für ihre roséfarbenen Seelen, obwohl mir dieser Farbton normalerweise gut gefiel.
Schließlich konzentrierte ich mich auf die Gestalt hinter der Seele, ein älterer Mann in einem unscheinbaren Anzug mit Krawatte, eine Aktentasche in der kräftigen Hand. Dem Aussehen nach niemand, vor dem man davonlaufen oder Angst haben sollte, aber ich wusste es besser.
Dieser Mann hatte gesündigt, und das in sehr großem Stil.
Ich ging wie in Trance auf ihn zu, während mein Gehirn mich anbrüllte, ich solle kehrtmachen und nach Zayne rufen. Allein seine Stimme zu hören, würde genügen, um mich davon abzuhalten, das zu tun, wonach jede Zelle meines Körpers schrie – das zu tun, was mir fast im Blut lag.
Der Mann drehte sich langsam zu mir um, sein Blick traf mein Gesicht und wanderte dann über meinen Körper. Seine Seele wirbelte wahnsinnig schnell und verfärbte sich mehr rot als schwarz. Er war alt genug, um mein Vater zu sein. Das machte es so widerlich, so absolut widerlich.
Sein grauenerregendes Lächeln hätte mich sofort dazu veranlassen müssen, die Flucht zu ergreifen und in die entgegengesetzte Richtung zu verschwinden. Ganz gleich, wie bösartig dieser Mann auch war und wie viele Mädchen mir einen Orden verleihen würden, wenn ich ihn unschädlich machte. Abbot hatte mich dazu erzogen, den Dämon in mir zu verleugnen. Ich war von ihm als Wächterin ausgebildet worden und hatte mich dementsprechend zu verhalten.
Doch Abbot war gerade nicht da.
Ich schaute dem Mann in die Augen und spürte, wie ein Lächeln meinen Mund umspielte. Mein Herz raste, mein ganzer Körper kribbelte und glühte. Ich wollte diese Seele. So sehr, dass sich meine Haut am liebsten vom Fleisch darunter abgelöst hätte. Es war wie die Vorfreude auf einen Kuss, wenn die Lippen sich schon beinahe berührten, jene Sekunden, in denen man gebannt den Atem anhielt. Ich war zwar noch nie geküsst worden, stellte es mir allerdings so vor.
Ich kannte nur das hier.
Die Seele dieses Mannes rief mich zu sich wie die Sirenen einst Odysseus. Es widerte mich an, dass mich das Böse in seinem Geist so sehr in Versuchung führte, aber eine finstere Seele war genauso gut wie eine reine.
Er lächelte mich an, seine Finger schlossen sich fester um den Griff seiner Aktentasche. Dieses Lächeln ließ mich an all die schrecklichen Dinge denken, die er verbrochen haben musste, um sich die wirbelnde Leere zu verdienen, die ihn umgab.
Jemand rammte mir den Ellbogen ins Kreuz, doch der minimale, flüchtige Schmerz war nichts im Vergleich zu der wundervollen Vorfreude. Nur noch ein paar Schritte, dann war seine Seele ganz dicht vor mir, zum Greifen nah. Der erste Kontakt würde ein Feuer in mir entfachen, wie man es sich schöner nicht vorstellen konnte. Wie ein Rausch, kurz zwar, aber dennoch reinste Ekstase. Eine unwiderstehliche Verlockung.
Seine Lippen mussten meine nicht mal berühren. Es genügte, wenn ich bis auf einen Fingerbreit an ihn herankam, dann konnte ich von seiner Seele kosten, sie ihm allerdings nicht nehmen. Wenn ich sie ihm nahm, würde ich ihn töten, und das war böse. Ich jedoch, ich war nicht …
Das war böse.
Ich zuckte zurück und unterbrach den Blickkontakt. Schmerz explodierte in meiner Mitte und schoss mir in Arme und Beine. Mich von dem Mann abzuwenden, war so, als würde ich meinen Lungen die Luft zum Atmen vorenthalten. Meine Haut brannte, meine Kehle war wie ausgedörrt, während ich mich zwang, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Weitergehen, Layla, nicht an den Mann denken und die Blenderin wiederfinden! Es war ein Kampf, der mir alles abverlangte. Aber schließlich entdeckte ich sie wieder und atmete erleichtert aus. Zumindest war es eine Ablenkung von der Versuchung, wenn ich mich voll und ganz auf den Dämon konzentrierte.
Ich folgte der Frau in eine schmale Gasse zwischen einem Ein-Dollar-Shop und einem Kredithai. Ich musste die Frau nur einmal anfassen, was ich eigentlich schon bei McDonald’s hätte tun können. Nach ein paar Schritten blieb ich stehen, schaute mich um und fluchte.
Die Gasse war leer.
Schwarze Müllbeutel säumten die mit Schimmel überzogenen Ziegelsteinmauern. Müllcontainer quollen von Abfall über, hier und da war ein Rascheln zu hören, und es bewegte sich etwas in den Schatten. Misstrauisch beäugte ich die Beutel. Wahrscheinlich nur Ratten, aber in den Schatten hielten sich auch andere Dinge verborgen. Dinge, die schlimmer waren als die Ratten.
Und viel, viel unheimlicher.
Ich ging weiter und suchte den düsteren Durchgang ab, dabei spielte ich gedankenverloren mit der Halskette. Wäre ich doch nur vorausschauend genug gewesen, eine Taschenlampe in meine Schultasche zu packen, doch das wäre ja eine viel zu sinnvolle Aktion gewesen. Stattdessen hatte ich mein neues Lipgloss und einen Beutel Kekse mitgenommen, was mir jetzt ganz sicher super helfen würde.
Plötzlich lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ich ließ den Ring los. Etwas stimmte hier nicht. Ich zog mein ramponiertes Handy aus der Hosentasche und drehte mich gleichzeitig langsam um.
Die Blenderin stand nicht weit von mir entfernt. Ihr Lächeln verwandelte die Falten auf ihrem Gesicht in tiefe Furchen. Blattsalat klebte an ihren gelben Zähnen. Ich holte einmal Luft, was ich sofort bereute, weil sie einen bestialischen Gestank nach Schwefel und verfaultem Fleisch verbreitete.
Dann legte die Blenderin den Kopf schräg und kniff ein wenig die Augen zusammen. Kein Dämon konnte mich als das erkennen, was ich war, weil in meinen Adern nicht genug dämonisches Blut floss. Aber so, wie sie mich anstarrte, schien sie dennoch zu bemerken, was ich verbarg.
Sie blickte auf meine Brust, hob den Kopf und schaute genau in meine Augen. Erschrocken schnappte ich nach Luft. Das helle Blau ihrer Augen begann sich wie ein Wirbel um die Pupillen zu drehen, die zu winzigen Punkten zusammenschrumpften.
Oh verdammt! Diese Lady war überhaupt keine Blenderin.
Ihre Gestalt schlug Wellen, dann verschob sie sich in sich selbst, was so aussah wie bei einem Fernseher, der ein digitales Bild zusammenzusetzen versuchte. Die faltige Haut wurde glatt und nahm eine wächserne Farbe an, der Körper streckte und dehnte sich aus, die Jogginghose und der fürchterliche Sweater wichen einer Lederhose und einer breiten, muskulösen Brust. Die ovalen Augen tosten wie die wilde See, Pupillen waren keine mehr zu erkennen. Die Nase war so platt, dass sie eigentlich nur aus zwei Löchern über dem breiten, erschreckenden Mund bestand.
Himmel! Das war ein Sucher-Dämon. So einen kannte ich bislang nur aus einem der alten Bücher in Abbots Arbeitszimmer. Ein Sucher war so etwas wie der Indiana Jones der Dämonenwelt, da er in der Lage war, so gut wie jedes Objekt aufzuspüren und zurückzubringen, auf das sein Meister ihn ansetzte. Aber im Gegensatz zu Indy waren Sucher bösartig und aggressiv.
Der Sucher lächelte mich so breit an, dass ich die spitzen, rasiermesserscharfen Zahnreihen in seinem Mund erkennen konnte. „Hab dich.“
Hab dich? Mich? Ernsthaft?
Plötzlich machte er einen Satz auf mich zu, ich sprang zur Seite und berührte ihn am Arm. Vor Angst wurden meine Handflächen feucht. Neonfarbenes Licht umgab seinen Körper, sodass ich ihn nur als einen rosa Schatten wahrnehmen konnte. Er reagierte nicht auf meine Markierung. Aber das tat keiner von ihnen. Nur die Wächter konnten die Markierung erkennen, mit denen ich die Dämonen versah.
Der Sucher griff in meine Haare und riss meinen Kopf zur Seite, gleichzeitig packte er mein Shirt. Das Handy glitt mir aus den Fingern und knallte auf den Boden. Ein Stechen jagte meinen Hals hinunter und sprang auf die Schultern über.
Panik überfiel mich, als hätte jemand einen Staudamm gesprengt, doch mein Instinkt ließ mich nicht im Stich. Das Training, das ich an so vielen Abenden mit Zayne absolviert hatte, zahlte sich nun aus. Dämonen zu markieren, konnte sich hin und wieder als schwierige Angelegenheit entpuppen, und auch wenn ich nicht gerade ein Ninja war, würde ich mich nicht kampflos geschlagen geben.
Ich holte aus, riss mein Bein hoch, und mein Knie landete genau dort, wo es wehtat. Gott sei Dank hatten Dämonen keine völlig andere Anatomie, weshalb der Sucher sich zusammenkrümmte und zurückwich. Dabei zerrte er mir ein Haarbüschel aus, was nicht gerade angenehm war.
Im Gegensatz zu den Wächtern konnte ich meine menschliche Hülle nicht abstreifen, damit ich meinem Gegenüber ordentlich in den Hintern treten konnte, doch wer mir die Haare ausriss, konnte sich auf was gefasst machen.
Höllische Schmerzen jagten durch meine Knöchel, sowie ich dem Sucher einen Haken gegen den Kiefer verpasste, der seinen Kopf zur Seite schleuderte. Das war kein Mädchenfausthieb! Oh Mann, Zayne wäre ja so stolz auf mich!
Langsam drehte sich der Dämon zu mir um. „Das war klasse. Tu das noch mal.“
Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf, und mit einem Mal wurde mir klar, dass ich gleich in dieser Gasse sterben würde. Der Dämon würde mich in Stücke zerfetzen, oder – was noch schlimmer war – er würde mich durch eines der über die ganze Stadt verteilten Portale schleifen und nach unten entführen. Wenn Leute auf unerklärliche Weise verschwanden, lag es üblicherweise daran, dass sie ein paar Etagen tiefer gezogen waren. In eine verdammt heiße Gegend. Der Tod war im Vergleich damit noch ein Segen. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst.
„Das reicht.“
Wir erstarrten beide mitten in der Bewegung, als wir die tiefe Stimme hörten, die gelassene Autorität verströmte. Der Sucher reagierte als Erster und ging einen Schritt zur Seite. Ich drehte mich langsam um, und dann sah ich ihn.
Der Neuankömmling war deutlich über einen Meter achtzig, also so groß wie ein Wächter. Sein Haar war schwarz wie Obsidian und schimmerte im schwachen Licht leicht bläulich. Er trug sein lockiges Haar bis über die Ohren, ein paar Locken hingen ihm lässig in die Stirn. Die Augen waren golden, seine hohen Wangenknochen ausgeprägt. Kurz gesagt: Er war ziemlich attraktiv. Sehr attraktiv sogar. Fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber das zynische Lächeln, das seine Mundwinkel umspielte, verlieh seiner Schönheit etwas Frostiges. Das schwarze T-Shirt spannte sich über die breiten Schultern und schmiegte sich an seinen flachen Bauch. Ein Schlangen-Tattoo wand sich um seinen Unterarm, der Schwanz des Tiers verschwand unter dem Ärmelstoff, der diamantförmige Kopf ruhte auf dem Handrücken. Der Kerl schien in meinem Alter zu sein. Absolut der Typ, in den sich jemand wie ich sofort verknallen konnte. Wäre da nur nicht das kleine Problem mit seiner Seele gewesen. Er hatte nämlich keine.
Stolpernd wich ich einen Schritt zurück. Gab es etwas Schlimmeres als einen Dämon? Ja, zwei Dämonen. Meine Knie zitterten so sehr, dass ich schon befürchtete, gleich mit dem Gesicht voran auf dem Asphalt zu landen. Noch nie war eine Markierung bei mir so schiefgelaufen. Ich war richtig am Arsch, das war nicht mehr witzig.
„Du mischst dich hier besser nicht ein“, sagte der Sucher und ballte die Fäuste.
Der Neuzugang machte lautlos einen Schritt nach vorn. „Und du küsst mir besser den Hintern. Wie wär’s?“
Ähm …
Darauf entgegnete der Sucher nichts mehr, sondern stand nur da und atmete schwer. Die Anspannung war so intensiv, dass man sie fast greifen konnte. In der sinnlosen Hoffnung, hier vielleicht doch noch heil rauszukommen, wich ich erneut einen Schritt zurück. Die beiden waren ganz eindeutig nicht vom selben Stamm, und ich wollte auf keinen Fall zwischen die Fronten geraten. Wenn zwei Dämonen aufeinander losgingen, brachten sie schon mal ganze Gebäude zum Einsturz. Schadhafte Fundamente? Falsch berechnete Dachkonstruktionen? Von wegen. Das war meistens das Werk von Dämonen, die sich gegenseitig auf Leben und Tod bekämpften.
Noch zwei Schritte nach rechts, dann konnte ich …
In diesem Moment traf mich der Blick des Neuankömmlings mit solcher Eindringlichkeit, dass mir die Luft wegblieb. Der Schultergurt meiner Tasche rutschte mir aus den Fingern. Der Anflug eines Lächelns umspielte die Mundwinkel des Unbekannten, und als er mit mir redete, klang seine Stimme sanft und tief: „Hässliche Lage, in die du dich da manövriert hast.“
Ich hatte keine Ahnung, zu welcher Art Dämon er gehörte, aber so wie er dort stand, schien er das Wort Macht überhaupt erst erfunden zu haben. Er konnte kein niederer Dämon sein wie dieser Sucher oder ein Blender. Oh nein, bei ihm handelte es sich bestimmt um einen Hohedämon – einen Herzog oder einen Infernalischen Herrscher. Nur Wächter nahmen es mit diesen Dämonen auf, und üblicherweise endete das dann in einer blutigen Bescherung.
Mein Herz raste. Ich musste weg hier, und zwar so schnell wie möglich. Auf keinen Fall durfte ich mich mit einem Hohedämon anlegen. Mit meinen armseligen Fähigkeiten konnte ich gegen den nichts ausrichten, und im Gegenzug würde er mir einen Tritt in den Hintern verpassen, an den ich dann noch lange zurückdenken konnte. Außerdem wurde der Sucher mit jeder Sekunde wütender. Zornig ballte er immer wieder die Fäuste. Hier würde jeden Moment die Hölle los sein, und dann wollte ich möglichst längst über alle Berge sein.
Ich hob meine Büchertasche auf und hielt sie vor mich, als könnte sie mir irgendeinen Schutz bieten. Dabei gab es abgesehen von einem Wächter nichts auf der Welt, das einen Hohedämon aufhalten konnte.
„Warte“, meinte er zu mir. „Lauf noch nicht weg.“
„Komm ja nicht auf die Idee, auch nur einen Schritt näherzukommen“, warnte ich ihn.
„Ich tu dir bestimmt nichts, was du nicht willst.“
Ich verstand zwar nicht, was er damit sagen wollte, hatte aber gerade nicht wirklich die Zeit, um sein Statement gründlich zu analysieren. Stattdessen ging ich weiter langsam um den Sucher herum und hielt auf die Einmündung zur Hauptstraße zu, die unendlich weit entfernt zu sein schien.
„Du läufst ja doch weg.“ Der Hohedämon seufzte. „Obwohl ich dich gerade gebeten habe, genau das nicht zu machen. Und ich dachte, ich hätte das sehr nett getan.“ Nachdenklich musterte er den Sucher. „Oder war ich etwa nicht nett zu ihr?“
Der Sucher knurrte. „Nichts für ungut, aber mir ist egal, wie nett du bist. Du störst mich bei der Arbeit, du Handlanger.“
Diese Beleidigung ließ mich aufhorchen. Nicht nur, dass der Sucher in einem solchen Tonfall mit einem Hohedämon redete, aber das war so eine … menschliche Bemerkung.
„Kennst du eigentlich dieses schöne alte Sprichwort?“, erkundigte sich der andere Dämon. „Stock und Stein brechen mein Gebein, doch dich hau ich kurz und klein.“
Verdammt! Wenn ich es zurück auf die Hauptstraße schaffte, konnte ich die beiden abschütteln. In der Gegenwart von Menschen konnten sie mich nicht angreifen, so war es in den Regeln festgelegt. Allerdings erschien es mir fraglich, ob die zwei sich überhaupt an irgendwelche Regeln halten würden. Kurz entschlossen machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte auf das Ende der Gasse zu.
Allzu weit kam ich jedoch nicht.
Der Sucher rammte mich wie ein Footballspieler und schleuderte mich gegen einen Müllcontainer. Schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen. Etwas Pelziges, Fiepsendes landete auf meinem Kopf und entlockte mir einen Schrei, bei dem jede Todesfee vor Neid erblasst wäre. Mit einer Hand kriegte ich einen zarten Leib zu fassen, der sich in meinem Griff wandte. Kleine Klauen krallten sich an meinen Haaren fest, doch endlich gelang es mir, mich von der Ratte zu befreien und sie in Richtung der Müllbeutel zu schmeißen. Quiekend prallte sie dort ab, knallte auf die Erde und verschwand in aller Eile durch einen Riss im Mauerwerk.
Leise knurrend stand der Hohedämon auf einmal hinter dem Sucher, packte ihn an der Gurgel und hob ihn hoch, bis er keinen Boden mehr unter den Füßen hatte und nur noch hilflos zappeln konnte. „Das war nicht sehr nett“, ließ der Hohedämon ihn in Unheil verkündendem Unterton wissen.
Er wirbelte herum und warf den Sucher wie einen nassen Sack gegen die Mauer, an der er dann nach unten rutschte und mit den Knien voran auf den Boden stürzte. Der Hohedämon hob den Arm, augenblicklich löste sich das Tattoo von seiner Haut und zerfiel in Zigtausende schwarze Punkte, die sekundenlang zwischen ihm und dem Sucher in der Luft hingen, zu Boden sanken und sich dort wieder zusammensetzten.
Und zwar zu einer mindestens drei Meter langen Schlange. Ich sprang auf und ignorierte mir in instinktivem Selbstschutz dermaßen einen ab, dass mir schwindlig wurde.
Brachte aber nichts, im Gegenteil. Das Ding drehte sich zu mir um und richtete sich auf. Die Augen leuchteten in einem unheilvoll lodernden Rot.
Mein Aufschrei blieb mir im Hals stecken.
„Du musst vor Bambi keine Angst haben“, versicherte der Dämon mir liebenswürdig. „Sie ist nur neugierig und hat vielleicht ein bisschen Hunger.“
Das Ding hieß Bambi?
Oh Gott, das Ding starrte mich an, als wollte es mich auf der Stelle verschlingen.
Das Di… Die Riesenschlange versuchte gar nicht erst, mich zu vertilgen, sondern drehte sich weg und wandte sich dem Sucher zu. Vor Erleichterung wär ich fast auf die Knie gesunken. Die Schlange schoss auf die gegenüberliegende Seite der Gasse zu und baute sich vor dem niederen Dämon auf, der wie erstarrt dalag. Langsam öffnete sie ihr Maul, zwei Fangzähne kamen zum Vorschein, so lang wie meine Hände. Dahinter klaffte ein bodenloses schwarzes Loch.
„Na ja“, murmelte der Dämon spöttisch. „Vielleicht hat sie ja doch richtig großen Hunger.“
Das war für mich das Stichwort, um die Flucht zu ergreifen.
„Warte!“, rief der Dämon mir hinterher, doch ich blieb nicht stehen, sondern rannte so schnell wie noch nie in meinem Leben. Sein wüster Fluch war das Letzte, was ich von den beiden hörte.
Ich überquerte die Straßen, die in den Dupont Circle mündeten, und kam an dem Laden vorbei, vor dem ich mich eigentlich mit Stacey und Sam hatte treffen sollen. Erst nachdem ich den Platz erreicht hatte, an dem mich Morris – unser Chauffeur und Mädchen für alles – abholen würde, blieb ich stehen und schnappte nach Luft.
Um mich herum pulsierte der sanfte Schein der Seelen, aber davon nahm ich keine Notiz. Während ich mich auf die Bank am Straßenrand setzte, fühlte sich mein Körper durch und durch taub an. Ich kam mir vor wie im falschen Film. Was zum Teufel war da gerade eben passiert? Eigentlich hatte ich heute Abend doch nur an Im Westen nichts Neues arbeiten wollen. Dass ich fast eine Seele verschlungen hätte und beinahe getötet worden wäre, dass ich zum ersten Mal einem Hohedämon begegnen und zusehen würde, wie sich eine Tätowierung in eine Anakonda verwandelte – das war alles nicht geplant gewesen.
Ich schaute auf meine leeren Hände.
Und auch nicht, dass ich mein Handy verlieren würde.
Elender Dreck.
2. KAPITEL
Auf dem Weg zum Haus in der Dunmore Lane sprach Morris kein Wort, was mich aber nicht wunderte. Morris war immer sehr schweigsam. Vielleicht hatten die Dinge ihm die Sprache verschlagen, die er in unserem Haus mit angesehen hatte. Ich kannte den Grund wirklich nicht.
Nachdem ich gut eine Stunde auf der Bank gesessen und auf ihn gewartet hatte, war ich so zappelig, dass ich während der Heimfahrt die ganze Zeit über mit einem Fuß gegen das Armaturenbrett tippte. Bis nach Hause waren es nur gerade mal vier Meilen, aber vier Meilen in Washington zogen sich hin wie eine Milliarde Kilometer in jeder anderen Stadt. Zügig kamen wir nur auf dem Abschnitt voran, der bereits zum Grundstück gehörte und zu Abbots gigantischem Anwesen führte.
Mit seinen drei Etagen, unzähligen Gästezimmern und sogar einem Pool im Untergeschoss war das Ganze eigentlich mehr ein Hotel als eine private Villa. Genau genommen war es der Ort, an dem die unverheirateten Wächter des Clans lebten und der die Funktion einer Kommandozentrale hatte. Als wir näher kamen, stutzte ich und stieß einen leisen Fluch aus, der mir einen missbilligenden Blick von Morris einbrachte.
Auf der Dachkante hockten sechs steinerne Gargoyles, die am Morgen noch nicht dort gewesen waren. Besuch. Na, großartig.
Ich nahm den Fuß vom Armaturenbrett und griff nach meiner Tasche. Sogar mit angelegten Flügeln und gesenkten Köpfen boten die Gestalten vor dem Sternenhimmel einen grandiosen Anblick.
In ihrer ruhenden Form waren Wächter so gut wie unzerstörbar. Feuer konnte ihnen nichts anhaben, mit Hammer und Meißel konnte man ihre Hülle nicht aufbrechen. Seit die Wächter an die Öffentlichkeit gegangen waren, hatten die Menschen es mit jeder verfügbaren Waffe versucht. Die Dämonen waren schon seit einer Ewigkeit damit beschäftigt, ohne jeden Erfolg. Wächter waren nur verwundbar, wenn sie menschliche Gestalt annahmen.
Als Morris den Wagen vor der breiten Veranda stoppte, sprang ich raus und rannte so schnell die Stufen rauf, dass ich ein Stück weit rutschte, ehe ich vor der Tür zum Stehen kam. In der oberen linken Ecke der Veranda drehte sich eine kleine Kamera in meine Richtung, bis sie mich erfasste. Das rote Licht blinkte. Irgendwo in den riesigen Räumen und Gängen unter dem Herrenhaus saß Geoff im Kontrollraum vor seinem Monitor und machte sich garantiert einen Spaß daraus, mich warten zu lassen.
Ich streckte ihm die Zunge raus.
Eine Sekunde später sprang das Licht auf Grün um.
Als ich hörte, wie die Tür entriegelt wurde, verdrehte ich die Augen, ging nach drinnen und warf meine Tasche auf den Boden im Foyer. Erst lief ich zur Treppe, überlegte es mir dann aber anders und nahm Kurs auf die Küche. Die war zum Glück menschenleer. Aus dem Kühlschrank holte ich eine Rolle Cookie-Teig, riss ein Stück ab und machte mich erst dann auf den Weg nach oben. Im Haus herrschte Totenstille. Zu dieser Tageszeit waren die meisten unten in der Trainingshalle oder bereits zur Jagd aufgebrochen.
Alle bis auf Zayne. Solange ich zurückdenken konnte, war Zayne nie auf die Jagd gegangen, ohne mich vorher noch gesehen zu haben.
Ich nahm drei Stufen auf einmal, kaute dabei auf dem Stück Teig herum und wischte die Finger schließlich an meinem Jeansrock ab. Mit der Hüfte stieß ich die Tür zu Zaynes Zimmer auf … und erstarrte. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, endlich mal anzuklopfen, bevor ich irgendwo reinmarschierte.
Als Erstes sah ich sein perlweißes, schillerndes Leuchten – das Leuchten einer reinen Seele. Im Gegensatz zu Menschen war die Essenz eines Wächters absolut rein, weil sie ihr Wesen widerspiegelte. Nur wenige Menschen besaßen noch eine reine Seele, wenn sie sich erst einmal für das geöffnet hatten, was sie als freien Willen bezeichneten. Ich hatte keine reine Seele, weil ich den Makel des Dämonenbluts in mir trug, das wusste ich. Ja, ich war mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt eine Seele besaß. Sehen konnte ich meine eigene jedenfalls nie.
Manchmal … manchmal beschlich mich das Gefühl, gar nicht dazu zu gehören … zu den Wächtern und zu Zayne.
Schamgefühl regte sich leise in mir, aber bevor es sich wie giftiger Rauch ausbreiten konnte, verblasste Zaynes Seele, und mit einem Mal drehten sich meine Gedanken um rein gar nichts.
Zayne kam gerade aus der Dusche und zog sich ein schlichtes schwarzes T-Shirt an. Ich erhaschte einen flüchtigen und sehr verlockenden Blick auf seine Bauchmuskeln. Eisernes Training sorgte dafür, dass sein Körper hart war wie aus Stein gemeißelt. Widerwillig ließ ich meine Augen nach oben wandern, nachdem sein Oberkörper unter dem Stoff verschwunden war. Sein feuchtes, sandbraunes Haar klebte an den markanten Wangen. Zaynes Gesicht war fast eine Spur zu vollkommen, wären da nicht diese wässrigblauen Augen gewesen, die jeder Wächter hatte.
Ich schlenderte durchs Zimmer und setzte mich auf die Bettkante. Solche Gedanken hätte ich in Bezug auf Zayne eigentlich gar nicht haben dürfen, immerhin war er für mich praktisch so etwas wie ein Bruder. Sein Vater Abbot hatte uns gemeinsam großgezogen, und Zayne betrachtete mich als die kleine Schwester, die man ihm irgendwie aufgehalst hatte.
„Was gibt’s, Layla-Biene?“, fragte er.
Einerseits gefiel es mir, wenn er den Spitznamen aus meiner Kindheit benutzte. Andererseits hasste ich es aber auch, denn ich war kein kleines Mädchen mehr. Ich warf ihm einen verstohlenen Blick zu. Inzwischen war er vollständig angezogen. Wirklich zu schade. „Wer ist das auf dem Dach?“
Er setzte sich zu mir. „Ein paar Leute von außerhalb, sie sind gerade in der Stadt und waren auf der Suche nach einem Platz, wo sie sich eine Weile ausruhen können. Abbot hat ihnen Betten angeboten, aber das Dach war ihnen lieber. Sie haben nicht …“ Mitten im Satz brach er ab, beugte sich vor und griff nach meinem Bein. „Wieso sind deine Knie aufgescheuert?“
Als seine Hand mein bloßes Bein berührte, kam es hinter meiner Stirn zu einem Kurzschluss. Meine Wangen glühten, dann breitete sich die Hitze über meinen restlichen Körper aus, weiter und weiter – sehr weit hinunter. Ich starrte auf seine hohen Wangenknochen, auf seine Lippen … oh Gott, diese Lippen waren einfach perfekt. Tausend Fantasien gingen mir durch den Kopf, die sich alle um ihn und mich und darum drehten, ihn zu küssen, ohne ihm gleichzeitig die Seele aus dem Leib zu saugen.
„Layla, was ist heute Abend passiert?“ Er ließ mein Bein los.
Ich schüttelte den Kopf und verscheuchte meine aussichtslosen Träume. „Ähm … eigentlich nichts.“
Zayne rückte näher und schaute mich eindringlich an. Tatsächlich besaß er die verblüffende Fähigkeit, genau zu merken, wann ich flunkerte. Aber wenn ich ihm alles erzählte, also auch die Sache mit dem Hohedämon, würden sie mich nie wieder allein aus dem Haus lassen. Ich genoss meine Freiheit. Sie war so ziemlich das Einzige, was ich hatte.
Ich seufzte. „Ich dachte, ich würde einen Blender verfolgen.“
„Aber es war keiner?“
„Nein.“ Ich wünschte, er würde wieder mein Bein berühren. „Er entpuppte sich als ein Sucher, der sich nur als Blender ausgegeben hatte.“
Es war schon erstaunlich, wie schnell Zayne sich von einem superscharfen Typen in einen todernsten Wächter verwandeln konnte. „Was meinst du damit, dass er sich nur als Blender ausgegeben hat?“
Ich zuckte betont lässig mit den Schultern. „Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich habe ihn zuerst bei McDonald’s gesehen. Da hatte er den Appetit eines Blenders und führte sich auch wie einer auf. Also bin ich ihm gefolgt, und dabei hat sich dann herausgestellt, dass er gar kein Blender war. Aber markiert habe ich ihn trotzdem.“
„Das ergibt keinen Sinn“, sagte er und zog die Brauen zusammen, so wie immer, wenn er angestrengt über eine Sache nachdachte. „Sucher-Dämonen sind Laufburschen, oder sie werden von irgendeinem Idioten gerufen, damit sie ihm irgendwelchen Blödsinn wie Froschaugen oder das Blut eines Weißkopfseeadlers bringen, das er unbedingt für einen Zauber benötigt, der dann sowieso nach hinten losgeht. Sich als Blender auszugeben, ist ganz untypisch für sie.“
Mir fiel wieder ein, was der Sucher gesagt hatte. Hab dich. Als hätte er nur auf mich gewartet. Eigentlich musste ich Zayne das erzählen. Aber sein Vater war schon unerträglich genug, wenn es darum ging, wohin ich wollte und mit wem ich unterwegs war. Von Zayne wiederum wurde erwartet, dass er seinem Vater alles Wichtige umgehend und haarklein berichtete, immerhin war Abbot das Oberhaupt des Wächterclans von D. C. Bestimmt hatte ich den Sucher nur falsch verstanden. Dämonen brauchten selten einen Grund, wenn sie schräge oder unerwartete Dinge machten. Sie waren Dämonen, und das reichte als Erklärung.
„Ist alles in Ordnung?“, wollte Zayne wissen.
„Ja, alles okay.“ Ich machte eine kurze Pause. „Nur hab ich mein Handy verloren.“
Er lachte. Oh Mann, für mich gab es kaum was Schöneres als sein tiefes lautes Lachen. „Himmel, Layla. Das wievielte ist das in diesem Jahr?“
„Das fünfte.“ Ich betrachtete seine vollgestopften Bücherregale und seufzte. „Von Abbot werde ich keins mehr kriegen. Er glaubt, ich verliere sie absichtlich. Tu ich aber gar nicht. Es ist einfach so, dass sie … dass sie mir die Freundschaft kündigen.“
Wieder musste Zayne lachen, dann stieß er mich mit dem Knie an. „Wie viele hast du heute markiert?“
Ich zählte nach, was in der Zeit zwischen Schulschluss und meinem Treffen mit Stacey und Sam passiert war. „Neun, davon zwei Blender, der Rest waren Chaos-Dämonen. Ausgenommen natürlich der Sucher.“ Den Zayne sehr wahrscheinlich nicht mehr finden würde, da davon auszugehen war, dass Bambi ihn verspeist hatte.
Zayne stieß einen anerkennenden Pfiff aus. „Nicht schlecht. Dann habe ich heute Nacht genug zu tun.“
Denn genau das war die Aufgabe der Wächter. Schon lange bevor sie an die Öffentlichkeit gegangen waren, hatte Generation für Generation die Dämonenbevölkerung in Schach gehalten. Ich war damals erst sieben gewesen, deshalb konnte ich mich nicht daran erinnern, wie die Öffentlichkeit reagiert hatte. Aber ich war mir sicher, dass nach so einer Enthüllung eine Menge Leute ausgerastet sein mussten. Seltsam, dass ich genau um diese Zeit herum von ihnen aufgenommen worden war.
Die Alphas – das waren die engelsgleichen Typen, die alle Fäden in der Hand hielten – hatten seinerzeit begriffen, dass es auf der Welt Gut und Böse geben musste: das Gesetz der Ausgewogenheit. Aber vor zehn Jahren war irgendwas vorgefallen. Dämonen quollen in Scharen durch die Portale und richteten überall Chaos und Verwüstung an, ganz egal wo sie auftauchten und mit wem oder was sie in Berührung kamen. Sie ergriffen von Menschen Besitz, was sich zu einem riesigen Problem entwickelte, bis die Situation völlig außer Kontrolle zu geraten drohte. Unsere Freunde aus der Hölle wollten nicht länger im Dunkeln bleiben, und die Alphas durften nicht zulassen, dass die Menschheit erfuhr, dass Dämonen tatsächlich existierten. Abbot hatte mir mal erzählt, dass das mit dem freien Willen und dem Glauben zusammenhing. Die Menschen mussten an Gott glauben, ohne zu wissen, dass die Hölle tatsächlich existierte. Da die Alphas entschlossen waren, alles zu tun, damit die Menschheit auch weiterhin Dämonen nicht für real hielt, hatten sie ihnen den Auftrag erteilt, die Existenz von Dämonen geheim zu halten. Das kam mir ziemlich riskant vor, weil die Menschen vielleicht irgendwann eins und eins zusammenzählen und dahinterkommen würden, dass Dämonen sehr wohl existierten. Aber was wusste ich schon?
Nur ein paar ausgesuchten Menschen war die Wahrheit bekannt. Von Morris abgesehen gab es weltweit einige Leute bei der Polizei, der Regierung und ganz sicher auch beim Militär, die von der Existenz der Dämonen wussten. Sie alle waren Menschen, die ihre Gründe hatten, den Rest der Bevölkerung im Unklaren zu lassen. Gründe, die nichts mit ihrem Glauben zu tun hatten. Hätten die Menschen gewusst, dass hinter ihnen in der Schlange ein Dämon stand, wenn sie morgens ihren Kaffee bestellten, die Welt wäre in Chaos versunken.
Aber so lief es nun mal. Die Wächter halfen dem jeweiligen Polizeidezernat dabei, Kriminelle zu fassen, unter denen sich auch einige Dämonen befanden. Unter anderen Umständen hätten sie sofort ihre „Du kommst aus dem Gefängnis frei“-Karte einlösen können, so aber wurden sie auf direktem Weg in die Hölle zurückgeschickt, ohne erst noch über „Los“ zu gehen. Sollten die Dämonen sich jemals der Menschheit zu erkennen geben, würden die Alphas alle Dämonen auf der Erdoberfläche vernichten, also auch meine halbdämonische Wenigkeit.
„In letzter Zeit wird es immer heftiger“, sagte Zayne, schien aber mehr mit sich selbst zu reden. „Es sind sehr viel mehr Blender unterwegs als üblich, und in einigen Bezirken sind Wächter sogar auf Hellions gestoßen.“
„Hellions?“, wiederholte ich erschrocken und sah ihn mit großen Augen an.
Als Zayne nickte, sah ich so eine übergroße Bestie direkt vor mir. Hellions hatten an der Oberfläche gar nichts zu suchen, das waren mutierte Affen mit einem Schuss Pitbull.
Zayne bückte sich und suchte etwas unter seinem Bett. Dabei fielen ihm die Haare ins Gesicht, also konnte er mich nicht sehen, und ich durfte ihn einen Moment lang unbemerkt anstarren. Er war nur vier Jahre älter als ich, aber als Wächter war er viel reifer als ein Mensch im gleichen Alter. Ich wusste alles über ihn, nur nicht, wie er wirklich aussah.
Das war das Eigenartige an Gargoyles. Die Hülle, in der sie tagsüber steckten, hatte nichts damit zu tun, wer sie in Wirklichkeit waren. Zum x-ten Mal rätselte ich über sein wahres Erscheinungsbild. In seiner menschlichen Hülle war er einfach nur heiß, aber im Gegensatz zu den anderen ließ er mich nie seine eigentliche Form sehen.
Da ich nur zur Hälfte Wächterin war, konnte ich mich anders als vollwertige Wächter nicht wandeln. Ich steckte auf Dauer in dieser menschlichen Form fest, war unwiderruflich mit einem Makel behaftet. Wächter mit Makeln taugten üblicherweise nicht viel, und wenn ich nicht diese besondere Fähigkeit besessen hätte, Seelen sehen und diejenigen markieren zu können, die keine besaßen, wäre ich insgesamt ziemlich überflüssig gewesen.
Als Zayne sich wieder aufrichtete, hielt er ein Fellknäuel in der Hand. „Guck mal, was ich gefunden habe. Du hast ihn neulich Abend hier vergessen.“
„Mr Snotty!“ Ich schnappte mir den zerlumpten Teddybär und lächelte strahlend. „Ich hatte mich schon gefragt, wo er steckt.“
Zayne erwiderte mein Lächeln. „Ich fass es ja nicht, dass du den Bären immer noch hast.“
Ich ließ mich nach hinten fallen und drückte den Teddy an meine Brust. „Den hast du mir geschenkt.“
„Das ist eine Ewigkeit her.“
„Er ist mein Lieblings-Stofftier.“
„Er ist dein einziges Stofftier.“ Zayne legte sich zu mir und schaute hinauf zur Decke. „Du bist früher zu Hause, als ich erwartet hätte. Wolltest du nicht noch mit deinen Freunden lernen?“
Ich zuckte lässig mit den Schultern.
Zayne tippte mit den Fingern auf seinen Bauch. „Das ist seltsam. Normalerweise quengelst du, weil du später nach Hause kommen willst.“
Ich biss mir auf die Lippe. „Ja, und? Ich hab dir doch erzählt, was passiert ist.“
„Stimmt, aber du hast mir nicht alles gesagt.“ Ich sah ihn an. „Welchen Grund hättest du, mich zu belügen?“
Unsere Gesichter waren sich sehr nah, aber noch nicht so nah, dass es hätte gefährlich werden können. Zayne vertraute mir, er war davon überzeugt, dass ich mehr Wächterin als Dämonin war. Ich musste an die Schlange denken … und an den Jungen, der eigentlich kein Junge, sondern ein hochrangiger Dämon war.
Mir schauderte.
Zayne legte seine Hand auf meine, und mein Herz setzte einen Schlag lang aus. „Sag mir die Wahrheit, Layla-Biene.“
Ich konnte mich noch gut an das erste Mal erinnern, als er mich so genannt hatte.
Es war in jener Nacht gewesen, als sie mich in dieses Haus gebracht hatten. Mit meinen damals sieben Jahren hatte ich panische Angst vor den geflügelten Kreaturen mit ihren spitzen Zähnen und roten Augen, die mich aus dem Haus meiner Pflegeeltern wegholten. Kaum hatten sie mich hier im Foyer abgesetzt, rannte ich los, versteckte mich im ersten Schrank, den ich finden konnte, und rollte mich zusammen. Einige Stunden später gelang es Zayne, mich aus meinem Versteck zu locken, indem er mir einen wunderschönen Teddybär hinhielt und mich Layla-Biene nannte. Selbst mit seinen elf Jahren war er mir da schon überlebensgroß erschienen, und von diesem Augenblick an war ich ihm nicht mehr von der Seite gewichen. Für die älteren Wächter war das ein gefundenes Fressen, um Zayne immer wieder aufzuziehen.
„Layla?“, fragte er und drückte meine Hand etwas fester.
„Glaubst du, ich bin böse?“, platzte ich heraus.
Er runzelte die Stirn. „Wie kommst du denn darauf?“
Ich sah ihn eindringlich an. „Zayne, ich bin zur Hälfte Dämonin …“
„Du bist eine Wächterin, Layla.“
„Das sagst du jedes Mal, aber das stimmt so nicht. Ich bin mehr wie ein … wie ein Maultier.“
„Ein Maultier?“, wiederholte er verwundert.
„Ja, ein Maultier. Du weißt schon, halb Pferd, halb Esel …“
„Ich weiß, was ein Maultier ist, Layla, und ich will sehr hoffen, dass du dich nicht mit einem vergleichst.“
Ich erwiderte nichts, denn ich war wirklich so wie ein Maultier. Ein seltsamer Mischling, halb Dämonin, halb Wächterin. Und genau deswegen würde man mich nie mit einem anderen Wächter verpaaren. Selbst Dämonen würden mich nicht haben wollen, wenn sie erst mal wussten, was ich war. Ja, doch, ich fand, der Vergleich traf zu.
„Nur weil deine Mutter das war, was sie war“, erklärte er seufzend, „macht dich das nicht zu etwas Bösem und erst recht nicht zu einem Maultier.“
Ich schaute wieder zur Decke. Der Ventilator drehte sich unablässig und warf seltsame Schatten quer über die Decke. Tochter einer dämonischen Mutter, der ich nie begegnet war, und eines Vaters, an den ich mich nicht erinnern konnte. Und da regte sich Stacey darüber auf, dass ihre Mutter alleinerziehend war. Wenn sie das schon für eine kaputte Familie hielt … Ich griff nach dem Ring an meiner Kette und spielte nervös damit.
„Das weißt du doch, oder?“, fuhr Zayne eindringlich fort. „Du bist nicht böse, Layla. Du bist gut und schlau und …“ Plötzlich unterbrach er sich, setzte sich auf und beugte sich wie ein Schutzengel über mich. „Du hast doch heute Abend niemandem die Seele genommen? Layla, falls doch, musst du es mir jetzt sofort sagen. Wir werden uns was überlegen. Ich werde es auch bestimmt vor meinem Vater geheim halten, aber du musst es mir sagen.“
Natürlich durfte Abbot auf keinen Fall etwas davon erfahren, sollte ich jemals so etwas machen – nicht mal, wenn es unabsichtlich geschah. So wichtig ich ihm auch sein mochte, dann würde er mich sofort vor die Tür setzen. Eine Seele zu rauben, war aus zig moralischen Gründen verboten.
„Nein, ich habe keine Seele geraubt.“
Zayne sah mich lange an, dann nahm er die Schultern zurück. „Mach mir nicht noch mal solche Angst, Layla.“
Ich drückte Mr Snotty fest an mich. „Tut mir leid.“
Zayne nahm meine Hand und zog sie vom Teddy weg. „Du hast Fehler gemacht, aber daraus hast du gelernt. Du bist nicht böse, das musst du dir immer vor Augen halten. Was früher einmal geschehen ist, ist für immer Vergangenheit.“
Nervös knabberte ich an meiner Unterlippe, während ich an besagte Fehler dachte. Es waren einige gewesen. Der erste Zwischenfall dieser Art hatte die Wächter zu meiner Pflegefamilie geführt. Unabsichtlich hatte ich dort jemandem die Seele geraubt, okay, nicht die komplette Seele, aber immerhin noch so viel, dass die Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auf irgendwelchen Umwegen hatten die Wächter davon erfahren und mich aufgespürt.
Bis zum heutigen Tag begriff ich nicht, wieso Abbot mich bei sich behalten hatte. Für die Wächter in ihrer schwarz-weißen Welt waren Dämonen immer nur schwarz. Es gab für sie keinen guten oder unschuldigen Dämon. Als halbdämonisch hätte man mit mir eigentlich nach dem Motto „Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon“ verfahren müssen, aber aus irgendeinem Grund sahen die Wächter in mir dennoch etwas anderes.
Du kennst den Grund, flüsterte mir eine hässliche Stimme in meinem Kopf zu, woraufhin ich die Augen zukniff. Meine Fähigkeit zu sehen, wer eine Seele besaß und wer nicht, eine Fähigkeit, die ich meinem dämonischen Anteil zu verdanken hatte, war ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen das Böse. Aber Wächter konnten Dämonen auch so wahrnehmen, wenn sie nur dicht genug an sie herankamen. Ohne mich wäre ihre Arbeit nur mühseliger gewesen, aber nicht völlig unmöglich.
Jedenfalls redete ich mir das ein.
Zayne drehte meine Hand um und schob seine Finger zwischen meine. „Du warst wieder am Keksteig. Hast du mir diesmal wenigstens etwas übrig gelassen?“
Wahre Liebe bedeutete, den Heißhunger auf irgendwas Verrücktes zu teilen. Zumindest wollte ich das glauben. Ich machte die Augen wieder auf. „Eine halbe Packung ist noch da.“
Lächelnd ließ er sich aufs Bett zurücksinken, hielt aber meine Hand weiter fest. Ein paar Haarsträhnen lagen quer über seiner Wange. Zu gern hätte ich sie zur Seite gestrichen, aber ich brachte es nicht fertig. „Morgen besorge ich dir ein neues Handy“, sagte er nach einer Weile.
Ich lächelte ihn so strahlend an, als wäre er mein persönlicher Handyhersteller. „Diesmal aber bitte eines mit Touchscreen. Alle anderen haben so was auch.“
Er zog eine Augenbraue hoch. „Das würdest du innerhalb von Sekunden kaputtkriegen. Nein, was du brauchst, ist eines von diesen klobigen Satellitentelefonen.“
„Damit würde ich bestimmt unheimlich cool aussehen!“ Ich zog die Nase kraus und schaute auf die Wanduhr. Er musste bald los. „Ich schätze, ich sollte mich langsam hinsetzen und für morgen lernen.“
Er lächelte wieder. „Geh noch nicht.“
Mir wurde ganz warm ums Herz. Abermals sah ich zur Uhr. Ihm blieben immer noch einige Stunden, um Jagd auf die von mir markierten Dämonen zu machen. Dankbar für seine Bitte drehte ich mich auf die Seite, Mr Snotty lag genau zwischen uns.
Zayne ließ meine Hand los und strich ein paar Haarsträhnen aus meinem Gesicht. „Deine Haare sind immer zerzaust. Weißt du eigentlich überhaupt, wie man eine Bürste benutzt?“
Ich schlug seine Hand zur Seite, was mich zu meinem Entsetzen an die Ratte in der Gasse erinnerte. „Ja, ich weiß, wie man eine Bürste benutzt, du Arsch.“
Zayne lachte leise und widmete sich erneut meinen Haaren. „Was ist denn das für eine Ausdrucksweise, Layla?“, fragte er amüsiert.
Ich wurde wieder ruhiger, als er behutsam einige der Strähnen löste, die sich verknotet hatten. Dass er meine Haare berührte, war neu, aber ich hatte bestimmt nichts dagegen. Er hielt die Strähnen hoch und arbeitete konzentriert.
„Ich muss mir die Haare schneiden lassen“, sagte ich schließlich.
„Nein.“ Er strich mir die Strähnen über die Schulter. „Deine Haare sind … wunderschön lang. Und sie stehen dir, so wie sie sind.“
Mein Herz schmolz förmlich dahin, als ich das hörte. „Willst du wissen, wie es heute in der Schule war?“
Seine Augen leuchteten. Von mir abgesehen waren alle Wächter zu Hause unterrichtet worden, und Zaynes Collegekurse hatten größtenteils online stattgefunden. Er hörte mir interessiert zu, als ich von der Klassenarbeit erzählte, für die ich eine Zwei bekommen hatte, und als ich erwähnte, dass sich in der Cafeteria zwei Mädchen um einen Jungen geprügelt hatten und wie Stacey sich nach dem Unterricht versehentlich im Büro des Vertrauenslehrers eingeschlossen hatte.
„Ach, das hätte ich ja fast vergessen.“ Ich unterbrach mich und gähnte übertrieben. „Sam möchte dich für die Schülerzeitung interviewen. Es soll sich um deine Aufgaben als Wächter drehen, glaube ich.“
„Na, ich weiß nicht“, gab er zurück und verzog den Mund. „Wir sollen eigentlich keine Interviews geben. Die Alphas empfinden das als Eitelkeit.“
„Ich weiß. Ich habe ihm auch direkt gesagt, dass er sich keine Hoffnungen machen soll.“
„Gut. Vater würde ausrasten, wenn ich mit Journalisten rede.“
Ich musste kichern. „Sam ist kein Journalist, aber ich weiß, was du meinst.“
Eine Weile noch stellte er mir Fragen über Fragen. Obwohl ich mich krampfhaft wachhielt, fielen mir irgendwann die Augen zu. Als ich später aufwachte, war er schon lange weg – irgendwo da draußen auf der Jagd nach Dämonen. Vielleicht waren sogar ein paar Hohedämonen dabei und vielleicht ja auch der eine mit der Schlange namens Bambi.
Fast noch im Halbschlaf kramte ich mein Bio-Buch aus dem Spind. Ich blieb gerade mal drei Sekunden allein, dann schob sich eine grünliche Seele in mein Gesichtsfeld. Ich hob den Kopf und atmete tief ein. Ich mochte es, unschuldige Seelen um mich zu haben. Sie waren wunderbar durchschnittlich und nicht so verlockend wie …
Ein Fausthieb traf mich am Arm. „Du bist nicht mehr zum Lernen gekommen, Layla!“
Der Treffer ließ mich zur Seite wanken, aber die Spindtür gab mir Halt. „Verdammt, Stacey, das gibt einen blauen Fleck.“
„Du hast uns hängen lassen. Wieder mal!“
Ich schlug die Spindtür zu und drehte mich zu meiner besten Freundin um. Staceys Fausthiebe waren nicht ohne, wie ich feststellen musste. „Tut mir leid, aber ich musste nach Hause. Es war was Dringendes.“
„Es ist immer irgendwas Dringendes.“ Sie sah mich wütend an. „Das ist wirklich albern. Kannst du dir vorstellen, dass ich mir eine Stunde lang anhören musste, wie viele Leute Sam bei Assassin’s Creed umgebracht hat?“
„Ist ja schrecklich“, sagte ich lachend, während ich die Bücher in meiner Tasche verstaute.
„Ja, das war es wirklich.“ Sie zog ein Haarband vom Handgelenk und band ihre Haare zum Pferdeschwanz zusammen. „Aber ich vergebe dir.“
Stacey vergab mir immer, ob ich nun für irgendwas zu spät dran war oder auch gar nicht erst aufkreuzte. Warum sie das machte, begriff ich wirklich nicht. Manchmal war ich eine schreckliche Freundin. Dabei war Stacey eigentlich beliebt und hatte jede Menge Freunde. Aber seit dem ersten Jahr schien sie mich wirklich zu mögen, wenn sie mir all diese Dinge durchgehen ließ.
Wir mischten uns unter die anderen Schüler, die im Flur in alle Richtungen hin und her rannten, und mir stieg eine Mischung aus unterschiedlichsten Parfüms und Körpergerüchen in die Nase. Meine Sinne waren ein wenig schärfer als die normaler Menschen. Nicht so außergewöhnlich wie bei einem vollwertigen Dämon oder einem Wächter, aber dummerweise genügte es, um Dinge zu riechen, die die meisten Menschen gar nicht wahrnehmen konnten. „Das mit gestern Abend tut mir wirklich leid. Ich hab’s nicht mal geschafft, für die Bio-Prüfung zu lernen.“
Stacey kniff ihre mandelförmigen Augen ein wenig zusammen. „Du siehst ja jetzt noch so aus, als wärst du im Halbschlaf.“
„Im Unterricht gerade eben habe ich mich so gelangweilt, dass ich eingenickt bin. Beinahe wäre ich vom Stuhl gerutscht.“ Ich sah zu einer Gruppe von Jungs in Sportkleidung, die in der Nähe der leeren Trophäenvitrinen rumhingen. Unser Football-Team taugte einfach nichts. Ihre Seelen waren wie ein Regenbogen aus sanften Blautönen. „Mr Brown hat mich angebrüllt.“
Stacey kicherte. „Mr Brown brüllt jeden an. Und du konntest überhaupt nicht mehr lernen?“
Pinkfarbene Seelen, die eine Gruppe ausgelassen lachender Zehntklässler umgaben, zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. „Was?“
„Biologie“, sagte sie und seufzte gequält. „Du weiß schon, die Wissenschaft vom Leben. Wir sind auf dem Weg zum Unterrichtsraum. Da schreiben wir gleich eine Arbeit.“
Ich riss mich von den hübschen Farbtupfern los. „Oh, ach so. Nein, wie gesagt, ich habe überhaupt nicht dafür gelernt.“
Stacey klemmte sich die Bücher unter den anderen Arm. „Ich hasse dich. Du hast nicht mal ein Buch aufgeschlagen, und trotzdem wirst du wieder eine Eins kriegen.“ Sie strich sich die Stirnfransen aus den Augen und schüttelte den Kopf. „Das ist so was von unfair.“
„Ich weiß nicht. Mrs Cleo hat mir bei der letzten Arbeit eine Zwei gegeben, und ich habe überhaupt keine Ahnung, um welches Thema es diesmal gehen soll.“ Ich stutzte, als mir klar wurde, dass das leider stimmte. „Oh Mann, ich hätte gestern Abend wirklich noch lernen sollen.“