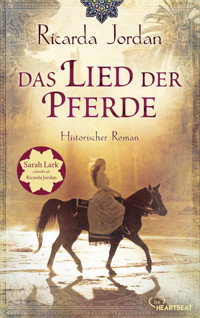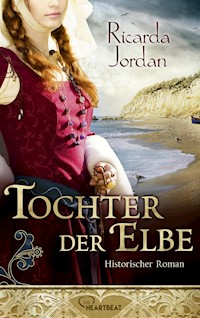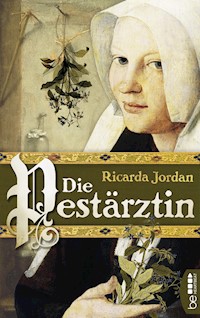7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Familien sind verfeindet. Hat ihre Liebe trotzdem eine Chance? Das bewegende Schicksal zweier Liebender vor prachtvoller historischer Kulisse
Mainz 1212. Bei der Krönung Friedrichs II. begegnen sich der junge Ritter Dietmar von Ornemünde und die schöne Sophia. Dietmar und Sophia verlieben sich auf den ersten Blick, doch eine Ehe ist undenkbar: Sophias Vater hat sich einst unrechtmäßig den Besitz von Dietmars Familie angeeignet und gar versucht, ihn und seine Mutter zu töten. Die Liebe zwischen den beiden scheint aussichtslos, vor allem als Sophia an den Hof Graf Raymonds von Toulouse geschickt wird - weit entfernt von Dietmar. Dabei gerät sie mitten in die Wirren des Albigenserkreuzzuges. Dietmar hingegen geht das Wagnis ein, sein Erbe zurückzufordern - mit entsetzlichen Folgen, nicht nur für die beiden Liebenden ...
Der neue fesselnde Mittelalterroman der Erfolgsautorin - eine farbenprächtige, gefühlvolle und spannende Fortsetzung von "Das Geheimnis der Pilgerin".
Die Bestseller-Autorin entführt uns als Sarah Lark ins ferne Neuseeland, als Ricarda Jordan lässt sie uns tief ins deutsche Mittelalter eintauchen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere historische Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
DAS URTEIL DES KÖNIGS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
DIE KRÖNUNG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
GETRENNTE WEGE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
DIE FEHDE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
DER KRIEG DER FRAUEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
DAS LÄCHELN GOTTES
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Nachwort
Weitere historische Romane der Autorin
Das Geheimnis der Pilgerin
Die Pestärztin
Der Eid der Kreuzritterin
Die Geisel des Löwen
Tochter der Elbe
Töchter des Schicksals
Das Lied der Pferde
Über die Autorin
Ricarda Jordan ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Sie wurde 1958 in Bochum geboren, studierte Geschichte und Literaturwissenschaft und promovierte. Sie lebt als freie Autorin in Spanien.
Unter dem Autorennamen Sarah Lark schreibt sie mitreißende Neuseeland- und Karibikschmöker, die allesamt Bestseller sind und auch international ein großes Lesepublikum erfreuen. Als Ricarda Jordan entführt sie ihre Leser ins farbenprächtige Mittelalter.
Über dieses Buch
Ihre Familien sind verfeindet. Hat ihre Liebe trotzdem eine Chance? Das bewegende Schicksal zweier Liebender vor prachtvoller historischer Kulisse
Mainz 1212. Bei der Krönung Friedrichs II. begegnen sich der junge Ritter Dietmar von Ornemünde und die schöne Sophia. Dietmar und Sophia verlieben sich auf den ersten Blick, doch eine Ehe ist undenkbar: Sophias Vater hat sich einst unrechtmäßig den Besitz von Dietmars Familie angeeignet und gar versucht, ihn und seine Mutter zu töten. Die Liebe zwischen den beiden scheint aussichtslos, vor allem als Sophia an den Hof Graf Raymonds von Toulouse geschickt wird – weit entfernt von Dietmar. Dabei gerät sie mitten in die Wirren des Albigenserkreuzzuges. Dietmar hingegen geht das Wagnis ein, sein Erbe zurückzufordern – mit entsetzlichen Folgen, nicht nur für die beiden Liebenden …
Der neue fesselnde Mittelalterroman der Erfolgsautorin – eine farbenprächtige, gefühlvolle und spannende Fortsetzung von Das Geheimnis der Pilgerin.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Ricarda Jordan
DAS ERBEDER PILGERIN
Historischer Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Titelillustration: © shutterstock/Galyna Andrushko
Umschlaggestaltung: Manuela Städele
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1629-1
be-ebooks.de
lesejury.de
DAS URTEILDES KÖNIGS
Paris – Al AndalusFrühling 1203
Kapitel 1
Er wird uns schon nicht gleich aufhängen.«
Gerlin de Loches’ Worte sollten ihren Gatten aufheitern, aber sie klangen eher so, als wolle sie sich selbst Mut zusprechen. Florís’ Miene, die schon während der ganzen Reise von ihrer Burg in Loches nach Paris eine Stimmung zwischen Trauer und Besorgnis ausdrückte, wandelte sich denn auch nur zu einem schwachen Grinsen.
»Da bin ich zuversichtlich«, gab der Ritter schließlich bemüht scherzhaft zurück. »Wir sind von hohem Adel. Wir haben ein Anrecht auf einen Tod durch das Schwert.«
Gerlin versuchte zu lachen. »Ach, Florís, Richards anderen Lehnsleuten hat er auch nichts getan. Im Gegenteil. Bisher wurden alle Treueschwüre huldvoll angenommen. Philipp ist doch froh, dass ihm das Land jetzt ganz ohne Krieg zufällt. Er kriegt genau das, was er wollte. Also warum sollte er dich nicht einfach in deiner Stellung bestätigen und …«
»Mir fielen da eine ganze Menge Gründe ein«, bemerkte Florís und überprüfte wohl zum zehnten Mal den Sitz seines juwelengeschmückten Gürtels über seiner feinen, wollenen Tunika. Er trug sein Schwert, war aber sonst nicht gerüstet. An diesem Tag war er schließlich eher ein Bittsteller denn ein stolzer Ritter und Herr über die Burg von Loches. »Du erinnerst dich nicht an die Schlacht von Fréteval? Und die Sache mit dem Kind?«
»Das ist so lange her …«, meinte Gerlin und musterte die Ausstattung ihres Sohnes.
Der fast zehnjährige Dietmar stand hinter ihnen, ähnlich gewandet wie sein Ziehvater Florís. Gerlin hatte seine Kleider aus dem gleichen edlen Wollstoff geschneidert wie die ihres Gatten, das dunkle Blau passte zu ihrer beider blondem Haar und ihren blauen Augen. Gerlin selbst hatte sich für ein möglichst unauffälliges Kleid entschieden, ein schlichtes, nicht zu weit ausgeschnittenes Gewand in Goldbraun. Ihr prächtiges kastanienfarbenes Haar verbarg sie unter einem strengen Gebende.
»Der König wird sich gar nicht mehr an uns erinnern«, behauptete sie.
Florís sah sie zweifelnd an. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand seine Gattin vergessen konnte, der je in ihre strahlenden aquamarinblauen Augen geblickt hatte. Und König Philipp August von Frankreich hatte sie sicher eindringlich gemustert.
»Seigneur et Madame de Loches? Seine Majestät wird Euch gleich empfangen!«
Bevor Florís noch etwas erwidern konnte, öffnete sich die Tür zu den Empfangsräumen des Königs, und ein Diener ließ Justin de Frênes, einen alten Freund und Waffengefährten Florís’, in den Saal, in dem Gerlin und ihre Familie warteten. Justin wirkte deutlich erleichtert. Zumindest ihn gedachte der König wohl nicht zu hängen.
»Wie ist die Stimmung?«, erkundigte Florís sich dennoch besorgt.
Gerlin unterzog ihren Aufzug und den ihres Sohnes noch einmal einer Kontrolle. Nervös tastete sie nach ihrem Hals, an dem an diesem Tag eine schlichte Kette das Medaillon ersetzte, das sie gewöhnlich trug. Eigentlich fühlte sie sich nackt ohne das Schmuckstück, ein Geschenk der Königin Eleonore zu ihrer ersten Hochzeit. Aber zur Audienz mit dem französischen König hatte sie es lieber abgenommen. Sie musste ihm schließlich nicht auch noch Anlass geben, sich an sie zu erinnern …
»Nun, seine Majestät ist bester Laune …«, meinte Justin bitter, »… und äußerst huldvoll gestimmt. Er hat mich kaum auf König Richard angesprochen. Ebenso wenig auf die Umstände, unter denen ich mein Lehen erworben habe …«
Justin war ebenfalls Herr über eine Burg bei Vendôme und hatte sein Lehen kurz nach Florís und Gerlin angetreten. Beide Burgen lagen in den Besitzungen der englischen Könige auf dem französischen Festland. Das Land war einst als Mitgift der Königin Eleonore unter die Herrschaft der Plantagenets geraten, und König Richard Löwenherz hatte es gehalten und gegen jeden Eroberungsversuch der französischen Krone verteidigt. Florís und Justin hatten in König Richards Armee gekämpft und sich dabei ausgezeichnet. Ihr Lohn war ein Lehen in den umstrittenen Gebieten – das sie jetzt seit neun Jahren hielten. Nach einer zwar nicht vernichtenden, aber äußerst peinlichen Niederlage gegen die Plantagenets im Jahre 1194 hatte der französische König keine weiteren Versuche gestartet, seinem Kernland das Vendoˆmois und die anderen Länder einzuverleiben.
Und nun, dachte Florís bitter, überreichen wir sie ihm auf dem Präsentierteller.
»Der Ritter de Trillon …«
Der Diener erschien erneut, dieses Mal, um Florís und seine Familie zum König zu rufen – unter Florís’ Geburtsnamen, ein schlechtes Zeichen. Philipp August erinnerte sich durchaus an die Herkunft der Burgherren von Loches.
»Na, dann viel Glück!«, wünschte Justin, ein noch junger, gut aussehender Ritter in dunkelroter Tunika.
Florís und Gerlin nickten ihm einen Gruß zu. Ganz sicher würde er nicht warten, um herauszufinden, wie es für seine Freunde ausging. Er schien eindeutig hocherfreut, den Louvre verlassen zu können – und immer noch Herr über seine Burg zu sein. Wie es aussah, hatte der König seinen Treueid huldvoll angenommen.
Florís und Gerlin sowie der eingeschüchterte Dietmar folgten dem Diener in die Empfangsräume des Königs. Sie waren neu und kostbar möbliert wie alles in Philipps neuem Palast, der dem Wehrbau etwas außerhalb der Stadt Paris angeschlossen war. Philipp August hatte den Louvre bauen lassen, da die alten Wehrbauten auf der le de Îla Cité für die wachsende Hauptstadt seines Reiches nicht mehr ausreichten. Gerlin und Florís hatten das Bauwerk gebührend bewundert. Neun Jahre zuvor, als es sie erstmals herverschlagen hatte, war die Burg noch im Bau gewesen.
Natürlich umgaben den Monarchen im Audienzraum etliche Berater und Höflinge, Ritter, Knappen und Diener. Gerlin und ihre Familie durchschritten ein Spalier kostbar gekleideter Herren und weniger Damen – aber es kam ihnen eher vor wie ein Spießrutenlauf. Schließlich knieten sie nieder vor dem Thron des französischen Königs. Philipp August schien zunächst kaum an ihnen interessiert zu sein. Scheinbar angeregt plauderte er mit der Dame neben ihm. War es die Königin oder eine Mätresse? Gerlin interessierte es im Grunde wenig. Sie hätte nur gern seine Aufmerksamkeit gehabt … oder vielleicht doch nicht zu viel davon. Ergeben senkte sie den Blick, als der König seine Besucher schließlich bat, sich zu erheben.
Florís dagegen zwang sich, seinem künftigen Herrn in die Augen zu sehen. Im Gegensatz zu Gerlin war er ihm noch nie begegnet, aber er hätte ihn sicher erkannt: Philipp August war ein hochgewachsener, gut aussehender Mann mit hellbraunem langem Haar, auf dem jetzt ein goldener Reif als Zeichen seiner Königswürde prangte. Seine Augen waren blau, vielleicht etwas stechend und etwas zu eng zusammenstehend. Sie musterten den Ritter nun prüfend. Und den Jungen, der neben ihm kniete – und Gerlin, seine Frau.
»Ich wundere mich, Euch hier zu sehen, Seigneur de Trillon – oder de Loches«, sprach der König Florís jetzt an. »Und Euch, Frau Gerlindis – ehemals von Lauenstein, wenn ich mich richtig erinnere. Solltet Ihr nicht eher nach England reisen, um den Plantagenets einen unverhofften Erben zu präsentieren?«
Gerlin errötete zutiefst.
»Majestät«, ergriff sie das Wort, noch bevor Florís antworten konnte. »Ich muss mich entschuldigen …«
Der König grinste. »Das müsst Ihr fürwahr. Aber rekapitulieren wir doch einmal. Ihr seid zweifelsfrei die Dame, die vor Jahren an meinem Hof erschien, um mir ihr Kind als Sohn des englischen Königs vorzustellen …«
Gerlin biss sich auf die Lippen. »Nicht ganz«, sagte sie dann. »Tatsächlich hatten Eure Truppen mich gefangen genommen … unter ziemlich unglücklichen Umständen. Man hielt mich für eine Jüdin. Und ich wollte nicht verbrannt werden …«
»Aber zu … so einer Furcht bestand doch kein Anlass.«
Philipp druckste ein wenig herum, er ließ sich ungern an die damaligen Ausschreitungen gegen Pariser Juden erinnern.
»In jenen Tagen schon«, erklärte Gerlin mutig. »Jedenfalls erschien es mir als einziger Ausweg, Euch anzulügen. Was mir jetzt natürlich äußerst leidtut.«
Der König schnaubte. »So, jetzt tut es Euch also leid, während Ihr vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch stolz darauf wart, den König von Frankreich hinters Licht geführt zu haben. Was meinte denn übrigens König Richard – Gott habe ihn selig – zu der Geschichte? Man möchte doch meinen, auch er wäre in Versuchung geraten, Euch zu verbrennen!«
Gerlin errötete erneut. »Er … sah sich nicht genötigt, das Kind anzuerkennen«, bemerkte sie dann, woraufhin der König schallend lachte. »Obwohl …«
Gerlin wollte anführen, dass zwischen ihrer Familie und der des englischen Königs stets freundschaftliche Bande bestanden hatten, aber Philipp August deutete es anders.
»… obwohl ihm der hübsche kleine Sohn doch sehr gut angestanden hätte«, lachte der König. »Im Grunde hätte ihm und England nichts Besseres passieren können. Der Junge schien doch gesund und gut gewachsen.«
»Das ist er, Herr«, erklärte Gerlin und schob Dietmar vor. »Wenn ich Euch vorstellen darf, Dietmar von Ornemünde zu … zu Loches augenblicklich, aber er ist der legitime Erbe der Ornemünder zu Lauenstein.«
Dietmar verbeugte sich brav, während es für den französischen König jetzt etwas zu schnell ging.
»Also, wie viele Väter will der junge Mann denn wohl einmal beerben?«, erkundigte er sich. »Wo Richard Plantagenet die Chance schon vertan hat, seinem missratenen Bruder einen eigenen Nachkommen vor die Nase zu setzen?«
»Nur …« Gerlin setzte zu einer Erklärung an, aber nun nutzte Florís die Gelegenheit, das Gespräch auf sein ursprüngliches Ansinnen zu bringen.
»Verzeiht, Majestät, aber da der Name König Johanns eben fällt … Wir sind … ich bin … Der Treueid …«
König Philipp wehrte ab. »O ja, Herr Florís, ich weiß, was Euch herführt. Und ich fühle mich natürlich geehrt, dass selbst meine ältesten Feinde …«
»Ich war ein treuer Untertan König Richards«, erklärte Florís würdevoll, »aber davon abgesehen nie Euer Feind.«
Der König lachte. »Da hattet Ihr aber eine seltsame Art, Eure Freundschaft zu zeigen«, bemerkte er. »Habt Ihr nicht das Schwert gegen mich geführt?«
»Wie alle anderen Ritter und Burgherren im Lande der Plantagenets. Lehnspflichtig dem rechtmäßigen Erben …«
Florís war damals zwar streng genommen noch ein Fahrender Ritter gewesen und niemandem lehnspflichtig. Er hatte sich König Richard hauptsächlich deshalb angeschlossen, weil er ihn als Ritter und Heerführer bewunderte. Aber das ließ er besser unerwähnt.
»Und König Johann ist nun nicht der rechtmäßige Erbe?« Die Stimme des Königs klang schneidend.
Florís biss sich auf die Lippen. Dies war die Frage, die er und all die anderen Burgherren befürchteten. Als Halter eines Lehens in den Ländern der Plantagenets war er Richards Nachfolger zur Treue verpflichtet. Und wie viele gute Gründe es auch immer dafür gab: Indem er hier war, beging er einen Verrat an seinem Herrn.
»Majestät«, sagte Florís gequält. »Ihr kennt König Johann, und ich bin nun hier, um Euch Treue zu schwören. Ich bin hier, um …«
»Ihr seid hier, um die Seiten zu wechseln!«, gab der König streng zurück. »Weil es Euch nicht gefällt, wie Euer König regiert.«
»Ihr seid unser König! Oder … oder Arthur de Bretagne …«
Florís wand sich. Tatsächlich war die Erbfolge höchst umstritten. König Richards Vasallen in seinen französischen Besitztümern hatten nach seinem überraschenden Tod zunächst seinem Nachfolger Johann die Treue geschworen – obwohl auch ein junger Prinz namens Arthur de Bretagne Erbrechte anmeldete. Dann war es allerdings zu erneuten Kämpfen zwischen Philipp und Johann gekommen, in denen der Engländer seine Leute kaum unterstützte, sondern feige nach England floh. Der größte Teil der Normandie ging damals schon an Philipp. Und kurz darauf hatte Johann dann auch noch eine aquitanische Prinzessin entführt und geheiratet, deren Familie daraufhin einen Lehnsprozess anstrengte. Nachdem Johann sich konsequent weigerte, vor Gericht zu erscheinen, verhängte dieses ein Versäumnisurteil: Offiziell ging Johann all seiner französischen Besitzungen verloren, das Land fiel an König Philipp. Allerdings waren die Vasallen der Plantagenets erst jetzt bereit, das auch anzuerkennen. Wobei wieder die Verhaftung des Prinzen Arthur de Bretagne eine Rolle spielte. Es hieß, Johann habe seinen Rivalen hinrichten lassen.
Für seine Lehnsleute auf dem Kontinent war dies der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. So entschlossen, wie sie für Richard Löwenherz gekämpft hatten, trafen sie auch jetzt ihre Entscheidung für Philipp ohne Wenn und Aber. Johann war seines Erbes nicht würdig. Einer seiner Lehnsleute nach dem anderen erschien vor Philipp August, um ihm die Treue zu schwören. Aber nur wenige pflegte der König dabei derart zu examinieren wie Gerlin und Florís de Trillon zu Loches.
»Und woran sehe ich, dass Ihr es ernst meint?«, fragte der König nun streng. »In den Kriegen mit König Richard habt Ihr mir allerhand Unbill bereitet …«
Florís ließ den Blick sinken. Er hatte im Stillen gehofft, dass der König nicht wusste, wer für Richards spektakulären Sieg bei Fréteval verantwortlich war, aber natürlich war Philipp seine und Gerlins Rolle dabei nicht verborgen geblieben.
»… dazu kommen die Schwindeleien Eurer Gattin, die zweifelhafte Abkunft ihres Sohnes … Ihr gedenkt, Loches doch einmal an diesen Jungen zu vererben, oder?« Der König warf einen strengen Blick auf Dietmar.
Der Junge hob die Augen. »Nein, Herr!«, sagte er dann überraschend mit klarer Stimme. »Äh … Majestät, Herr … Ich … ich werde irgendwann mein Erbe im Fränkischen antreten.«
Der König runzelte die Stirn. »Das da nur auf Euch wartet, Dietmar von … Ornemünde?«
Gerlin wunderte sich, dass der König sich den Namen des Jungen gemerkt hatte, aber die Ornemünder waren ein weit verzweigtes Adelsgeschlecht, das ihm zweifellos bekannt war.
»Nein, Majestät«, erklärte Dietmar gelassen. »Ich werde es erobern müssen. Es ist zurzeit von einem Usurpator besetzt. Aber mein Ziehvater, der Herr Florís, wird mich mit allen Kräften unterstützen und …«
Der König lachte. Die Ernsthaftigkeit des Jungen rührte ihn an. »Aha«, bemerkte er dann und wandte sich wieder an Gerlin und ihren Gatten. »Wie gesagt, die Verhältnisse auf der Festung Loches sind fragwürdig und gelinde gesagt unübersichtlich. Womöglich zieht Ihr morgen die gesamte Ritterschaft ab und wendet Euch gegen eine Burg in deutschen Landen. Nach wie vor, Herr Florís: Wie weiß ich, ob ich Euch trauen kann?«
Gerlin überlegte kurz. Ihr schoss ein Gedanke durch den Kopf, aber womöglich würde sie den König noch mehr gegen sich aufbringen, wenn sie den Vorschlag äußerte. Andererseits – es war kaum möglich, noch mehr von seiner Gunst zu verlieren …
»Majestät«, meldete sie sich zu Wort. »Wie wäre es, wenn wir eine Sicherheit stellten? Ihr nehmt unseren Treueschwur an, und wir geben Euch meinen Jungen als Geisel!«
Florís schien ob Gerlins Dreistigkeit die Luft wegzubleiben. Tatsächlich waren Arrangements wie dieses durchaus gang und gäbe – allerdings nicht zwischen einem König und einem unbedeutenden Burgherrn. Der Austausch von Geiseln fand meist zwischen gleichrangigen oder doch annähernd gleich starken Herrschern oder Adelshäusern statt. Es kam einer Art Nichtangriffspakt gleich, wenn das Kind des einen im Haushalt des anderen aufwuchs. Die Anwesenheit des eigenen Nachkommen in der Burg des anderen garantierte die Einhaltung von Verträgen und Abkommen, die man mit Gewalt nicht durchsetzen konnte. Wohingegen es für Philipp August einfach gewesen wäre, sich eines Florís de Trillon und seiner mehr oder weniger legitimen Nachkommenschaft zu entledigen: Er brauchte den Ritter nur festnehmen zu lassen und seine Familie aus der Burg zu werfen.
Der Monarch musterte Gerlin denn auch zunächst ungläubig, aber dann brach er erneut in Gelächter aus. »Ihr seid unglaublich, Gerlindis von Sonstwo zu Loches!«, stieß er zwischen zwei Lachanfällen hervor. »Warum sagt Ihr es nicht gleich: Ihr wollt in Eurer behaglichen Burg bleiben und Eurem Ritter das Bett wärmen, und ich soll derweil Euren Sohn erziehen, damit er dann erfolgreich seine Fehde im Frankenland führen kann!«
Gerlin lächelte. Sie hatte immer ein bezauberndes Lächeln gehabt. Auch Richard Löwenherz hatte sich seiner Wirkung nicht entziehen können.
»Ich bin überzeugt«, sagte sie jetzt, »mein Sohn würde Euch Ehre machen!«
Der König winkte den Jungen zu sich. »So wärest du gern Knappe an meinem Hof?«, fragte er.
Dietmar nickte. »Ich sollte an König Richards Hof erzogen werden«, erklärte er freimütig – ein Umstand, auf dessen Erwähnung Gerlin lieber verzichtet hätte. »Aber … aber …«
Gerlin biss sich auf die Lippen. Wenn er jetzt etwas von dem bedeutendsten Hof der Christenheit sagte, als welcher der Hof König Richards und seiner Mutter Königin Eleonore zweifellos gegolten hatte, dann war alles vergebens!
Aber Dietmar erwies sich als würdiger Sohn seines leiblichen Vaters, der kein großer Krieger gewesen war, dafür ein begabter Diplomat.
»… aber jetzt, als ich die Festung hier gesehen habe! Sie ist großartig, Majestät, diese Mauern, die Türme, der Palast … Das ist … das ist … Majestät, wenn ich Euch hier dienen dürfte … Dies ist sicher der bedeutendste Hof der Christenheit!«
Der König lächelte wohlwollend. »Ein kluger Junge, Frau Gerlindis«, bemerkte er. »Also gut, Dietmar, du wirst als Knappe bei uns bleiben. Und Ihr, Madame und Seigneur de Loches, Ihr könnt mir nun den Eid schwören und gehen. Ich bin sicher, Burg und Festung von Loches werden weiter in meinem Sinne verwaltet werden.«
Kapitel 2
Er wird uns schon nicht gleich aufhängen«, meinte Miriam.
Sie lenkte ihre rassige weiße Maultierstute neben den mit Waren beladenen Karren, den Abram lustlos durch das mit Gräsern und Gewürzpflanzen spärlich bewachsene Land zwischen Al Mariya und Granada steuerte. Es ging hier ständig bergauf, und die Pferde und Maultiere der Kaufmannskarawane, der die beiden sich angeschlossen hatten, schnauften unwillig. Auch Miriam war weit davon entfernt, den Ritt zu genießen, obwohl die Straße oft von spektakulären Felsformationen gesäumt war und die klare Luft atemberaubende Ausblicke auf die schneebedeckten Berge bot. In deren Ausläufern lag Granada, ihr Ziel, und der Palast des Emirs, der sie zu sich beordert hatte.
»Und ich hab ihr auch gar nichts Schlimmes geweissagt«, fuhr Miriam fort und spielte mit dem Schleier, der ihr Gesicht und ihren Körper fast zur Gänze verbarg. Es war heiß unter der arabischen Reisekleidung. »Das mache ich doch nie. Ich hab ihr nur geschrieben, dass …«
»Wahrscheinlich hätte sie sich gar nicht erst mit dir in Verbindung setzen dürfen«, mutmaßte Abram. Er hatte es in seinen weiten maurischen Leinengewändern erheblich bequemer als seine Frau. Juden und Mauren kleideten sich hier gleich: eine weite Hose und ein langes darüberfallendes Gewand. Eine gelbe Leinenkappe kennzeichnete Abram als Juden, aber es gab keine Pflicht, sie zu tragen. »In so einem Harem ist wahrscheinlich alles verboten. Und womöglich ist Sterndeuterei auch noch gegen deren Glauben. Die fanatischen Christen betragen sich da ja mitunter etwas seltsam …«
»Der Emir hat seine eigenen Sterndeuter«, wusste Miriam. »So verboten kann es also nicht sein. Und die Frauen in Moxacar können fast alle schreiben. Wenn mich eine konsultiert, dann meistens aus dem Harem heraus. Die normalen Frauen haben doch gar nicht das Geld für ein ausgiebiges Horoskop … Überhaupt, dass diese Frau des Emirs von mir wusste … das hat sich nicht ›herumgesprochen‹ – die Frauen aus Moxacar und Granada treffen sich nie. Also werden sie einander geschrieben haben. Nein, wenn ich es mir recht überlege, kann der Emir gar nichts gegen mich haben! Es muss mit der Reliquie zu tun haben, die du ihm verkauft hast.«
»Das war eine ganz einwandfreie Reliquie«, verteidigte sich Abram. »Ein Finger des heiligen Eulogius, mit einer Echtheitsbescheinigung aus Alexandria … Ein Geschenk des Emirs für die christliche Gemeinde in Granada – das werden die doch nicht beanstandet haben!«
Während die beiden noch nachdachten – sie taten nichts anderes mehr, seit der Ruf des Emirs einige Tage zuvor erfolgt war –, regte sich etwas in der Vorhut der Handelskarawane. Abram und Miriam erkannten drei offenbar christliche Ritter, die der Karawane wohl entgegengekommen waren. Sie verhandelten ziemlich laut mit dem Anführer der Händler, einem jüdischen Kaufmann aus Al Mariya. Ein zum Schutz der Händler abgestellter maurischer Lanzenreiter saß daneben auf seinem Pferd, mischte sich jedoch nicht ein. Wahrscheinlich wurde das Gespräch in einer für ihn fremden Sprache geführt.
Der Rest der aus insgesamt sechs schweren Wagen mit Fahrern und Begleitreitern bestehenden Karawane wirkte über die Begegnung mit den Fremden nicht alarmiert – in Al Andalus rechnete man nicht ständig mit bewaffneten Angriffen von Wegelagerern und Raubrittern wie in deutschen und französischen Waldgebieten. Abram und Miriam wussten nicht, ob dies damit zusammenhing, dass kein arbeitswilliger Mensch in Granada hungerte, dass die Ritter kultivierter und das Zusammenleben insgesamt besser geordnet waren oder einfach mit den drakonischen Strafen, welche die islamische Rechtsprechung auch gegenüber ranghohen Missetätern verhängte. In Kronach, wo Abram geboren war, hatte es immer Verbrechen gegeben, die letztlich nicht geahndet wurden – sei es, weil die Mörder, Plünderer und Vergewaltiger von Adel waren und die Opfer Bürger oder Bauern, sei es, weil Bürger oder Bauern ihre schlechte Laune an den weitgehend rechtlosen Juden ausließen.
In Al Andalus ging es gerechter zu. Christen und Juden zahlten mehr Steuern als die maurische Bevölkerung, aber dafür genossen sie auch den Schutz der Gesetze. Der Handel war frei, niemand sperrte Juden in spezielle Wohnviertel, die nachts abgeschlossen wurden, und es war ihnen auch nicht verboten, ein Schwert zu führen. Abram griff nun besorgt nach dem seinen. Diese Männer da vorn gefielen ihm nicht. Er trieb seine Maultiere an und schloss zu den vorderen Wagen auf.
»Gibt es Schwierigkeiten?«, erkundigte er sich bei dem etwas ratlos wirkenden jungen Lanzenreiter.
Der angesehene Kaufmann, der den ersten Wagen lenkte, war Friedensrichter in Al Mariya. Er redete in unsicherem Französisch auf die christlichen Ritter ein, die zwar nicht in voller Rüstung, aber doch in Kettenhemden und auf Streitrossen unterwegs waren. Sie wirkten, als suchten sie Ärger.
»Gut, dass du kommst, Abram«, begrüßte ihn Baruch ibn Saul fast etwas erleichtert. »Die Herren sprechen kein Arabisch und auch nur unvollkommen Kastilianisch. Und mein Französisch war nie sehr gut …«
Abram nickte. »Ich kann gern übersetzen, Herr«, bot er sich an, hocherfreut, dem angesehenen Handelsherrn einmal positiv aufzufallen, statt immer nur im Rahmen von Schlichtungsverhandlungen.
Abram nahm es nicht ganz ernst mit den Regeln der Kaufmannschaft. Er betrog nicht direkt, aber er neigte dazu, seinen Kunden Dinge aufzuschwatzen, die sie nicht wirklich brauchten – und ließ sie obendrein teuer dafür bezahlen. Auch sein florierender Reliquienhandel war den seriösen Kaufleuten ein Dorn im Auge – konnten sie sich doch denken, dass nicht jeder Holzsplitter, den Abram maurischen Kriegern als Glücksbringer verkaufte, wirklich von Noahs Arche stammte. Und auch in den noch teureren Amuletten für die gläubigen Ritter befand sich kaum Mähnenhaar des mythischen Pferdes oder Maultiers, das den Propheten Mohammed weiland in den Himmel entrückt hatte. Von den diversen Körperteilen christlicher Heiliger, die irgendwann im Orient den Märtyrertod gestorben waren, ganz zu schweigen.
Jetzt verbeugte sich Abram höflich vor den französischen Rittern. »Was ist Euer Begehr, edle Herren?«, fragte er freundlich, aber nicht unterwürfig.
Den unterwürfigen Tonfall gegenüber Christen hatte er sich in sieben Jahren Leben in Al Andalus abgewöhnt – ein Fehler, wie sich jetzt herausstellte.
»Du wagst es, das Wort an uns zu richten, Jude?« Der Anführer der Ritter spuckte das Wort förmlich aus.
Abram zuckte die Schultern. »Ich dachte, ein paar Worte in Eurer Sprache würden die Verständigung vereinfachen«, bemerkte er. »Aber so …«
Er tat so, als mache er Anstalten, seinen Wagen zu wenden – ein Manöver, das völlig aussichtslos war. Die Straße wurde auf der einen Seite von einem Abhang, auf der anderen von Felsen begrenzt. Es wäre höchst kompliziert gewesen, ein Wendemanöver durchzuführen, allenfalls hätte ein Wagen nach dem anderen, beginnend mit den hinteren Gefährten, umkehren können.
»Wenn ich den Herrn richtig verstanden habe, besteht er darauf, dass wir ihm ausweichen, damit er die Straße vor uns passieren kann«, meinte Baruch ibn Saul unglücklich auf Hebräisch. »Da er ein Ritter ist und wir nur Juden. Unseren jungen Freunden hier«, er wies auf den maurischen Ritter, dem sich jetzt ein zweiter Lanzenreiter zugesellt hatte, »habe ich das besser nicht übersetzt, ebenso wenig wie dem maurischen Handelsherrn im dritten Wagen. Keiner der drei scheint sehr langmütig.«
Abram runzelte die Stirn. »Können sie nicht einfach an uns vorbeireiten? Wenn wir die Wagen ganz nach rechts lenken und anhalten, müsste das gehen.«
Baruch ibn Saul zuckte die Achseln. »Ich schätze, sie möchten inmitten der Straße im Galopp an uns vorbei. Sie suchen Streit, Abram, aber vielleicht kannst du ja vermitteln.«
Abram nickte und versuchte es noch einmal. »Ich darf Euch im Namen von Tariq ibn Ali al Guadix und Muhammed ibn Ibrahim al Basra in ihrem Land willkommen heißen«, erklärte er und wies auf die maurischen Ritter. »Auch sie sind Angehörige des Ritterstandes, die sich freundlicherweise um die Bewachung unserer Waren kümmern.« Wie es dem Brauch entsprach, erwähnte Abram nicht, dass die Männer dafür fürstlich entlohnt wurden. »Wie es aussieht, gibt es kleine Differenzen bezüglich der Passage dieses Weges – wobei wir selbstverständlich anerkennen, dass Ihr in eiliger und wichtiger Mission unterwegs seid. Wir würden Euch gern den Vortritt lassen, aber wie Ihr unschwer erkennen könnt, wäre das nur unter größten Schwierigkeiten möglich. Wenn wir hier wenden, würde Euch das länger aufhalten, als wenn Ihr den Vorschlag des Herrn Tariq annähmet.« Der maurische Ritter hatte zwar gar keinen gemacht, aber er würde Baruchs Anweisungen zweifellos Folge leisten. »Bitte erlaubt unseren Rittern, Euch eine halbe Meile zurückzubegleiten. Ihr könntet Euch dabei über … hm … Eure vergangenen Ruhmestaten austauschen.« Abram ließ offen, wie das ohne gemeinsame Sprache möglich sein sollte, aber dieser Ritter wirkte nicht so, als sei er beim Prahlen auf verständige Zuhörer angewiesen. »Sobald sich die Straße verbreitert, werden wir demütig zur Seite ausweichen und Euch passieren lassen.«
Baruch nickte Abram wohlgefällig zu. Er sprach zwar schlecht Französisch, schien seiner Rede jedoch folgen zu können.
Leider waren die französischen Ritter nicht gewillt, logischen Argumenten nachzugeben.
»Jude, wir gehören zum Gefolge des Grafen von Toulouse, und wir überbringen wichtige Nachrichten!«, brüstete sich einer von ihnen. »Und ganz sicher werde ich keinem Judenbengel auch nur eine Handbreit weit weichen! Also aus dem Weg!«
Er wies auf den Abhang neben der Straße und grinste. Schon für einen Reiter wäre es schwierig gewesen, dorthin auszuweichen. Für die schweren Wagen war es unmöglich.
Abram seufzte. Dann zog er das Schwert. Für die maurischen Ritter eine Aufforderung. Die zwei fackelten nicht lange. Ihre hochblütigen leichten Stuten flogen auf die schweren Streithengste der Franzosen zu, die sich daraufhin ebenfalls in Bewegung setzten. Schwere Lanzen trafen auf leichte Rüstungen, von den Mauren geworfen, von den Christen vom Pferd aus geführt. Auf den ersten Blick hatten die französischen Ritter die besseren Aussichten, diesen Kampf zu gewinnen. Sie waren zweifellos erfahrener als die beiden sehr jungen Mauren, deren ersten Angriff sie kaltblütig abwehrten. Aber sie hatten nicht mit der Wehrhaftigkeit der Kaufleute gerechnet!
Die jüdischen und maurischen Händler dachten gar nicht daran, sich im Falle eines Angriffs zur Wagenburg zusammenzuschließen und den Kampf den Rittern zu überlassen. Stattdessen flog den Franzosen beim zweiten Angriff ein Pfeilhagel entgegen, Steine wurde geworfen und weitere Männer schwangen ihre Schwerter. Abram stellte sich beherzt dem Kampf mit dem einzigen Ritter, den der erste Angriff vom Pferd geworfen hatte, und verblüffte ihn durch seine gekonnten Paraden.
Zum Leidwesen seiner Familie war Abram immer ein besserer Schwertkämpfer und Ringer als Kaufmann und Schriftgelehrter gewesen. Schon als junger Mann hatte er sich mitunter als Christ ausgegeben und keine Kneipenschlägerei in den Straßen von Kronach gescheut. Miriam sah dem Kampfgeschehen recht gelassen zu. Auch für sie hatte Abram sich schon mehr als einmal geschlagen. Sie verdankte seinem Mut und seiner Kampfkraft ihr Leben – und im Streit mit diesem Ritter griff obendrein das Überraschungsmoment. Ganz sicher hatte der Mann noch nie einem schwertschwingenden Juden gegenübergestanden. Abram beförderte ihn denn auch sehr schnell den Abhang hinunter – wobei er von dem Sturz sicher kaum noch etwas spürte, Abrams Klinge hatte vorher sein Herz durchbohrt.
Der junge Tariq erledigte in ritterlichem Zweikampf den zweiten Franzosen, der dritte hauchte sein Leben unter den Stockschlägen und Messerstichen der Knechte und Wagenlenker der anderen Kaufleute aus, die sich auf ihn stürzten, kaum dass er vom Pferd gestoßen worden war.
»Jetzt werden die ungemein wichtigen Briefe des Grafen von Toulouse leider noch etwas warten müssen«, bemerkte Abram und reinigte sein Schwert. »Die Herren wären besser zurückgeritten. Irgendwelche Verletzten auf unserer Seite?«
Niemand meldete sich. Die Übermacht der Händler war erdrückend gewesen – und völlig unerwartet für die Ritter.
»Dann kann’s ja weitergehen«, erklärte Baruch ibn Saul, nachdem die Knechte auch die Leichname der anderen Ritter in die Schlucht geworfen hatten – natürlich nicht ohne sie vorher ihrer Rüstungen zu berauben. Abram warf einen kurzen Blick auf den einzigen Brief, der sich bei den Männern fand.
»Eine Art Liebesbrief«, beschied er die ungeduldig wartenden Kaufleute. »In keiner Weise dringlich. Es war, wie wir dachten, die Kerle suchten Streit.«
Baruch ibn Saul nickte. »Vielen Dank, Abram ibn Jakob, für deine tatkräftige Hilfe. Ich hatte gehofft, dass es bei Übersetzungsdiensten bleiben würde. Aber auch deine Fähigkeiten im Schwertkampf sind sehr beeindruckend.« Der Kaufmann holte einen Schlauch Wein unter seinem Bock hervor und winkte Abram damit zu. »Wir sollten dem Ewigen für unseren Sieg danken und anschließend einen Schluck darauf trinken, meinst du nicht auch? Komm, übergib deinen Wagen einem meiner Knechte und leiste mir ein wenig Gesellschaft.«
Abram nickte, obwohl er gern auf den Wein verzichtet hätte, wenn ihm dafür das sicher hochnotpeinliche Gespräch mit dem Kaufmann erspart geblieben wäre. Baruch ibn Saul war ein Freund seines Vaters – unzweifelhaft würde es sich also um die Vertretung seines Handelshauses in Al Andalus drehen. Und die betrieb Abram, wie er selbst wusste, nicht mit dem nötigen Ernst.
»Du bringst Seidenstoffe zum Markt von Granada?«, erkundigte sich Baruch denn auch gleich, nachdem Abram sich zu ihm gesetzt hatte, während die Wagen weiterrollten. »Lohnt sich denn das? Gibt es nicht darauf spezialisierte Händler?«
Abram zuckte die Achseln. »Ich muss in einer anderen Angelegenheit nach Granada«, meinte er ausweichend. »Und da dachte ich … bei der Gelegenheit …«
»Sehr gut überlegt«, lobte Baruch. »Auch wenn es vielleicht manchen verdrießlich stimmt, dass da plötzlich neue Konkurrenz auftaucht.«
Abram seufzte. Wahrscheinlich hatte sich schon einer der anderen Händler beschwert.
»So … ist dein Vater zufrieden mit dem Gang der Geschäfte?«, führte Baruch die Befragung fort.
Er sprach arabisch – wobei Abram sich an die hier allgemein übliche vertrauliche Anrede erst mal hatte gewöhnen müssen. Abram selbst hatte die Sprache schon als Jugendlicher gelernt, beherrschte sie aber nicht so gut wie seine Frau, die mit Feuereifer die Werke arabischer Astrologen studierte. Nun dachte er kurz daran, Verständnisprobleme vorzutäuschen.
»Nun … wir haben unser Auskommen«, meinte er schließlich.
Das stimmte, Abram und Miriam litten nicht unter wirtschaftlicher Not. Sie bewohnten ein hübsches Haus im Judenviertel eines kleinen Dorfes bei Al Mariya – wobei die Wahl auf das winzige Moxacar nicht deshalb gefallen war, weil es geschäftlich zentral lag, sondern weil sich nur dort ein Haus mit einem Turm gefunden hatte. Ein Turm war für Miriams Sternbeobachtung unabdingbar, zumindest hatte Abram ihr einen solchen versprochen, als die beiden die Ehe eingingen. Miriam verbrachte denn auch glückliche Nächte in luftiger Höhe mit ihrem Astrolabium – und in den Armen von Abram, der sie leidenschaftlich unter dem Sternenhimmel liebte.
Fernhändler verirrten sich allerdings eher selten in das Dorf, das zwar nah der Küste lag, aber keinen eigenen Hafen besaß. Auch die nächsten Manufakturen fanden sich erst in Al Mariya, mehr als dreißig Meilen entfernt. Den idealen Standort für seine Dependance im Emirat Granada hatte Jakob von Kronach sich unzweifelhaft anders vorgestellt.
»Und wer ist nun der neue Geschäftspartner in Granada?«, fragte Baruch weiter. »Ich gestehe, dass ich neugierig bin, aber soweit ich weiß, wickelt ein kastilianischer Fernhändler die Handelsbeziehungen zwischen Franken und Granada ab.«
Abram überlegte kurz, ob er schwindeln sollte, aber wenn er sich jetzt neue Handelsbeziehungen ausdachte, würde Baruch das sicher seinem Vater berichten. Er nahm einen langen Schluck Wein – und begann sich nach dem Treffen mit dem Emir zu sehnen. Viel schlimmer als diese Befragung konnte es da auch nicht werden.
»Oh, wir treffen uns nicht mit irgendeinem Kaufmann, wir haben eine Audienz beim Emir.«
Miriams Stimme klang sanft und weich wie Honig. Sie hatte ihr Maultier neben Baruchs Wagen gelenkt, und Abram sah an ihren Augen, dass sie lächelte. Mehr als ihre warmen nussbraunen Augen waren von ihrem Gesicht nicht zu erkennen, aber schon ihr Anblick genügte, damit er sich besser fühlte. Und auch Baruch ibn Saul betrachtete die Frau wohlgefällig. Er hatte Miriam mehr als einmal unverschleiert gesehen. Die Frauen der Juden passten sich dem Brauch der Araber zwar in der Öffentlichkeit an, aber bei privaten Einladungen unter sich oder am Sabbat in der Synagoge ließen sie zumindest ihre Gesichter sehen, wenn auch nicht immer ihr Haar. Die Schönheit von Abram ibn Jakobs junger Gattin war insofern jedem bekannt.
»Und es geht auch nicht um Seidenstoffe«, meinte Miriam sanft. »Nein, ich … wir … glauben, es geht um mich!«
Baruch ibn Saul warf ihr einen entsetzten Blick zu und musterte dann Abram mit dem Ausdruck eines Menschen, der seinem Gegenüber wirklich alles zutraut: »Abram ibn Jakob! Du willst deine Frau verkaufen?«
Kapitel 3
Abram und Miriam erheiterten sich noch über Baruchs fassungsloses Gesicht, als sie gegen Abend Granada erreichten, dort in einem Funduk Wohnung nahmen und schließlich getrennt voneinander die Bäder besuchten. Abram zahlte ein kleines Vermögen für abgeschiedene Räume in der Herberge, aber Miriam bestand darauf, sich in Ruhe auf die Audienz beim Emir vorbereiten zu können.
»Vielleicht lässt er ja nur dich hinrichten«, neckte sie ihren Mann, »und nimmt mich in seinen Harem.«
»Das ist nicht komisch«, murmelte Abram.
Je näher die Audienz rückte, desto stärker kehrten seine Ängste zurück. Er wusste nicht, was an den kleinen Unregelmäßigkeiten wirklich strafbar war, mit denen er seinen Geschäftsalltag würzte, aber langsam bereute er zumindest den Handel mit islamischen Reliquien. Sicher focht es den Emir nicht an, wenn er Christen übers Ohr haute. Aber die Haare des heiligen Pferdes Barak, die in Wirklichkeit aus der Mähne von Miriams Maultier Sirene stammten …
»Komm, Abram, er wird uns schon nichts tun«, versuchte Miriam ihn zu beruhigen. Sie sah betörend schön aus, nun, da sie die schlichten Reisekleider gegen weite, mit Goldfäden durchwirkte Seidenhosen und ein passendes langes Obergewand in hellerem Grün eingetauscht hatte. In ihr dunkelblondes langes Haar hatte sie Perlenfäden geflochten, aber natürlich wurde die Pracht nur schemenhaft sichtbar unter ihrem Schleier. Das feine Gespinst verbarg auch ihr Gesicht und ließ die Klarheit ihrer Züge und ihren honigfarbenen Teint nur erahnen. Lediglich ihre Augen würde der Emir in voller Schönheit bewundern können, weshalb Miriam sie sorgfältig geschminkt hatte – ein Kajalstrich betonte ihre leicht schräge Stellung und ihr warmes Leuchten. »Wenn er dich wegen Betrugs verhaften lassen wollte und mich wegen irgendetwas anderem, konnte er einfach die Stadtwache schicken. Dann hätte man uns in Ketten nach Granada gebracht. Warte ab, so schlimm kann es gar nicht kommen. Was machst du übrigens, wenn er mich wirklich kaufen will?«
Miriam tat es fast leid, den grauen Reiseumhang wieder über ihren kostbaren Staat ziehen zu müssen, aber bis zum Albaicen, einem Hügel, auf dem der Palast des Emirs thronte, waren es noch einige Meilen zu reiten. Die Funduks, traditionelle arabische Unterkünfte für Handelsherren, lagen meist außerhalb der Stadt oder zumindest in Vororten, so passierten Miriam und Abram die Sukhs von Granada. Und wäre da nicht die Beklommenheit vor ihrem Auftritt gewesen, hätten sie sich an der Vielfalt der angebotenen Waren, dem Duft der Gewürze und den Farben der Stoffe und Keramikwaren berauschen können. So aber versuchten sie nur, den Weg rasch hinter sich zu bringen.
In Granada fanden sie sich dann allerdings in einer Schlange von anderen Bittstellern und Besuchern wieder, die auf eine Audienz beim Emir warteten. Offensichtlich hielt der Herrscher an diesem Tag Gericht, und das in aller Öffentlichkeit. Ein Diener hieß Abram und Miriam in den hinteren Reihen des bevölkerten Audienzsaals Platz nehmen. Wie die meisten maurischen Häuser war auch dies kaum möbliert. Es lagen nur Teppiche auf dem Boden, und die Ratgeber des Emirs saßen ihm zu Füßen auf weichen Kissen. Der Emir selbst thronte auf einem erhöhten, mit Kissen gepolsterten Podest, vor dem die Bittsteller sich zu seiner Huldigung niederwarfen.
Miriam und Abram warteten mit zunehmender Nervosität ab, bis er alle Besucher und Gesandte anderer Emirate willkommen geheißen, Streitigkeiten um Land und Vieh geschlichtet und strenge Verwarnungen an aufmüpfige Untertanen ausgesprochen hatte, die sich irgendwelcher Unregelmäßigkeiten schuldig gemacht hatten. Offensichtlich konnte jeder, der sich ungerecht behandelt fühlte, vor dem Emir Klage führen. Abram wurde immer mulmiger zumute – es war nicht unwahrscheinlich, dass gleich mehrere Beschwerden gegen ihn vorlagen. Miriam dagegen beruhigte sich zusehends. Bislang hatte der Emir keine wirklich schweren Delikte verhandelt und keine nennenswerten Strafen verhängt. Es war, wie sie sich schon gedacht hatte: Echte Verbrechen kamen vor den Kadi – der Emir bewies nur Wohlwollen, Weisheit und Volksnähe, indem er jeden Bürger empfing und ernst nahm, der um Rat und Hilfe nachsuchte.
Abram und Miriam waren dann die Letzten, die der Zeremonienmeister heranwinkte. Beide warfen sich dem Emir zu Füßen, wie sie es vorher gesehen hatten. Abram lag eine Begrüßungsrede auf der Zunge. Er hatte lange darüber nachgedacht, wie er dem Emir schmeicheln konnte, aber dann schwieg er doch, wie es ihm geheißen worden war. Kein Bittsteller durfte das Wort an den Emir richten, bevor er dazu aufgefordert worden war.
Der Emir wandte sich nun erst mal an den Diener neben ihm.
»Die … Juden aus Moxacar?«, vergewisserte er sich.
Der Mann nickte.
Der Emir, ein noch junger Mann mit heller Haut, aber schwarzem Bart und Haar, machte eine huldvolle Geste, mit der er seinen Besuchern erlaubte, aus der liegenden in eine kniende Haltung zu wechseln. Miriams dunkler Reiseumhang verrutschte dabei ein wenig und gab den Blick auf den festlichen Staat frei, den sie darunter trug.
»Du bist die Sterndeuterin?«, fragte er verwundert. »Bei Allah, dich hatte ich mir anders vorgestellt! Man denkt da doch mehr an eine alte Vettel.«
Miriam hob den Blick und ließ ihn das Leuchten ihrer Augen sehen. »Es wird mich bis an mein Ende betrüben«, sagte sie, »dass mein Anblick meinen großmütigen Herrn enttäuschte.«
Der Emir lachte schallend. »Es hieße, Allahs Gnade und Großmut zu beleidigen, würde ich mich enttäuscht zeigen ob der Schönheit, mit der er dich gesegnet hat«, erklärte er dann galant. »Ich mag dein Herr und Herrscher sein, aber ich verharre in Demut vor deinem Anblick.« Miriam lächelte verschämt. »Wobei Allah dich wohl auch noch mit anderen Gaben überschüttet hat. Aber darüber …« Der Emir erhob sich. »Volk von Granada, ich werde diese Audienz jetzt beenden. Mit Allahs Hilfe habe ich versucht, all eure Fragen zu beantworten und eure Streitigkeiten zu schlichten. Am Ausgang erwartet euch ein kleines Geschenk. Ich danke euch für euer Vertrauen. Gott leite euch sicher in eure Wohnungen!« Während die Menschen im Saal applaudierten, wandte sich der Emir an Abram und Miriam. »Und ihr folgt mir bitte in meine Privaträume. Es gibt Dinge zu besprechen, die nicht jeder hören muss …«
Der Emir begab sich heraus, und der erleichterte Abram bewunderte nicht nur seine königliche Haltung, sondern besonders den kostbaren Brokat seiner Kleidung. Es musste tatsächlich lukrativ sein, diesen Hof zu beliefern, vielleicht sollte er sich doch etwas mehr um Aufträge bemühen, die auch vor den Augen seines Vaters bestehen konnten.
Der Diener verneigte sich nun sowohl vor ihm als auch vor Miriam und wies die beiden an, ihm zu folgen. Kurz darauf befanden sie sich in einem kleineren, mit Kissen und zum Sitzen einladenden Podesten versehenen Raum, dessen Wände mit kunstvoll ineinander verschlungenen Blütenranken bemalt waren. Ein Diener kredenzte Fruchtgetränke und in Honig getauchtes Gebäck. Der Emir trat eben durch eine andere Tür ein. Er hatte den schweren Brokatmantel gegen ein kaum weniger wertvolles seidenes Hausgewand eingetauscht. Miriam verstand den Wink und ließ ihren schweren Reisemantel sinken. Der Emir konnte den Blick kaum von ihr wenden, nahm sich dann aber zusammen.
»Also: Was hast du ihr gesagt?«, wandte er sich ohne weitere Vorrede an Miriam.
Die junge Frau runzelte die Stirn. »Wem … gesagt?«
»Susana. Die nun Ayesha heißt, seit sie den Islam angenommen hat. Du hast ihr die Sterne gedeutet. Und … du hast eine Veränderung erzielt, an die nie … nie zu denken gewesen wäre. Was hast du ihr gesagt?« Der Emir ließ sich auf einem der Sitzkissen nieder und gestattete auch Miriam und Abram Platz zu nehmen.
Miriam errötete. »Ich … habe ihr geschrieben, dass die Sterne ihr ein wundervolles Leben voller Sicherheit und Liebe zeigen würden. Ich meine, das stimmt doch, im … im Harem des Emirs …«, stotterte sie.
Miriam zumindest war nichts eingefallen, was der jungen Frau in den Frauengemächern des Palastes passieren konnte. Sicher gab es Haremsintrigen. Aber Susana war gläubige Christin und Sklavin gewesen – viel zu niedrig in der Hierarchie des Harems, dass jemand ihr nach dem Leben trachten könnte.
»Und?«, fragte der Herrscher weiter.
»Nun, dass … ihr Leben in der letzten Zeit eine Wende genommen habe …« Das war nicht schwer zu erraten gewesen. Susana war bei einem Überfall der Mauren auf eine christliche Siedlung in Kastilien gefangen genommen worden. Da sie eine erlesene Schönheit war, hatte sie ihr Weg über einen Sklavenhändler zum Wesir des Statthalters von Murcia geführt, der sie dem Emir von Granada zum Geschenk machte. Miriam konnte dem Eunuchen, der ihren Brief beförderte, zwar keine näheren Umstände entlocken, aber es war offensichtlich, dass die junge Frau mit ihrem Schicksal haderte. »… aber dass die dunkelste Strecke ihrer Reise jetzt hinter ihr liege«, führte Miriam weiter aus. »In ihrer Zukunft sähe ich einen warmen, leuchtenden Stern, der über sie wache.«
Der Emir strahlte. Plötzlich wirkte er gar nicht mehr wie ein gestrenger Herrscher, sondern wie ein kleiner Junge, dem man ein lang erträumtes Geschenk gemacht hat.
»Das ist es! So nennt sie mich! Ihren warmen, leuchtenden Stern, dessen Licht sie erleuchtet bei Nacht …«
»Dich, Herr?«, fragte Miriam überrascht.
Sie hatte da eigentlich eher an Schutzengel gedacht, oder was Christen sich sonst vorstellten, um sich über eine missliche Lage hinwegzutrösten. Susana haderte zweifellos mit ihrem Glauben, aus ihrem Brief ging hervor, dass sie fürchte, Gott habe sie verlassen.
»Warum nicht mich?«, fragte der Emir jetzt streng. »Du willst doch nicht sagen, du hast jemand anderen gesehen!«
Miriam schüttelte den Kopf. »Ich habe gar nicht so viel gesehen, Herr«, gab sie zu. »Ich bin Astronomin, ich kann den Lauf der Sterne berechnen und voraussehen, nicht den Lauf des Lebens deiner Konkubinen. Aber wenn jemand es wünscht, so kann ich auch Horoskope erstellen. Und …«
»Und dabei hat Allah dir in diesem Fall zweifellos die Hand geführt!«, freute sich der Emir. »Um nicht zu sagen, er stattete dich mit einem bewundernswerten Gespür dafür aus, wie sich die Geschicke der Menschen zu aller Wohl lenken lassen …«
»Nun …« Miriam senkte verlegen den Blick. Tatsächlich hatte sie bei ihrem ehemaligen Lehrmeister, Martinus Magentius, nicht nur gelernt, die Bahn der Sterne zu bestimmen. Der Mann war auch sehr gut darin gewesen, Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Miriam selbst war ein Opfer seiner Strategien zwischen Versprechungen und Drohungen geworden. Erst Abram hatte ihr den Weg hinaus gewiesen. »Die Sterne, Herr, sind etwas so Schönes«, sagte sie schließlich. »Wie kann ich den Menschen da Böses weissagen? Das habe ich auch deiner Geliebten versichert, Herr. Gott hat uns die Sterne geschenkt, um uns zu erfreuen. Durch sie schaut er in Liebe auf uns herab …«
Der Emir lächelte. »Ja, auch das hat sie gesagt. Gott habe mich ihr gesandt, sie wisse es jetzt. Und durch mich erkannte sie auch die Größe Allahs. Wie gesagt, sie hat den Islam angenommen. Und ich habe sie zu meiner dritten Gattin erhoben. Nachdem sie sich mir vorher monatelang verweigerte! Sie weinte nur und betete zu ihrem Christengott – von mir und meiner Liebe wollte sie nichts wissen. Bis dein Horoskop eintraf! Ich verdanke dir mein Glück, Miriam von Moxacar – oder woher du ursprünglich kommst. Ihr seid nicht aus Al Andalus, oder?«
Miriam schüttelte den Kopf. »Nein, Herr. Ich stamme aus Wien, mein Vater war Münzmeister des Herzogs Friedrich von Österreich. Und Abram kommt aus einer Kaufmannsfamilie aus Kronach. Wir sind hergekommen, weil wir … nun, unter deiner Herrschaft, Erhabener, können wir in Frieden leben.«
Im Stillen hoffte sie, dass dies auch auf Susana – Ayesha – im Harem des Emirs zutraf. Mit einer Eheschließung hatte Miriam nun wirklich nicht gerechnet. Sie hätte sonst sicherlich eine Warnung vor eifersüchtigen Erst- und Zweitgattinnen in das sternglänzende Horoskop einfließen lassen.
Das Gesicht des Emirs umschattete sich ein wenig. »So kommt ihr nicht aus französischen Landen?«, fragte er.
Miriam und Abram schüttelten die Köpfe.
»Nein«, ergriff Abram schließlich das Wort. »Aber wir sprechen beide die französische Sprache. Wenn wir dir da also helfen können …«
Der Emir lachte. »Nein, danke, als Übersetzer brauche ich euch nun wirklich nicht, ich beherrsche die Sprache selbst ausreichend, um … nun, um meinen derzeitigen Besucher zu verstehen. Dazu gehört auch nicht viel, der Mann ist ein grober Klotz …«
»Der Graf von Toulouse?«, rutschte es Miriam heraus. Sie hatte blitzschnell ihre Schlüsse gezogen.
Der Emir sah sie verwundert an. »Aus welchen Sternen hast du das denn jetzt gelesen? Aber wie auch immer, der Mann ist einer der Gründe, weshalb ich euch zu mir gebeten habe. Ich kann doch darauf zählen, dass ihr treue Untertanen seid?«
Abram und Miriam nickten gleichzeitig.
»Du hast keine treueren Untertanen als uns Juden!«, erklärte Abram.
Selten hatte er etwas so ehrlich gemeint. Die jüdische Bevölkerung unterstützte den Emir vorbehaltlos, auch wenn es sie mitunter teuer zu stehen kam. In Sachen Sonderbesteuerungen war der Emir kaum weniger unersättlich als christliche Herrscher. Aber Pogrome und andere Ausschreitungen gab es nie.
»Gut«, sagte der Emir. »Also werde ich offen reden. Die Christen bedrohen uns, offiziell, weil wir ihren Gott nicht anbeten – aber sicher auch aus Neid um unseren Reichtum. Der Papst ruft einen Kreuzzug nach dem anderen aus – zurzeit geifert er gegen christliche Abtrünnige, die in Frankreich sitzen. Aber auf die Dauer geht es gegen uns, ich bin mir da sicher. Und trotz aller Hilfstruppen, oft aus Marokko oder anderen afrikanischen Ländern, die uns unterstützen, können wir nicht viel ausrichten, die Christen sind stark. Gerade, wenn sie ihre Kirche hinter sich wissen.«
»Die vergibt ihnen ja auch schon im Vorfeld alle Sünden«, meinte Abram bitter.
Der Emir nickte. »Sie sind gefährlich. Deshalb will ich mir nicht mehr Feinde unter ihnen machen, als es unbedingt nötig ist. Weshalb ich denn auch die Völlerei, Bosheit und Dummheit dieses Grafen von Toulouse unter meinem Dach dulde …«
»Was will der Mann denn hier?«, erkundigte sich Abram vorsichtig.
Der Emir lächelte. »Er ist auf der Jagd nach einer Reliquie«, erklärte er. »Der Herr ist verliebt. Er hat vor Kurzem eine Prinzessin aus Aragón geheiratet, nachdem er vorher schon drei oder vier Frauen verstoßen hat. Der allerbeste Christ scheint er also nicht zu sein. Aber die Neue, Leonor von Aragón, ist eine glühende Verehrerin der heiligen Perpetua. Die soll man irgendwann in Karthago den Löwen vorgeworfen haben. Zur Römerzeit. Nun ja, und nun wünscht sie sich einen Körperteil der Toten für ihre Hauskapelle.«
»Und den sucht ihr Gatte in Granada?«, fragte Abram. »Wie kommt er darauf?«
»Irgendjemand hat ihm das geraten«, meinte der Emir schulterzuckend. »Und was uns angeht, so fragen wir jetzt herum. Aber entweder haben die christlichen Gemeinden in diesem Emirat keine Reliquie der Perpetua, oder sie geben es nicht zu. Die wollen ihre Heiligtümer ja auch behalten. Außerdem … ich will gar nicht drum herumreden, erst recht nicht im Gespräch mit einem Kaufmann. Wenn sie sich davon trennen würden, so wäre es sehr teuer.«
Abram grinste. »Und nun denkst du, dass ich …«
Der Emir zwinkerte ihm zu. »Du bist dafür berühmt, selbst das Pferd Mohammeds wieder lebendig zu machen«, bemerkte er. »Wie erklärst du nur den Verlust all dieser Mähnenhaare auf dem direkten Flug in den Himmel über Jerusalem …? Aber zurück zur heiligen Perpetua – sie sollte doch keine Schwierigkeit für dich darstellen.«
Abram lächelte. »Ein bisschen Zeit für die Suche musst du mir schon geben. Zumal die Löwen ja wahrscheinlich nicht viel übrig gelassen haben. Fressen Katzen nicht alles bis auf die Gallenblase?«
Der Emir nickte ernst. »Ein Echtheitszertifikat sollte natürlich auch dabei sein«, meinte er. »Aber ich sehe schon, wir verstehen uns.«
Abram verbeugte sich, wurde das flaue Gefühl aber immer noch nicht los, das ihn seit der Einladung des Emirs plagte. Sollte das wirklich alles gewesen sein, weshalb man sie nach Granada beordert hatte? Ein Dankgeschenk für Miriam und die Bestellung einer Reliquie hätte sich auch mittels eines Boten organisieren lassen.
»Das zweite Anliegen, das ich an euch habe, ist sehr viel delikater.« Der Emir nahm einen Schluck von seinem Fruchtsaft, bevor er weitersprach. »Es würde euch einige Opfer abverlangen. Wobei ich euch weder zwingen kann noch will. Nach meinen Erfahrungen ist Zwang eher abträglich, wenn man auf die diplomatischen Fähigkeiten eines Untertanen angewiesen ist …« Der Emir ließ seinen Blick von Abram zu Miriam wandern.
»Diplomatische Fähigkeiten?«, fragte die junge Frau.
Der Emir nickte. »Es ist so, dass unser Herr Graf von Toulouse ein großer Anhänger der Sterndeuterei ist. Er hatte stets einen Hofastrologen, aber mit dem augenblicklichen ist er unzufrieden. Was kein Wunder ist, der Mann ist uralt und fast blind. Der kann die Sterne kaum noch erkennen. Und nun hat man ihm in Aragón gesagt, dass niemand weiter fortgeschritten ist in der Erforschung der Sterne als die Meister in Al Andalus …«
»Das stimmt, Herr!«, sagte Miriam überzeugt. »Ich habe mir immer gewünscht, von ihnen lernen zu dürfen. Aber natürlich unterrichten sie keine Frauen – das ist hier auch nicht anders als im Abendland. Also blieben mir nur ihre Bücher.«
Der Emir lächelte. »Oh!«, bemerkte er. »Da gibt es also doch etwas, womit ich dich locken kann, die Herren Sterngucker könnte ich zwingen … Aber bleiben wir bei Graf Raymond. Der hätte gern einen maurischen Hofastrologen.«
»Astronomie und Astrologie ist nicht dasselbe«, wagte Miriam anzumerken.
Der Emir sah sie strafend an. »Halte mich nicht für dumm!«, sagte er streng. »Graf Raymond mag das nicht wissen, aber ich wurde in die Grundlagen der Sternkunde eingeführt – und ich weiß genau, welche Einwände ernsthafte Astronomen wie Hipparchos gegen die Sterndeuterei vorgebracht haben. Ich habe deshalb keinen Hofastrologen. Erst recht keinen Sklaven, den ich einfach verschenken kann. Wobei es natürlich Männer in Granada gibt, die Horoskope stellen – die Damen in meinem Harem geben alljährlich ein kleines Vermögen dafür aus, zu erfahren, ob sie mir irgendwann einen Sohn schenken werden. Und wenn das Kind dann da ist, wird ihm immer ein Horoskop gestellt – das zum Glück grundsätzlich gut ausfällt. Nun, wem sage ich das, du verdienst ja auch dein Geld damit.«
»Ungern, Herr«, gab Miriam zu. »Es ist nur so, dass niemand einem etwas dafür bezahlt, wenn man neue Sterne entdeckt und ihre Bahnen errechnet. Aber Astrolabien und Fernrohre sind teuer …«
Der Emir lächelte. »Eigentlich wollte ich dir eine Goldkette zum Geschenk machen, aber ich merke, dass dich andere Dinge glücklicher machen. Nun, das vereinfacht die Sache. Ich könnte dir garantieren, Miriam von Wien, dass dich die besten Astronomen Granadas in ihre Künste einführen werden und dass du zeitlebens die modernsten Gerätschaften gestellt bekommst, die du brauchst, um neue Sterne zu entdecken.«
Miriam strahlte, während Abram düster dreinsah. Er ahnte, was jetzt kam.
»Ich würde den ersten nach dir benennen!«, erklärte Miriam dem Emir. »Oder nach deinem erstgeborenen Sohn.«
Der Emir lachte. »Das wäre zu einfach, Sayyida. Ein bisschen mehr musst du mir schon bieten. Kurz und gut, Miriam von Wien – ich bitte dich darum, für ein paar Jahre als Hofastrologin in die Dienste des Grafen von Toulouse zu treten – dein Gatte könnte dich natürlich begleiten. Verstehst du auch ein bisschen von Sternen, Abram von Kronach?«
»Ich verstehe vor allem etwas von christlichen Höfen«, erklärte Abram unwillig. »Ein Jude lebt da gefährlich. Wenn Miriam mal etwas Falsches weissagt …«
Der Emir rieb sich die Schläfe. »Ich traue deiner Gattin ein Höchstmaß an Diplomatie zu«, sagte er. »Wozu natürlich eine gewisse … Beeinflussung des Grafen im Sinne der Mauren von Al Andalus gehört …«
»Das kann ich, Herr«, versicherte Miriam.
Was Verstellung anging, war sie immer unbekümmert gewesen. Als Abram sie kennenlernte, war sie als Christin gereist, obwohl sie nicht einmal wusste, wie man richtig das Kreuz schlägt.
»Wenn der Kerl auf Juden überhaupt hört!«, wandte Abram ein. »Ich bleibe dabei, dass die Stellung eines Juden an einem christlichen Hof, egal in welcher Position, gefährlich ist!«
Der Emir nickte. »Ich verstehe«, meinte er. »Ihr … ihr würdet nicht vielleicht den Islam annehmen?«
Miriam und Abram schüttelten die Köpfe.
»Bei allem Respekt vor deinem Glauben, Herr …« Abram setzte zu einer Entgegnung an.
Miriam lächelte und unterbrach ihn. »Es müsste ja keiner wissen!«, erklärte sie.
»Was wissen?«, fragte Abram unwillig.
»Dass wir keine Mauren sind«, sagte Miriam. »Wenn wir uns arabische Namen geben, merkt kein Mensch, dass wir Juden sind. Mauren sind sogar beschnitten, nicht wahr?«
Der Emir nickte. »Wenn ihr das auf euch nehmen wolltet …«
Abram wollte erneut widersprechen, aber Miriam gebot ihm Schweigen. Dies war ihre Gelegenheit, ihre Chance! Sie würde dem Grafen ein paar Jahre Horoskope stellen, und dann stand ihr der Himmel offen. Sie hatte für eine Einweisung in die Sternkunde schon Schlimmeres getan. Und noch etwas kam hinzu: Miriam hätte es nie zugegeben, aber sosehr sie ihr Haus in Moxacar und die Sicherheit in Al Andalus liebte, sie hatte längst begonnen, sich zu langweilen. Mit den jüdischen Matronen in der Synagoge hatte sie wenig gemein – und nichts mit den maurischen Frauen, die am Brunnen ihre Wäsche wuschen und klatschten. Eine Zeitlang war das alles schön gewesen, aber Miriam fehlte die Herausforderung. Bei ihren Forschungen trat sie auf der Stelle, die Lehrer verweigerten sich ihr, und Abram machte das Handelshaus seines Vaters nicht glücklich.
»Ich werde dem Grafen gleich das erste Horoskop stellen!«, erklärte sie jetzt entschlossen. »Und auch wenn es ihn nicht gerade erfreuen wird, zu hören, was gestern mit dreien seiner Ritter geschehen ist – er wird feststellen, dass die Sterne nicht lügen!«
DIE KRÖNUNG
Loches – MainzWinter 1212
Kapitel 1
Gerlin hatte den Boten, der ihr den Brief mit dem Siegel von Lauenstein übergab, reich belohnt. Ihr Herz klopfte immer schneller, wenn sie es sah – nicht nur, weil ihr Sohn selten schrieb, sondern vor allem, weil das Siegel sie an ihr altes Leben als Gattin des Grafen von Lauenstein erinnerte. Und daran, was in nicht allzu ferner Zukunft vor ihr liegen würde. Das Kapitel Lauenstein war längst nicht beendet, und sie freute sich darüber, dass auch ihr Sohn Dietmar dies nicht vergaß.
Gerlin zog sich mit dem Schreiben aus Paris in ihre Kemenate zurück, warf aber noch einen Blick aus dem Fenster in den Burghof, bevor sie das Siegel brach.
Richard, ihr zwölfjähriger Sohn, übte sich vor der Burg mit anderen jungen Knappen im Schwertkampf. Gerlin lächelte, wenn sie seinen blonden Schopf bei einer raschen Parade aufblitzen sah. Seine Manier, das Schwert zu führen, erinnerte jetzt schon an seinen Vater Florís de Trillon. Und bald würde es Zeit werden, ihn zur Erziehung an einen anderen Hof zu geben.
Gerlin seufzte. Die Kinder wurden zu schnell groß! Aber Richard würde sie nicht gleich nach Paris schicken wie seinen älteren Halbbruder. Auch wenn der Junge von einer Ausbildung am Königshof träumte – Gerlin sah ihn lieber auf einer der benachbarten Burgen im Vendômois. Und Isabelle …
Gerlin entdeckte ihre zehnjährige Tochter, der sie den Namen ihrer viel zu früh verstorbenen Mutter gegeben hatte, beim Hüpfspiel gemeinsam mit der Tochter der Köchin. Auch sie würde eines Tages fortgehen müssen. Dabei hätte Gerlin sie gern auf ihrer Burg behalten und ihrerseits andere Mädchen als Gespielinnen für sie aufgenommen. Aber das ging nicht, sie konnte sich nicht festlegen. Auch hier bestimmte der Schatten von Lauenstein nach wie vor ihr Leben.
Aber nun sah sie Florís, dessen großer Schimmel eben durchs Burgtor trat. Wie immer galt sein erster Blick seiner Frau – er schaute hoch zu ihrem Fenster, nachdem er sie im Burghof nicht erspäht hatte. Gerlin winkte ihm zu. Sie würde auf ihn warten, dann konnten sie Dietmars Brief gemeinsam lesen.
Florís brachte einen Krug Wein mit hinauf, als er kurze Zeit später die Tür ihrer gemeinsamen Räume öffnete. »Hier, der edelste Tropfen, um dir die Kehle zu befeuchten!«, sagte er lächelnd und küsste sie.
Gerlin erwiderte die Liebkosung. »Dietmar hat geschrieben. Der Brief ist an uns beide adressiert, wie immer«, erklärte sie.
Dietmar liebte und achtete seinen Ziehvater Florís. Der Ritter hatte stets größten Wert darauf gelegt, den Jungen zwar einerseits wie einen eigenen Sohn zu behandeln, andererseits das Andenken an Dietmars leiblichen Vater in ihm wachzuhalten. Florís de Trillon hatte Dietrich von Lauenstein bis zu seinem viel zu frühen Tod treu gedient. Der Graf hatte ihm seinen Sohn und sein Weib auf dem Sterbebett anvertraut. Wohl wissend, dass der Ritter Gerlin liebte.
»So schenke uns ein«, sagte Gerlin nun lächelnd und brach das Siegel des Briefes, während Florís Wein in zwei silberne Pokale füllte. Er konnte sich den Luxus leisten. Die Wälder und die fruchtbaren Ländereien von Loches brachten genügend Gold ein, um dem König die Abgaben zu zahlen und auch selbst sorglos zu leben.
Geliebte Mutter, geehrter Pflegevater,
wie immer ist zu viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal zur Feder gegriffen habe – ich hoffe, Ihr verzeiht es mir auch jetzt wieder. Ihr wisst, ich habe ein Schwert zu führen.