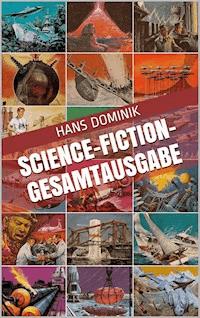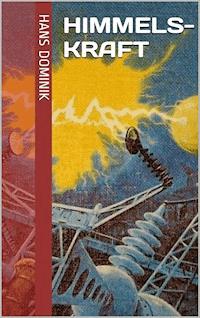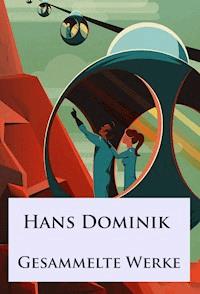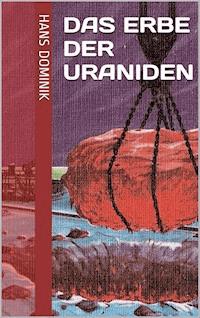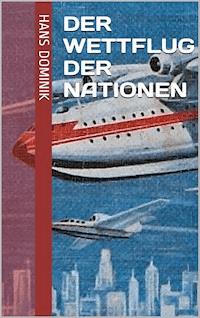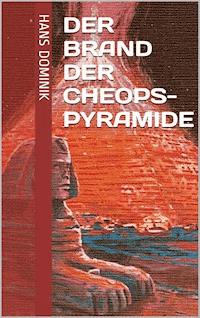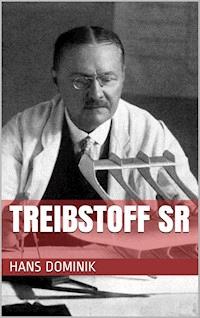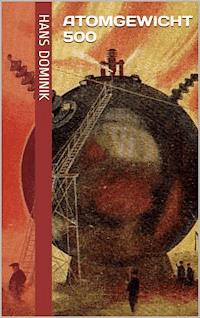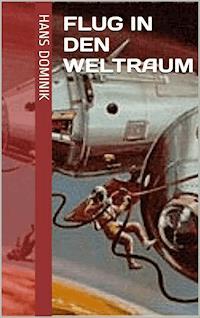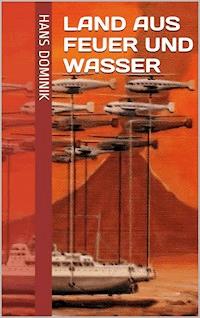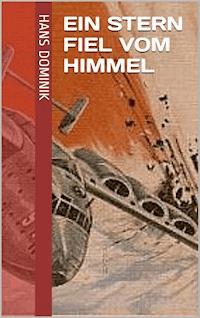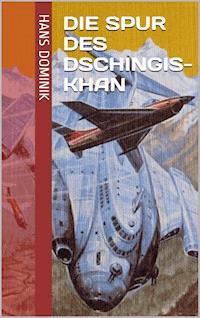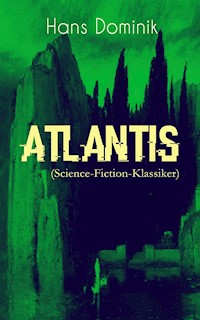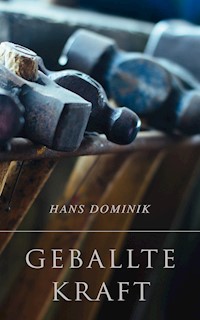Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Das ewige Herz' von Hans Dominik wird die Geschichte eines jungen Wissenschaftlers erzählt, der ein revolutionäres Verfahren zur Verlängerung der menschlichen Lebensspanne entdeckt. Das Buch, das im 20. Jahrhundert veröffentlicht wurde, zeichnet sich durch seinen futuristischen und technologischen Ansatz aus, der die Leser dazu bringt, über die Auswirkungen von wissenschaftlichen Entwicklungen auf die Gesellschaft nachzudenken. Hans Dominiks literarischer Stil ist geprägt von präzisen Beschreibungen und einem klaren Fokus auf die Darstellung von wissenschaftlichen Konzepten. 'Das ewige Herz' kann als Pionierwerk der Science-Fiction-Literatur angesehen werden, das die Leser dazu ermutigt, über die ethischen und moralischen Fragen im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Fortschritt nachzudenken. Hans Dominik war ein bekannter deutscher Schriftsteller und Ingenieur, der für seine visionären Werke im Bereich der Science-Fiction-Literatur berühmt war. Sein Hintergrund in der Technik und sein Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen haben ihn dazu inspiriert, 'Das ewige Herz' zu schreiben, um die Leser über die möglichen Konsequenzen von wissenschaftlichen Durchbrüchen zu informieren. Mit seiner Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Ideen auf eine zugängliche Weise darzustellen, hat Dominik es geschafft, ein breites Publikum für seine Werke zu begeistern. 'Das ewige Herz' ist ein faszinierendes Buch, das nicht nur Science-Fiction-Fans, sondern auch alle Leser, die sich für die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft interessieren, ansprechen wird. Durch seine kluge und einfühlsame Darstellung von moralischen Dilemmata und ethischen Fragen regt es zum Nachdenken über die Zukunft der Menschheit an und lädt dazu ein, die Grenzen der Wissenschaft neu zu überdenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das ewige Herz
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Die Tages- und Nachtstunde zu wissen, auch wenn die Sonne sich hinter Wolken verbarg oder der Mond nicht am Himmel stand, wurde Bedürfnis für die Menschheit, sobald sie eine gewisse Kulturstufe erreichte. So entstand schon in altersgrauer Zeit im Lande der Ägypter die Wasseruhr, wurde tausend Jahre hindurch verbessert und erhielt schließlich ein Räderwerk, das zu Zeigern führte.
Ein phantasievoller Kopf mag zuerst mit dem Gedanken gespielt haben, das Räderwerk durch ein sinkendes Gewicht anstelle des fließenden Wassers anzutreiben; ein unbekannt gebliebener Erfinder setzte die Idee in die Tat um, indem er in Gestalt eines gleichmäßig hin- und herschwingenden Waagbalkens die »Hemmung« schuf, durch welche der gleichmäßige Gang der reinen Räderuhr überhaupt erst möglich wurde. So muß die Geschichte der eigentlichen Uhrmacherkunst mit dem paradoxen Satz beginnen: »Die Hemmung war der große Fortschritt«.
Nach dem Schema: Antrieb des Räderwerkes durch ein Gewicht, Hemmung durch einen Waagbalken mit Lappenspindel wurden vom frühen Mittelalter an Turmuhren und später auch Wand- und Tischuhren gebaut. Die nächste Verbesserung fügte zu dem Gangwerk der Uhr noch ein Schlagwerk, so daß der Türmer die Stunden und Viertelstunden nicht mehr von Hand mit einem Hammer an einer Glocke anzuschlagen brauchte. Im vierzehnten Jahrhundert kam man schließlich dazu, für Tisch- und Wanduhren die Spannkraft einer stählernen Spiralfeder zum Antrieb der Räderwerke nutzbar zu machen. Als ältestes Beispiel dafür ist die Tischuhr des Herzogs Philipp des Guten von Burgund erhalten geblieben, die in ihrer äußeren Form als ein Prachtstück des damaligen Kunstgewerbes gelten darf.
Zunftmäßig gehörten die Uhrmacher bis tief in das sechzehnte Jahrhundert hinein zum Schlossergewerk, wo sie nach der Art der Arbeit und den dabei benützten Werkzeugen auch durchaus hinpaßten. Die große Wandlung wurde eingeleitet als Peter Henlein »Meister auf dem Schlosserwerk« zu Nürnberg um 1510 den kühnen Plan faßte, »ein klein orologium« zu schaffen, das man im Geldbeutel bei sich tragen könne, also eine Taschenuhr zu bauen. Genialer Erfindungsgeist und zähe, ein reichliches Jahrzehnt dauernde Entwicklungsarbeit waren vonnöten, um den Plan zu verwirklichen. Die »nürnberger Eylein« waren das Ergebnis solcher Mühe. So ist die Taschenuhr eine deutsche Erfindung und da sich nun der Todestag des Meisters, der sie der Welt schenkte, zum vierhundertsten Male jährt, geziemt es sich, seiner und seines Lebenswerkes zu gedenken.
Das soll durch das vorliegende Büchlein geschehen. Für den Verfasser galt es dabei, das Leben und Treiben in einer freien Reichsstadt zu Beginn eines neuen Zeitalters zu malen; jene Jahre wieder lebendig werden zu lassen, in denen das alte Deutsche Reich noch einmal zu voller Macht erblühte, und die Männer zu zeigen, die jener Zeit das Gepräge gaben; und schließlich auch noch darzustellen, wie das Erbe Meister Henleins, das für unser Land schon fast verloren schien, zurück gewonnen und weiter gemehrt wurde.
Als wertvollste Quelle stand dem Verfasser dafür das Buch »Peter Henlein – der Erfinder der Taschenuhr« von Albert Gümbel zur Verfügung, der in seiner Eigenschaft als Oberarchivar in Nürnberg in der Lage war, sämtliche den Meister Peter betreffenden Eintragungen in den Nürnberger Akten lückenlos zusammenzutragen. Ferner ist er dem Leiter der Meisterschule des deutschen Uhrmacherhandwerks in Glashütte, Oberstudiendirektor Dr. K. Giebel zu besonderem Dank verpflichtet, der ihn bei seiner Arbeit mit Rat und Tat unterstützt hat.
Hans Dominik.
Die Taschenuhr im Gallischen Krieg
(54 v. Chr.)
Hastig läßt der Geheimschreiber Rufinus die Rohrfeder über das Pergament gleiten; er hat Mühe, den Worten des Imperators zu folgen, der einen Erlaß an die Legionen in den Winterlagern diktiert. »Gegeben zu Samarobriva an den Nonen des November im Jahre 709 nach der Gründung der Stadt« endet der Feldherr.
»Hast Du, Rufinus?« – »Ich habe es, Cäsar.«
»Laß es acht Mal abschreiben und durch Eilboten an die Winterquartiere abgehen.«
Der Schreiber rafft seine Federn und Pergamente zusammen und verläßt den Raum. Als die Türe hinter ihm in's Schloß fällt, kommt Bewegung in die bisher unbeweglichen Mienen Cäsars und Sorge malt sich in seinen Zügen. Während er in dem Gemach auf und ab schreitet, formen seine Lippen im Selbstgespräch Worte. ›Seit Oktober keine Nachricht mehr von Quintus Titus ... seit einer Woche keine von Quintus Cicero ...!‹
Ein tiefer Gongschlag reißt ihn aus seinen Gedanken. Eine Stahlkugel, die ein sinkendes Wassergefäß in eine Bronzeschale stieß, ließ den Ton aufklingen.
›Schon die zehnte Stunde!‹ Leise spricht es der Einsame und schreitet auf die Wand zu, von welcher der Klang kam.
Ein eigenartiges Gebilde steht hier, kunstvoll aus Eisen und Silber, aus Bronze und Elfenbein gefügt. Fast die halbe Wandfläche nimmt es ein und reicht beinahe bis zur Decke des Raumes. Eine ägyptische Wasseruhr ist das Ganze, eine Klepsydra, die Marcus Licinius Krassus vor fünf Jahren, kurz nachdem sie mit Pompejus das Dreierbündnis schlossen, seinem Freunde Julius Cäsar als Geschenk sandte.
... Licinius Krassus ... was mag der jetzt treiben? Im Osten des Reiches kämpft er gegen die Parther ... vielleicht um sein Leben ... Sein Sohn, der Quästor Titus Krassus hat wohl einen ruhigeren Posten ... der steht jetzt in Gallien im Bellovakerland ... nicht allzuweit von Samarobriva hat er sein Winterlager ... der braucht sich nicht um Überfälle syrischer Schleuderer und parthischer Bogenschützen zu sorgen, wie sein Vater ... der Reiche ... ein königliches Geschenk war es, das der damals sandte ...
Sinnend verhält der Imperator den Schritt vor der Klepsydra. Sein Ohr vernimmt das leise Rauschen, mit dem das Wasser aus dem oberen Behälter durch feine Röhren nach unten in Meßgefäße fließt. Sein Auge verfolgt das Spiel von Waagebalken, welche die Meßgefäße tragen, bis einmal die Last zu schwer wird, ein Balken unter dem stärkeren Druck des gefüllten Gefäßes sich neigt und einer Metallkugel den Sturz in die bronzene Schale freigibt.
Deutlich erinnert er sich jetzt des Erbauers, der die Uhr damals selbst aus Alexandria nach Rom brachte und ein Lächeln geht über seine Züge, als ihm die Erzählung jenes Künstlers wieder in den Sinn kommt. Was wußte er doch zu berichten? Seit unvordenklichen Zeiten hielten die sternkundigen ägyptischen Priester in ihren Tempeln heilige Affen und sie beobachteten ... das Lächeln Cäsars vertieft sich, während seine Gedanken weiterwandern ... sie beobachteten, daß diese Affen genau jede zweite Stunde ihr Wasser ließen. Fanden die Beobachtung durch den Lauf der Gestirne bestätigt und einer jener priesterlichen Astronomen hatte den erfinderischen Einfall, die Natur nachzuahmen und ein Gerät zu schaffen, in dem gleichmäßig aus Röhren fließendes Wasser der Zeitmessung dienstbar gemacht wurde. Vor vielen Jahren, vor vielen Jahrhunderten vielleicht schon geschah das. Was sind tausend Jahre für ein Land wie Ägypten? Aber unaufhörlich wurde an der Verbesserung der ersten Erfindung weitergearbeitet. Welch ein langer Weg von jenen Tempelaffen zu diesem mechanischen kostbaren Kunstwerk, geht es Cäsar durch den Sinn, während sein Blick auf der Klepsydra ruht ...
Andere Gedanken drängen sich ihm auf und zwingen seinen Geist in eine andere Richtung ... der Feldzug im Sommer dieses letzten Jahres? War es zweckmäßig, Nordgallien von Truppen zu entblößen und mit drei Legionen nach Britanien überzusetzen? Der Grundgedanke war wohl richtig. Ständig steckten ja die britischen Fürsten mit den Galliern zusammen und verleiteten sie zu immer neuen Aufständen. Die Quelle dieser ewigen Unruhen mußte verstopft werden. Es war notwendig, denen auf ihrer Insel die Adler Roms zu zeigen. Aber ... die Legionen, die dort den Kassivelaunus jagten, hatten inzwischen im Norden Galliens gefehlt. Die immer unruhigen Stämme der Eburonen, der Aduatiker und Nervier konnten daraus nur allzuleicht Mut zu neuen Aufständen schöpfen. Und nun ... die Gedanken Cäsars kehren zu den Legionen im Gebiet dieser Völkerschaften zurück, bis ein neuer Gongton ihn aus seinem Sinnen reißt. Wieder läßt die Wasseruhr eine Kugel in die Schale fallen. Eine Stunde ist über seinem Grübeln verstrichen. Eine neue, die elfte Stunde bricht an.
Der Imperator wendet sich einem mit Skripturen bedeckten Tische zu, als Lärm ihn aufhorchen läßt; im nächsten Augenblick tritt ein Zenturio ein, gibt den Schwertgruß und meldet: »Cäsar, es ist ein Bote vom Legaten Quintus Cicero gekommen.«
»Von Cicero?! Aus dem Winterlager im Lande der Nervier?«
Für kurze Zeit verläßt den Imperator die eiskalte Ruhe. Er eilt in den Vorraum. Dort umringen die Legionäre der Wache einen Gallier, der an seinem Speer nestelt und aus dessen hohlem Schaft ein zusammengerolltes Pergament herauszieht. Cäsar nimmt es ihm aus den Händen, liest es und sein blasses Antlitz wird noch um eine Schattierung farbloser. Unerhörtes künden ihm die auf das Pergament geworfenen Zeilen ... das Winterlager im Gebiet der Eburonen verbrannt, die Legaten Sabinus und Cotta gefallen, fünfzehn Kohorten vernichtet ... daher so lange keine Nachricht aus dem Lande der Belgier ... auch das Lager des Quintus Cicero belagert, von sechzigtausend aufständischen Nerviern eingeschlossen. Seine Legion seit vielen Tagen in schwerstem Kampf ...
Noch während der Imperator die letzten Zeilen liest, hat er seinen Entschluß gefaßt. Hilfe muß sofort gebracht werden, wenn Cicero nicht das Schicksal des Sabinus und des Cotta erleiden soll.
Schon ist er in sein Gemach zurückgekehrt und wartet die Ankunft des Rufinus nicht erst ab. Auf eine Wachstafel schreibt er mit stählernem Griffel den Befehl an den Quästor Krassus, sofort mit seiner Legion aus dem Lager im Bellovakerland aufzubrechen und zu ihm nach Samarobriva zu eilen.
Bevor die Wasseruhr eine neue Kugel in das Becken wirft, ist ein Reiter mit dem Befehl auf dem Wege zu Krassus. – –
Die Herbstnacht bricht an. Auch der Bote des Cicero hat sich bald wieder auf den Rückweg gemacht. Diesmal birgt sein Speerschaft einen Brief in griechischer Sprache, den Cäsar selbst schrieb. Fangen die Aufständischen den Boten ab, so werden sie den Inhalt des Schreibens doch nicht verstehen; erhält ihn Quintus Cicero, so wird er wissen, daß der Imperator ihm mit drei Legionen zu Hilfe eilt. – –
Lange noch hat Cäsar geplant und gearbeitet. Erst nach Mitternacht begibt er sich zur Ruhe; kurz nach Sonnenaufgang ist er schon wieder tätig, denn wenige Stunden Schlaf genügen ihm. Gefolgt von seinem Adjutanten, dem Zenturio Lucius Valerius schreitet er durch das Lager von Samarobriva und läßt die Kohorten seiner Legion marschfertig machen. Öfter als einmal geht sein Blick nach Südosten, von wo her Titus Krassus kommen muß, dabei wirft er die Frage hin: »Wie spät mag es sein?«
Es ist eine rhetorische Frage, auf die er auf dem freien Platz hier, auf dem sich die Kohorten um ihre Feldzeichen sammeln, kaum eine Antwort erwarten darf. Ein wenig erstaunt wirft er einen Blick auf Valerius, den eleganten Gardeoffizier, der erst vor kurzem aus der Hauptstadt zu ihm stieß. Warum greift der plötzlich in seinen Mantel? Was für ein kleines Ding aus silbern blinkendem Metall hält er jetzt in seiner Rechten. Ein Ring scheint es zu sein, der etwa die Breite eines Daumens und eines Daumens Länge als Durchmesser hat. Was ist das? Eine neue Modetorheit der römischen Stutzer?
Die Stirn des Imperators legt sich in Falten. Solche Dinge sieht er bei seinen Offizieren nicht gern und muß doch unwillkürlich weiter hinschauen. Eine kurze Schnur ist an dem Ring befestigt, an der läßt Valerius ihn jetzt senkrecht hinabhängen, hält ihn in Brusthöhe vor sich und dreht die Schnur bis die Ebene des Ringes auf die Sonne weist. Ein kleines Loch hat der Ring an seinem Umfang, durch das nun ein feiner Sonnenstrahl fällt und auf einer an der Innenweite des Ringes eingravierten Skala einen hellen Punkt abzeichnet. Der Zenturio beugt sich vor, blickt scharf auf die Skala und den Lichtpunkt. Sagt dann: »Die zweite Hälfte der dritten Tagesstunde hat begonnen, Cäsar.«
»Die zweite Hälfte der dritten Stunde« wiederholt der Feldherr für sich die Worte des Valerius, »die Vorhut des Krassus kann nicht mehr weit von den Toren sein«.
Er winkt den Führer einer Manipel heran und gibt ihm einen kurzen Befehl. Der salutiert, wirft sein Roß herum und sprengt an der Spitze seiner Schar davon. Eine kurze Weile blickt Cäsar dem Enteilenden nach, dann wendet er sich wieder an seinen Adjutanten.
»Was hattest Du da, Valerius? Eine Sonnenuhr schien's mir zu sein; kaum größer als ein As.«
Lucius Valerius zieht den Ring wieder aus dem Bausch seines Mantels, reicht ihn dem Fragenden und spricht dabei:
»Du sagst es, Cäsar. Es ist eine winzige Sonnenuhr, bequem in einer Manteltasche mitzunehmen, und doch ein zuverlässiger Zeitweiser ...«
»Wenn die Sonne klar am Himmel steht, Valerius!«
»Das gilt für alle Sonnenuhren, Cäsar. Nur die heiteren Stunden zeigen sie an.«
»Das Leben bringt mehr trübe als heitere Stunden.« Mehr zu sich selbst als zu dem Anderen hat es der Feldherr gesagt, während er die feine Ziselierung des Ringes betrachtet.
»Eine kunstvolle Arbeit, Valerius«, spricht er weiter. »Die ephesichen Silberschmiede bilden ähnliche Figuren auf Bechern und Tellern ab.« Valerius zuckt die Achseln. »Ich weiß nicht Cäsar, welcher Künstler den Ring verfertigte. Ich erwarb ihn vor zwei Jahren in Rom von einem griechischen Händler, der sein Gewölbe neben dem Tempel der Ceres hat. Es mag wohl sein, daß er aus Ephesus stammt, denn der Grieche pries das Stück als eine neue Erfindung aus Kleinasien. In überschwenglichen Worten setzte er mir auseinander, wie wichtig es gerade für einen Offizier wäre, auch auf dem Marsch im freien Felde die genaue Stunde zu wissen.
Ich hörte damals kaum auf sein Geschwätz, dachte mir, jeder Händler lobt seine Ware und kaufte das Stück einfach, weil mir seine hübsche Form gefiel. Aber später im Kriege gegen Pharnaces hat mir das kleine Ding gute Dienste geleistet. Es ist recht nützlich zum Weisen der Stunde.«
»Wenn die Sonne scheint, Valerius« unterbricht ihn Cäsar und spricht halblaut für sich weiter: »Man müßte eine solche kleine Uhr erfinden, die unabhängig vom Tagesgestirn die Zeit anzeigt ...«
Langhallende Tubaklänge übertönen seine letzten Worte. Die ersten Kohorten des Titus Krassus marschieren in das Standlager ein. Mit einer raschen Bewegung reicht der Imperator den Ring zurück. Was gilt ihm jetzt ein griechisches Spielzeug? Um Größeres geht es nun. Kostbar sind die Stunden, wertvoll die Minuten. Aufzubrechen gilt es jetzt und der bedrohten Legion im Nervierland in Eilmärschen Hilfe zu bringen.
Fünfzehnhundert und mehr der kreisenden Jahre verrauschten.
Herr Caspar geht ein Bisamäpflein kaufen
Ein Sonntag im Maimond des Jahres 1510. Helle Morgensonne liegt über der freien Reichsstadt Nürnberg, umstrahlt die Türme der alten Kaiserburg und vergoldet die Giebel der Bürgerhäuser. Der Gottesdienst in St. Katherinen ist beendet. Während die letzten Orgelklänge verhallen, treten zwei Männer mittleren Alters aus der Kirchentür. Ihre Kleidung, die pelzverbrämten Samtschauben, das brokatene Gewand des einen, das seidene Wams des anderen lassen erkennen, daß es Patrizier der reichen Handelsstadt an der Pegnitz sind. Auf dem Platz vor der Kirche bleiben sie eine kurze Weile stehen.
»Wohin führt Euch Euer Weg, Herr Leonhard Groland?« wendet sich der im Seidenwams an seinen Gefährten. Der Gefragte deutet auf eine nach Süden laufende Gasse.
»Dortlang, Herr Caspar Nützel. Ich habe ein Geschäft bei unserem Gießermeister, Peter Vischer.«
»Da haben wir denselben Weg, Herr Leonhard. Ich will den Meister Henlein aufsuchen; dessen Haus liegt gleich daneben.«
»Ist richtig so«, bestätigt der Ratsherr Leonhard Groland, die Bemerkung seines Begleiters. »Die beiden Peter, der Gießer und der Plattenschlosser hausen dicht beisammen.«
Während ihres Gespräches sind sie schon weiter gegangen und haben bald ihr Ziel in der engen Gasse hinter St. Katharinen erreicht. Vor dem stattlichen Hause Peter Vischers setzt der Ratsherr den kunstvollen Bronzeklopfer gegen die Eichentüre in Bewegung, vor dem bescheideneren des Schlossermeisters läßt Herr Caspar Nützel einen handgeschmiedeten gegen das Türholz schlagen.
»Grüß Gott, Frau Meisterin«, entbietet er der Hausfrau seinen Gruß. »Treffe ich den Meister daheim?« Mit Wohlgefallen ruht sein Blick auf der jugendlichen Gestalt der Frau Kunigunde Ernstin, mit der Meister Henlein vor einem Jahre den Bund für's Leben geschlossen hat. »Finde ich den gestrengen Eheherrn beim Frühtrunk?« fragt er weiter.
»Nein, wohlweiser Herr. Er ist in der Werkstatt.«
»Am Sonntag in der Werkstatt?« Etwas verwundert bringt Herr Caspar die Worte heraus. »Hat er so dringende Arbeit, daß er am Tage des Herrn am Schraubstock stehen muß?«
Die Meisterin antwortet stockend: »Das ist es nicht, Herr Caspar. Der Meister ist von einem neuen Einfall besessen. Er arbeitet an einer Erfindung. Deswegen hockt er schon seit Monaten an jedem Feiertag allein in der Werkstatt. Die Aufträge könnte er mit den vier Gesellen wohl an den Werktagen fertig bringen. Er hat den zweiten Gehilfen, den Martin so trefflich angelernt, daß der junge Gesell die Bisamknöpflein fast so kunstvoll zu machen versteht, wie der Meister selber ...«
»Bisamäpflein ... um derenwegen komme ich«, wirft Herr Caspar Nützel ein, »er hat sie in der Werkstatt? Da will ich ihn dort aufsuchen«
»Ich werde Euch geleiten«, sagte die Meisterin und führt den Besucher über einen halbdunkeln Gang zu der im Hinterhaus befindlichen Werkstatt.
Geräuschlos tritt Herr Caspar ein. Still und verlassen liegt der weite Raum heute da, in dem an den Wochentagen reges Leben herrscht. Das Feuer in der Schmiedeesse ist erloschen. Die Plätze an den Feilbänken sind leer und unbenutzt liegt das Handwerkzeug neben den Schraubstöcken. Nur Meister Henlein ist zugegen. An seinem Werkplatz vor einem Fenster sitzt er über den Tisch gebeugt, so sehr in seine Arbeit vertieft, daß er den Eintretenden nicht wahrnimmt. Auch der verhält jetzt den Schritt und blickt sich prüfend um.
Ist das, was seine Augen hier erschauen, eine Schlosserwerkstatt von alter Art oder hat hier schon eine Wandlung zu etwas Neuem stattgefunden? Schwere Hämmer und kräftige Zangen neben der Esse lassen wohl erkennen, daß auch größere Stücke geschmiedet werden; etwa jene gewichtigen Türbänder und Scharniere, deren Herstellung Sache eines Plattenschlossers ist. Auch die schweren Schrotfeilen deuten auf gröbere Schlosserarbeit hin; aber auf anderen Arbeitsplätzen liegt viel feineres Werkzeug. Auch dort erblickt Herr Caspar Feilen, aber sie sind unendlich viel kleiner und zierlicher. Auch die stärksten darunter haben kaum die Größe einer dünnen Federspule und stählerne Stichel liegen daneben, so winzig wie man sie sonst nur bei Goldschmieden und Juwelieren findet. Bohrer sieht er, die kaum die Stärke eines Pferdehaares haben. Sieht auch ein Gerät, das er nach allem, was er von diesen Dingen versteht, für eine Drehbank halten muß. Aber unvorstellbar zierlich und winzig ist das Ganze; kaum zwei Zoll lang und einen Zoll hoch, daß ihm doch wieder Zweifel über den Zweck dieses eigenartigen Dinges kommen.
Herr Caspar Nützel ist ein Mann«, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Er weiß sehr wohl, daß die Schlosser, die sich seit geraumer Zeit auch mit dem Bau von Wohnungsuhren befassen, ein feinerer Handwerkszeug benötigen als jene anderen, welche die großen Turmuhren verfertigen; die mannigfachen Uhren, die hier in der Werkstatt teils an den Wänden hängen, teils auf den Feilbänken stehen, beweisen, daß des Meister Henlein auch den Kleinuhrenbau betreibt. Aber eine Erklärung für diese unwahrscheinlich zwerghaft anmutenden Werkzeuge vermag Herr Caspar nicht zu finden. Etwas anderes, Neues muß dahinter stecken, und das möchte er erfahren.
Mit festen Schritten geht er auf den Meister zu und legt ihm die Hand auf die Schulter. Die Berührung reißt den aus seiner Versunkenheit. Als ob er aus einem Traum erwache, richtet er sich ein wenig auf und wendet sich Herrn Caspar zu. Der erschrickt fast, als er ihm ins Antlitz blickt. Was hat Meister Henlein da am rechten Auge? Eines jener kugelig geformten Gläser scheint es zu sein, wie sie Schreiber und Gelehrte des öfteren in Gebrauch haben. Unwillkürlich muß er an Herrn Melchior Sartorius, den ersten Schreiber des Hohen Rates der freien Reichsstadt denken. Der besitzt so ein Ding, das er Brille nennt. Ein Gestell mit zwei Kugelgläsern, das er bald auf der Nase trägt und bald vor die Stirn schiebt.
Aber der Meister hier trägt nur vor einem Auge ein Glas und das ist nicht in ein Drahtgestell gefügt. Es sitzt in einem kurzen Rohr, das er sich geschickt ins Auge klemmt. Jetzt nimmt er es heraus und stellt es auf den Werktisch. Danach erst scheint er sich der Gegenwart der anderen voll bewußt zu werden und erhebt sich, um den vornehmen Besucher gebührend zu empfangen. Herr Caspar Nützel erwidert seinen Gruß und wendet dann seine Aufmerksamkeit dem Gebilde zu an dem der Meister gearbeitet hat.
Ein Uhrwerk ist es, muß es wohl sein, denn was könnten die feinen Zahnräder und der zierliche Schwingbalken, der mit ihnen verbunden ist, anderes bedeuten. Aber so winzig und fein ist das Ganze, um viele Male kleiner ist es als jene anderen Uhren an den Wänden und auf den Tischen. Noch in das Schauen versunken, begreift Herr Caspar wozu jene zwerghaften Werkzeuge dienen, die vor kurzem sein Staunen erregten. Er versteht es auch, daß der Meister ein vergrößerndes. Glas benutzen muß, um alle Einzelheiten dieser Arbeit richtig erkennen zu können und im gleichen Augenblick erfüllt ihn die Erkenntnis: Es ist wirklich etwas noch nie Dagewesenes, das hier entsteht. Peter Henlein jagt wirklich, wie die Meisterin es ihm draußen sagte, einer neuen Erfindung nach und er ist dabei, ihr in Stahl und Eisen Form zu verleihen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: