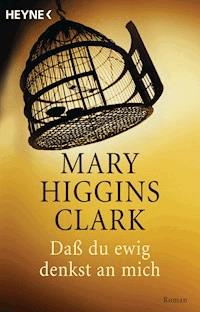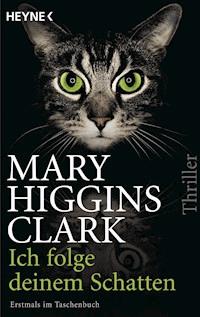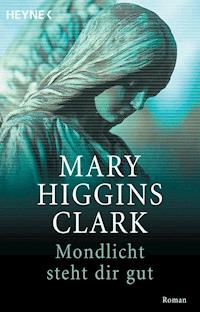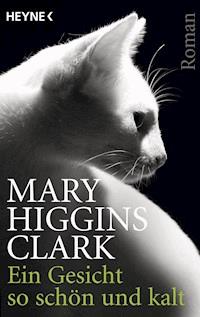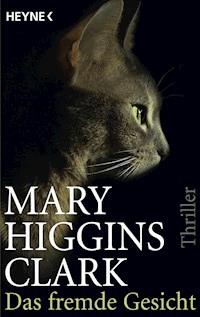
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
«Eine der erfolgreichsten Erzählerinnen unserer Zeit.» THE WASHINGTON PRESS
Eine junge Frau auf der Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Vater - ist er ein Mörder?
Ein aufregender, ungemein spannender Psychococktail: «Gruselig, schockierend, glänzend geschrieben.» THE HEROLD STATESMAN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Ähnliche
DAS BUCH
Die Reporterin Meghan Collins sieht zufällig in der Notaufnahme eine Sterbende, die ihr auf geradezu unheimliche Weise ähnelt. Ein fürchterlicher Schrecken, zumal Meghan noch schwer von einem anderen Schicksalsschlag gezeichnet ist: Bei einem Massenunfall auf einer Brücke hatte sie erst kurz zuvor ihren geliebten Vater verloren; seine Leiche wurde nie gefunden. Ungewißheit quält seitdem die Familie, genau wie die allmähliche Entdeckung, daß Daddy ein Doppelleben geführt haben muß. Eine Reihe merkwürdiger Begebenheiten weist darauf hin, daß er noch am Leben ist. Auf der Suche nach dem Schicksal ihres Vaters kommt Meghan einem entsetzlichen Geheimnis auf die Spur. Und auch für den Tod der Frau findet sich plötzlich eine grausige Erklärung ...
DIE AUTORIN
Mary Higgins Clark, geboren in New York, lebt und arbeitet in Saddle River, New Jersey. Sie zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautorinnen weltweit. Mit ihren Büchern führt sie regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an. Sie hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u.a. den begehrten »Edgar Award«. Zuletzt bei Heyne erschienen: »Flieh in die dunkle Nacht«.
Inhaltsverzeichnis
Für mein neuestes Enkelkind Jerome Warren Derenzo »Scoochie« mit Liebe und Freude
Im Schimpfe wurzelnd widerstand sein Ruhm, Und fälschlich wahr hielt ihn treulose Treu!
ALFRED LORD TENNYSON, KÖNIGSIDYLLEN
TEIL I
1
Meghan Collins stand etwas abseits von dem Pulk der anderen Journalisten in der Notaufnahme des Roosevelt Hospital in Manhattan. Minuten zuvor war ein ehemaliger Senator der Vereinigten Staaten auf der Central Park West überfallen und sofort hier eingeliefert worden. Die Medienleute drängten sich in Erwartung einer Nachricht zu seinem Zustand.
Meghan ließ ihre schwere Tasche auf den Boden gleiten. Das drahtlose Mikrofon, das Funktelefon und die Notizblöcke führten dazu, daß ihr der Tragriemen in die Schulter schnitt. Sie lehnte sich an die Wand und schloß für eine kurze Ruhepause die Augen. All die Reporter waren müde. Seit dem frühen Nachmittag waren sie im Gericht gewesen und hatten auf das Urteil in einem Unterschlagungsprozeß gewartet. Um neun Uhr, als sie gerade abziehen wollten, kam der Anruf, sie sollten über den Überfall berichten. Jetzt war es bald elf. Der frische Oktobertag war einer verhangenen Nacht gewichen, die einen unwillkommenen frühen Winter verhieß.
Es herrschte reger Betrieb in dem Krankenhaus. Junge Eltern mit einem blutenden Kleinkind auf den Armen wurden am Anmeldeschalter vorbei durch die Tür zum Untersuchungsbereich gewiesen. Leidtragende eines Autounfalls, mit Prellungen und sichtbar mitgenommen, trösteten einander, während sie auf ihre medizinische Versorgung warteten.
Draußen verstärkte das unablässige Aufheulen ankommender und abfahrender Krankenwagen die vertraute Kakophonie des New Yorker Verkehrs.
Eine Hand berührte Meghan am Arm. »Na, wie geht’s denn so, Frau Anwältin?«
Es war Jack Murphy von Channel 5. Seine Frau hatte mit Meghan an der New York University Jura studiert. Meghan Collins, Doktor der Rechte, hatte ein halbes Jahr bei einer Kanzlei an der Park Avenue gearbeitet, dann gekündigt und bei dem Rundfunksender WPCD eine Stelle als Nachrichtenreporterin bekommen. Sie war jetzt seit drei Jahren dort, und im letzten Monat hatte PCD Channel 3, der angeschlossene Fernsehsender, sie regelmäßig ausgeliehen.
»Soweit ganz gut, denke ich«, entgegnete ihm Meghan. Ihr Piepser meldete sich.
»Komm bald mal zu uns zum Essen«, sagte Jack. »Ist schon so lange her.« Er ging wieder zu seinem Kameramann, während sie nach ihrer Tasche griff, um das Funktelefon herauszuholen.
Der Anruf kam von Ken Simon in der Nachrichtenzentrale von WPCD. »Meg, der Ambulanz-Spezialempfänger hat gerade einen Krankenwagen aufgespürt, der zum Roosevelt fährt. Opfer mit Stichwunden, Ecke Sechsundfünfzigste Straße und Zehnte. Kümmer’ dich drum.«
Der ominöse Ieee-Oooah-Ton eines sich nähernden Rettungswagens fiel mit dem Stakkato-Getrappel hastender Füße zusammen. Das Traumatologie-Team war auf dem Weg zum Eingang der Notaufnahme. Meg stellte das Telefon ab, steckte es in ihre Tasche und folgte der leeren Krankentrage, die zu der halbkreisförmigen Auffahrt geschoben wurde.
Die Ambulanz kam quietschend zum Stehen. Erfahrene Hände halfen eilends, das Opfer auf die Bahre zu legen. Eine Sauerstoffmaske wurde über das Gesicht der Frau gestülpt. Das Tuch, das ihren schlanken Körper bedeckte, war voller Blut.
Wirres haselnußbraunes Haar betonte noch die bläuliche Blässe ihres Halses.
Meg rannte zur Fahrertür. »Irgendwelche Zeugen?« fragte sie rasch.
»Hat sich niemand gemeldet.« Das Gesicht des Fahrers war von Erschöpfung gezeichnet, seine Stimme sachlich. »Da ist ein Durchgang zwischen zwei dieser alten Mietshäuser bei der Zehnten. Ist wohl einer von hinten gekommen, hat sie da reingestoßen und auf sie eingestochen. Ist wahrscheinlich blitzschnell passiert.«
»Wie schlimm ist sie dran?«
»Könnte nicht schlimmer sein.«
»Irgendein Hinweis, wer sie ist?«
»Nichts. Sie ist beraubt worden. Wahrscheinlich irgend so ein Fixer, der was zum Drücken gebraucht hat.«
Die Bahre wurde hineingerollt. Meghan huschte zurück und hinterher in die Notaufnahme.
Einer der Reporter schnauzte: »Der Arzt des Senators gibt jetzt’ne Stellungnahme ab.«
Die Medienhorde flutete durch den Raum, um den Schalter zu belagern. Meghan wußte nicht, welche Eingebung sie bei der Bahre verharren ließ. Sie sah, wie der Arzt, der eine Infusion anlegen wollte, die Sauerstoffmaske entfernte und die Augenlider des Opfers aufschob.
»Sie ist tot«, sagte er.
Meghan warf einen Blick über die Schulter einer Krankenschwester und starrte in die blicklosen Augen der toten jungen Frau.
Sie rang nach Luft, als sie diese Augen in sich aufnahm, die breite Stirn, die gewölbten Brauen, die hohen Wangenknochen, die gerade Nase, die vollen Lippen.
Es war, als schaute sie in einen Spiegel.
Sie betrachtete ihr eigenes Gesicht.
2
Meghan nahm ein Taxi zu ihrem Apartment in Battery Park City, ganz unten an der Spitze von Manhattan. Die Fahrt war teuer, aber es war spät, und sie war sehr müde. Bis sie nach Hause kam, vertiefte sich der betäubende Schock vom Anblick der Toten noch, anstatt nachzulassen. Man hatte das Opfer in die Brust gestochen, wohl vier oder fünf Stunden, bevor sie gefunden wurde. Sie hatte Jeans an, eine abgesteppte Jeansjacke, Sportschuhe und Socken. Raub war vermutlich das Motiv gewesen. Ihre Haut war braungebrannt. Schmale Streifen hellerer Haut an ihrem Handgelenk und mehreren Fingern ließen vermuten, daß Ringe und eine Uhr fehlten. Ihre Taschen waren leer, und man hatte keine Handtasche gefunden.
Meghan machte das Licht am Eingang an und blickte quer durch das Zimmer. Von ihren Fenstern aus konnte sie Ellis Island und die Freiheitsstatue sehen. Sie konnte den Vergnügungsschiffen folgen, wie sie zu ihren Anlegeplätzen auf dem Hudson gelotst wurden. Sie liebte das Geschäftszentrum von New York, die Enge der Straßen, die majestätische Wucht des World Trade Center, die Betriebsamkeit des Finanzbezirks.
Die Wohnung war ein geräumiges Einzimmerapartment mit einer Schlafnische und einer Küchenzeile. Meghan hatte es mit ausrangierten Gegenständen ihrer Mutter ausstaffiert, in der Absicht, später einmal eine größere Wohnung zu beziehen und sich nach und nach neu einzurichten. In den drei Jahren, seit sie für WPCD arbeitete, war es nicht dazu gekommen.
Sie warf ihren Mantel über einen Stuhl, ging ins Bad und zog sich Pyjama und Morgenrock an. Die Wohnung war angenehm warm, doch sie fröstelte, als sei sie krank. Ihr wurde bewußt, daß sie es vermied, in den Spiegel über ihrem Frisiertisch zu schauen. Schließlich drehte sie sich um und musterte sich, während sie nach der Reinigungscreme griff.
Ihr Gesicht war kalkweiß, die Augen stierten ihr entgegen. Ihre Hand zitterte, als sie sich das Haar löste, so daß es ihr um den Nacken fiel. Fassungslos und wie erstarrt versuchte sie, Unterschiede zwischen sich und der Toten herauszufinden. Sie wußte noch, daß das Gesicht des Opfers etwas voller gewesen war, die Form der Augen eher rund als oval, das Kinn kleiner. Aber der Hautton und die Haarfarbe und die offenen – nunmehr blicklosen – Augen waren fast genauso wie bei ihr.
Sie wußte, wo das Opfer jetzt war: im Leichenschauhaus der Gerichtsmedizin, für Fotos und Fingerabdrücke. Und man würde die Zähne registrieren.
Und dann die Obduktion.
Meghan merkte, daß sie zitterte. Sie eilte zu der Kochnische, öffnete den Kühlschrank und holte die Milchtüte heraus. Heißer Kakao. Vielleicht würde das helfen.
Sie hockte sich auf die Couch und schlang die Arme um die Knie, die dampfende Tasse vor sich. Das Telefon klingelte. Es war vermutlich ihre Mutter, weshalb sie hoffte, ihre Stimme wirke gefaßt, als sie den Hörer abnahm.
»Meg, hoffentlich hast du noch nicht geschlafen.«
»Nein, bin grad’ nach Haus gekommen. Wie geht’s denn, Mom?«
»Ach, es geht schon. Die Versicherungsleute haben sich heute gemeldet. Sie kommen morgen nachmittag wieder vorbei. Ich hoffe bei Gott, daß sie nicht wieder wegen dem Kredit zu fragen anfangen, den Dad auf seine Policen aufgenommen hat. Die scheinen einfach nicht zu kapieren, daß ich keine Ahnung hab’, was er mit dem Geld gemacht hat.«
Ende Januar war Meghans Vater auf der Heimfahrt nach Connecticut vom Flughafen Newark aus unterwegs gewesen. Es hatte den ganzen Tag geschneit und gehagelt. Um zwanzig nach sieben rief Edwin Collins vom Wagen aus einen Arbeitskollegen an, Victor Orsini, um einen Termin für den nächsten Morgen zu vereinbaren. Er teilte Orsini mit, er sei auf der Zufahrt zur Tappan Zee Bridge.
Möglicherweise nur wenige Sekunden später geriet auf der Brücke ein Tanklaster außer Kontrolle und krachte in einen Sattelschlepper, wodurch es zu einer Folge von Explosionen und einem Feuerball kam, der sieben oder acht Kraftfahrzeuge erfaßte. Der Sattelschlepper schleuderte gegen die Leitplanke der Brücke und riß ein gähnendes Loch hinein, bevor er in das strudelnde, eisige Wasser des Hudson stürzte. Der Tankwagen folgte nach und riß die übrigen, in lauter Teile auseinanderfliegenden Fahrzeuge mit sich.
Ein schwerverletzter Augenzeuge, dem es gelungen war, dem Tankwagen auszuweichen, sagte aus, eine dunkelblaue Limousine sei vor ihm zur Seite gewirbelt und durch den zerborstenen Stahl verschwunden. Edwin Collins hatte einen dunkelblauen Cadillac gefahren.
Es war die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Brücke. Acht Menschenleben waren zu beklagen. Megs sechzigj ähriger Vater kam an jenem Abend nicht nach Hause. Man ging davon aus, daß er in der Explosion umgekommen war. Die New Yorker Verkehrsbehörden suchten noch immer nach Wrackteilen und menschlichen Überresten, doch bis jetzt, fast neun Monate später, war noch immer keine Spur von ihm oder seinem Wagen gesichtet worden.
Man hatte eine Gedenkmesse eine Woche nach dem Unglück abgehalten, doch da kein Totenschein ausgestellt worden war, lag eine Sperre auf dem gesamten gemeinsamen Vermögen von Edwin und Catherine Collins, und seine hohen Lebensversicherungen waren nicht ausgezahlt worden.
Schlimm genug für Mom, dieser schreckliche Kummer, auch ohne den Ärger, den ihr diese Leute machen, dachte Meg. »Ich komm’ morgen nachmittag raus, Mom. Wenn sie sich weiter so anstellen, müssen wir sie vielleicht verklagen.«
Sie überlegte kurz, entschied dann aber, daß ihre Mutter jetzt am allerwenigsten die Nachricht vertragen konnte, daß eine Frau, die Meghan zum Verwechseln ähnlich sah, erstochen worden war. Statt dessen erzählte Meg von dem Gerichtsverfahren, über das sie an diesem Tag berichtet hatte.
Lange Zeit lag Meghan unruhig im Bett und döste vor sich hin. Endlich schlief sie richtig ein.
Ein hoher Quietschton rüttelte sie wach. Das Faxgerät fing an zu jammern. Sie schaute auf die Uhr: Es war Viertel nach vier. Was in aller Welt ...? dachte sie. Sie knipste das Licht an, zog sich auf einen Ellbogen hoch und beobachtete, wie das Papier langsam aus der Maschine glitt. Sie sprang aus dem Bett, rannte durch den Raum und griff nach der Botschaft.
Sie lautete: VERSEHEN. ANNIE WAR EIN VERSEHEN.
3
Tom Weicker, der zweiundfünfzigjährige Nachrichtenchef von PCD Channel 3, hatte sich Meghan Collins immer häufiger von der Hörfunk-Abteilung ausgeliehen. Er war dabei, einen weiteren Reporter für das Live-Nachrichtenteam nach sorgfältiger Überlegung auszuwählen, und hatte die Kandidaten abwechselnd ausprobiert, aber nun stand seine Entscheidung fest: Meghan Collins.
Er war zu dem Schluß gekommen, daß sie sich gut präsentierte, von einem Moment auf den anderen improvisieren konnte und selbst einer weniger wichtigen Nachricht stets ein Gefühl von Unmittelbarkeit und Dringlichkeit verlieh. Ihre juristische Ausbildung war ein echtes Plus bei Gerichtsverfahren. Sie sah verdammt gut aus und strahlte natürliche Wärme aus. Sie mochte Menschen und konnte mit ihnen umgehen.
Am Freitag morgen ließ Weicker Meghan zu sich kommen. Als sie an die offene Tür zu seinem Büro klopfte, winkte er sie herein. Meghan trug eine hervorragend sitzende Jacke in Tönen von Blaßblau und Rostbraun. Ein Rock aus der gleichen feinen Wolle reichte bis zu ihren Stiefeln hinunter. Klasse, dachte Weicker, genau richtig für den Job.
Meghan betrachtete Weickers Miene und versuchte, seine Gedanken zu erraten. Er hatte ein schmales, scharf geschnittenes Gesicht und trug eine randlose Brille. Dies und sein schon schütteres Haar ließen ihn älter erscheinen, als er tatsächlich war, und eher wie einen Bankkassierer denn wie ein Medienenergieb ündel. Dieser Eindruck war jedoch schnell verflogen, sobald er zu sprechen anfing. Meghan mochte Tom, wußte aber, daß er seinen Spitznamen »Tödlicher Weicker« nicht umsonst erhalten hatte. Als er begann, sie vom Rundfunksender auszuleihen, hatte er deutlich gemacht, es sei zwar eine schlimme, scheußliche Sache, daß ihr Vater sein Leben in dem Brückenunglück verloren habe, aber er brauche ihre Zusicherung, daß dies ihre Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen werde. Es hatte sie nicht beeinträchtigt, und nun vernahm Meghan, wie ihr die Stelle angeboten wurde, die sie sich so sehr wünschte.
Als unwillkürliche Reaktion durchfuhr sie sofort der Gedanke: Ich kann’s nicht abwarten, das Dad zu erzählen!
Dreißig Stockwerke weiter unten, in der Tiefgarage des PCD-Geb äudes, durchsuchte Bernie Heffernan, der Garagenwächter, in Tom Weickers Wagen das Handschuhfach. Dank einer genetischen Ironie waren Bernies Gesichtszüge dazu angetan, ihm den Ausdruck eines unbeschwerten Gemüts zu verleihen. Seine Wangen waren voll, sein Kinn und Mund klein, seine Augen groß und arglos, seine Haare voll und wuschelig, sein Körperbau war kräftig, wenn auch etwas rundlich. Mit seinen fünfunddreißig Jahren vermittelte er einem Beobachter den Eindruck, er sei ein Mensch, der einem einen platten Reifen wechseln würde, obwohl er gerade seinen besten Anzug anhatte.
Er wohnte noch bei seiner Mutter in dem schäbigen Haus in Jackson Heights, Queens, wo er geboren worden war. Von dort weg gewesen war er nur zu jenen düsteren, alptraumhaften Zeiten seiner Inhaftierung. Am Tag nach seinem zwölften Geburtstag wurde er zum ersten von einem Dutzend Malen in eine Besserungsanstalt für Jugendliche eingewiesen. Mit Anfang Zwanzig hatte er drei Jahre in einer psychiatrischen Anstalt verbracht. Vier Jahre lag es zurück, daß er zu zehn Monaten auf Riker’s Island verurteilt worden war. Das war, nachdem die Polizei ihn dabei erwischt hatte, wie er sich im Wagen einer Studentin versteckt hielt. Man hatte ihn wieder und wieder verwarnt, er solle sich von ihr fernhalten. Komisch, dachte Bernie – er konnte sich jetzt nicht einmal mehr daran erinnern, wie sie aussah. Nicht an sie, und auch nicht an all die anderen. Und sie waren ihm alle einmal so wichtig gewesen.
Bernie wollte nie mehr ins Gefängnis. Die anderen Häftlinge machten ihm angst. Zweimal hatten sie ihn zusammengeschlagen. Er hatte seiner Mama geschworen, er würde sich nie mehr im Gebüsch verstecken und in Fenster hineinschauen oder einer Frau folgen und sie zu küssen versuchen. Er schaffte es auch schon sehr gut, sein Temperament zu zügeln. Den Psychiater hatte er nicht ausstehen können, der Mama ständig warnte, eines Tages werde dieses tückische Temperament Bernie noch in Schwierigkeiten bringen, die keiner mehr gutmachen konnte. Bernie wußte, daß sich niemand mehr um ihn Sorgen machen mußte.
Sein Vater war abgehauen, als er noch ein Baby war. Seine verbitterte Mutter verließ das Haus nicht mehr, und Bernie mußte daheim ihr endloses Wiederaufwärmen all der Ungerechtigkeiten ertragen, die ihr das Leben während ihrer dreiundsiebzig Jahre zugefügt habe, und was er ihr doch alles schuldig sei.
Nun ja, was immer er ihr »schuldete«, Bernie gelang es jedenfalls, den größten Teil seines Geldes in elektronischer Ausrüstung anzulegen. Er hatte ein Radio, das den Polizeifunk einfing, ein anderes Spezialradio, das Programme aus der ganzen Welt empfangen konnte, einen Apparat, der die Stimme veränderte.
Abends sah er pflichtschuldig zusammen mit seiner Mutter fern. Nachdem sie jedoch um zehn Uhr zu Bett gegangen war, schaltete Bernie den Fernseher ab, eilte in den Keller hinunter, machte die Radioapparate an und begann, die Moderatoren von Talk-Shows anzurufen. Zu diesem Zweck dachte er sich Namen und Lebensgeschichten aus. So rief er etwa einen rechtslastigen Showmaster an und beschwor liberale Werte, dann einen liberalen Moderator und erging sich in Lobeshymnen über die extreme Rechte. In seiner Anruf-Persönlichkeit liebte er Auseinandersetzungen, Konfrontationen, den Austausch von Beleidigungen.
Ohne das Wissen seiner Mutter hatte er auch einen Fernsehapparat mit einem Ein-Meter-Bildschirm und einen Videorecorder im Keller und sah sich oft Filme an, die er aus Porno-L äden mit nach Hause gebracht hatte.
Der Polizeiempfänger regte zu weiteren Einfällen an. Er begann, Telefonbücher durchzugehen und Nummern zu umkringeln, die bei weiblichen Namen angegeben waren. Mitten in der Nacht wählte er dann eine jener Nummern und erklärte, er rufe von einem Funktelefon direkt beim Haus der Frau an und werde jetzt einbrechen. Dann flüsterte er, vielleicht komme er nur eben auf einen Sprung herein, oder vielleicht bringe er sie um. Anschließend pflegte Bernie grinsend dazusitzen und im Polizeifunk mitzuhören, wie ein Streifenwagen eilends zu der Adresse geschickt wurde. Es war fast so gut, wie an Fenstern zu spionieren oder Frauen zu verfolgen, und er brauchte sich nie Sorgen zu machen, daß sich plötzlich die Scheinwerfer eines Polizeiwagens auf ihn richten würden oder ein Bulle mit einer Flüstertüte brüllen würde: »Keine Bewegung!«
Der Wagen, der Tom Weicker gehörte, war eine wahre Goldgrube an Informationen für Bernie. Weicker hatte ein elektronisches Adressenverzeichnis in seinem Handschuhfach. Darin hatte er die Namen, Adressen und Nummern der wichtigsten Mitarbeiter des Senders gespeichert. Die großen Tiere, dachte Bernie, als er die Telefonnummern auf sein eigenes elektronisches Register übertrug. Er hatte sogar Weickers Frau eines Abends zu Hause erreicht. Sie hatte zu kreischen angefangen, als er ihr erzählte, er sei am Hintereingang und im Begriff, hereinzukommen.
Bei der Erinnerung an ihr Entsetzen hatte er noch stundenlang danach gekichert.
Was ihm aber inzwischen zu schaffen machte, war die Tatsache, daß er zum ersten Mal seit seiner Entlassung aus Riker’s Island das bedrückende Gefühl hatte, nicht in der Lage zu sein, sich jemanden aus dem Kopf zu schlagen. Dieser Jemand war eine Reporterin. Sie war so hübsch, daß er beim Aufhalten der Wagentür dagegen ankämpfen mußte, sie anzufassen.
Ihr Name war Meghan Collins.
4
Irgendwie brachte es Meghan fertig, Weickers Angebot gelassen zu akzeptieren. Die Kollegen witzelten darüber, wenn man sich zu sehr »Ach, wie toll«-erfreut über eine Beförderung zeige, würde Tom Weicker noch ins Grübeln geraten, ob er die richtige Wahl getroffen habe. Er wollte ehrgeizige Leute, die nicht zu bremsen waren und die fanden, jede Anerkennung, die man ihnen zollte, sei längst überfällig.
Bemüht, möglichst sachlich zu wirken, zeigte sie ihm die Fax-Botschaft. Während er sie las, hob er die Augenbrauen. »Was soll das heißen?« fragte er. »Was ist das für ein ›Versehen ‹? Wer ist Annie?«
»Ich weiß nicht. Tom, ich war im Roosevelt Hospital, als das Opfer des Messerstechers gestern nacht eingeliefert wurde. Ist sie inzwischen identifiziert worden?«
»Noch nicht. Was ist mit ihr?«
»Ich glaube, Sie sollten etwas wissen«, sagte Meghan widerstrebend. »Sie sieht aus wie ich.«
»Sie sieht Ihnen ähnlich?«
»Sie könnte fast meine Doppelgängerin sein.«
Toms Augen zogen sich zusammen. »Wollen Sie damit sagen, daß dieses Fax etwas mit dem Tod dieser Frau zu tun hat?«
»Es ist wahrscheinlich bloß ein Zufall, aber ich dachte, ich sollte Sie’s wenigstens sehen lassen.«
»Das ist auch gut so. Lassen Sie’s mir da. Ich finde heraus, wer in diesem Fall die Ermittlungen leitet, und lasse ihn einen Blick drauf werfen.«
Für Meghan war es eine ausgesprochene Erleichterung, die Daten für ihre nächsten Berichte in der Nachrichtenredaktion abzuholen.
Es war ein relativ zahmer Tag. Eine Pressekonferenz im Amt des Bürgermeisters, wo er seine Entscheidung für den neuen Polizeichef bekanntgab, ein verdächtiges Feuer, das ein Mietshaus im Stadtteil Washington Heights in Schutt und Asche gelegt hatte. Am Spätnachmittag sprach Meghan mit dem Büro des Gerichtsmediziners. Eine Zeichnung und eine Beschreibung der toten jungen Frau waren von der Vermißtenstelle ausgegeben worden. Ihre Fingerabdrücke waren nach Washington unterwegs zum Vergleich mit den Akten der Regierung und des Bundeskriminalamts. Sie war an einer einzigen tiefen Stichwunde in der Brust gestorben. Die inneren Blutungen waren langsam, aber massiv gewesen. Arme wie Beine hatten einige Jahre früher Brüche erlitten. Falls innerhalb von dreißig Tagen niemand Anspruch darauf erhob, würde man ihre Leiche auf dem Armenfriedhof in einem numerierten Grab beisetzen. Eine weitere »Jane Doe« – ein anonymes Opfer aus den Polizeiakten.
Um sechs Uhr abends machte Meghan gerade Schluß mit der Arbeit. Wie stets seit dem Verschwinden ihres Vaters wollte sie das Wochenende bei ihrer Mutter verbringen. Für Sonntag nachmittag war ihr ein Bericht über eine Veranstaltung in der Manning Clinic zugeteilt worden, einem Institut für künstliche Fortpflanzung, das vierzig Minuten von ihrem Zuhause in Newtown entfernt lag. Die Klinik hielt ihr jährliches Treffen der Kinder ab, die aus den künstlichen Befruchtungen, die man dort ausführte, hervorgegangen waren.
Der für die Zuteilung zuständige Redakteur fing sie am Fahrstuhl ab. »Steve ist Ihr Kameramann am Sonntag bei der Manning Clinic. Ich hab’ ihm gesagt, er soll Sie dort um drei treffen.«
»Okay.«
Die Woche über benützte Meghan einen Wagen des Senders. Heute morgen war sie mit ihrem eigenen Auto gekommen. Der Lift kam ruckend auf Höhe der Tiefgarage zum Stillstand. Sie lächelte, als Bernie sie entdeckte und sich sofort im Dauerlauf zur unteren Parkebene in Bewegung setzte. Er fuhr mit ihrem weißen Mustang vor und hielt ihr die Fahrertür auf. »Gibt’s was Neues von Ihrem Dad?« fragte er teilnahmsvoll.
»Nein, aber danke für die Frage.«
Er beugte sich vor, so daß sein Gesicht ihrem ganz nahe kam. »Meine Mutter und ich beten für ihn.«
Was für ein netter Kerl! dachte Meghan, während sie den Wagen die Rampe hinauf zur Ausfahrt steuerte.
5
Catherines Haar sah stets so aus, als wäre sie gerade mit der Hand durchgefahren. Es war ein kurzer, lockiger Schopf, jetzt aschblond getönt, der den frischen Reiz ihres herzförmigen Gesichts noch hervorhob. Gelegentlich bemerkte Catherine Meghan gegenüber, wie gut es sei, daß sie das energische Kinn ihres Vaters geerbt habe. Ansonsten sähe sie jetzt mit ihren dreiundfünfzig Jahren wie ein dahinwelkendes Engelsp üppchen aus, ein Eindruck, der durch ihre Körpergröße noch verstärkt würde. Kaum einen Meter fünfzig groß, nannte sie sich selbst den Hauszwerg.
Meghans Großvater Patrick Kelly war mit neunzehn Jahren aus Irland in die Vereinigten Staaten gekommen, »mit den Kleidern auf meinem Buckel und einmal Unterwäsche extra unter meinem Arm aufgerollt«, wie es in seiner Geschichte hieß. Nachdem er tagsüber in der Küche eines Hotels an der Fifth Avenue als Tellerwäscher und nachts mit der Putzkolonne eines Bestattungsunternehmens gearbeitet hatte, war er zu dem Schluß gekommen, es gebe zwar eine Menge Dinge, worauf die Leute verzichten könnten, doch niemand könne das Essen oder das Sterben aufgeben. Da es erfreulicher war, die Leute beim Essen als im Sarg mit darübergestreuten Nelken vor sich zu sehen, entschied sich Patrick Kelly, all seine Energien im Gaststättengewerbe einzusetzen.
Fünfundzwanzig Jahre später baute er in Newtown, Connecticut, den Gasthof seiner Träume und taufte ihn Drumdoe nach dem Dorf seiner Geburt. Er hatte zehn Gästezimmer und ein hervorragendes Restaurant, das die Menschen aus einem Umkreis von achtzig Kilometern anlockte. Pat vollendete den Traum mit der Renovierung eines bezaubernden Farmhauses auf dem Nachbargrundstück als Familiensitz. Dann erwählte er sich eine Braut, zeugte Catherine und führte seine Gaststätte bis zu seinem Tod im Alter von achtundachtzig Jahren.
Seine Tochter und seine Enkelin waren buchstäblich in dem Gasthaus großgezogen worden. Catherine führte es jetzt mit der gleichen Hingabe, die Patrick ihr eingeflößt hatte, und ihre Arbeit dort half ihr, mit dem Tod ihres Mannes besser fertig zu werden.
In den neun Monaten jedoch seit der Tragödie auf der Brücke war es ihr unmöglich gewesen, nicht daran zu glauben, daß eines Tages die Tür aufgehen und Ed fröhlich rufen würde: »Wo sind denn meine Mädchen?« Gelegentlich ertappte sie sich noch immer dabei, wie sie horchte, ob nicht die Stimme ihres Mannes erklang.
Zusätzlich zu all dem Schrecken und Kummer war jetzt auch ihre finanzielle Situation zu einem akuten Problem geworden. Zwei Jahre zuvor hatte Catherine das Gasthaus für sechs Monate geschlossen, darauf eine Hypothek aufgenommen und eine grundlegende Renovierung und Neugestaltung durchgeführt.
Der Zeitpunkt dafür hätte sich nicht als ungünstiger erweisen können. Die Wiedereröffnung fiel mit der allgemeinen Rezession zusammen. Die Hypothekenzahlungen waren vom gegenwärtigen Gewinn nicht abgedeckt, und die vierteljährlichen Steuern waren bald fällig. Auf ihrem Privatkonto waren nur noch ein paar tausend Dollar.
Noch Wochen nach dem Unglück hatte Catherine sich für den Anruf gewappnet, der ihr mitteilen würde, die Leiche ihres Mannes sei aus dem Fluß geborgen worden. Jetzt betete sie darum, der Anruf möge kommen und die Unsicherheit beenden.
Es war ein so überwältigendes Gefühl von Unvollständigkeit. Catherine mußte oft daran denken, daß Menschen ohne Verständnis für Leichenbegängnisse nicht begriffen, daß diese Rituale für das Gemüt nötig waren. Sie wollte in der Lage sein, Eds Grab zu besuchen. Pat, ihr Vater, hatte des öfteren von einer »anständigen christlichen Beerdigung« gesprochen. Sie und Meg machten gern ihre Witze darüber. Wenn Pat den Namen eines Freundes von früher in den Todesanzeigen entdeckte, dann frotzelte sie oder Meg: »Du liebe Güte, er hat doch hoffentlich eine anständige christliche Beerdigung gekriegt.«
Sie machten keine Witze mehr darüber.
Am Freitag nachmittag war Catherine im Haus und machte sich fertig, um für die Abendessenszeit zur Gaststätte hin überzugehen. TGIF, wie es heißt, Thank God it’s Friday, das kann man wohl sagen, dachte sie – wie gut, daß es Freitag ist. Freitag hieß, daß Meg bald zum Wochenende daheim sein würde.
Die Leute von der Versicherung mußten jeden Moment kommen. Wenn sie mir wenigstens eine Teilzahlung geben, bis die Taucher von der Behörde Wrackteile des Wagens finden, überlegte Catherine, als sie sich eine Schmucknadel an das Revers ihrer Jacke mit dem Hundezahnmuster steckte. Ich brauche das Geld. Sie versuchen bloß, sich aus der Verdoppelung der Entschädigungssumme bei Tod durch Unfall herauszuwinden, aber ich bin bereit, darauf zu verzichten, bis sie den Beweis haben, von dem sie ständig reden.
Doch als die zwei ernst blickenden Versicherungsangestellten eintrafen, war es nicht, um die Zahlung in Gang zu setzen. »Mrs. Collins«, erklärte der ältere der beiden, »ich hoffe, Sie verstehen unsere Position. Wir haben Verständnis für Sie und sind uns im klaren über die mißliche Lage, in der Sie sich befinden. Das Problem ist, daß wir die Auszahlung auf die Police Ihres Mannes nicht ohne einen Totenschein bewilligen können, und der wird offenbar nicht ausgestellt.«
Catherine starrte ihn an. »Sie meinen, er wird nicht ausgestellt, solange kein absoluter Beweis für seinen Tod vorliegt? Aber was ist, wenn seine Leiche flußabwärts bis in den Atlantik getragen worden ist?«
Die Männer sahen beide verlegen aus. Der jüngere antwortete ihr. »Mrs. Collins, die New Yorker Verkehrsbehörde, in ihrer Eigenschaft als Eignerin und Betreiberin der Tappan Zee Bridge, hat in einem umfassenden Einsatz alles darangesetzt, sowohl die Opfer wie die Wrackteile aus dem Fluß zu bergen. Zugegeben, die Explosionen haben dazu geführt, daß die Fahrzeuge zerfetzt wurden. Trotzdem lösen sich schwere Teile wie Getriebe und Motoren nicht einfach auf. Außer dem Sattelschlepper und dem Tanklaster sind sechs Fahrzeuge über die Seitenplanke gegangen, oder sieben, wenn wir den Wagen Ihres Mannes mitrechnen würden. Von allen anderen sind Teile aufgefunden worden. All die anderen Leichen sind ebenfalls geborgen worden. Da ist nicht einmal ein Rad oder Reifen, eine Tür oder ein Motorenteil eines Cadillac im Flußbett unter der Unglücksstelle.«
»Sie wollen also sagen ...« Es fiel Catherine schwer, die Worte zu formulieren.
»Wir wollen damit sagen, daß der umfassende Bericht über das Unglück, den die Behörde demnächst zur Veröffentlichung freigibt, kategorisch feststellt, daß Edwin Collins bei dem Brückenunglück an jenem Abend nicht zu Tode gekommen sein kann. Die Experten meinen, er mag zwar durchaus in der Nähe der Brücke gewesen sein, aber keiner glaubt, daß Edwin Collins eins der Opfer war. Wir glauben, daß er entkam, als die anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden, und dieses günstige Zusammentreffen dazu ausnutzte, um sein schon geplantes Verschwinden in die Tat umzusetzen. Wir denken, daß er der Meinung war, er könnte Sie und Ihre Tochter mit der Versicherung versorgen und sich dann dem neuen Leben zuwenden, das er auf die eine oder andere Weise bereits ins Auge gefaßt hatte.«
6
Mac, wie Dr. Jeremy MacIntyre von seinen Freunden genannt wurde, wohnte mit seinem siebenjährigen Sohn Kyle ganz in der Nähe der Familie Collins.
Während seiner College-Jahre an der Yale University hatte Mac den Sommer über als Kellner im Drumdoe Inn gearbeitet. Während jener Sommermonate hatte er eine dauerhafte Vorliebe für die Gegend entwickelt und beschlossen, sich dort eines Tages niederzulassen.
Als er heranwuchs, hatte Mac die Beobachtung gemacht, daß er der Typ in der Menge war, den die Mädchen nicht beachteten. Durchschnittliche Größe, durchschnittliches Gewicht, durchschnittliches Aussehen. Es war eine einigerma ßen zutreffende Beschreibung, doch in Wirklichkeit wurde Mac sich selbst nicht gerecht. Beim zweiten Hinschauen fanden Frauen sehr wohl etwas Herausforderndes an dem spöttischen Ausdruck seiner braunen Augen, eine attraktive Jungenhaftigkeit an dem sandfarbenen Haar, das immer vom Wind zerzaust schien, eine wohltuende Verläßlichkeit in der souveränen Haltung, mit der er sie auf die Tanzfläche führte oder sie an einem frostigen Abend mit der Hand am Ellenbogen nahm.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!