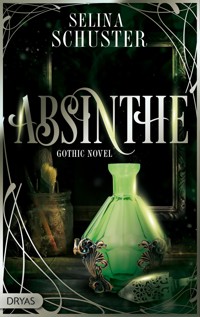Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ian Ashtons Großvater, Lord Ashton, liegt im Sterben. Seit dem Tod seiner Eltern ist Ian ihm sehr verbunden und wacht daher an seinem Sterbebett. Im Fieberwahn spricht Lord Ashton immer wieder von Ians vor Jahren im Moor verschollenen Schwester Celice. Zudem nimmt er Ian das Versprechen ab, das Gemälde im Treppenaufgang von Ashton Manor nie aus den Augen zu lassen. Keine leichte Aufgabe für Ian, der das Bild seit Jahren meidet, denn die Augen des jungen Mannes im Gemälde scheinen ihn zu verfolgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selina Schuster
Das Gemäldevon Ashton Manor
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Epilog
Inhaltshinweise
Verschwundenes Kind, Tod naher Verwandter, manipulative Beziehung
Prolog
Ashton Manor, Romney Marsh. November 1878
»Komm raus, komm raus, wo immer du bist!«
Die hohe Stimme des Jungen kam kaum gegen das Rauschen des Windes im Schilfrohr an. Langsam begann er zu frieren. Seine Füße waren bereits klamm und kalt. Sie steckten in viel zu großen Wellingtons, die ihm bis über die Knie gingen. Ebenso war der Regenmantel, den sein Großvater ihm geschenkt hatte, noch ein wenig zu lang, sodass er zwar den allgegenwärtigen Nieselregen abhielt, ihn jedoch in seiner Bewegungsfreiheit erheblich einschränkte. Die Ärmel des Mantels waren bereits mehrfach umgekrempelt, trotzdem lugten lediglich seine Fingerspitzen unter den Aufschlägen hervor.
Suchend blickte der Junge sich um, doch er sah nichts weiter als öde Marschlandschaft, über der sich ein grauer, wolkenverhangener Himmel auftürmte. Hier und dort blieb seine Aufmerksamkeit an einem vertrockneten Schilfhalm hängen, der sich im auffrischenden Wind bog, ansonsten konnte er jedoch keinerlei Bewegung ausmachen.
Mist.
Er mochte es nicht, mit ihr Verstecken zu spielen.
Es war nicht gerecht.
Sie hatte den Vorteil, so fürchterlich klein zu sein, dass sie sich problemlos hinter jedem noch so fadenscheinigen Gestrüpp verstecken konnte und man sie schlichtweg übersah. Selbst das weiße Wollkleidchen, welches gut sichtbar unter ihrer Jacke hervorblitzte, half ihm nicht bei seiner Suche. Wieder und wieder sah er sich nach dem weißen Farbtupfer um, doch überall war alles nur braun und grau.
»Celice, wo steckst du?«, rief er erneut, diesmal lauter und ein wenig genervter als zuvor und formte seine Hände vor seinem Mund zu einem improvisierten Trichter.
Erneut nichts weiter als Rauschen.
Enttäuscht ließ er die Arme sinken und wusste einen Augenblick lang nicht, was tun.
Er hatte keine Lust mehr auf dieses dumme Spiel. Ihm war kalt und sein Magen meldete sich knurrend zu Wort.
Die Lippen geschürzt, stemmte er trotzig die Hände in die Hüften und stapfte lustlos mit den Stiefeln im Matsch herum.
»Das macht keinen Spaß, wenn du dich so gut versteckst!«
Missmutig sprang er mit den schlackernden Stiefeln in eine große Pfütze und blieb beinah im Morast hängen.
»Ian, du gibst dir gar keine Mühe!«
Sein Kopf schnellte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Hoch und dünn war sie zu ihm herübergeweht worden und sie hatte sich dabei von ihm entfernt.
Ein feines Grinsen zerrte an seinen Mundwinkeln.
Sein Blick glitt über die braunen Grasbüschel und ölig erscheinenden, kleinen Tümpel der Marsch. Er konnte ein leises, rhythmisches Platschen hören.
Sie lief wieder zurück Richtung Haus!
Wasser spritzte an seinen Waden hinauf, lief von oben in die Schäfte seiner Stiefel, dass es seine dicken Wollsocken tränkte, doch es kümmerte ihn nicht.
Das sich hell gegen den grauen Novemberhimmel abhebende Haus kam immer näher. Mit federnden Schritten nahm er je zwei Stufen des Hausaufganges auf einmal und platzte schwer atmend in die Eingangshalle. Der Wind stob durch die Tür und schien ihn weiter ins Innere des Hauses zu drücken.
Hektisch sah er sich um. Sein Blick huschte über den auf Hochglanz polierten Holzboden, das flackernde Feuer im Kamin, mit den so gemütlichen Ohrenbackensesseln davor und den imposanten Treppenaufgang ihm gegenüber.
Wo konnte sie sich versteckt haben? Es gab hunderte Möglichkeiten … Er wollte grade schon resigniert die Schultern sinken lassen, als er sie entdeckte.
Fußspuren.
Ein feines Grinsen schlich sich zurück auf seine Gesichtszüge.
Winzige, nasse Fußspuren, die sich über den perfekt gewienerten Parkettboden der Eingangshalle erstreckten. Sie führten um die Ecke, herüber zum Aufgang der Dienerschaft. So leise und schnell er konnte, streifte er sich den Regenmantel und das verkrustete Schuhwerk ab, warf alles achtlos in die Ecke neben der Tür und schlich auf nassen Strümpfen herüber zur Tür des Dienstbotenaufgangs.
Er konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen.
Sie war nur angelehnt.
Vorsichtig drückte er die Holztür auf und blickte die dunkle Treppenflucht empor. Schief und buckelig waren die Stufen über die Jahre geworden, abgetreten von vielen schnellen Schritten. Er setzte einen Fuß auf die erste Stufe und verlagerte prüfend sein Gewicht nach vorne. Augenblicklich zuckte er zusammen und hielt wie schockgefroren in der Bewegung inne, als das alte Holz ein erbärmliches Ächzen von sich gab.
Verdammt!
Er musste leise sein, sonst würde Celice sofort wissen, dass er ihr auf den Fersen war.
Behutsam setzte er einen Fuß vor den anderen, stets darum bemüht, die Stufen nur an den Seiten zu betreten. Nichtsdestotrotz knarrte die Treppe bei beinah jedem mit noch so viel Bedacht gesetzten Schritt und ein jedes Mal fuhr es ihm wie ein Schrei durch alle Glieder. Er atmete erleichtert aus, da er endlich den rettenden Treppenabsatz erreicht hatte und sich suchend umblickte.
Wo konnte sie sich nur versteckt haben? Unschlüssig drehte er sich einmal um die eigene Achse und ließ seinen Blick vorbeischweifen an einer Flucht aus dunklen, verschlossenen Türen.
Nein, in den Dienstbotenzimmern würde sie sich mit Sicherheit nicht versteckt haben, oder?
Mit eisigen Fingern strich er eine an seiner Stirn klebende Haarsträhne beiseite, ehe er seine Aufmerksamkeit der Treppe am Ende des Ganges zuwandte und zielstrebig darauf zusteuerte. Erneut musste er grinsen, als er die klammen Spuren winziger Füße auf den abgeschabten Holzstufen sah.
Mit entschlossenen Schritten erklomm er die nächste Treppenflucht. Immer den blasser werdenden Fußabdrücken hinterher. Er hörte ein seltsames Geräusch.
Ein Kratzen, oder Schrammen.
Die Stiegen wurden zunehmend schmaler und enger, die Stufen immer wackeliger und schiefer. Ehe der Junge sich versehen konnte, fand er sich vor einer nur noch in einer Angel hängenden Tür auf einem in einer Sackgasse endenden, letzten Treppenabsatz wieder. Der Wind pfiff schneidend durch das nicht mehr vollkommen dichte Bleiglasfenster zu seiner Rechten. Der auffrischende Wind ließ das bunte Glas in den metallenen Einfassungen erzittern und erbärmlich klirren. Unweigerlich fröstelte es ihn.
»Celice?«
Seine Stimme klang belegt. Kleine Finger griffen nach dem Knauf mit der abplatzenden Emaille.
»Celice, ich weiß, dass du hier bist.«
Knarzend drehte sich der Knauf in seiner Hand und mit einem kräftigen Ruck zog er die Tür zu sich. Sie schrammte schwerfällig mit einem durchdringenden Kratzgeräusch über die aufgequollenen Dielenbretter.
Nun wusste er definitiv, dass sie sich hier versteckt hielt. Auch, wenn sie noch nie hier oben gewesen waren, so wussten sie doch beide, welcher Raum sich hinter der verwitterten Tür befand.
Der Dachboden.
Und er wusste auch, dass Großvater es niemals erfahren durfte, dass sie sich hier heraufgeschlichen hatten.
Kein Sterbenswörtchen durften sie ihm davon verraten. Hoffentlich hatte Eduard sie nicht bemerkt. Er würde sie sofort bei Großvater verpetzen. Und auch Celice konnte manchmal ihr Mundwerk nicht halten …
Er musste Celice dringend einschärfen, Stillschweigen zu bewahren – sobald er sie gefunden hatte.
Er hatte die Tür noch nicht zur Gänze geöffnet, da hätte er sie am liebsten gleich wieder lautstark zugeschlagen.
Der muffige Geruch nach alten Möbeln, Moder und abgestandener Nässe schlug ihm wie eine mannshohe Wand entgegen und setzte sich penetrant in seinem Rachen fest. Er schluckte heftig und kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Für einen schrecklich langen Moment sah er hinter dem Türrahmen nichts weiter als Dunkelheit. Unweigerlich wich er einen Schritt zurück, fasste sich dann jedoch ein Herz, als sich seine Augen an das schummrige Licht gewöhnt hatten. Einige erbärmliche, blass-blaue Strahlen kämpften sich ihren Weg durch mit wahllos zusammengestellten Brettern verrammelte Fenster. Die meisten besaßen keine Verglasung mehr, sodass der Wind in unsteten, gnadenlosen Intervallen ins Innere des Dachbodens pfiff. In den dünnen Strahlen tanzten aufgescheuchte Staubfontänen und einige verirrte Blätter auf und nieder.
Mit Ausnahme des an den Brettern zerrenden Windes war kein Geräusch zu vernehmen.
»Celice?«
Noch mehr Staub stob auf als er begann den Dachboden abzusuchen. Angewidert verzog er die Mundwinkel als er mit spitzen Fingern ein schäbiges Stück Stoff hochhob, von dem man noch nicht einmal mehr erahnen konnte, was es einst gewesen sein mochte. Aber er musste sicherstellen, dass sich Celice nicht unter dem darunter befindlichen Tisch versteckt hielt. Das wäre doch ein perfektes Versteck.
Doch seine Hoffnung wurde jäh enttäuscht. Mit matten Bewegungen ließ er das undefinierbare Stück Stoff zurück an seinen Platz sinken, ehe er die Hände erneut in die schmalen Hüften stemmte und seinen Blick über das allgegenwärtige Durcheinander schweifen ließ.
Dort!
Für einen kurzen Moment machte sein Herz einen Hopser, da er den massiven Kleiderschrank unter der Deckenschräge erblickte und mit einem erleichterten »Da bist du!« die schweren Türen aufriss.
Dunkelheit und ein undefinierbarer Gestank gähnten ihm entgegen und mit einem eisigen Schauer schmiss er die Türen so schnell wieder ins Schloss, wie er sie aufgerissen hatte.
Wo konnte sie denn nur sein?
Ein erneuter, hektischer Blick über allerlei Plunder.
So langsam gingen ihm die Ideen aus. Sie musste doch hier oben sein. Es gab keine andere Möglichkeit. Und es passte zu Celice, sich ausgerechnet an einem solchen Ort zu verstecken. Von fern her mischte sich das rhythmische Klappern von Pferdehufen in das allgegenwärtige Tosen des Windes, doch er schenkte der Geräuschkulisse keine größere Beachtung. Mit jeder weiteren verstrichenen Minute auf dem dunklen Dachboden, kroch etwas in ihm hoch, das er zunächst nicht recht beziffern konnte. Doch je länger er so dastand, desto mehr konnte er diesem Gefühl einen Namen geben, welches mit eisigen Fingern an seinem Herzen zerrte.
Angst.
Das wenige Licht, das durch die Ritzen der Bretter kroch, wurde zusehends fahler und schwächer.
»Ich habe keine Lust mehr, Verstecken zu spielen!«
Seine Stimme hallte hoch und schrill von den nackten Wänden wider und ohne es zu wollen, begannen seine Hände seine Oberarme zu umklammern.
Celice antwortete nicht.
»Du hast gewonnen, du kannst rauskommen!«, setzte er eilig und um einiges versöhnlicher klingend nach und tat zaghaft einen Schritt in die Richtung, in der er die Tür vermutete.
»Versprochen ist versprochen: Du darfst eine Woche lang meinen Pudding essen. Komm doch endlich raus. Bitte!«
Das von den Wänden zu ihm zurückgeworfene Echo hatte einen flehenden Tonfall angenommen. Das immer lauter werdende Klappern der Hufe unterhalb der vernagelten Fenster begann ihm Kopfschmerzen zu bereiten.
Ein ruckartiges Rauschen, lauter als jeder Wind es je sein könnte, gefolgt von einem dumpfen Schlag, ließ ihn zusammenzucken und erschrocken die Augen aufreißen.
»Celice!«
Das musste sie sein!
Panisch kletterte er über mit Laken verhangene Möbelstücke, ausrangierte Schrankkoffer und Berge an von Motten zerfressenen Büchern. Er riss einen der aufgetürmten Bücherstapel um, doch es kümmerte ihn nicht weiter.
Er wollte nur endlich Celice finden und mit ihr von diesem gruseligen Ort verschwinden, sich in eine wärmende Decke gehüllt in den weichen Ohrenbackensessel vor dem Kamin kuscheln und heiße Schokolade trinken.
Sein Fuß blieb an einem Beistelltisch hängen und nur mit Müh und Not konnte er den Sturz in eine ausrangierte Stehlampe verhindern. Leise fluchend landete er hart auf den Ellenbogen, rappelte sich aber sofort wieder auf.
Für einen Moment kam es ihm so vor, als habe in diesem Moment jemand seinen Namen geflüstert.
Kaum hörbar. Nicht vielmehr als ein Wispern.
»Celice!«
Seine Stimme schnappte über vor Freude.
Endlich hatte er sie gefunden. Gott sei Dank.
Die Erleichterung hielt jedoch nur wenige Herzschläge lang an. Sein Rann, blindlings in die Richtung des seltsamen Geräusches, hatte ihn in den hintersten Winkel des Dachbodens geführt. Staub stob noch immer von dem zerknittert am Boden liegenden Laken auf, das beim Herunterfallen wohl das Geräusch verursacht haben musste. Langsam folgte sein Blick den aufgewirbelten Staubfontänen, glitt einen goldenen Rahmen empor und blieb letztlich an dem beinah überlebensgroßen Portrait eines jungen Mannes in Reiterkleidung hängen.
Unweigerlich trat er einen Schritt zurück, um es in voller Größe sehen zu können.
Das Bild musste alt sein. Die Ölfarbe begann bereits zu brechen und das Blattgold des Rahmens zerfiel zu Goldstaub.
Doch das war es nicht, was ihm einen Schauer die Wirbelsäule hinaufkriechen ließ.
Es war der Blick des Mannes in dem Gemälde.
Er war eisig und für einen Moment war ihm, als könne dieser gemalte Mann direkt in ihn hineinblicken. Sein Innerstes und all seine Geheimnisse offen vor sich sehen, als bestünde er aus Glas. Es zog etwas in ihm zusammen. Blindlings tastete er hinter sich, während er einige weitere Schritte rückwärts tat, den Blick derweil noch immer starr auf die weiß hervorstechenden Augen des Portraits gerichtet.
Seine Hände begannen zu zittern und er konnte sich nicht einmal erklären, wieso. Erst langsam, ganz langsam, setzte sich die Erkenntnis in seinem Geist fest und es schnürte ihm die Kehle zu.
Er hatte überall nach ihr gesucht.
Celice war nicht auf diesem Dachboden.
Er hatte aufgegeben. Sie hatte keinen Grund mehr, sich zu verstecken.
Celice war nicht hier.
Er blinzelte gegen die aufkommenden Tränen an, doch war es sinnlos. Ohne, dass er es hätte verhindern können, rannen sie ihm in siedend heißen Linien über das kleine Gesicht und ein dunkler Schluchzer brach sich aus seiner Kehle Bahn.
Mit unbeholfenen Bewegungen wischte er sich wieder und wieder mit den viel zu großen Ärmeln über die Augen.
Moment mal …
Stockend ließ er die Arme sinken und starrte durch einen grauen Schleier aus Tränen herauf zu dem Portrait. Er blinzelte erneut. Viel zu schnell und viel zu hektisch. Doch egal, wie oft er auch blinzelte, eine Sache änderte sich nicht.
Der Mann lächelte.
Sein Herz begann so schnell hinter seinem Brustbein zu hämmern, dass es sich a nfühlte, als wollte es seine Rippen durchbrechen.
Wieso lächelte der Mann?
Er hatte eben nicht gelächelt.
Da war er sich sicher. Er konnte es beschwören. Der Mann hatte nicht gelächelt. Lediglich mit ausdrucksloser Miene durch ihn hindurchgestarrt.
»Wieso lächelst du?«, wisperte der Junge mit versagender Stimme, taumelte erneut einen Schritt rückwärts, stolperte über irgendetwas am Boden und fiel auf seine Knie, dass der Stoff seiner Hose riss und er sich an den rauen Dielen blutig schrammte. Doch er beachtete es kaum. Sofort schnellte sein Blick wieder nach oben.
Das Lächeln war definitiv noch da.
Und es machte ihm eine Heidenangst.
Es wirkte fast so, als würde sich das Portrait darüber freuen, dass …
Zitternd schlug er sich die Hände vor den Mund und unterdrückte ein Wimmern. Er kniff die Augen so fest zusammen, bis bunte Punkte hinter seinen Lidern wild umherhüpften.
Das ist nicht echt. Das ist nicht real.
Sieh nicht hin!
Er hörte nur noch entfernt das laute Poltern schwerer Schritte auf den unzähligen windschiefen Treppenstufen.
Die tiefe Stimme seines Großvaters, die immer lauter nach ihm rief.
Verwaschen und unscharf, wie ein Schwarm Glühwürmchen in einer Waschküche, bahnte sich das Licht vieler schwankender Petroleumlaternen seinen Weg in sein Gesichtsfeld. Er bekam die Schimpftirade seines Großvaters nur noch am Rande mit als heftige Schluchzer, die sukzessive in ein gutturales Gurgeln übergingen, seinen ganzen Körper zum Beben brachten. Vertraute Arme legten sich um seine zitternden Schultern und pressten ihn an eine ebenso vertraute Brust.
»Mein Junge.«
Er konnte die heisere Stimme seines Großvaters ganz nah an seinem Ohr hören und spürte, wie eine Hand seinen Kopf fest an seine Schulter drückte.
Dieser kleine Junge, der weinend in den Armen seines Großvaters lag, wusste noch nicht, dass er seine Schwester nie wiedersehen würde.
Dieser kleine Junge war ich.
Und bis heute verfolgen mich die Worte, von denen ich mir einbilde, dass mein Großvater sie wieder und wieder flüsterte. An diesem unglückseligen Tag auf dem Dachboden. Während er mich immer enger an sich presste:
»Was habt ihr nur getan?«
Kapitel 1
Ashton Manor, Romney Marsh. September 1888
»Es steht nicht gut um Ihren Großvater.«
Die dünnen Finger Dr. Trellawnys schieben seinen Kneifer ein Stück weiter den schmalen Nasenrücken hinauf. Seine grauen Augen wirken hinter den Gläsern ungemein klein und wässrig.
Ich nicke kurz und versuche das bellende Husten auf der anderen Seite der Schlafzimmertür zu ignorieren. Wohlwissend, dass ich das nicht kann.
»Die notwendige Medizin werde ich Ihnen hierlassen. Sorgen Sie bitte dafür, dass er absolute Bettruhe einhält und die Dosierung beachtet wird.«
Wieder nicke ich nur und nehme das mir entgegengehaltene dunkelbraune Fläschchen in Empfang. Etwas zieht sich in mir zusammen, als ich bei einem schnellen Überfliegen des Etiketts das Wort Morphium entziffere.
»Es ist überaus bedauerlich, dass Ihr Großvater den Kuraufenthalt in Baden-Baden ablehnt«, fährt Dr. Trellawny fort, wohl als Reaktion auf meine skeptisch zusammengezogenen Augenbrauen beim Lesen der Beschriftung. Schnell reiße ich mich von den Zeilen los und lasse die Flasche in meiner Hand sinken.
»Ich habe mit Engelszungen auf ihn eingeredet, aber ich konnte ihn leider nicht überzeugen.« Ich seufze leise. »Er sagt, er will in keinem fremden Land in einem Sanatorium sterben.«
Dr. Trellawny sieht mich durchdringend an und räuspert sich. »Das ist zwar durchaus verständlich, aber dennoch bedauerlich. Ich fürchte, ohne einen solchen Sanatoriumsaufenthalt, gibt es nicht mehr viel, das ich für ihn tun kann. Außer …«
Ich nicke verständnisvoll mit dem Kopf und schiele erneut auf das braune Fläschchen in meiner Hand.
»Eduard wird Sie zur Tür geleiten«, murmele ich und deute mit einem abgehackten Rucken meines Kopfes auf den Butler des Hauses Ashton, der wie eh und je, einem Gespenst gleich, an genau der Stelle erscheint, an der man ihn am meisten braucht. Wortlos und mit dem ihm eigenen, nichtssagenden Lächeln auf den schmalen Lippen, hat Eduard Hut und Mantel des Arztes fein säuberlich über seinen linken Arm drapiert und hält ihm in stummer Aufforderung seinen Gehstock entgegen.
»Danke.« Dr. Trellawny nickt knapp und greift sich zum Abschied mit zwei Fingern an die Krempe der frisch aufgesetzten Melone.
»Dann bis in zwei Tagen.«
Er wendet sich bereits zum Gehen, als er jedoch noch einmal innehält und sich auf dem Absatz umdreht.
»Ach, und eins noch: Ihr Großvater darf sich unter keinen Umständen aufregen.« Er räuspert sich. »Das Morphium kann zu Halluzinationen und geistiger Umnachtung führen, gerade zu Beginn der Behandlung. Wenn Ihr Großvater also meint, er sieht die kuriosesten Dinge in seinem Schlafzimmer erscheinen, dann ist dem so. Unterlassen Sie es bitte, ihm dies auszureden. Er würde es Ihnen sowieso nicht glauben.«
»Natürlich, Doktor.« Ich nicke eilig.
Dr. Trellawny wirft mir einen letzten prüfenden Blick über die Schulter zu und ruckt mit dem Kinn.
Meine Finger fühlen sich gleichsam taub und kribbelig an, so fest habe ich sie um die kleine Flasche verkrampft.
Ich seufze leise und wende mich der Schlafzimmertür zu. Das Husten auf der anderen Seite der Tür klingt fürchterlich gepresst und seltsam metallisch. Blechern.
Entschlossen drehe ich den Türknauf.
»Dr. Trellawny hat Medizin für dich dagelassen, Großvater«, höre ich meine Stimme sagen und versuche meine Mundwinkel zu einem aufmunternden Lächeln zu verziehen. Mir ist klar, dass es mir gründlich misslingt, selbst ohne die skeptisch zusammengezogenen Augenbrauen meines Großvaters.
»So, so. Hat er das, der alte Quacksalber?«
Seine Stimme ist vom vielen Husten schrecklich heiser. Es tut beim Zuhören weh. Schweigend ziehe ich die Tür hinter mir ins Schloss. Das Zimmer ist abgedunkelt, die schweren Brokatvorhänge sperren die Sonne beinahe zur Gänze aus. Lediglich die schwach flackernde Flamme der Nachttischlampe spendet ein wenig Licht. Lange Schatten tanzen unstet über die Wände.
Mit drei schnellen Schritten durchmesse ich den Raum zwischen Tür und dem großen Bett und lasse mich auf dem Stuhl an der Bettseite nieder.
»Wenn du Dr. Trellawny nicht vertraust, warum beorderst du ihn dann stets hierher?«, frage ich mit einem resignierten Seufzen. Ich kann mir seine Antwort schon denken.
Der alte Mann, der in dem ausladenden Bett beinah zu verschwinden scheint und kaum noch Ähnlichkeit mit dem einstmals so stattlichen Lord Ashton meiner Kindheit aufweist, vollführt eine wegwerfende Handbewegung, während er verächtlich schnaubt.
»Pah, die anderen sind doch keinen Deut besser. Da ist es egal, welchen Pfuscher ich mir ins Haus hole.«
Er sieht aus, als wolle er bei diesen Worten auf den Boden spucken.
»Dr. Trellawny sprach sehr angetan von den Ärzten in Deutschland«, versuche ich erneut mein Glück. »Ein Sanatorium in Baden-Baden ist auf Tuberkulosepatienten spezialisiert und –«
»Lass gut sein, mein Junge. Lass gut sein«, fährt er mir mit einer unwirschen Bewegung seiner Hand dazwischen und funkelt mich an. »Auf meine alten Tage ist das eine Weltreise, die ich nicht mehr bereit bin, anzutreten.« Neugierig greift er nach der Flasche. »Zeig mal her, was er mir da verordnet hat.«