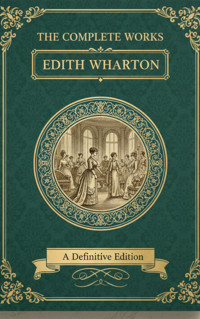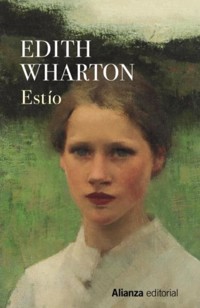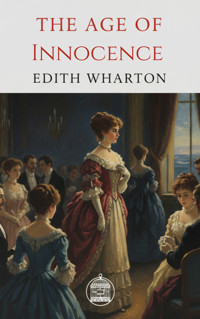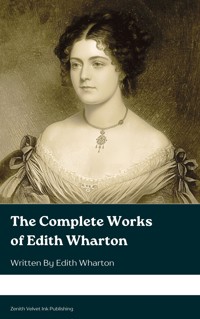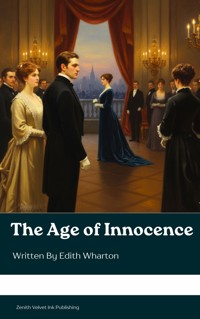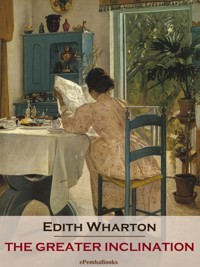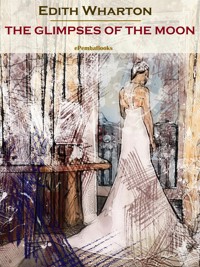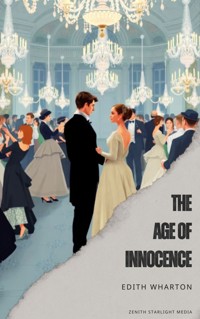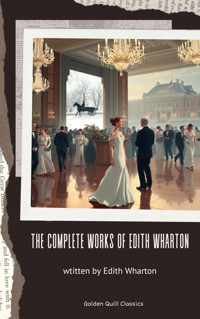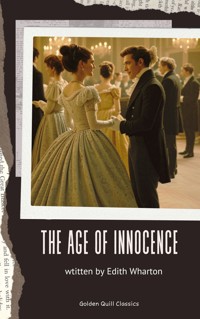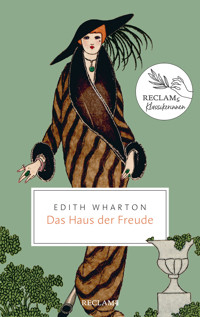
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Lily Bart ist jung, schön und ein gern gesehener Gast auf den gesellschaftlichen Events der New Yorker High Society. Doch mit dem Ruin ihrer Familie kann sie ihr Leben in den feinen Kreisen nur fortführen, wenn sie einen reichen Ehemann findet. Lily muss sich entscheiden: Will sie als bloßes Schmuckstück an der Seite eines Mannes Reichtum und Luxus – oder will sie ein Leben gemäß ihrer tatsächlichen Gefühle? Wie in »Zeit der Unschuld« zeigt sich die Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton auch in ihrer 1905 erschienenen Sozialsatire als kühle Beobachterin, die mit bitterböser Raffinesse die schillernden und oberflächlichen Kreise der Reichen und Schönen zerlegt. – Mit einer kompakten Biographie der Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Edith Wharton
Das Haus der Freude
Reclam
Englischer Originaltitel: The House of Mirth
1988, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: © akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961859-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020636-2
www.reclam.de
Inhalt
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Zweites Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Anhang
Nachwort
Zeittafel
Erstes Buch
I
Selden hielt überrascht inne. Im nachmittäglichen Trubel des Grand Central Bahnhofs hatte der Anblick von Miss Lily Bart seine Augen erfrischt.
Es war ein Montag, früh im September, und er kehrte gerade zu seiner Arbeit zurück nach einem kurzen Abstecher aufs Land; aber was machte Miss Bart in der Stadt um diese Jahreszeit? Wenn sie den Eindruck vermittelt hätte, als wolle sie einen Zug erreichen, hätte er daraus schließen können, er habe sie im Moment des Wechsels von einem Landhaus zum anderen getroffen, wo man sich um ihre Anwesenheit stritt, nachdem die Saison in Newport zu Ende gegangen war. Aber ihr anscheinend planloses Verhalten verwunderte ihn. Sie stand abseits von der Menge und ließ diese an sich vorüberziehen in Richtung auf den Bahnsteig oder auf die Straße und gab sich dabei ein ganz und gar unentschlossenes Aussehen, das, wie er vermutete, auch die Maske für ganz bestimmte Absichten sein konnte. Es kam ihm gleich der Gedanke, dass sie auf jemanden warten würde, aber er fragte sich, warum ihn diese Überlegung derart fesselte. Es war nichts Neues an Lily Bart, und doch konnte er sie nie sehen, ohne dass er ein leises Interesse an ihr verspürte; es war typisch für sie, dass sie ständig Spekulationen verursachte, dass selbst ihre einfachsten Handlungen als Resultat weitreichender Absichten erschienen.
Einem Impuls von Neugier folgend, verließ er den direkten Weg zum Ausgang und schlenderte an ihr vorbei. Er wusste, dass sie, wenn sie nicht gesehen werden wollte, versuchen würde, ihm auszuweichen, und der Gedanke, dass er so ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen würde, amüsierte ihn.
»Mr. Selden – was für ein Glück!«
Sie trat lächelnd einige Schritte vor, schon fast begierig in ihrem Bemühen, ihn abzufangen. Einige Leute, die eben an ihnen vorbeieilten, blieben stehen und schauten sich um, denn Miss Bart war eine Erscheinung, die sogar einen eiligen Vorstadtreisenden auf seinem Weg zum letzten Zug anhalten ließ.
Selden hatte sie nie strahlender gesehen. Ihr Kopf mit den lebhaften Farben, der sich gegen die matte Tönung der Menge abhob, ließ sie noch mehr auffallen als im Ballsaal, und unter ihrem dunklen Hut und Schleier hatte sie wieder die mädchenhafte Weichheit, die Reinheit der Farbe, die sie nach elf Jahren späten Zubettgehens und unermüdlichen Tanzens zu verlieren begann. Waren es wirklich schon elf Jahre, fragte sich Selden erstaunt, und hatte sie wirklich schon ihren neunundzwanzigsten Geburtstag hinter sich, wie ihre Rivalen behaupteten?
»Was für ein Glück!«, wiederholte sie. »Wie nett von Ihnen, dass Sie zu meiner Rettung kommen.«
Er antwortete freudig, dass dies zu tun die Mission seines Lebens sei, und fragte, wie die Rettung denn aussehen solle?
»Oh, irgendwie – Sie könnten sich sogar auf eine Bank setzen und mit mir unterhalten. Man setzt einen Cotillon lang aus, warum nicht einen Zug lang? Es ist hier schließlich nicht wärmer als in Mrs. Van Osburghs Wintergarten – und einige Frauen hier sind auch kein bisschen hässlicher.«
Sie unterbrach sich lachend, um zu erklären, dass sie von Tuxedo aus in die Stadt gekommen sei auf ihrem Weg zu den Gus Trenors auf Bellomont und den Zug um drei Uhr fünfzehn nach Rhinebeck verpasst habe.
»Und es fährt kein anderer bis halb sechs.« Sie sah auf ihre kleine juwelenbesetzte Armbanduhr zwischen den Spitzen ihres Ärmels. »Genau zwei Stunden zu warten. Und ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Mein Mädchen ist schon heute Morgen in die Stadt gefahren, um einige Einkäufe für mich zu erledigen, und sollte um ein Uhr nach Bellomont weiterfahren. Das Haus meiner Tante ist abgeschlossen, und ich kenne keinen Menschen in der Stadt.« Sie sah sich bekümmert im Bahnhof um. »Es ist doch noch heißer hier als bei Mrs. Van Osburgh. Wenn Sie Zeit hätten, könnten Sie mich dann nicht ein wenig zum Luftschnappen ausführen?«
Er erklärte, dass er ihr ganz und gar zur Verfügung stehe; das Abenteuer schien ihm recht unterhaltsam. Als Zuschauer hatte er sich immer an Lily Bart erfreut, und sein Leben lag so ganz außerhalb ihres Kreises, dass es ihm Vergnügen bereitete, für kurze Zeit auf die plötzliche Vertrautheit einzugehen, die sich aus ihrem Vorschlag ergab.
»Sollen wir zu Sherry’s hinübergehen und eine Tasse Tee trinken?«
Sie lächelte zustimmend, schnitt aber dann eine kleine Grimasse.
»Montags kommen so viele Leute in die Stadt – man kann sicher sein, eine Menge Langweiler zu treffen. Ich bin natürlich so alt wie Methusalem, und es sollte mir nichts ausmachen; aber wenn ich auch alt genug bin, Sie sind es nicht«, wandte sie fröhlich ein. »Ich lechze natürlich nach einer Tasse Tee, aber gibt es kein ruhigeres Eckchen?«
Er erwiderte ihr Lächeln, das lebhaft sein Gesicht suchte. Ihre Diskretion interessierte ihn beinahe genauso sehr wie ihre Frechheiten; er war ganz sicher, dass beide zu einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan gehörten. Bei der Beurteilung von Miss Bart hatte er sich immer des »Beweises aus Zweckmäßigkeit« bedient.
»Die Möglichkeiten, die New York bietet, sind ziemlich mager« sagte er, »aber ich werde zuerst einmal nach einer Droschke sehen, und dann werden wir uns etwas einfallen lassen.«
Er führte sie durch das Gedränge heimkehrender Urlauber, vorbei an Mädchen mit fahlen Gesichtern und absurden Hüten, an flachbrüstigen Frauen, die sich mit Papierbündeln und Palmblattfächern abmühten. War es möglich, dass sie zu derselben Art gehörte? Die Farblosigkeit, die grobe Machart des Durchschnitts der Frauen machte ihm bewusst, wie delikat sie gearbeitet war.
Ein rascher Schauer hatte die Luft abgekühlt, und noch immer hingen Wolken erfrischend über der nassen Straße.
»Wie herrlich! Lassen Sie uns ein wenig spazieren gehen«, sagte sie, als sie aus dem Bahnhof traten.
Sie bogen in die Madison Avenue ein und begannen in nördlicher Richtung zu schlendern. Wie sie so neben ihm herging mit ihrem weitausholenden leichten Schritt, kam Selden die Tatsache zu Bewusstsein, dass er ein ungeheures Vergnügen an ihrer Nähe empfand, an der Formung ihres kleinen Ohres, an der kraus nach oben gebogenen Welle ihres Haares – war es vielleicht ein klein wenig künstlich aufgehellt? – und an dem dichten Wuchs ihrer geraden dunklen Wimpern. Alles an ihr war zugleich kraftvoll und exquisit, zugleich stark und fein. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass es große Mühen gekostet haben musste, sie zu erschaffen, dass viele öde und hässliche Menschen auf mysteriöse Weise hatten geopfert werden müssen, um sie hervorzubringen. Er war sich bewusst, dass die Qualitäten, die sie vor der Menge ihres Geschlechts auszeichneten, vorwiegend äußerlicher Natur waren, so als ob eine feine Glasur von Schönheit und wählerischem Geschmack über ganz gewöhnlichen Ton gezogen worden wäre. Doch diese Analogie ließ ihn unbefriedigt, denn grobes Material würde man nicht zu solcher Vollendung bringen können, und war es nicht möglich, dass der Stoff, aus dem sie gemacht war, von feiner Qualität war, dass die Umstände ihn aber in eine oberflächlich gearbeitete Form gebracht hatten?
Als er diesen Punkt seiner Überlegungen erreicht hatte, kam die Sonne heraus, und ihr aufgespannter Sonnenschirm machte seine Freude an ihrem Aussehen zunichte. Einen Moment später blieb sie stehen und seufzte.
»Oje, mir ist so heiß und ich habe solchen Durst; und was für eine scheußliche Stadt New York doch ist!« Sie blickte mit verzweifeltem Gesichtsausdruck die triste Straße entlang. »Andere Städte ziehen im Sommer ihre besten Sachen an, aber New York scheint in Hemdsärmeln dazusitzen!« Ihre Augen wanderten in eine der Seitenstraßen. »Jemand war dort wenigstens menschlich genug, ein paar Bäume zu pflanzen. Wollen wir in den Schatten gehen?«
»Ich freue mich, dass meine Straße Ihre Zustimmung findet«, sagte Selden, als sie um die Ecke bogen.
»Ihre Straße? Wohnen Sie hier?«
Sie betrachtete mit Interesse die neuen Häuserfassaden aus Ziegel und Sandstein mit ihren wunderlichen Variationen, die dem übertriebenen amerikanischen Bedürfnis nach Neuheit entsprachen. Andererseits wirkten die Häuser mit ihren Markisen und Blumenkästen aber auch wieder frisch und einladend.
»Ach ja, natürlich: The Benedick. Was für ein hübsches Haus! Ich glaube nicht, dass ich es schon einmal gesehen habe.« Sie sah zu dem flachen Gebäude mit seinen Marmorsäulen und der pseudo-georgianischen Fassade hinüber. »Welche sind Ihre Fenster? Die mit den heruntergelassenen Markisen?«
»Im obersten Stockwerk, ja.«
»Und der nette kleine Balkon, ist das Ihrer? Wie schön kühl es da oben aussieht!«
Er zögerte einen Moment. »Kommen Sie herauf, und sehen Sie es sich an«, schlug er vor. »Ich kann Ihnen in kürzester Zeit eine Tasse Tee anbieten – und Sie werden keine Langweiler treffen.«
Die Farbe ihrer Wangen vertiefte sich um ein weniges – noch immer verfügte sie über die Fähigkeit, zur rechten Zeit zu erröten –, aber sie nahm seinen Vorschlag so leichthin auf, wie er gemacht worden war.
»Warum nicht? Es ist zu verlockend – ich werde das Risiko eingehen«, erklärte sie.
»Oh, ich bin nicht gefährlich«, sagte er in demselben Ton. Wahrhaftig, er hatte sie noch nie so gemocht wie in diesem Augenblick. Er wusste, dass sie ohne irgendwelche Hintergedanken zugestimmt hatte; er würde nie ein Faktor in ihren Kalkulationen sein, und es lag etwas Überraschendes, ja fast Erfrischendes, in der Spontaneität, mit der sie einwilligte.
An der Türschwelle hielt er einen Moment inne und suchte nach seinem Hausschlüssel.
»Es ist niemand da; aber ich habe einen Dienstboten, der morgens immer kommt, und es besteht die Möglichkeit, dass er den Teetisch gedeckt und für Kuchen gesorgt hat.«
Er geleitete sie in eine winzige Diele, an deren Wänden alte Stiche hingen. Ihr fielen die Briefe und Karten auf, die in einem unordentlichen Haufen auf dem Tisch zwischen seinen Handschuhen und Spazierstöcken lagen; dann fand sie sich in einer kleinen Bibliothek wieder, dunkel, aber freundlich mit Wänden voller Bücher, einem angenehm verblassten türkischen Läufer, einem unordentlichen Schreibtisch und, wie er vorausgesagt hatte, einem Teetablett auf einem niedrigen Tisch in der Nähe des Fensters. Ein leichter Wind war aufgekommen, der blies die Vorhänge aus Musselin ein wenig in den Raum und brachte einen frischen Duft von den Reseda- und Petunienpflanzen in den Blumenkästen auf dem Balkon mit sich.
Lily sank mit einem Seufzer in einen der abgenutzten Ledersessel.
»Wie herrlich, einen Ort wie diesen ganz für sich allein zu haben! Es ist eine elende Angelegenheit, eine Frau zu sein!« Sie lehnte sich, ihre Unzufriedenheit genießend, zurück.
Selden durchsuchte einen Küchenschrank nach Kuchen.
»Sogar Frauen«, sagte er, »sollen schon das Privileg einer eigenen Wohnung genossen haben.«
»Ach ja, Erzieherinnen – oder Witwen. Aber Mädchen nicht, arme, unglückliche, heiratsfähige Mädchen nicht!«
»Ich kenne sogar ein Mädchen, das in einer Wohnung lebt.«
Sie setzte sich überrascht auf. »Wirklich?«
»Ja, wirklich«, versicherte er ihr und kam mit dem gesuchten Kuchen aus dem Küchenschrank hervor.
»Ach, ich weiß – Sie meinen Gerty Farish.« Sie lächelte etwas unfreundlich. »Aber ich sagte doch heiratsfähige Mädchen – und außerdem hat sie eine scheußliche kleine Wohnung und kein Stubenmädchen und so sonderbare Dinge zum Essen. Ihre Köchin macht auch die Wäsche, und das Essen schmeckt dann nach Seife. Das könnte ich nicht leiden, wissen Sie.«
»Sie sollten nicht an den Waschtagen bei ihr essen,« sagte Selden und schnitt dabei den Kuchen an.
Sie lachten beide, und er kniete am Tisch nieder, um die Flamme unter dem Kessel anzuzünden, während sie den Tee abmaß und in die kleine Teekanne mit der grünen Glasur gab. Während er ihre Hand beobachtete, glatt wie ein Stück altes Elfenbein, mit den schmalen rosigen Fingernägeln und dem Saphirarmband, das ihr über das Handgelenk gerutscht war, fiel ihm auf, welche Ironie in seinem Vorschlag lag, ein Leben zu führen, wie es sich seine Cousine Gertrude Farish ausgesucht hatte. Sie war so eindeutig ein Opfer der Zivilisation, die sie hervorgebracht hatte, dass die Glieder ihres Armbands fast wie Handschellen wirkten, die sie an ihr Schicksal ketteten.
Sie schien seine Gedanken erraten zu haben. »Es war hässlich von mir, das von Gerty zu sagen«, sagte sie mit bezauberndem Bedauern. »Ich hatte vergessen, dass sie Ihre Cousine ist. Aber wir sind so verschieden, wissen Sie; ihr macht es Spaß, gut zu sein, und mir macht es Spaß, glücklich zu sein. Und außerdem ist sie frei und ich nicht. Wenn ich es wäre, könnte ich allerdings sogar in ihrer Wohnung glücklich sein. Es muss die reine Glückseligkeit sein, die Möbel so stellen zu dürfen, wie man es gern hat, und alle Scheußlichkeiten dem Aschenmann mitgeben zu können. Wenn ich mir nur den Salon meiner Tante vornehmen könnte, ich wüsste, ich würde ein besserer Mensch werden.«
»Ist er so furchtbar scheußlich?«, fragte er teilnahmsvoll. Sie lächelte ihn über die Teetasse hinweg an, die sie hochhielt, um sie füllen zu lassen.
»Das zeigt, wie selten Sie zu uns kommen. Warum kommen Sie nicht öfter?«
»Wenn ich komme, ist es nicht, um mir Mrs. Penistons Möbel anzuschauen.«
»Unsinn«, sagte sie. »Sie besuchen uns ja überhaupt nicht – und dabei kommen wir so gut miteinander aus, wenn wir uns treffen.«
»Vielleicht ist das der Grund«, antwortete er prompt. »Ich fürchte, ich habe keine Sahne, hätten Sie stattdessen etwas gegen ein Stückchen Zitrone einzuwenden?«
»Das wäre mir sogar noch lieber.« Sie wartete, bis er die Zitrone aufgeschnitten hatte und eine dünne Scheibe in ihre Tasse gab. »Aber das ist nicht der Grund«, bohrte sie weiter.
»Der Grund wofür?«
»Dafür, dass Sie uns nie besuchen.« Sie lehnte sich ein wenig vor, und er konnte einen Schatten von Verwirrung in ihren bezaubernden Augen erkennen. »Ich wünschte, ich wüsste es – ich wünschte, ich würde aus Ihnen klug. Natürlich weiß ich, dass es Männer gibt, die mich nicht mögen; das kann man mit einem einzigen Blick feststellen. Und dann gibt es andere, die sich vor mir fürchten; sie glauben, ich wollte sie heiraten.« Sie lächelte ihn offen an. »Aber ich glaube nicht, dass Sie mich nicht mögen – und Sie können unmöglich denken, ich wolle Sie heiraten.«
»Nein, davon kann ich Sie ohne weiteres freisprechen«, stimmte er zu.
»Nun, dann –?«
Er trug seine Tasse zum Kamin, lehnte sich gegen den Kaminsims und sah zu ihr hinunter mit einem Ausdruck lässigen Amüsements. Die Provokation in ihren Augen verstärkte sein Vergnügen noch; er hatte nicht gedacht, dass sie ihr Pulver um einer so wenig verheißungsvollen Beute willen verschwenden würde. Aber vielleicht wollte sie nur ihren Einfluss spüren, oder vielleicht kannte ein Mädchen ihrer Art nur Unterhaltungen über Persönliches. Auf jeden Fall war sie erstaunlich hübsch, und er hatte sie zum Tee eingeladen und musste nun seinen Verpflichtungen gerecht werden.
»Nun denn«, er gab sich einen Ruck, um es herauszubringen, »vielleicht ist das der Grund.«
»Was?«
»Die Tatsache, dass Sie mich nicht heiraten wollen. Vielleicht halte ich das nicht für einen so starken Anreiz, Sie zu besuchen.« Er fühlte, wie ein leichtes Zittern sein Rückgrat entlanglief, als er das zu sagen wagte, aber ihr Lachen beruhigte ihn.
»Lieber Mr. Selden, das war Ihrer aber nicht würdig. Es ist dumm von Ihnen, mir Liebeserklärungen zu machen, und Dummheit passt gar nicht zu Ihnen.« Sie lehnte sich zurück und trank ihren Tee in kleinen Schlucken mit einem so bezaubernd kritischen Gesichtsausdruck, dass er, wenn sie im Salon ihrer Tante gewesen wären, vielleicht versucht hätte, den Gegenbeweis zu ihren Schlussfolgerungen anzutreten.
»Sehen Sie denn nicht«, fuhr sie fort, »dass mir schon genug Männer angenehme Dinge sagen, und dass das, was ich brauche, ein Freund ist, der keine Angst hat, mir die unangenehmen zu sagen, wenn ich das nötig habe? Ich habe einmal geglaubt, Sie könnten dieser Freund sein – ich weiß auch nicht warum, außer dass Sie weder ein Pedant noch ein Flegel sind, und dass ich Ihnen nichts vormachen oder vor Ihnen auf der Hut sein müsste.« Ihre Stimme hatte einen ernsthaften Ton angenommen. Sie saß da und blickte zu ihm auf mit dem besorgten Ernst eines Kindes.
»Sie wissen nicht, wie sehr ich einen solchen Freund brauche«, sagte sie. »Meine Tante ist voll von Anstandsregeln, aber die gelten für das Benehmen, das in den frühen Fünfzigern üblich war. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich mich wirklich daran halten wollte, auch Organdy und Keulenärmel tragen müsste. Und die anderen Frauen – meine besten Freundinnen – na ja, die benutzen oder verleumden mich, aber es ist ihnen völlig egal, was aus mir wird. Mich gibt es gesellschaftlich einfach schon zu lange; die Leute werden meiner müde. Es fängt schon an, dass sie sagen, ich sollte heiraten.«
Es entstand eine kurze Pause, in der Selden ein oder zwei Erwiderungen überdachte, die darauf angelegt waren, die Pikanterie der Situation noch zu erhöhen. Er verwarf sie jedoch zugunsten der einfachen Frage: »Nun, warum tun Sie es nicht?«
Sie errötete und lachte. »Ah, ich sehe, Sie sind doch ein wirklicher Freund, und diese Frage gehört genau zu den unangenehmen Dingen, nach denen ich verlangt habe.«
»Sie war aber nicht so unangenehm gemeint«, erwiderte er freundschaftlich. »Ist Heirat nicht Ihre Berufung? Ist es nicht das, wofür Sie erzogen wurden?«
Sie seufzte. »Ich glaube schon. Was gäbe es auch sonst?«
»Genau. Und warum geben Sie sich dann nicht einen Ruck und bringen es hinter sich?«
Sie zuckte die Achseln. »Sie reden, als ob ich den ersten Mann heiraten sollte, der mir über den Weg läuft.«
»Ich habe nicht andeuten wollen, dass Sie sich in einer derartigen Zwangslage befänden. Aber es muss doch jemanden mit den erforderlichen Qualifikationen geben.«
Sie schüttelte müde den Kopf. »Ein oder zwei gute Chancen habe ich vergeben, ganz zu Anfang, als ich in die Gesellschaft eingeführt wurde; ich glaube, das tut jedes Mädchen; und, wie Sie wissen, bin ich entsetzlich arm – und sehr kostspielig. Ich brauche eine ganze Menge Geld.«
Selden hatte sich umgewandt, um nach dem Zigarettenkasten auf dem Kaminsims zu greifen.
»Was ist denn aus Dillworth geworden?«, fragte er.
»Oh, seine Mutter bekam Angst; sie hatte die Befürchtung, ich würde den gesamten Familienschmuck neu fassen lassen. Außerdem sollte ich ihr versprechen, dass ich den Salon der Familie nicht umdekorieren würde.«
»Aber genau deswegen wollen Sie ja heiraten!«
»Eben. Also schiffte sie ihn nach Indien ein.«
»Pech – aber Sie können doch etwas Besseres als Dillworth finden.«
Er bot ihr den Kasten mit den Zigaretten an; sie nahm drei oder vier heraus, steckte eine zwischen die Lippen und ließ die anderen in ein kleines Goldtäschchen an einer langen Perlenkette gleiten.
»Habe ich denn noch Zeit? Ein paar kurze Züge also.« Sie lehnte sich vor und hielt die Spitze ihrer Zigarette an die seine. Während sie das tat, bemerkte er mit ganz unpersönlichem Wohlgefallen, wie gleichmäßig ihre schwarzen Wimpern an ihren samtigen weißen Lidern wuchsen, und wie der zartlila Schatten unter ihnen langsam in das reine Weiß ihrer Wangen überging.
Sie fing an, in seinem Zimmer umherzuwandern, und betrachtete dabei prüfend zwischen den kleinen Wolken ihres Zigarettenrauchs die Bücherregale. Einige Bände hatten die reife Färbung feiner Punzarbeit und alten marokkanischen Leders, und ihre Augen hingen an ihnen mit liebevollem Blick, nicht mit der Anerkennung des Fachmanns, aber mit der Freude an angenehmen Farben und Stoffen, für die sie in ganz besonderem Maße empfänglich war. Plötzlich veränderte sich ihr Gesichtsausdruck von planlosem Genießen zu aktiver Mutmaßung; sie wandte sich mit einer Frage an Selden.
»Sie sammeln, nicht wahr? Sie kennen sich aus mit Erstausgaben und diesen Dingen?«
»So sehr, wie sich jemand, der kein Geld auszugeben hat, damit auskennen kann. Dann und wann entdecke ich etwas im Abfall, und ich gehe auch manchmal und schaue mir die großen Verkaufsauktionen an.«
Sie hatte sich wieder den Regalen zugewandt, aber jetzt schweiften ihre Augen ohne besondere Aufmerksamkeit über sie hinweg, und er sah, dass sie mit einer neuen Idee beschäftigt war.
»Und Amerikana – sammeln Sie Amerikana?«
Selden machte große Augen und lachte.
»Nein, das liegt nun ganz und gar nicht auf meiner Linie. Sehen Sie, ich bin kein wirklicher Sammler. Ich habe nur gern gute Ausgaben von den Büchern, die ich besonders mag.«
Sie zog ein Gesicht. »Und Amerikana sind wahrscheinlich entsetzlich öde?«
»Ja, das finde ich eigentlich schon – außer für den Historiker natürlich. Aber ein echter Sammler schätzt ein Ding wegen seines Seltenheitswertes. Ich nehme nicht gerade an, dass diejenigen, die Amerikana kaufen, nächtelang aufbleiben, um sie zu lesen. Der alte Jefferson Gryce hat das jedenfalls mit Sicherheit nicht getan.«
Sie hörte mit gespannter Aufmerksamkeit zu. »Und dennoch erzielen sie fabelhafte Preise, nicht wahr? Es kommt mir so seltsam vor, so viel Geld für ein hässliches, schlecht gedrucktes Buch auszugeben, das man doch nie lesen wird. Außerdem nehme ich an, die Besitzer von Amerikana sind nicht einmal Historiker?«
»Nein, nur sehr wenige Historiker können es sich leisten, sie zu kaufen. Sie müssen diejenigen in öffentlichen Bibliotheken oder privaten Sammlungen benutzen. Es ist wohl nur der Seltenheitswert, der den Durchschnittssammler anzieht.«
Er setzte sich auf die Lehne des Sessels, neben dem sie gerade stand, und sie fragte ihn weiter nach den seltensten Ausgaben, ob Jefferson Gryces Sammlung wirklich für die beste der Welt gehalten werde, und was der höchste Preis gewesen sei, den man jemals für eine einzelne Ausgabe erzielt hätte.
Es war so angenehm dazusitzen und zu ihr aufzuschauen, während sie das eine oder andere Buch aus den Regalen nahm, und ihre Finger die Seiten schnell durchblätterten, wobei ihr zum Boden gewandtes Profil sich gegen den warmen Hintergrund der alten Einbände abhob, dass er weiterhin erzählte, ohne auf den Gedanken zu kommen, dass ihr plötzliches Interesse für ein so wenig aufregendes Thema doch eigentlich sonderbar war. Aber er konnte nie lange mit ihr zusammen sein, ohne den Versuch zu machen, für das, was sie tat, einen Grund zu finden, und als sie seine Erstausgabe von La Bruyère zurückstellte und sich vom Bücherschrank abwandte, begann er sich zu fragen, worauf sie hinauswollte. Ihre nächste Frage war nicht so geartet, dass sie ihm darüber Aufschluss gegeben hätte. Sie blieb vor ihm stehen mit einem Lächeln, das ihn gleichzeitig in eine gewisse Vertrautheit einzubeziehen und ihn an die Einschränkungen zu erinnern schien, die es ihm auferlegte.
»Tut es Ihnen nie leid«, fragte sie plötzlich, »dass Sie nicht reich genug sind, all die Bücher zu kaufen, die Sie gern haben möchten?«
Er folgte ihrem Blick durch das Zimmer mit dem abgenutzten Mobiliar und den schäbigen Wänden.
»Ja, tut es mir nicht sogar in eben diesem Moment leid? Halten Sie mich für einen Heiligen auf einer Säule?«
»Und dass Sie arbeiten müssen, stört Sie das nicht?«
»Ach, die Arbeit an sich ist nicht so schlecht; ich habe viel für die Juristerei übrig.«
»Nein, aber dass man so angebunden ist, die Routine. Möchten Sie denn niemals einfach wegfahren, um neue Gegenden und neue Leute kennen zu lernen?«
»Schrecklich gern, vor allem, wenn ich sehe, wie alle meine Freunde sich beeilen, um auf das Dampfboot zu kommen.«
Sie atmete mitfühlend auf. »Aber es stört Sie nicht genug – um zu heiraten, damit Sie aus dieser Situation herauskommen?«
Selden lachte auf. »Um Gottes willen!«, rief er.
Sie erhob sich mit einem Seufzer und warf ihre Zigarette in den Kamin.
»Ah, da liegt eben der Unterschied – ein Mädchen muss, ein Mann kann, wenn er sich dafür entscheidet.« Sie betrachtete ihn kritisch. »Ihr Mantel ist ein bisschen schäbig, aber wen kümmert das. Es hält die Leute nicht davon ab, Sie zum Essen einzuladen. Wenn ich schlecht gekleidet wäre, wollte mich niemand bei sich haben: Wenn eine Frau eingeladen wird, dann ebenso sehr um ihrer Kleidung wie um ihrer selbst willen. Die Kleidung ist der Hintergrund, der Rahmen, wenn Sie so wollen; sie garantiert nicht für den Erfolg, aber sie macht einen Teil davon aus. Wer will schon eine schäbige Frau? Von uns erwartet man, dass wir hübsch und gut gekleidet sind, bis wir umfallen – und wenn wir das nicht allein durchhalten können, müssen wir uns einen Teilhaber für das Geschäft suchen.«
Selden schaute sie amüsiert an. Es war unmöglich, auch wenn ihre Augen ihn noch so flehentlich ansahen, ihren Fall mit Sentimentalität zu betrachten.
»Na ja, es liegt sicher schon einiges an Kapital bereit für eine solche Investition. Vielleicht erfüllt sich Ihr Schicksal heute Abend bei den Trenors.«
Sie erwiderte seinen Blick fragend.
»Ich dachte, Sie würden vielleicht auch hinfahren – o nein, nicht in dieser Eigenschaft! Aber es werden viele aus Ihrem Kreis da sein, Gwen Van Osburgh, die Wetheralls, Lady Cressida Raith – und die George Dorsets.«
Sie machte eine kleine Pause vor dem letzten Namen und warf ihm unter den Wimpern einen kurzen forschenden Blick zu, aber er blieb ungerührt.
»Mrs. Trenor hat mich eingeladen, aber ich bin bis Ende der Woche unabkömmlich. Und diese großen Gesellschaften langweilen mich.«
»Ach, mich auch«, rief sie.
»Warum gehen Sie dann hin?«
»Das gehört zum Geschäft – Sie vergessen! Und außerdem, wenn ich nicht hinginge, würde ich mit meiner Tante in Richfield Springs Bésigue spielen müssen.«
»Das ist ja fast so schlimm wie eine Heirat mit Dillworth«, stimmte er ihr bei, und sie lachten beide aus reinem Vergnügen über ihre plötzliche Vertrautheit.
Sie schaute zur Uhr.
»Oje! Ich muss gehen. Es ist nach fünf.«
Sie hielt vor dem Kaminsims inne und betrachtete sich im Spiegel, während sie ihren Schleier zurechtsteckte. Ihre Haltung brachte die lange Biegung ihrer schlanken Silhouette zur Geltung, die ihren Umrissen eine Art urtümlicher Grazie gab – als wäre sie eine gefangene Dryade, für die Konventionen gesellschaftlichen Umgangs gezähmt. Selden dachte darüber nach, dass eben dieser Zug urwaldhafter Freiheit in ihrem Wesen ihrer Künstlichkeit den besonderen Reiz verlieh.
Er folgte ihr durch den Raum bis zum Eingang, aber an der Türschwelle hielt sie ihm ihre Hand mit einer Abschiedsgeste entgegen.
»Es war herrlich; und jetzt werden Sie meinen Besuch erwidern müssen.«
»Aber wollen Sie nicht, dass ich Sie zum Bahnhof begleite?«
»Nein, auf Wiedersehen hier, bitte.«
Sie ließ ihre Hand einen Moment lang in der seinen liegen und wandte ihm ein anbetungswürdiges Lächeln zu.
»Nun dann, auf Wiedersehen und viel Glück auf Bellomont!«, sagte er, indem er die Tür für sie öffnete.
Auf dem Treppenabsatz hielt sie an, um sich umzusehen. Die Chancen, dass sie jemanden treffen könnte, standen tausend zu eins, aber man wusste ja nie, und sie zahlte für ihre wenigen Unvorsichtigkeiten immer mit einem zumindest zeitweise betont umsichtigen Verhalten. Es war aber niemand zu sehen, außer einer Putzfrau, die die Treppe scheuerte. Deren eigene üppige Gestalt und die sie umgebenden Geräte nahmen so viel Raum ein, dass Lily, um an ihr vorbeizukommen, ihre Röcke hochnehmen und sich an der Wand entlangschieben musste. Als sie das tat, hielt die Frau in ihrer Arbeit inne und schaute neugierig auf, wobei sie ihre geballten Fäuste auf das nasse Tuch legte, das sie gerade aus ihrem Eimer gezogen hatte. Sie hatte ein breites blasses Gesicht, das mit einigen Pockennarben bedeckt war, und dünnes strohfarbenes Haar, durch das ihre Kopfhaut auf unangenehme Weise hindurchschien.
»Entschuldigen Sie«, sagte Lily, wobei ihre Höflichkeit Kritik am Benehmen ihres Gegenübers ausdrücken sollte.
Die Frau schob, ohne zu antworten, ihren Eimer zur Seite und starrte weiter auf Miss Bart, die mit einem leisen Knistern ihrer Seidenunterröcke vorbeischwebte. Lily fühlte, wie sie unter diesem Blick errötete. Was dachte dieses Wesen sich? Konnte man niemals auch nur etwas ganz Einfaches, völlig Harmloses tun, ohne gleich den hässlichsten Verdächtigungen ausgesetzt zu sein? Nach der Hälfte der nächsten Treppe lächelte sie darüber, dass es sie derart störte, von einer Putzfrau angestarrt zu werden. Das arme Ding war wahrscheinlich geblendet von einer so ungewohnten Erscheinung. Aber waren solche Erscheinungen etwas Ungewöhnliches auf Seldens Treppe? Miss Bart war mit dem Moralkodex in Junggesellenwohnungen nicht vertraut, und wieder stieg ihr die Farbe in die Wangen, als ihr der Gedanke kam, dass der beharrliche Blick der Frau eine vorsichtige Verbindung mit Vergangenem andeuten könnte. Aber mit einem Lächeln über ihre eigenen Befürchtungen schob sie den Gedanken beiseite und beeilte sich nach unten zu kommen, wobei sie sich fragte, ob sie wohl noch vor der Fifth Avenue eine Droschke finden würde.
Unter dem georgianischen Eingangsvorbau hielt sie wieder an und blickte die Straße hinauf und hinunter auf der Suche nach einer Droschke. Es war keine zu sehen, aber als sie den Bürgersteig erreichte, stieß sie fast mit einem kleinen, geschniegelt aussehenden Mann mit einer Gardenie im Knopfloch zusammen, der seinen Hut mit einem erstaunten Ausruf zog.
»Miss Bart? Ja, dass ich gerade Sie hier treffe. Das nenne ich Glück«, erklärte er, und sie entdeckte ein Funkeln amüsierter Neugier zwischen seinen zusammengezogenen Lidern.
»Oh, Mr. Rosedale, wie geht es Ihnen?«, sagte sie und bemerkte dabei, dass der unbezähmbare Ärger in ihrem Gesicht mit einer plötzlichen Vertraulichkeit in seinem Lächeln beantwortet wurde.
Mr. Rosedale stand da und betrachtete sie von oben bis unten mit Interesse und Wohlgefallen. Er war ein dicklicher rosiger Mann vom Typ des blonden Juden in eleganter Londoner Kleidung, die ihm wie eine Polsterung passte, und kleinen, schrägen Augen, die ihm einen Ausdruck verliehen, als würde er Menschen wie Nippsachen abschätzen. Er schaute fragend auf den Eingang des Benedick.
»Schätze, Sie waren in der Stadt, um ein paar Einkäufe zu erledigen?«, sagte er in einem Ton, der die Vertraulichkeit einer Berührung hatte.
Miss Bart wich ihm ein wenig aus und stürzte sich dann in voreilige Erklärungen.
»Ja, ich bin in die Stadt gekommen, um meine Schneiderin aufzusuchen. Ich bin gerade dabei, den Zug zu den Trenors zu nehmen.«
»Ah, Ihre Schneiderin, natürlich«, sagte er höflich. »Ich wusste gar nicht, dass irgendwelche Schneiderinnen im Benedick wohnen.«
»Im Benedick?« Sie sah ein wenig verwirrt drein. »Ist das der Name dieses Gebäudes?«
»Ja, das ist sein Name; ich glaube, es ist ein altes Wort für Junggeselle, nicht? Ich bin zufällig der Besitzer des Gebäudes, deswegen weiß ich das.« Sein Lächeln vertiefte sich, als er mit stärkerem Nachdruck hinzufügte: »Aber Sie müssen mir erlauben, Sie zum Bahnhof zu bringen. Die Trenors sind sicher auf Bellomont. Sie haben kaum noch Zeit genug, den Zug um fünf Uhr vierzig zu erreichen. Ich nehme an, die Schneiderin hat Sie warten lassen.«
Lily erstarrte bei dieser kleinen scherzhaften Bemerkung.
»Oh, danke,« stammelte sie; und im selben Moment wurde sie einer Droschke ansichtig, die langsam die Madison Avenue entlangfuhr. Sie winkte mit verzweifelten Gesten.
»Sie sind sehr freundlich, aber ich möchte Sie wirklich nicht bemühen«, sagte sie, wobei sie Mr. Rosedale ihre Hand hinstreckte; und ungeachtet seiner Einwände sprang sie in das rettende Fahrzeug und rief dem Fahrer atemlos zu, wohin er sie fahren solle.
II
In der Droschke lehnte sie sich mit einem Seufzer zurück.
Warum musste man als Mädchen so teuer für das geringste Abweichen von der Normalität bezahlen? Warum konnte man nie etwas ganz Natürliches tun, ohne es hinter einem kunstvollen Gebäude kleiner Listen verbergen zu müssen? Sie hatte einem Impuls nachgegeben, als sie in Lawrence Seldens Wohnung mitgegangen war, und es war so selten, dass sie sich den Luxus impulsiven Handelns erlauben konnte! Diesmal würde es sie jedenfalls mehr kosten, als sie sich leisten konnte. Es beunruhigte sie sehr, dass sie erkennen musste, dass sie trotz jahrelanger Wachsamkeit zweimal innerhalb von fünf Minuten einen Fehler begangen hatte. Die dumme Geschichte von der Schneiderin war schlimm genug – es wäre so einfach gewesen, Rosedale zu erzählen, dass sie mit Selden Tee getrunken hatte! Die reine Feststellung der Tatsache hätte diese in harmlosem Licht erscheinen lassen. Aber nachdem sie sich einmal bei einer Unwahrheit hatte ertappen lassen, war es doppelt dumm gewesen, den Zeugen ihrer Verwirrung so schroff abzufertigen. Hätte sie Geistesgegenwart genug bewiesen und Rosedale erlaubt, sie zum Bahnhof zu fahren, so hätte dieses Zugeständnis vielleicht sein Schweigen erkaufen können. Er verfügte über die Genauigkeit seiner Rasse im Abschätzen von Werten, und zu einer lebhaft bevölkerten Nachmittagsstunde in Gesellschaft von Miss Lily Bart den Bahnsteig entlangzugehen, wäre bares Geld in seiner Tasche gewesen, wie er es vielleicht selbst ausgedrückt hätte. Er wusste natürlich, dass auf Bellomont eine große Gesellschaft gegeben würde, und die Möglichkeit, für einen von Mrs. Trenors Gästen gehalten zu werden, hatte er bei seinen Kalkulationen sicher berücksichtigt. Mr. Rosedale war zurzeit noch in einem Stadium seines sozialen Aufstiegs, in dem es wichtig war, solche Eindrücke hervorzurufen.
Das Ärgerliche war, dass Lily all das wusste, wusste, wie einfach es gewesen wäre, ihn auf der Stelle zum Schweigen zu bewegen, und wie schwierig es werden würde, dies im Nachhinein zu tun. Mr. Simon Rosedale gehörte zu den Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, alles über jedermann in Erfahrung zu bringen; er glaubte, seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft dadurch unter Beweis stellen zu können, dass er eine lästige Vertrautheit mit den Gewohnheiten derjenigen zeigte, die er gern als gute Bekannte hingestellt hätte. Lily war davon überzeugt, dass innerhalb von vierundzwanzig Stunden die Geschichte von ihrem Besuch bei ihrer Schneiderin im Benedick unter Mr. Rosedales Bekanntschaft in regem Umlauf sein würde. Das Schlimmste bei alledem war, dass sie ihn immer abweisend behandelt oder ganz ignoriert hatte. Bei seinem ersten Auftreten in der Gesellschaft – als ihr unbedachter Cousin Jack Stepney ihm eine Einladung für eine der ausufernden, unpersönlichen Van-Osburgh-»Riesengesellschaften« besorgt hatte (zum Ausgleich welcher Art von Gefälligkeiten war nur zu leicht zu erraten) –, war Rosedale mit dieser Mischung aus künstlerischem Einfühlungsvermögen und geschäftlicher Cleverness, die seiner Rasse eigen ist, instinktiv zu Miss Bart hingezogen worden. Sie durchschaute seine Motive, denn ihr eigenes Vorgehen wurde von ebenso hübschen Berechnungen gesteuert. Erziehung und Erfahrung hatten sie gelehrt, sich gegenüber Neuankömmlingen gastfreundlich zu verhalten, da sogar ganz und gar nicht Vielversprechende ihr später von Nutzen sein konnten; außerdem gab es genug »Verliese«, die sie verschlucken würden, wenn sie es nicht waren. Aber ein instinktiver Widerwille hatte all die Jahre gesellschaftlicher Disziplin zunichtegemacht und sie Mr. Rosedale ohne jegliche Anhörung in sein »Verlies« abschieben lassen. Er hinterließ nur noch die kleine Welle des Amüsements, das sein schleuniges Abgefertigtwerden bei ihren Freunden hervorrief; und obwohl er später (um die Metapher zu wechseln) weiter unten im Strom wieder auftauchte, war es doch nur für flüchtige Augenblicke mit langen Zwischenzeiten, in denen er unter der Oberfläche blieb.
Bisher war Lily nicht von Skrupeln geplagt worden. In ihrem unmittelbaren Kreis hatte man Mr. Rosedale für »unmöglich« erklärt und man ließ Jack durchaus die Verachtung spüren, die man für seinen Versuch empfand, seine Schulden mit Abendeinladungen zu bezahlen. Sogar Mrs. Trenor, deren Sinn für Abwechslung schon zu einigen riskanten Experimenten geführt hatte, weigerte sich, auf Jacks Bemühungen einzugehen und Rosedale als gesellschaftliche Neuheit auszugeben; sie erklärte, dass dieser kleine Jude ja wohl, soweit sie sich erinnern konnte, bereits ein Dutzend Mal der Gesellschaft serviert und von ihr zurückgewiesen worden war; und solange Judy Trenor unbeugsam blieb, waren Mr. Rosedales Chancen äußerst gering, über den äußeren Kreis der Van-Osburgh-Riesenempfänge hinaus in die Gesellschaft einzudringen. Jack gab das Rennen mit einem lachenden »Ihr werdet schon sehen« auf, blieb aber mannhaft bei seinen Waffen und zeigte sich mit Rosedale in den Restaurants, die gerade in Mode waren, in Gesellschaft persönlich sehr farbiger, gesellschaftlich aber eher obskurer Damen, die für solche Zwecke jederzeit zur Verfügung stehen. Seine Bemühungen waren bisher jedoch umsonst gewesen, und da Rosedale ohne Zweifel für die Dinners zahlte, hatte der Schuldner bisher den größeren Gewinn von der Sache.
Mr. Rosedale war daher, wie unschwer zu erkennen ist, noch kein Faktor, den man fürchten musste –, es sei denn, man begab sich in seine Gewalt. Und das war genau, was Miss Bart getan hatte. Ihre unbeholfene Schwindelei hatte ihm gezeigt, dass sie etwas zu verbergen hatte; und sie war sicher, dass er noch ein Hühnchen mit ihr zu rupfen hatte. Etwas in seinem Lächeln sagte ihr, dass er nicht vergessen hatte. Sie versuchte mit leisem Schaudern, den Gedanken loszuwerden, aber er verfolgte sie den ganzen Weg zum Bahnhof und auch den Bahnsteig entlang mit einer Beharrlichkeit, als wäre er Mr. Rosedale selbst.
Sie hatte gerade noch Zeit, ihren Platz einzunehmen, bevor der Zug anfuhr; aber nachdem sie sich einmal in ihrer Ecke zurechtgesetzt hatte mit dem instinktiven Gefühl für Wirkung, das sie nie im Stich ließ, schaute sie sich um in der Hoffnung, noch andere Gäste der Trenor-Party zu sehen. Sie wollte sich von sich selbst ablenken, und Konversation war das einzige Fluchtmittel, das sie kannte.
Ihre Suche wurde mit der Entdeckung eines sehr blonden Mannes mit weichem rötlichem Bart belohnt, der am andern Ende des Wagens offenbar versuchte, sich hinter einer entfalteten Zeitung zu verbergen. Lilys Augen leuchteten, und ein kleines Lächeln entspannte ihre Mundwinkel. Sie hatte gewusst, dass Mr. Percy Gryce auf Bellomont sein würde, aber sie hatte nicht mit dem glücklichen Zufall gerechnet, ihn im Zug für sich zu haben. Diese Tatsache vertrieb alle beunruhigenden Gedanken an Mr. Rosedale. Vielleicht würde der Tag schließlich doch noch besser enden, als er begonnen hatte.
Sie fing an, die Seiten ihres Romans aufzuschneiden, wobei sie in aller Ruhe ihre Beute durch die niedergeschlagenen Wimpern hindurch betrachtete und sich gleichzeitig eine geeignete Methode für den Angriff zurechtlegte. Etwas in seiner Haltung völligen Aufgehens in seine Lektüre sagte ihr, dass er sich ihrer Anwesenheit bewusst war: Kein Mensch war jemals derartig in eine Abendzeitung vertieft gewesen! Sie erriet, dass er zu schüchtern war, um zu ihr zu kommen, und dass ihr eine Möglichkeit, ihn anzusprechen, einfallen müsste, die nicht wie ein Annäherungsversuch von ihrer Seite wirken durfte. Der Gedanke, dass jemand, der so reich war wie Mr. Percy Gryce, schüchtern sein könnte, amüsierte sie; aber sie hatte sehr viel Nachsicht mit solchen Eigenarten, und außerdem konnte seine Schüchternheit ihren Zwecken besser dienen als zu viel Selbstsicherheit. Sie verstand die Kunst, den Verlegenen Selbstbewusstsein zu vermitteln, aber sie war nicht sicher, ob sie ebenso über die Fähigkeit verfügte, selbstbewusste Menschen in Verlegenheit zu bringen.
Sie wartete, bis der Zug den Tunnel verlassen hatte und durch die ärmlichen Ausläufer der nördlichen Vororte raste. Dann, als er seine Geschwindigkeit in der Nähe von Yonkers verlangsamte, stand sie auf und ging langsam den Wagen entlang. Als sie an Mr. Gryce vorüberging, schlingerte der Zug plötzlich, und er merkte, dass eine schmale Hand sich an der Rücklehne seines Sitzes festhielt. Er fuhr erschreckt auf, sein argloses Gesicht sah aus, als ob man es in karmesinrote Farbe getaucht hätte, sogar die rötliche Färbung seines Bartes schien sich zu vertiefen.
Der Zug schwankte wieder und warf Miss Bart dabei fast in seine Arme. Sie verschaffte sich mit einem Lachen Halt und trat ein wenig zurück, aber er wurde vom Duft ihres Kleides umhüllt, und seine Schulter hatte ihre flüchtige Berührung gespürt.
»Oh, Mr. Gryce, Sie sind es? Es tut mir ja so leid – ich habe gerade versucht, den Steward zu finden, um eine Tasse Tee zu bekommen.«
Sie gab ihm die Hand, als der Zug seine normale Geschwindigkeit wieder aufnahm, und stand dann noch ein wenig im Gang, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Ja – er sei auf dem Weg nach Bellomont. Er habe gehört, dass sie mit von der Partie sein würde – er errötete wieder, als er dies zugab. Und würde er auch eine Woche lang dort sein? Wie wundervoll!
Als ihr Gespräch diesen Punkt erreicht hatte, zwängten sich noch ein paar verspätete Reisende vom letzten Bahnhof in den Wagen, und Lily musste zu ihrem Sitzplatz zurückkehren.
»Der Platz neben meinem ist frei – setzen Sie sich doch zu mir«, sagte sie über die Schulter, und Mr. Gryce gelang es, wenn er auch ziemlich außer Fassung war, einen Wechsel zu bewerkstelligen, der ihn und seine Taschen an ihre Seite brachte.
»Ah, und hier ist der Steward, und vielleicht können wir unseren Tee jetzt bekommen.«
Sie winkte die Bedienung herbei, und in kürzester Zeit war – mit der Leichtigkeit, welche die Erfüllung all ihrer Wünsche zu begleiten schien – ein kleiner Tisch zwischen ihren Sitzen aufgestellt worden, und sie hatte Mr. Gryce geholfen, seine sperrigen Besitztümer unter diesem zu verstauen.
Als der Tee kam, beobachtete er sie mit wortloser Faszination, während ihre Hände über das Tablett flatterten und sich dabei wunderbar fein und schmal ausnahmen im Gegensatz zu dem groben Porzellan und klumpigen Brot. Es erschien ihm wie ein Wunder, dass jemand mit so lässiger Behendigkeit die schwere Aufgabe meistern konnte, in aller Öffentlichkeit und in einem schlingernden Zug Tee aufzugießen. Er hätte nie gewagt, ihn für sich zu bestellen, um die Aufmerksamkeit seiner Mitreisenden nicht auf sich zu lenken, aber im Schutz ihrer alles Interesse auf sich ziehenden Person, nippte er von dem tintenschwarzen Gebräu mit einem herrlichen Gefühl von Behaglichkeit.
Lily, noch mit dem Geschmack von Seldens Karawan-Tee auf den Lippen, hatte keine große Lust, diesen in der Brühe, die in der Bahn serviert wurde, zu ertränken, während diese Brühe für ihren Reisegefährten reiner Nektar zu sein schien. Aber, wie sie richtig annahm, lag einer der Reize des Tees darin, dass man ihn zusammen trinken konnte, und sie machte sich daran, Mr. Gryces Freuden zur Vollendung zu bringen, indem sie ihn über ihre erhobene Tasse hinweg anlächelte.
»Ist er richtig so, habe ich ihn nicht zu stark gemacht?«, fragte sie besorgt, und er antwortete mit Überzeugung, er habe nie besseren Tee getrunken.
»Das könnte womöglich sogar stimmen«, überlegte sie und erwärmte sich bei dem Gedanken, dass Mr. Percy Gryce, der die tiefsten Tiefen hemmungsloser Genusssucht hätte auskosten können, vielleicht wirklich seine erste Reise allein mit einer hübschen Frau unternahm.
Es schien ihr eine glückliche Fügung, dass ausgerechnet sie das Instrument zu seiner Einführung in diese Dinge sein sollte. Manche Mädchen hätten nicht gewusst, wie sie mit ihm umgehen mussten. Sie hätten die Neuheit des Abenteuers überbetont und so versucht, ihn den Reiz einer Eskapade daran empfinden zu lassen. Lilys Methoden aber waren subtiler. Sie erinnerte sich, dass ihr Cousin Jack Stepney Mr. Gryce einmal als einen jungen Mann beschrieben hatte, der seiner Mutter versprochen hat, bei Regen niemals ohne seine Überschuhe auszugehen. Lily legte diesen Hinweis also allem, was sie tat, zugrunde und beschloss, der Szene eine liebenswürdig häusliche Atmosphäre zu verleihen, in der Hoffnung, ihr Reisegefährte werde, statt zum Gefühl, etwas Leichtsinniges oder Ungewöhnliches zu tun, vielmehr zum Nachdenken über die Vorteile einer ständigen Begleiterin gebracht, die einem im Zug den Tee zubereitet.
Aber trotz ihrer Bemühungen ging ihnen der Gesprächsstoff aus, nachdem das Tablett weggeräumt worden war, und sie hatte Anlass, aufs Neue Mr. Gryces Grenzen abzuschätzen. Es war schließlich nicht Gelegenheit, sondern Phantasie, was ihm fehlte, sein geistiger Gaumen würde niemals lernen, zwischen dem Tee der Bahn und Nektar zu unterscheiden. Es gab jedoch ein Thema, auf das sie immer zurückgreifen konnte, eine Triebfeder, die sie nur berühren musste, um seine einfache Mechanik in Bewegung zu setzen. Sie hatte sich das bisher versagt, weil dies ein letztes Mittel für sie war, und hatte auf andere Künste gezählt, um andere Gefühle zu wecken. Als aber nach und nach ein entschiedener Zug von Langeweile auf seinem offenen Gesicht erschien, erkannte sie, dass extreme Maßnahmen vonnöten waren.
»Und wie«, sagte sie und lehnte sich dabei vor, »geht es mit Ihren Amerikana voran?«
Seine Augen wurden gleich ein bisschen weniger trübe; es war, als ob ein Film, der eben im Entstehen begriffen war, von ihm abgezogen worden wäre, und Lily empfand den Stolz eines geschickten Operateurs.
»Ich habe da ein paar neue Sachen«, sagte er, durchströmt von Freude, wobei er aber seine Stimme senkte, als ob er fürchtete, seine Mitreisenden könnten sich verbündet haben, um ihn auszuplündern.
Sie entgegnete mit einer verständnisvollen Rückfrage, und ganz allmählich wurde er dazu gebracht, von seinen letzten Erwerbungen zu erzählen. Dies war das einzige Gesprächsthema, das es ihm ermöglichte, sich selbst zu vergessen, oder vielmehr ihm erlaubte, sich seiner selbst ohne Befangenheit bewusst zu sein, denn das war sein Feld, und hier vermochte er eine Überlegenheit geltend zu machen, die ihm nur sehr wenige streitig machen konnten. Kaum einer seiner Bekannten hatte Interesse an Amerikana oder wusste etwas über sie, und das Bewusstsein dieser Unkenntnis machte Mr. Gryces Kenntnisse zu einer angenehmen Erleichterung. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, das Thema ins Gespräch zu bringen und an ihm als Hauptgesprächsgegenstand festzuhalten; die meisten Menschen zeigten leider kein Bedürfnis, ihre Unwissenheit vermindert zu sehen, und Mr. Gryce war daher so etwas wie ein Kaufmann, dessen Lagerhäuser bis zum Dach mit Waren gefüllt sind, die er nicht auf den Markt bringen kann.
Aber Miss Bart wollte, wie es schien, wirklich etwas über Amerikana erfahren, und darüber hinaus war sie bereits informiert genug, um die Aufgabe weiterer Belehrung ebenso leicht wie angenehm zu gestalten. Sie befragte ihn auf sehr intelligente Weise, sie lauschte ihm ergeben, und da er auf den Ausdruck von Lethargie gefasst gewesen war, der normalerweise auf den Gesichtern seiner Zuhörer erschien, wurde er unter ihrem aufnahmebereiten Blick geradezu beredt. Die Bruchstücke, die sie klugerweise bei Selden hatte sammeln können – genau diesen Zufall voraussehend –, halfen ihr nun so ausgezeichnet, dass sie schon anfing, ihren Besuch bei ihm für das glücklichste Vorkommnis des Tages zu halten. Sie hatte wieder einmal ihr Talent bewiesen, vom Unerwarteten zu profitieren, und unter der Oberfläche lächelnder Aufmerksamkeit, die sie ihrem Reisegefährten weiterhin zuwandte, keimten gefährliche Theorien darüber, ob es ratsam sei, plötzlichen Eingebungen zu folgen.
Mr. Gryces Gefühle waren, wenn auch weniger entschieden, doch ebenso angenehm. Er empfand das undeutliche Kitzeln, mit dem die niederen Organismen auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse reagieren, und all seine Sinne taumelten in einem vagen Wohlgefühl, durch das er Miss Barts Person undeutlich aber wohltuend wahrnahm.
Mr. Gryces Interesse für Amerikana war nicht aus ihm selbst heraus erwachsen; es war unmöglich, ihn sich als jemanden vorzustellen, der eigenständig Geschmack an einer Sache findet. Ein Onkel hatte ihm eine Sammlung hinterlassen, die in bibliophilen Kreisen bereits Beachtung gefunden hatte. Das Vorhandensein dieser Sammlung war das Einzige, das je dem Namen Gryce eine gewisse Glorie verliehen hatte, und der Neffe war so stolz auf sein Erbe, als ob es sein eigenes Werk gewesen wäre. Es kam sogar so weit, dass er es als solches ansah und ein Gefühl persönlicher Selbstzufriedenheit empfand, wenn ihm ein Hinweis auf die Gryce’schen Amerikana in die Hände kam. Ängstlich bemüht, wie er war, persönlich nicht aufzufallen, hatte er doch ein so exquisites und übermäßiges Vergnügen daran, seinen Namen gedruckt zu sehen, dass dies geradezu ein Ausgleich für seine Furcht vor der Erregung persönlichen Aufsehens zu sein schien.
Um dieses Gefühl so oft wie möglich genießen zu können, abonnierte er alle Zeitschriften, die sich mit dem Sammeln von Büchern im Allgemeinen und mit amerikanischer Geschichte im Besonderen befassten. Da sich die Hinweise auf seine Bibliothek in den Seiten dieser Journale häuften, die sein einziger Lesestoff waren, begann er, sich selbst als jemanden zu sehen, der eine wichtige Stellung in der Öffentlichkeit einnimmt, und fing an, den Gedanken daran zu genießen, welches Interesse die Leute, die er auf der Straße traf oder zwischen denen er auf Reisen saß, an ihm haben würden, wenn sie plötzlich erführen, dass er der Besitzer der Gryce’schen Amerikana sei.
Die meisten Ängste haben solche geheimen Möglichkeiten der Kompensation, und Miss Bart war scharfsichtig genug zu erkennen, dass innere Eitelkeit im Allgemeinen in direkter Proportion zur äußeren Geringschätzung der eigenen Person steht. Mit einem selbstbewussteren Menschen hätte sie nicht gewagt, sich so lange bei einem Thema aufzuhalten oder so übertriebenes Interesse dafür zu zeigen; aber sie hatte erraten, dass Mr. Gryces Egoismus ein durstiger Boden war, der nach ständiger Nahrung von außen verlangte. Miss Bart hatte die Gabe, einen verborgenen Gedankengang zu verfolgen, während sie an der Oberfläche der Unterhaltung mit Leichtigkeit dahinzugleiten schien, und in diesem Fall nahm ihr gedanklicher Abstecher die Gestalt eines schnellen Überblicks von Mr. Percy Gryces Zukunft in Verbindung mit ihrer eigenen an. Die Gryces kamen aus Albany und waren erst vor kurzem in die Hauptstadt eingeführt worden, in die Mutter und Sohn nach dem Tode des alten Jefferson Gryce gekommen waren, um sein Haus in der Madison Avenue in Besitz zu nehmen – ein scheußliches Haus, ganz brauner Stein von außen und schwarzes Walnussholz von innen, mit der Gryce’schen Bibliothek in einem feuersicheren Anbau, der wie ein Mausoleum aussah. Lily wusste jedoch bereits alles über sie: Die Ankunft des jungen Mr. Gryce hatte die Mutterherzen von New York höher schlagen lassen, und wenn ein Mädchen keine Mutter hat, die für es ins Zittern kommt, muss es verständlicherweise selbst auf dem Posten sein. Lily hatte deshalb nicht nur dafür gesorgt, den Weg des jungen Mannes zu kreuzen, sondern auch die Bekanntschaft von Mrs. Gryce gemacht, einer monumentalen Erscheinung mit der Stimme eines Kanzelpredigers und einem Kopf, der voll war von den Schandtaten ihrer Dienstboten. Diese Dame kam manchmal, um Mrs. Peniston Gesellschaft zu leisten und zu erfahren, wie es ihr gelang, das Küchenmädchen daran zu hindern, Esswaren aus dem Haus zu schmuggeln. Mrs. Gryces Wohltätigkeit war von ganz und gar unpersönlicher Art: Fälle, in denen es um die Notlage eines Einzelnen ging, betrachtete sie mit Misstrauen, aber sie unterstützte Institutionen, wenn deren Jahresbericht ein eindrucksvolles Plus verzeichnete. Ihre häuslichen Pflichten waren zahlreich, denn sie reichten von heimlichen Inspektionen der Dienstbotenkammern bis zu unangekündigten Besuchen im Keller; viele Vergnügungen hatte sie sich dagegen nie erlaubt. Einmal jedoch ließ sie eine Sonderausgabe des Sarum Rule1 in roter Schrift drucken und versah alle Kleriker der Diozöse damit. Das vergoldete Album, in dem die Dankesbriefe eingeklebt waren, stellte das wichtigste Schmuckstück auf dem Tisch ihres Salons dar.
Percy war nach Grundsätzen erzogen worden, die eine so exzellente Frau gar nicht umhinkonnte, ihm einzuimpfen. Jede Form von Vorsicht und Misstrauen war einer Natur eingepflanzt worden, die von sich aus schon zögernd und vorsichtig war, mit dem Resultat, dass es für Mrs. Gryce kaum nötig gewesen wäre, ihrem Sohn das Versprechen wegen der Überschuhe abzunehmen, so wenig wahrscheinlich war es, dass er sich im Regen draußen in Gefahr gebracht hätte. Nachdem er volljährig geworden war und das Vermögen des seligen Mr. Gryce geerbt hatte, das dieser mit einem Patent, um frische Luft von Hotels fernzuhalten, gemacht hatte, lebte der junge Mann zunächst weiterhin mit seiner Mutter in Albany; aber nach Jefferson Gryces Tod, als ein weiterer großer Besitz in die Hände ihres Sohnes überging, fand Mrs. Gryce, dass, was sie seine »Interessen« nannte, seine Anwesenheit in New York erforderte. Sie ließ sich also in dem Haus in der Madison Avenue nieder, und Percy, dessen Pflichtgefühl dem seiner Mutter in nichts nachstand, verbrachte all seine Wochentage in einem hübschen Büro in der Broad Street, wo ein Trupp blasser Männer für ein kleines Gehalt bei der Verwaltung der Gryce’schen Besitzungen ergraut war, und wo er mit angemessener Ehrerbietung in alle Einzelheiten der Kunst des Geldscheffelns eingewiesen wurde.
Soweit Lily in Erfahrung bringen konnte, war dies bisher Mr. Gryces einzige Beschäftigung gewesen, und man sollte ihr verzeihen, dass sie die Aufgabe nicht als allzu schwer empfand, das Interesse eines jungen Mannes zu wecken, den man bei so strenger Diät gehalten hatte. Auf jeden Fall fühlte sie sich so völlig Herrin der Lage, dass sie sich einem Gefühl der Sicherheit hingab, in dem alle Furcht vor Mr. Rosedale und vor den Schwierigkeiten, von denen diese Furcht abhing, hinter dem Horizont bewussten Denkens verschwanden.
Dass der Zug in Garrisons hielt, hätte sie von ihren Gedanken nicht abgelenkt, wenn sie nicht plötzlich einen gequälten Ausdruck in den Augen ihres Reisegefährten entdeckt hätte. Sein Sitz war der Tür zugewandt, und sie erriet, dass er von einem sich nähernden Bekannten beunruhigt worden war, eine Tatsache, die durch sich umwendende Köpfe und eine allgemeine Unruhe bestätigt wurde, so wie es oft geschah, wenn sie selbst ein Eisenbahnabteil betrat.
Sie erkannte die Symptome sofort und war nicht erstaunt, von der hohen Stimme einer hübschen Frau begrüsst zu werden, die in den Zug kam in Begleitung einer Zofe, eines Bullterriers und eines Gepäckträgers, der unter der Last von Taschen und Reisenecessaires daherwankte.
»Oh, Lily – fährst du nach Bellomont? Dann kannst du mir wohl nicht deinen Platz überlassen, oder? Aber ich muss einen Platz in diesem Abteil finden – Schaffner, Sie müssen mir sofort einen Platz besorgen! Kann nicht jemand woanders hingesetzt werden? Ich will bei meinen Freunden sitzen. Oh, wie geht es Ihnen, Mr. Gryce? Versuchen Sie doch ihm begreiflich zu machen, dass ich einen Sitzplatz bei Ihnen und Lily haben muss!«
Mrs. George Dorset stand in der Mitte des Ganges, ohne auf den schüchternen Versuch eines Reisenden mit einer Reisetasche zu achten, der sein Bestes tat, ihr Platz zu machen, indem er ausstieg; sie verbreitete um sich jene allgemeine Irritation, die gutaussehende Frauen auf Reisen nicht selten verursachen.
Sie war kleiner und schlanker als Lily Bart, mit einer ruhelosen Biegsamkeit in ihrer Haltung, so als ob man sie hätte zusammenknüllen und durch einen Ring ziehen können, wie die wallenden Stoffe, an denen sie Gefallen fand. Ihr kleines blasses Gesicht schien nur die Fassung für ein Paar dunkler unglaublicher Augen zu sein, deren träumerischer Blick in sonderbarem Kontrast zu der Selbstsicherheit ihrer Stimme und Gestik stand, so dass einer ihrer Freunde bemerkte, sie gleiche einem körperlosen Geist, der eine Menge Raum einnahm.
Nachdem sie schließlich doch entdeckt hatte, dass der Sitzplatz neben Miss Bart zu ihrer Verfügung stand, nahm sie ihn mit einer weiteren Verdrängung ihrer Umgebung in Besitz, während sie erklärte, dass sie am Morgen in ihrem Wagen von Mount Kisko gekommen sei und sich in Garrisons eine Stunde lang die Beine in den Bauch habe stehen müssen, noch dazu ohne den Trost einer Zigarette, weil der Rohling von Ehemann vergessen hatte, ihr Etui aufzufüllen, bevor sie am Morgen weggefahren war.
»Und um diese Tageszeit hast du, nehme ich an, keine einzige mehr übrig, oder Lily?«, schloss sie mit klagender Stimme.
Miss Bart fing den erstaunten Blick von Mr. Percy Gryce auf, dessen Lippen nie von Tabak besudelt wurden.
»Was für eine absurde Frage, Bertha!«, rief sie und errötete bei dem Gedanken an den Vorrat, den sie bei Lawrence Selden angelegt hatte.
»Wieso, rauchst du nicht? Seit wann hast du es denn aufgegeben? Was – du hast nie – und Sie auch nicht, Mr. Gryce? Ah, natürlich – wie dumm von mir – ich verstehe.«
Und Mrs. Dorset lehnte sich zurück in ihre Reisepolster mit einem Lächeln, das Lily wünschen ließ, es wäre kein Platz neben ihrem frei gewesen.
III
Bridge dauerte auf Bellomont meist bis in die frühen Morgenstunden; und als Lily in dieser Nacht zu Bett ging, hatte sie länger gespielt, als sie sich leisten konnte.
Weil sie kein Bedürfnis verspürte, in ihr Zimmer zu gehen, wo sie sich für ihr Verhalten würde Rechenschaft ablegen müssen, verweilte sie noch ein wenig auf der breiten Treppe und schaute in den Saal hinunter, wo die letzten Kartenspieler um ein Tablett mit hohen Gläsern und silberummantelten Karaffen gruppiert saßen, das der Butler gerade auf einem niedrigen Tisch neben dem Kamin abgesetzt hatte.
Der Saal war mit Arkaden versehen und mit einer Galerie, die von Säulen aus blassgelbem Marmor getragen wurde. Hohe Büsche blühender Pflanzen hatte man vor dem Hintergrund dunklen Blattwerks in den Ecken arrangiert. Auf dem karmesinroten Teppich dösten ein Jagdhund und einige Spaniels wohlig vor dem Feuer, und das Licht der großen Deckenlampe in der Mitte des Raumes gab dem Haar der Frauen strahlenden Glanz und ließ ihre Juwelen Funken sprühen, wenn sie sich bewegten.
Es gab Augenblicke, in denen solche Szenen Lily viel Freude bereiteten, in denen sie ihrem Sinn für Schönheit und ihrem Verlangen nach der äußerlichen Vollendung des Lebens entgegenkamen; es gab aber auch solche, in denen sie ihr noch verschärft vor Augen führten, wie dürftig ihre eigenen Möglichkeiten waren. Jetzt war gerade ein Moment, in dem sie vornehmlich diesen letzten Gegensatz empfand, und sie wandte sich ungeduldig ab, als Mrs. George Dorset Percy Gryce hinter sich her in ein vertrauliches Eckchen unter der Galerie zog, wobei der Flitter, der sich auf ihrem Kleid schlängelte, im Licht glitzerte.
Nicht, dass Miss Bart gefürchtet hätte, sie könnte den eben erst erworbenen Einfluss auf Mr. Gryce verlieren. Mrs. Dorset würde ihn vielleicht in Erstaunen versetzen oder blenden können, aber sie hatte weder das Geschick noch die Geduld, ihn wirklich zu erobern. Sie war zu ichbezogen, um die Tiefen seiner Schüchternheit zu ergründen, und außerdem, warum sollte sie sich die Mühe machen? Höchstens einen Abend lang konnte es sie amüsieren, sich über seine einfache Art lustig zu machen – danach würde er ihr nur zur Last fallen, und weil sie das wusste, würde sie ihn, erfahren, wie sie war, nicht ermutigen. Aber allein der Gedanke an diese andere Frau, die sich einen Mann nehmen und ihn beiseite schieben konnte, wie sie wollte, ohne ihn als möglichen Faktor in ihren Plänen ansehen zu müssen, erfüllte Lily mit Neid. Percy Gryce hatte sie den ganzen Nachmittag über gelangweilt – schon der Gedanke an ihn schien ein Echo seiner eintönigen Stimme in ihr wachzurufen –, aber sie konnte ihn am andern Morgen nicht einfach unbeachtet lassen, sie musste ihren Erfolg ausnutzen, musste sich weiterer Langeweile unterwerfen, musste ihm von neuem entgegenkommen und ihr Anpassungsvermögen unter Beweis stellen, und all das allein in der Hoffnung, dass er ihr schließlich und endlich die Ehre geben würde, sie für den Rest ihres Lebens zu langweilen.
Ihr Schicksal war hassenswert, aber wie konnte man ihm entrinnen? Welche Wahl hatte sie denn? Sie konnte nur sie selbst sein oder eine Gerty Farish. Als sie ihr Schlafzimmer betrat mit seinem weich abgedunkelten Licht, den Morgenrock aus Spitze über die seidene Bettdecke gebreitet, ihren bestickten Pantöffelchen vor dem Kamin, mit einer Vase voller Nelken, welche die Luft mit ihrem Duft erfüllten, und den neuesten Romanen und Magazinen, die noch unaufgeschnitten auf einem Tisch neben der Leselampe lagen, kam ihr Miss Farishs beengte Wohnung in den Sinn, deren billige Annehmlichkeiten und hässliche Tapeten. Nein, für vulgäre und schäbige Umgebungen, für die elenden Kompromisse der Armut, war sie einfach nicht gemacht. Ihr ganzes Wesen entfaltete sich erst in einer Atmosphäre von Luxus; das war der Hintergrund, den sie brauchte, das einzige Klima, in dem sie zu atmen vermochte. Aber der Luxus anderer war nicht das, was sie wollte. Vor wenigen Jahren hatte er ihr noch genügt: Sie hatte ihre tägliche Zuteilung an Vergnügen angenommen, ohne sich darum zu kümmern, wer sie ihr gab. Jetzt fing sie an, die Verpflichtungen, die daraus erwuchsen, als aufreibend zu empfinden; sie fühlte sich wie jemand, der den Glanz nur als Leihgabe erhält, den sie einmal als ihren eigenen betrachtet hatte. Es gab sogar Augenblicke, in denen ihr bewusst wurde, dass sie für ihren Lebensstil bezahlen musste.
Lange Zeit hatte sie sich geweigert, Bridge zu spielen. Sie wusste, dass sie es sich nicht leisten konnte, und sie fürchtete sich davor, Geschmack an etwas so Kostspieligem zu finden. Sie hatte die Gefahr am Beispiel von mehr als einem ihrer Bekannten erkannt; einer war Ned Silverton, der liebenswerte blonde junge Mann, der jetzt mit völliger Hingabe dicht neben Mrs. Fisher saß, einer auffälligen, geschiedenen Dame mit Augen und Gewändern, die ebenso aufdringlich wirkten wie die Schlagzeilen, die ihrem »Fall« gewidmet worden waren. Lily konnte sich noch erinnern, wie der junge Silverton in ihren Kreis gestolpert war, mit dem Auftreten des verirrten Arkadiers, der entzückende Sonette in der Zeitschrift seines Colleges veröffentlicht hatte. Seither hatte er eine Vorliebe für Mrs. Fisher und Bridge entwickelt, und Letzteres zumindest hatte ihn in Unkosten gestürzt, aus denen ihn mehr als einmal gequälte, unverheiratete Schwestern gerettet hatten, die seine Sonette wie einen Schatz hüteten und ihren Tee ohne Zucker tranken, um ihren Liebling weiterhin über Wasser zu halten. Neds Fall war Lily vertraut: Sie hatte gesehen, wie der Ausdruck seiner bezaubernden Augen – die viel mehr Poesie in sich hatten als seine Sonette – sich veränderte, zunächst von Überraschung in Vergnügen und dann von Vergnügen in Angst, als er nach und nach den Verlockungen des schrecklichen Glücksgottes erlag, und sie hatte Angst davor, dieselben Symptome an sich zu entdecken.