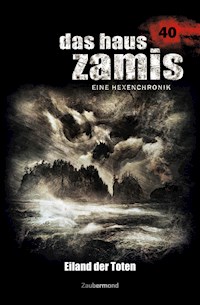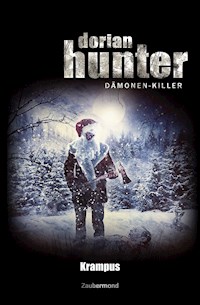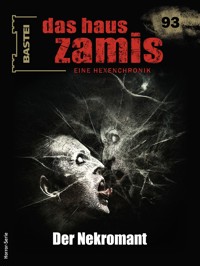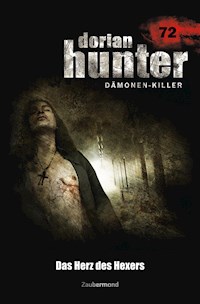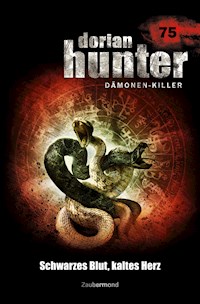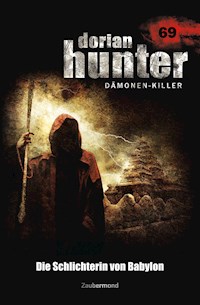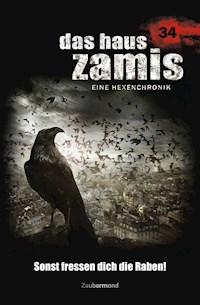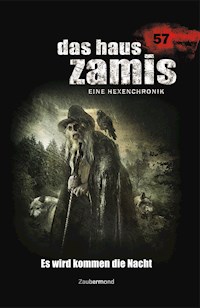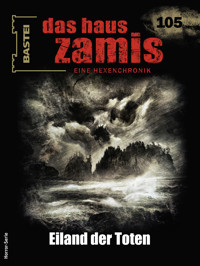
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Was kann ich für dich tun?«, fragte ich Asmodi.
»Du wirst an einer Besichtigungstour teilnehmen.«
Ich runzelte die Stirn. Das klang viel zu harmlos, um alles gewesen zu sein. »Was für eine Besichtigungstour?«
»Die Insel Île de Sainte Croix steht zum Verkauf. Der Verwalter hat am nächsten Wochenende mögliche Investoren zu einer Besichtigung eingeladen.«
Ich runzelte die Stirn. »Das war’s? Wo ist der Haken?«
»Du stellst zu viele Fragen, Coco.«
»Ich versuche nur herauszufinden, an welcher Stelle es für mich gefährlich wird«, verteidigte ich mich.
»Wenn du den Auftrag zur Abwechslung einmal zu meiner Zufriedenheit erfüllst, bekommst du sogar dein Balg zurück.«
»Wann soll ich aufbrechen?«, fragte ich, mühsam die Wut unterdrückend.
»Morgen ...«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
EILAND DER TOTEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. Michael Zamis sucht indes Verbündete unter den Oppositionsdämonen, die sich Asmodis Sturz auf die Fahnen geschrieben haben. Sein Unternehmen scheitert, und er wird von Asmodi zur Strafe in eine krötenartige Kreatur verwandelt. Während eines Schwarzen Sabbats wird Asmodi von Thekla Zamis vorgeführt. Aus Angst vor seiner Rache flüchten die Zamis vorübergehend aus Wien, kehren schließlich jedoch dorthin zurück. Asmodi erlöst Michael Zamis von seinem Freak-Dasein. Im Gegenzug soll Coco Asmodis missratenen Sohn Dorian Hunter töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Bald erhält das Café Zamis Besuch von Osiris' Todesboten. Sie überbringen die Nachricht, dass Coco innerhalb einer Woche sterben wird. Ebenso erhalten ihr Vater Michael und Skarabäus Toth die Drohung. Alle drei bitten Asmodi um Hilfe, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr ungeborenes Kind entrissen. Mit Hilfe ihres Bruders Volkart gelingt es Coco, die Todesboten zu besiegen, doch Asmodi gibt das Kind zunächst nicht wieder her. Im Gegenteil, er erpresst Coco. In seinem Auftrag reist sie nach Moskau, zusammen mit dem zwielichtigen Dämon Helmut von Bergen. Coco trifft dort auf Theodotos Wolkow, einen dämonischen Oligarchen, der in Besitz des Schwarzen Zimmers sein soll. Er besitzt aber nur einen Teil davon. Wolkow wird vom Schwarzen Zimmer verschlungen, während Michael Zamis den Zugang für immer verschließt. Aber wieder hat Coco den Auftrag nicht zu Asmodis Bedingungen erfüllt. Abermals gibt er den Fötus nicht heraus – mehr noch, er behauptet, das Kind sei nicht von Hunter, sondern von ihm ...
EILAND DER TOTEN
von Susanne Wilhelm
Schwester Azela hielt inne, um das Kruzifix an der Wand wieder ordnungsgemäß auf den Kopf zu drehen. Bei den Ausschweifungen der vergangenen Nacht musste jemand dagegen gestoßen sein, und es hatte sich so gedreht, dass der leidende Christus mit den Füßen nach unten hing. Schwester Azela verzog das Gesicht, als sie daran dachte, was der Gast, den sie am Tor abholen sollte, dazu gesagt hätte. Gut, dass sie es rechtzeitig bemerkt hatte.
Sie trat zurück, überprüfte ihr Werk mit einem letzten, kritischen Blick und eilte dann weiter.
Der Gast wartete schon ungeduldig, als Azela das Tor mit einer tiefen Verbeugung öffnete. Es war derselbe Mann, der immer an diesem Tag in der Woche kam. Sie sah ihn mit einem freundlichen Lächeln an, doch ihr Blick glitt an seinem Gesicht ab, fand keinen Halt.
»Bring mich zu ihr«, forderte er.
»Sofort. Bitte folgen Sie mir.«
1. Kapitel
Sie schlug den Weg ein, den sie gekommen war, die schweren Schritte des Besuchers immer hinter ihr. Die Echos in den alten Gängen ließen es klingen, als säße ihr eine ganze Armee im Nacken. Schließlich sah sie am Ende des Ganges den Schein der blauen Flammen. Dann kam das Feuerbecken in Sicht, und daneben, halb im Schatten, die schwere, alte Tür.
»Es ist schlimmer geworden«, sagte sie leise, während der Gast die Hände in die Flammen hielt.
»Tatsächlich?«, fragte er scharf.
Sie biss sich auf die Unterlippe. Dumm von ihr. Natürlich war es schlimmer geworden. Es wurde immer schlimmer.
Der Gast schöpfte einen Teil des blauen Feuers heraus. Die magischen Flammen züngelten auf seinen Handflächen. Er spritzte sie sich wie Wasser ins Gesicht, wo sie genauso abperlten wie Azelas Blicke. Sie flossen an seinem Oberkörper hinab und landeten als langsam verglühende Pfützen auf dem Steinboden.
»Wir haben noch eine weitere Schutzmaßnahme eingeführt.« Schwester Azela nahm eine Pestmaske von einem Ständer im Schatten des Beckens. Sie war weiß, besaß einen langen Schnabel.
»Eine alte Pestmaske?« Der Gast klang amüsiert.
»Mit einer ganz besonderen Mischung von Kräutern und gemahlenen Knochen im Schnabel.«
»Nun gut.« Er setzte die Maske auf, und endlich hatte Azelas Blick etwas, an dem sie sich festhalten konnte. »Können wir dann?«
Eilig öffnete sie die Tür.
Gemeinsam mit dem Gast trat sie ein. Der Gestank nahm ihr beinahe den Atem. Das Zimmer war dunkel, die Gestalt im Bett nur schemenhaft zu erkennen.
Schwester Azela blieb bei der Tür stehen. Der Gast trat auf das Bett zu. »Theresa.«
»Mein Liebster.« Theresas Stimme klang heiser. »Du kommst immer noch.«
»Natürlich.« Er setzte sich auf einen Schemel neben dem Bett und ergriff Theresas Hand. »Ich will dich sehen.«
»Nein, glaube mir, das willst du nicht.«
»Doch. Schwester, zieh die Vorhänge auf!«
Schwester Azela eilte zu den Vorhängen und zog sie zur Seite. Sonnenlicht flutete in den Raum. Sie senkte den Blick und bemühte sich, nicht hinzusehen. Aber sie konnte nichts dagegen tun. Aus dem Augenwinkel erhaschte sie einen Blick auf Theresas Gesicht.
Die Augen waren zwei Edelsteine inmitten einer Kraterlandschaft. Die ehemals seidige Haut Theresas war von schwarzen Pusteln übersät. An einigen Stellen waren sie aufgeplatzt. Eiter floss heraus, den Theresa mit einem einstmals weißen Spitzentaschentuch abwischte.
Theresa hob eine Hand. »Sieh mich nicht an!«
»Ich will sehen, wofür ich ein Heilmittel zu finden habe.«
»Niemand findet ein Heilmittel gegen die Dämonenpest.«
Der Gast ballte die Hände zur Faust. »O doch! So viele habe ich ihr bereits zum Fraß vorgeworfen. Ich werde sie auch zurückrufen! Sie hat mir zu gehorchen.«
Theresa schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht mehr genug Zeit!«
Wieder ergriff der Gast ihre Hand. Er beugte sich vor, und der Schnabel der Maske berührte fast ihr zerstörtes Gesicht. »Ich werde dein Leben retten, Theresa. Ich schwöre es.«
St. Petrus, Frankreich
Jacques
Jacques sah sich zufrieden um. Beinahe fünfzig Personen hatten sich vor dem Rathaus in St. Petrus versammelt. Ein voller Erfolg für diese Demonstration. Die Menschen trugen Plakate mit der Aufschrift:
»Finger weg von der Île de Sainte Croix.«
»Keine Macht dem Geiz!«
Oder: »Die Insel gehört uns!«
Besonders gut gefiel Jacques das Transparent, das die Witwe Magdalena gebastelt hatte. »Wir werden keine Touristenfalle.« Andererseits, vielleicht gefiel ihm vor allem die Witwe, deren Busen wogte, während sie ihr Transparent schwenkte. Mit ihrer energischen Art erinnerte sie ihn an seine Antonia – Gott habe sie selig.
Jean stieß ihn in die Seite. »Noch ein Sprechchor?«
Jacques riss sich vom Anblick der Witwe los. »Warum nicht?«
Sofort hob Jacques' schmächtiger Kollege sein Megafon. »Was wollen wir nicht, Leute?«
»Dass die Insel verkauft wird!«, rief die Menge.
»Was wollen wir hier nicht?«
»Touristen!«
»Wem gehört die Insel?«
»Uns!«
»Was sagen wir?«, rief Jean.
»Kein Geld von reichen Investoren«, brüllten die Demonstranten. »Sonst gibt's was auf die Ohren.«
Der Reim war verbesserungswürdig, das musste Jacques zugeben. Doch insgesamt lief die Aktion nicht schlecht.
Jean ließ das Megafon sinken. Er lehnte sich zu Jacques und senkte die Stimme. »Ernsthaft, Jacques. Ich denk immer noch, diese reichen Russen, oder was auch immer, sollen sich an der verfluchten Insel einfach mal die Zähne ausbeißen.«
»Komm mir nicht wieder mit den Schauergeschichten, Jean.«
Jean schnaubte beleidigt. »Ich hab sie gesehen, die wandelnden Toten.«
»Du hast ein paar Gestalten im Nebel gesehen.«
»Aber die sind echt komisch gelaufen. So steif und so. Und sie haben ganz schrecklich gestöhnt. War wirklich unheimlich. Glaub's mir. Und was ist mit Pierre?«
Jacques schüttelte den Kopf. »Pierre ist besoffen ins Wasser gefallen und ertrunken.«
»Warum wurde dann nie seine Leiche gefunden?«
Jacques zuckte mit den Schultern. »Das Meer ist groß und die Fische hungrig. Haben wir das nicht alles schon diskutiert?«
Jean hob die Hände. »Ist ja gut. Ich unterstütz dich ja auch. Aber denk noch mal über den Plan für heute Nachmittag nach.«
»Jean, es ist nur eine Insel.«
»Eine verlassene, unheimliche Insel.«
»Verlassene Orte sind immer ein bisschen unheimlich.«
Die Sprechgesänge ließen langsam nach. Jean hob wieder das Megafon. »Was sagen wir?«
»Die Insel gehört uns!«, brüllte die Menge.
Erneut senkte er das Megafon. Er spähte Richtung Rathaus. »Sieht nicht so aus, als würden wir was erreichen.«
Tatsächlich regte sich im Rathaus auffallend wenig.
»Vielleicht sollten wir's gut sein lassen für heute«, schlug Jean vor.
»Da kommt er!«, rief in diesem Moment die Witwe Magdalena.
Jacques sah sich nach ihr um. Sie deutete zur linken Ecke des Rathauses. Dort kam der Bürgermeister gerade vom Parkplatz. Er trug noch Gummistiefel und seine Arbeitshose.
»Jetzt noch mal alle«, rief Jean durch das Megafon.
»Kein Geld von reichen Investoren! Sonst gibt's was auf die Ohren!«
»Was soll das hier?« Bürgermeister Lafayette kam etwas außer Atem vor dem Eingang des Rathauses an. »Jacques? Jean?«
»Wir protestieren gegen den Verkauf der Insel«, erklärte Jacques.
Müde fuhr sich der Bürgermeister über die spärliche Haartracht. »Wir haben doch eine Abstimmung gemacht. Der Verkauf ist beschlossen.«
»Die ganzen jungen Leute haben dafür gestimmt!«, protestierte die Witwe. »Denen ist doch egal, was aus St. Petrus wird! Die ziehen doch eh alle früher oder später in irgendeine Stadt!«
Der Bürgermeister seufzte. »Sie ziehen weg, weil sie hier keine Jobs finden. Wenn ein paar Touristen herkämen ...«
»Sie würden Jobs finden!«, brüllte jemand von weiter hinten dazwischen. »Wenn sie Fischer werden würden! Aber dafür sind sie sich ja zu fein!«
Bürgermeister Lafayette schüttelte den Kopf. »Es wurde nun mal abgestimmt, und die Mehrheit war dafür. Also machen wir's. So funktioniert Demokratie, Leute.«
»Hab schon immer gesagt, dass die jungen Leute viel zu früh wahlberechtigt sind«, grummelte jemand aus der Menge.
»Das lassen wir uns nicht gefallen!«, rief die Witwe und wedelte mit ihrem Transparent. Jacques konnte nicht anders, als ihr zuzustimmen.
»Genau«, rief er. »Wenn niemand auf uns hören will, dann gehen wir jetzt eben zum zweiten Teil der Demonstration über!«
»Jacques, bitte überleg's dir noch mal«, flüsterte Jean. Doch gleichzeitig strahlte die Witwe Jacques an. Es war längst zu spät, um es sich anders zu überlegen.
»Wir besetzen die Insel!«
Jubel brandete Jacques entgegen.
Als der erste Nebel über das Wasser kroch, begann Jacques an seinem Plan zu zweifeln.
Er stand an der Reling von Jeans Fischerboot. Die Witwe stand im Bug und spähte nach vorn. Sie hatten nur kurz miteinander geredet, und sie hatte ihm erzählt, wie glücklich sie damit war, mit ihren beiden Töchtern zusammen einen männerfreien Haushalt zu führen. Mit einem Mal hatte der Tag viel von seiner Großartigkeit verloren.
Und nun kam auch noch der Nebel. Er folgte zeitverzögert den Bewegungen der Wellen. Ein ganz eigenes, träges Meer. Er legte sich um den Bug des Boots, und Nebelfinger krochen daran hoch, schienen nach Jacques zu greifen.
Wenig später legten sich Nebelschwaden auch auf Jacques' Gesicht. Er spähte nach vorne, konnte aber nur eine dunkle Form erkennen, von der sich nur vermuten ließ, dass es die Insel sein könnte. Mistwetter. Wo war der Nebel plötzlich hergekommen? Nicht gerade das typische Wetter für St. Petrus im Herbst.
Mit einem Mal schrie die Witwe auf.
Jacques eilte nach vorne zum Bug. Magdalena deutete mit bebendem Finger in die Fluten. »Da ... da!«
»Was ist?« Jacques beugte sich vor, konnte aber nur wogende, weiße Schwaden und darunter ein paar schmutzig graue Wellen erkennen.
»Da war eine Hand!«
»Eine Hand?«
Die Witwe drückte eine Hand an ihre Brust. »Sie hat kurz aus dem Wasser geragt!«
»Jean!«, rief Jacques nach hinten Richtung Steuer. »Irgendeine Meldung, dass bei den anderen Schiffen jemand ins Wasser gefallen ist?«
»Was? Nee.«
»Dort!«, schrie die Witwe.
Diesmal sah Jacques es auch. Und es war keine Hand. Es war ein Kopf, der aus dem Wasser ragte. Dunkle Augenhöhlen starrten Jacques durch den Nebel an. Dann waren sie wieder verschwunden.
»Was zum ...«
Von einem der anderen Boote hallte ein Schrei herüber. Etwas platschte.
»Mann über Bord!«
»Hey, Jacques«, rief Jean. »Jetzt gibt's ne Meldung.«
»Ich sehe nichts in dem verdammten Nebel. Was ist da passiert?« Jacques kniff die Augen zusammen, doch das machte die Umrisse der anderen Boote in den weißen Schwaden auch nicht besser sichtbar.
Weitere Schreie hallten über das Wasser. Sie klangen panisch, mischten sich mit verwirrten Rufen.
»Was ist da passiert?«
»Louis, wo bist du?«
»Weg von der Reling!«
Und dann schrie auch die Witwe Magdalena wieder.
Aus dem Wasser war wieder der Kopf aufgetaucht, diesmal nahe der Bordwand. Eine Hand tastete am Bug nach oben und fand an einer Zierleiste Halt. Der zugehörige Arm steckte in einem zerfetzten Ärmel. Jacques kniff die Augen zusammen. Irgendetwas anderes hing ebenfalls in Fetzen von dem Arm herab ...
Er schnappte nach Luft. Die Haut! Weißes, blutleeres Fleisch kam darunter zum Vorschein. Und die Augenhöhlen, die Jacques anstarrten, sie blieben leer, egal wie genau Jacques hinsah. Es waren keine Augen mehr darin.
Der Fischer stolperte von der Reling zurück. Neben ihm wollte Magdalenas Schrei gar nicht mehr verstummen. Das Wesen aus dem Wasser zog sich höher. Die zweite Hand griff nach der Kante der Reling. Knochen schimmerten durch das Fleisch.
»Magdalena! Weg da! Weg!«
Der Kopf tauchte über der Reling auf. Er schien Jacques anzugrinsen. Im nächsten Moment schlossen sich halb verweste Finger um Magdalenas Arm.
Ihr Schrei wurde so schrill, dass er Jacques in den Ohren wehtat. Jetzt wich sie zurück, doch die Hand hielt sie unerbittlich fest. Ein Oberkörper erschien über dem Rand der Reling, von dem das Fleisch abblätterte wie billige Farbe. Panisch zerrte Magdalena an ihrem Arm, versuchte ihn freizubekommen, aber es gelang ihr nicht.
Verzweifelt sah Jacques sich nach etwas um, das er als Waffe verwenden konnte. Eine Taurolle, etwas Segeltuch ...
Magdalenas Schrei erreichte eine neue Höhe – dann platschte es, und es war still.
Jacques fuhr herum. Der Platz an der Reling war leer.
»Magdalena?« Er warf sich nach vorne, starrte ins Wasser. Nichts als Wellen und Nebel und vielleicht ein dunkler Schatten ein Stück rechts von ihm. Schnell schnappte er sich das Tau. Er musste sie wieder hochziehen. Ein Ende des Taus warf er ins Wasser, das andere sicherte er am Mast. Dann kehrte er an die Reling zurück und starrte angestrengt in die Wellen.
Er hielt den Atem an, wartete darauf, dass die Witwe wieder an die Oberfläche kam. Aber sie kam nicht mehr hoch. Die Witwe Magdalena blieb verschwunden.
»Magdalena!«
Der Schrei hallte über das Wasser, vermischte sich mit denen von den anderen Booten. Für einen Moment glaubte Jacques, auch dort Gestalten an den Schiffsrümpfen hängen zu sehen.
Und das Tau, das er ins Wasser geworfen hatte, spannte sich.
Für einen Moment flammte Hoffnung in Jacques auf. Vielleicht hatte es die Witwe doch noch geschafft. Eilig packte er das Seil, wollte es schon hochziehen.
Da fiel sein Blick auf leere Augenhöhlen im Wasser.
Jacques schrie und ließ das Seil los. Doch die Kreatur im Wasser hielt sich weiter daran fest. Sie zog sich an dem Seil nach oben! Jacques verfluchte sich selbst. Er hatte diese Kreatur förmlich dazu eingeladen, ins Boot zu klettern!