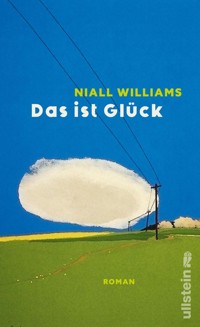
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Liebesbrief an das verschlafene, gemächliche und herrlich kauzige Irland, das so gut wie verschwunden ist.« Irish Independent Nach einer Glaubenskrise zieht der siebzehnjährige Seminarist Noel für einen Sommer zu seinen Großeltern nach Faha, einem kleinen irischen Dorf, in dem nichts sich je ändert; auch der Regen nicht, der das Dorf seit Anbeginn begleitet. Bis er eines Tages, wir schreiben die Karwoche des Jahres 1958, plötzlich aufhört. An diesem Tag kommt auch Christy in das Örtchen, ein weitgereister Mann, der im Auftrag der Regierung durch das Land zieht und für die Elektrifizierung wirbt. Christy wird Untermieter bei Noels Großeltern und für den jungen Mann ein Freund und Mentor. Während Noel erste Gefühle für ein Mädchen entwickelt und nach seinem Weg im Leben tastet, offenbart sich der wahre Grund von Christys Anwesenheit. Er ist zurückgekehrt, um Abbitte bei einer geliebten Frau zu leisten. Doch auch wenn die Zeit in Faha bis anhin stillzustehen schien, vor seinen Bewohnern macht auch sie nicht Halt. Und Christy könnte zu spät gekommen sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das ist Glück
NIALL WILLIAMS wurde 1958 in Dublin geboren. Er ist Autor von neun Romanen. Die Geschichte des Regens war für den Booker Prize nominiert. Das Alphabet der Liebe wird gerade verfilmt. Das ist Glück stand auf der Shortlist des Irish Book Award und auf der Longlist des Walter Scott Prize. Niall Williams lebt in Kiltumper an der irischen Westküste.TANJA HANDELS übersetzt aus dem Englischen, darunter Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Toni Morrison und Charlotte McConaghy. Ihre Übersetzungen wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis.
Nach einer Glaubenskrise zieht der siebzehnjährige Seminarist Noel für einen Sommer zu seinen Großeltern nach Faha, einem kleinen irischen Dorf, in dem nichts sich je ändert; auch der Regen nicht, der das Dorf seit Anbeginn begleitet. Bis er eines Tages, wir schreiben die Karwoche des Jahres 1958, plötzlich aufhört. An diesem Tag kommt auch Christy in das Örtchen, ein weitgereister Mann, der im Auftrag der Regierung durch das Land zieht und für die Elektrifizierung wirbt. Christy wird Untermieter bei Noels Großeltern und für den jungen Mann ein ungleicher Freund und Mentor. Während Noel erste Gefühle für ein Mädchen entwickelt und nach seinem Weg im Leben tastet, offenbart sich der wahre Grund von Christys Anwesenheit.Er ist zurückgekehrt, um Abbitte bei einer geliebten Frau zu leisten. Doch auch wenn die Zeit in Faha bis anhin stillzustehen schien, vor seinen Bewohnern macht sie nicht halt. Und Christy könnte zu spät gekommen sein.
Niall Williams
Das ist Glück
Roman
Aus dem Englischen von Tanja Handels
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2019unter dem Titel This is Happiness bei Bloomsbury, London
© 2019 by Niall Williams© der deutschsprachigen Ausgabe2025 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenAutorenfoto: © Eva LindbladE-Book-Konvertierung powered by PepyrusWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3536-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DANKSAGUNG
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Widmung
Zum Andenken an P. J. Brown (1956–2018)
Motto
All diese Ungewitter, die uns treffen, sind Anzeichen, dass der Himmel sich bald aufheitert und unsre Angelegenheiten wieder gut gehen werden; denn es ist nicht möglich, dass Glück und Unglück von Dauer sind. Daraus folgt, dass, nachdem das Unglück lange gedauert hat,das Glück jetzt nahe ist.
Miguel de Cervantes, Don Quijote
1
Es hatte aufgehört zu regnen.
2
Niemand in Faha wusste mehr, wann es angefangen hatte. Der Regen war dort an der westlichen Küste ein Daseinszustand. Er kam senkrecht und seitlich herab, kam von hinten und von vorn und aus allen anderen Richtungen, die Gott sonst noch einfielen. Er kam in Schwüngen, in Wellen und manchmal auch in Schleiern. Er kam als Niesel, als Fiesel, als Sprühnebel, als häufiger und weitschweifiger Schauer, als nasser Nebel, als feuchter Tag, als Tröpfeln, als Triefen und als waschechter Wolkenbruch. Er kam an schönen Tagen, an blendenden Tagen und an Tagen, die versprochen hatten trocken zu bleiben. Er kam zu jeder Tages- und Nacht- und auch zu jeder Jahreszeit, beachtete weder den Kalender noch die Wettervorhersage, bis in Faha die Kleider zu Regen wurden, die Haut zu Regen wurde und das eigene Haus zu Regen mit offenem Feuer. Von der grauen Weite des Atlantik kam er her und warf sich auf das Land wie ein einmal verschmähter und nun umso wilder entschlossener Liebhaber. Er kam in Begleitung von Silbermöwen, Salzgeruch und Seetang. Er kam mit kalter Luft und verhangenem Licht. Er kam wie das Weltgericht oder, in der harmloseren Variante, wie ein Segen, den Gott nicht richtig zugedreht hatte. Er kam und holte sich das taschentuchgroße Stück blauen Himmels, kam mit dem Westwind und manchmal – warum auch nicht? – mit dem Ostwind, kam in Wolken, die sich an den Bergen von Kerry das Kreuz brachen und dann auf Clare herunterstürzten, den Boden schlammig machten und die Luft blind. Er kam kostümiert als Hagel, als Graupel, aber nie als Schnee. Mal fiel er sacht und mal zärtlich, seine Nadeln wurden zu Küssen, und er regnete als Regen, der vorgab, keiner zu sein, der nur herabgekommen war, um den Feldern näher zu sein, deren Grün er liebend hegte und pflegte, bis er es dann ertränkte.
Das alles soll nur die eine Wahrheit bezeugen: In Faha, da regnete es.
Aber jetzt hatte es aufgehört.
Nicht, dass jemand in Faha es bemerkt hätte. Denn erstens war es kurz nach drei Uhr nachmittags am Karmittwoch, und die ganze Gemeinde war ziehharmonikagleich in die Bänke der Männerseite, der Frauenseite und des Mittelschiffs der versinkenden Kirche gefältelt, die damals noch St. Cecelia hieß. Zweitens waren die Köpfe der Gläubigen, als sie wieder nach draußen kamen, noch ganz beflügelt vom Kirchenlatein, und das Leiden Christi des Erlösers ließ ihnen jeden Gedanken an etwas anderes belanglos erscheinen. Und drittens waren sie mit dem Regen nun schon so lange verheiratet, dass sie ihn kaum noch zur Kenntnis nahmen.
Ich für meinen Teil bin achtundsiebzig Jahre alt und erzähle hier von einer Zeit, die mehr als sechs Jahrzehnte zurückliegt. Mir ist klar, wie unwahrscheinlich es klingen mag, dass ausgerechnet Faha der Ort sein soll, an dem ich damals wirklich zu leben lernte, aber meiner Erfahrung nach ist das Wahrscheinliche keine Vokabel aus Gottes Wörterbuch.
Diese Welt, in der die Haustüren tagsüber allesamt offen standen und die Hintertüren nie abgeschlossen wurden, sodass man abends bloß den Riegel zu heben und einzutreten brauchte, hinab, mit Gottes Segen, auf einen Steinboden und mitten hinein in eine Wolke aus Torf- und Tabakqualm, diese Welt ist heute längst vergangen. Und auch wenn manche, die sie damals bevölkerten, Michael Donnelly etwa, Delia Considine, Mary Egan und Marty Brogan, dem Friedhof bislang noch eine Absage erteilen und in einsamen alten Häuschen draußen auf dem Land verharren, wo Rheumatismus und Feuchte wohnen und der ständige Kampf mit den langen Nachmittagen, so hält an ihren Türen doch die Vorsicht Wache und die Angst vor dem zersetzenden Wesen wehmütiger Nostalgie. Und weil ich mich selbst schon zu den Antiquitäten zähle und weiß, dass dank der Gnade der Schöpfung die Erinnerung an Not und Regen als Erste schwindet, ist mir auch klar, dass die Kluft zwischen damals und heute womöglich zu breit ist, so wie die zwischen Mythos und Geschichte; und dass in dieser Welt, die Sie heute bewohnen, jene, in der es am Karmittwoch in Faha zu regnen aufhörte, vielleicht zu weit weg ist, zu fern in ihren Zeiten und Gebräuchen, um sie zu betreten.
Bleiben Sie trotzdem ein Weilchen nachsichtig mit mir; Großväter besitzen so wenige Privilegien, und das Wissen um die eigene Entbehrlichkeit hat scharfe Zähne.
Hundert Bücher würden nicht reichen, um ein einzelnes Dorf einzufangen. Das soll keine Abwertung sein, ich spreche hier aus Erfahrung. Faha war weder mehr noch weniger als jeder vergleichbare Ort. Wer es entdeckte, war sicher eigentlich auf dem Weg woandershin. Auf dem Land finden sich zahllose Orte, die auf den ersten Blick schöner sind. Es sei ihnen gegönnt. Faha interessiert das nicht. Es hatte sich längst mit seinem Schicksal abgefunden, durch seinen Charakter und seine Lage nur im Vorüberziehen bemerkt und dann ebenso sacht wie vollständig wieder vergessen zu werden.
Und so war für die Menschen in Faha der Regen, in diesem Tal mit seinen in den Fluss verliebten Feldern, ein zu vernachlässigendes Etwas. Sein Anfang, irgendwann vor Urzeiten, war längst sagenumwoben, und seinem Aufhören sollte es nicht anders ergehen.
Die bekannte Welt war damals längst noch nicht so scharf umrissen, und Wissen wurde nicht mit Tatsachen gleichgesetzt. Geschichten waren eine Art menschlicher Kitt. Besser kann ich es nicht umschreiben. Es wurde überall erzählt. Und weil es nur wenige Quellen gab, über die sich etwas erfahren ließ, wurde auch viel mehr zugehört. Einzelne sprachen auch immer noch über den Regen, standen im Niesel am Gartentor, blickten in den Himmel und trafen ungenaue und höchst eigenwillige Vorhersagen, als würden sie die Sprache der Vögel, der Beeren oder des Wassers immer noch fließend beherrschen, und meistens ließen die anderen sie gewähren, hörten sich alles wie eine Geschichte an, nickten und sagten Ach, wirklich?, und dann gingen sie ihrer Wege und glaubten kein Wort, gaben die Geschichte aber dennoch wie eine zwischenmenschliche Währung an jemand anders weiter.
Damals war auch die Kirche nicht, was sie heute ist, und stand auch nicht, wo sie heute steht. Sobald Tom Joyce, der Küster, in Anzug und Weste die Straße überquerte und die siebenundzwanzig Stufen des Glockenturms erklomm, um die Glocke zu läuten, die noch eine echte Glocke war, vom Bischof geweiht und in allen sieben Gemeinden des Bistums zu hören, verließen die Menschen einfach ihre Häuser und gingen hin, die Sündhaften ebenso wie die Frommen. Auf allen Wegen im Dorf drängten sich Fahrräder, Pferde, Karren, Traktoren und Fußgänger. Dort auf dem Land waren die Straßen noch nicht asphaltiert, teilweise nicht einmal geschottert. Die vor dem Haus meiner Großeltern bestand nur aus Schlamm, der fest und weich, dann wieder fest und dann wieder weich getreten wurde. Sie war von Schuhen, Karrenrädern und Hufen erschaffen worden und buckelte zur Mitte hin wie ein Rückgrat, über das dann die ganze Gemeinde holperte, vorbei an den offenen Haustüren, und im Vorbeigehen all die Neuigkeiten auflas und weiterstreute, aus denen ein solcher Ort seine Lebenskraft zieht.
Und so herrschte in der Stunde vor der Messe reges, vielfältiges Verkehrsaufkommen. Trat man aus der Tür und blickte nach Westen, sah man lauter Köpfe, bemützt, behütet und bekopftucht, die wie Hostien über den Hecken schwebten. Die Rinder auf den Feldern, vom Regen begriffsstutzig gemacht, hoben die entrückten, leeren Mienen zu ihnen hin, schwere Sabberringe um die Mäuler, als fräßen sie wässriges Licht. Die Menschenprozession, auf Fahrrädern, Karren und zu Fuß, verlief sich allmählich – das Klappern der Pferdehufe klang noch minutenlang nach, wenn das eigentliche Pferd längst außer Sicht war, wurde aber schließlich ebenfalls vom grünen Schweigen geschluckt. Wenn dann Sam Cregg, dessen Uhr notorisch nachging, sowohl im konkreten als auch im übertragenen Sinn, in dem langen Militärmantel und den Reithosen vorbeischritt, die ihm sein Bruder, der General, aus Burma geschickt hatte, war der Einzug bereits im Gange. Und alle Straßen hin zur Kirche versanken in vollkommener Stille.
Das damalige Faha hatte zudem einiges mehr zu bieten als das heutige. Die Läden waren klein, es gab aber viele davon, Gemischtwaren, Metzgereien, Eisen- und Tuchwaren, Bestatter und eine Apotheke, und alle waren aufs Unerbittlichste geprägt vom Wesen derjenigen, die sie betrieben. Bluts- und Familienbande regierten den Einkauf. War man irgendwie, ganz gleich, welchen entfernten Grades, verwandt mit Clohessy oder Bourke, die beide den gleichen Tee, das gleiche Mehl und den gleichen Zucker, die gleichen drei Gemüsesorten und die gleichen ewig haltbaren Konserven anboten, erledigte man dort seine Besorgungen. Beim jeweils anderen ließ man sich nicht blicken. Wenn man an einem vergessenen Ort lebt, gehört der Erhalt persönlicher Eigenarten zu den großen Privilegien. Und weil die Hauptstadt so weit weg und noch dazu kaum bekannt war, galt in Faha das Exzentrische als Norm.
Starrsinn, Widerborstigkeit und Tradition wollten es, dass die Männer sich vor der Messe vor den beiden Fenstersimsen von Prendergasts Postamt versammelten – wer zu spät kam, musste mit dem abschüssigeren Sims von Gaffneys Apotheke vorliebnehmen. Wie die Faha’sche Version der römischen Prätorianergarde trugen sie allesamt braune oder graue Anzüge, dazu Hut oder Mütze, aber keinen Regenmantel. Obwohl der Regen ihnen längst die Schultern gesattelt hatte und ihnen abverlangte, ihre Zigaretten taktisch klug umgedreht zu rauchen, geschützt zur Handfläche hin. Es waren Männer, die fern der Städte lebten, und die Einsamkeit hatte ihr Wesen glasklar geschliffen. Dass sie am Ende in die Kirche gehen würden, stand außer Frage, aufgrund des durchaus heiklen Verhältnisses alles Religiösen zur Vorstellung von Männlichkeit legten sie aber keine übertriebene Eile an den Tag, wehrten jeden Anflug von Vergeistigung durch einstudierte Lässigkeit ab und beherrschten die hohe Kunst des beredten Schweigens bis zur Perfektion.
Das Konzept des Parkens war den Menschen in Faha noch nicht geläufig. In jener Karwoche lag die flächendeckende Einführung der Fahrprüfung noch fünf Jahre in der Zukunft, und es sollte weitere drei Jahre dauern, bis sich jemand aus Faha ihr unterzog. In der ganzen Gemeinde gab es nur zehn Autos. Diejenigen, die sie fuhren, waren schon zufrieden, wenn sie grob dort ankamen, wo sie hinwollten, und die Kinder, die Alten und die Nachbarn, die beim Einsteigen das Auto und beim Aussteigen den Fahrer mit Gottes Segen bedachten, absetzen konnten. Was machte es da schon, wenn das Auto, wie das von Pat Healy, noch halb auf der Fahrbahn stand, sodass dort, wo sich die Straße in hoffnungsloser Sehnsucht der grauen Zunge des Flusses entgegenreckte, niemand mehr vor und zurück kam. Sie gingen schließlich in die Kirche, sollten sich diese Heiden doch alle zum Teufel scheren.
~
Wie auf Noahs Arche, so gab es auch in Faha eine ungeschriebene Reihenfolge, in der die Gemeindemitglieder St. Cecelia betraten und ihre Plätze einnahmen. Und da jede Woche dieselben Leute kamen und Außenstehende oder Ortsfremde seinerzeit praktisch nicht existierten, wusste man selbst mit geschlossenen Augen, dass Matthew Leary – stets der Erste in der Kirche und der Letzte, der sie verließ – in der vordersten Bank mit gesenktem Kopf und gefalteten, zum Gebet erhobenen Händen unter der Last seiner unermesslichen und ehrfurchtgebietenden Sünden auf den Knien lag; dass Mick Madigan nicht hereinkam, sondern aus unerfindlichen Gründen direkt vor der Kirchentür im Regen stehen blieb; und dass Mary Falsey an diesem Morgen zwar ein Haus verlassen hatte, das jeder Ausstellung über die irische Hungersnot zur Zierde gereicht hätte, nun aber als kleine, schnurgerade Säule ganz vorn auf der Frauenseite saß, während ihr Mann Pat mit seiner Dauererkältung ganz hinten auf der Männerseite schniefte. Man wusste, dass Mrs Pender, die den reinlichsten Haushalt der ganzen Gemeinde führte (ihr Sean war ja nicht mehr), mit sieben beinebaumelnden Pender-Kindern neben Kathleen Connor saß, die bereits drei Mal die letzte Ölung erhalten hatte, sich aber, hieß es, nicht in den Himmel aufmachen wollte, solange sie nicht sicher sein konnte, dass ihr Mann Tom am entgegengesetzten Ort gelandet war; dass auf halber Höhe im Mittelschiff die Familie Cotter saß, wunderbare Menschen, dahinter die Murrihys, die alle den Weg ins Verderben gewählt und dabei auch gar nicht lange gefackelt hatten; daneben oder zumindest in ihrer Nähe die Fureys und am äußersten Rand Sean, der Stubengelehrte, der vor Liebe sterben sollte. Auf der anderen Seite dann eine stolze Kirchenbank voller McInerneys (Gott segne dieses Werk) und eine verschämt geduckte, aber kaum weniger fruchtbare voll Morrisseys, die alle im April geboren waren, neun Monate nach der Heuernte, und alle etwas vom Sommer im Wesen trugen. Ein Stück weiter das Mittelschiff hinauf saßen links die Liddys, Bridget und Jerome, mit ihren zehn Kindern, die ihre Nächte auf drei Betten verteilt mit dem Versuch zubrachten, einander abzumurksen, und bei Tag entsprechend aussahen. Nicht weit weg von ihnen eine unbestimmte Anzahl Clancys, deren ganze Kindheit nach Tränen schmeckte. Schräg gegenüber die Laceys mit vier Töchtern, allesamt bemüht, ihre Fußschmerzen zu verbergen, weil sie abgelegte Schuhe trugen, aus denen sie längst herausgewachsen waren, die aber erst an Weihnachten ersetzt würden. Und hinter ihnen Mick Boylan, der an einer unheilbaren Krankheit namens Maureen litt. In der dritten Reihe saß Mona Clohessy, die Tom, als er Unterstützung im Laden brauchte, von einem der wohlhabenden Höfe im Hinterland als Ehefrau heimgeführt hatte. Tom wusste genau, was er tat. Mona hätte auch noch billiges Plastikspielzeug nach China zurückverkauft. Hinter Mona saß, hübsch herausgeputzt, Mina. Dann die Collins, die Kings, die Devitts, die Davitts und die Dooleys, Johnny Mac, dessen Hässlichkeit von einer Art war, die jede Pub-Theke zierte, Thomas Dineen, ein hervorragender Fiddler, und überhaupt waren die Dineens jenes sagenumwobene Etwas, eine musikalische Familie, sie konnten jedes beliebige Instrument zur Hand nehmen und ihm Töne entlocken.
Mittig hinten, mit genügend Abstand zu den Frommen ganz vorn und den Sündhaften hinten, saß Doktor Troy mit seinen drei schwanengleichen Töchtern, die aussahen, als wären sie nicht zur Tür hereingekommen, sondern aus anderen Sphären eingeschwebt, in denen die Menschen der Schönheit näher kamen, als es in Faha der Fall sein konnte. Ob nun aufgrund wohldurchmischter Erbanlagen, der Kleidung, der Haltung oder jener numerologischen Mystik, die die Drei zur göttlichen Zahl bestimmt, ihre Gegenwart allein bewirkte die stillen Verwerfungen einer Naturgewalt. Das Walten von Anziehungskraft ist so undurchsichtig und überraschend wie eine Zwiebel, aber man kann doch mit Fug und Recht behaupten, dass die Schönheit dieser jungen Frauen in der Gemeinde Faha eine Qual hervorrief, der nicht nur ich schutzlos ausgeliefert war.
Für den Moment will ich nichts weiter über die Troy-Schwestern sagen, Sie werden noch früh genug ihre Bekanntschaft machen, aber ich stelle doch mit Freuden fest, dass sich mein Herz auch in dieser betagten Brust noch regt, wenn nur ihr Name fällt.
Die Frauenseite habe ich weniger klar vor Augen. Da muss ich um Verständnis bitten. Denn während die Männer alle ihre Hüte abgelegt hatten, bedeckten die Frauen, vielleicht im Rückgriff auf das mahnende Beispiel der Batseba, allesamt ihr Haupt. Manche Frauen interpretierten die Vorschrift, eine Kopfbedeckung zu tragen, als Einladung zum Auftrumpfen, allen voran Mrs Sexton, die eine ganze Kollektion ausgefallener Hüte besaß, einer davon eine Kreation wie ein fremdartiges Wunderland, ein Berg aus künstlichen Blumen, umflattert von winzigen Kolibris, eine wahre Karibikinsel auf ihrem Kopf, die ihr ein Höchstmaß an Balance abverlangte, wenn sie vor der Altarbrüstung niederkniete.
~
Jemand hat einmal gesagt, die Religion habe sich in Irland deshalb so lange gehalten, weil wir ein derart fantasiebegabtes Völkchen seien und uns das Höllenfeuer daher besonders plastisch vor Augen rufen könnten. Vielleicht ist da ja was dran. Trotz allem aber, was im Lauf der Zeit durchsickern und ein Umschreiben der Kirchengeschichte nötig machen sollte, war sie damals schlichtweg Teil der Weltordnung, und ihre Zeremonien und Rituale besaßen ihre ganz eigene Schönheit. In jener Karwoche war St. Cecelia mit Blumen geschmückt. Die ein Meter zwanzig hohen, mehr schlecht als recht zusammenpassenden Statuen der Heiligen Petrus und Paulus hatten, zusammen mit der des heiligen Senán mit seiner Kapuze und der, die zur heiligen Cecelia erklärt worden war, aus Anlass des Osterfests frische Gesichter gemalt und sämtliche Scharten ausgebessert bekommen. Mrs Reidy, hervorragend an der Ziehharmonika, ließ die Jigs und die Reels an diesem Tag ruhen, legte ihre Stirn in Falten und spielte mit feierlichem Ernst die Orgel.
Pater Coffey, der Kaplan, war damals noch jung und in tiefer Berufungsliebe zu seiner neuen Gemeinde entbrannt. Blass und dünn wie eine Hostie, war er ein ergebener Jünger der Produkte von Wilkinson Sword und rasierte sich bis aufs Blut. Er trug die ungeschönte Miene eines angehenden Heiligen zur Schau und den glasigen Blick derer, die mit dem eigenen heißen Blut im Clinch liegen. Aber da er in der unantastbaren Privatheit des Priesterstands lebte, machte sich niemand in Faha Gedanken über sein Wohlergehen und stellte es erst recht nicht infrage. Im lilafarbenen Ornat des nahenden hohen Osterfests stand er an diesem Nachmittag allein am Altar. Pater Tom, der Pfarrer und Nachfolger jenes Teufels in Menschengestalt namens Kanonikus Sully, wurde von seiner Gemeinde innigst geliebt. Seit vierzig Jahren nahm er jeder Seele hier die Beichte ab und war erschöpft von der Absolution. Durch die Ablagerungen der gesammelten Sünden seiner Schäfchen in ihm litt er gerade unter einem seiner wiederkehrenden Brustkatarrhe.
Um dem jungen Pater Coffey die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt, sei hier erwähnt, dass er einundfünfzig Jahre lang seinen Dienst in der Gemeinde versehen hat und dafür viel aufgab. Er hatte sich zwei Mal der Versetzung verweigert und alle Sanktionen, die vom Bischofssitz dafür verhängt wurden, schweigend ertragen, nur um Faha treu bleiben zu können. In späteren Jahren, während er, weit über das Rentenalter hinaus, aber ohne Rente, mit drahtigem weißem Haar, das ihm aus den Ohren spross, tagtäglich für vier verbliebene Seelen die Messe las – strumpfsockig, weil ihm zwei unbehandelte Morton-Neurome das Schuhetragen unmöglich machten –, sollte man ihn in der Zwischenzeit so oft ausrauben, dass er sich angewöhnte, den Schlüssel in der Tür des Pfarrhauses stecken zu lassen und auf dem Esstisch etwas Kleingeld und einen Imbiss bereitzustellen, bis die Diebe schließlich auch den Tisch mitgehen ließen.
Damals, am Karmittwoch, drehte Pater Coffey seiner Gemeinde den Rücken zu, schloss die Augen und reckte das Kinn in die Luft. Aus den Tiefen seiner Kehle ließ er ein schallendes Te Deum aufsteigen, ohne auch nur zu ahnen, dass währenddessen über ihm der Himmel aufklarte.
3
Ich war an jenem Nachmittag in St. Cecelia nicht dabei. Ich war siebzehn und mit dem Zug aus Dublin angereist, nicht direkt in Ungnade – dafür waren meine Großeltern, Doady und Ganga, viel zu eigensinnig und abgefeimt –, aber doch eindeutig fern aller Gnade, falls man unter Gnade den Zustand versteht, die eigene Zeit auf Erden in Behaglichkeit zu verbringen.
Wie ich damals war, ist nicht leicht einzufangen, zumeist zeigte sich der Crowe-Anteil in mir in inneren Widersprüchen, mein Wesen ein unrundes Konstrukt, das zwischen Starrheit und Vorschnelle, Unbeweglichkeit und Sprungbereitschaft pendelte. Ein solcher Ausschlag des Pendels hatte mich in das stachelige Umfeld eines Internats in Tipperary versetzt. Ein weiterer in die dornige Ödnis eines Priesterseminars und wieder ein weiterer fort von dort, nachdem ich eines Nachts hochgeschreckt war, erfüllt von einer Angst, die ich nicht benennen konnte, später aber als die Befürchtung deutete, ich könnte womöglich nie herausfinden, was es bedeutet, ein erfülltes Menschenleben zu führen.
Ich bin mir gar nicht sicher, was ich mir damals darunter vorstellte, war aber vernünftig genug zu erkennen, dass es mir an etwas mangelte und es diesen Mangel zu fürchten galt. Wenn es stimmt, dass wir alle von Geburt an eine große Liebe zur Welt in uns tragen, bestand das Streben meiner Kindheit und Schulzeit darin, genau diese Liebe in mir auszulöschen. Ich hatte viel zu große Angst vor der Welt, um sie zu lieben.
Wie sich herausstellte, war es erheblich einfacher, ein Teil der Kirche zu werden, als sie wieder zu verlassen. Der für mich zuständige Seelsorger hieß Pater Walsh. Er hatte die rosigen, ungeformten Lippen eines Säuglings, aber das kalte Blut des örtlichen Leichenbeschauers. Um sicherzustellen, dass seine Seminaristen ihr Ziel nicht aus dem Blick verloren, beherrschte er etliche Kunstgriffe, Schachzüge und Listigkeiten. Sein lockiges Haar, das er mit einer gallertartigen Pomade zähmte, war pechschwarz, seine Haut nie mit der Sonne in Berührung gekommen. In dem Zimmer, schwer von Mahagoniholzmöbeln, wie die Frommen sie bevorzugen, wo ich ihm eröffnete, dass ich gehen wollte, bestand seine erste Taktik darin, zu schweigen. Er legte die langen Finger zum Zeltdach aneinander und bewegte sie, wie eine kleine Kirche, die immer wieder auseinanderfiel und neu zusammengefügt wurde. Den Blick hielt er dabei fest auf mich gerichtet. Stumm durchlief er eine innere Debatte, die zarten Lippen spannten sich, die Brillengläser blitzten, bis er schließlich zu einer zufriedenstellenden Lösung fand. Da nickte er, wie um dem Ratschlag einer höheren Instanz beizupflichten. Und dann setzte er mir auseinander, dass ich keineswegs endgültig gehen würde, sondern er mich vielmehr als beurlaubt betrachte, auf vorübergehendem Rückzug. Es gebe für so etwas zahllose Beispiele aus dem Leben der Heiligen. Er sei zuversichtlich, sagte er, dass ich, wenn ich erst einmal gesehen hätte, wie es »da draußen« zugehe, gestärkt in meiner Berufung zurückkehren würde. Dann stand er auf, schob die Zungenspitze zwischen die Lippen und reichte mir seine kalte Hand sowie eine Ausgabe der Bekenntnisse des Augustinus.
»Der Herr sei mit dir.«
Ich lebte zu der Zeit in tiefster Einsamkeit. Warum, das weiß ich nicht so recht, und auch nicht, wie es überhaupt passieren kann, dass ein Mensch sich plötzlich am Rand des Lebens wiederfindet, aber genau da stand ich nun. Ich war das Gegenteil von forsch und selbstbewusst. Ich fand keinerlei Bodenhaftung und konnte nicht erkennen, wie man auch nur irgendwo dazugehören sollte.
Wund und verstört kehrte ich aus dem Seminar nach Dublin zurück, nach Hause. Mein Vater, in bewusster Auflehnung gegen das Crowe-Blut in sich, war in allen Dingen äußerst vorsichtig. Er machte nie viele Worte, und seine kurzen, dichten Brauen wie Morse-Striche verliehen ihm ein unentschlüsselbares Aussehen. Der eigene Vater ist ein Rätsel, für dessen Lösung man ein ganzes Leben braucht. Nach dem Tod meiner Mutter hatte er sich die vorgeschriebenen drei Tage frei genommen, den öffentlichen Beweis seiner Trauer erbracht und sich dann wieder in sein bevorzugtes Fegefeuer des Repräsentantenhauses zurückgezogen. Damals grassierte die Dummheit, den eigenen Vater als grundsätzlich unerreichbar zu betrachten. Und so versuchte ich erst zwanzig Jahre später, ihn zu erreichen, in dem Jahr, als er starb und ich ihn zum ersten Mal beim Vornamen nannte. Ich bin jetzt älter als er bei seinem Tod und kann teilweise nachvollziehen, was es ihm abverlangt haben muss, am Leben zu bleiben. Mir scheint, das ist etwas, was man wirklich erst begreift, wenn man eines Morgens als alter Mann oder als alte Frau aufwacht und sich darin neu orientieren muss. Damals haben wir unsere Väter nie genug umarmt. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Ich jedenfalls umarme ihn, jetzt, wo er tot ist, und nenne ihn bei seinem Vornamen, Jack – solche Albernheiten gönnt man sich im Alter. Ob es ihm guttut, kann ich nicht sagen. Aber mir hilft es manchmal ein wenig.
~
Ein paar Wochen verbrachte ich also zu Hause, während er zur Arbeit ging. Aber es liegt so ein Verhängnis im ersterbenden Licht eines späten Nachmittags. Dort in dem leeren, alten Haus an der Marlborough Road platzten alle Nähte auf, die mich mit diesem Leben verbanden. Ich kam nicht gegen das Gefühl an, dass an meinem Rücken gefaltete Flügel lagen, die sich einfach nicht öffnen wollten.
~
Manchmal glaube ich, ein junger Mensch kann gar nichts Schlimmeres empfinden, als vergeblich nach einer Antwort auf die Frage zu suchen, was man bloß anfangen soll mit dem Leben, das einem geschenkt wurde. In manchen Momenten spürt man, wie sie einem auf der Zunge liegt, weiß aber trotzdem nicht, was als Nächstes kommen soll. So ungefähr. Inzwischen kann ich berichten, dass dies in anderer Form auch im Alter noch einmal geschieht, wenn einem plötzlich in den Sinn kommt, dass man doch eigentlich etwas gelernt haben sollte, wo man nun schon so lange lebt. Und so schlägt man vor der Morgendämmerung die Augen auf und denkt: Was habe ich denn gelernt, was will ich eigentlich sagen?
Weil ich es zu Hause nicht mehr aushielt, kein Geld hatte und auch nicht wusste, wo ich sonst hinsollte, war ich in jenem April nach Clare gekommen. Dort wohnten meine Großeltern in einem niedrigen, langgestreckten Bauernhaus, das ursprünglich einmal drei Zimmer hatte, später vier, dann viereinhalb und schließlich um die fünf, nachdem die Fruchtbarkeit jede Klugheit übertrumpft hatte und die zwölf Crowe-Brüder über das Haus hereingebrochen waren – meine ungestümen Onkel, deren gewaltiger Drang in die Welt hinaus sich nicht darauf beschränkte, sämtliche Pokale, Medaillen, Plaketten und Trophäen in ganz Faha einzuheimsen, sondern unvermindert fortbestand, bis sich alle, mit Ausnahme meines vorsichtigen Vaters, in den zwölf Ecken der Welt ausgetobt hatten, wie Ganga immer sagte. Dort sollten sie sich dann als rabaukenhafte Stuckateure, leichtfertige Rohrverleger, temporeiche Häuserbauer, windschiefe Schreiner, rasende Busfahrer und, in einem unfassbaren Fall, sogar als Polizist in Chicago verdingen, aber nicht wieder vereint sein, bis zu jenem legendären Tag in Faha, als Ganga begraben wurde und alle entdeckten, wie viele Menschen ihm zugetan waren.
Eine Erinnerung von diesem Begräbnis: Ganga besaß einen Hund namens Joe, den er sehr liebte, und mit der jedem Hund eigenen Fähigkeit, gute Menschen zu erkennen, liebte Joe ihn gleichermaßen. Er war ein mittelgroßer, schwarz-weißer Hütehundmischling, der in Hundejahren mindestens die Hundert erreicht haben musste, und man kann mit Fug und Recht sagen, dass er die Verzweigungen von Gangas Geist besser kannte als jedes andere Lebewesen. Am Tag des Begräbnisses nun wurde Joe im Haus zurückgelassen, auf dem Häkelkissen, das er sich seit so langen Jahren immer wieder aus Gangas Sessel holte, dass Doady es längst aufgegeben hatte, sich darüber zu beklagen. Die dunkle Wolke aus Onkeln, Cousins und Cousinen beliebigen Verwandtschaftsgrads, Nachbarinnen und Nachbarn sowie den beiden Conefreys, die beim Bestattungsunternehmen Carty angestellt waren, hatte sich endlich doch zur Tür hinausgeschoben. Der Letzte, Onkel Peter, trug Joe auf, das Haus zu hüten, dann schloss er die Tür, ließ den Hund zurück und reckte das Kinn, um seinem Vater zur Kirche zu folgen.
Als die Messe zu Ende war, wechselten die Brüder sich damit ab, den Sarg aus St. Cecelia hinaus- und die elendig abschüssige Church Street hinabzutragen. Ganz West-Clare war zugegen. Und als der Leichenzug die Abzweigung beim Haus der Mangans erreichte, saß dort Joe und wartete. »Da ist Joe Crowe«, sagte Mary Breen, und ohne weitere Erlaubnis oder Aufforderung erhob sich der Hund von seinem Platz, schloss sich der Prozession an und folgte ihr bis zum Grab, von dessen Rand er sich an diesem Tag nicht mehr wegbewegte. Treu wie Gott selbst.
~
Obwohl es sich nicht leugnen lässt, dass ich Faha, wann immer ich dort war, jedes Mal kleiner und ärmlicher fand, als es mir in meiner Kindheit erschienen war, hielt sich doch das Gefühl in mir, dort einen Zufluchtsort zu haben.
Das Haus von Doady und Ganga stand am Hang, nur ein Feld vom Fluss entfernt. Es war ein hastig erbautes Haus, wie Ganga erzählte, denn seine Vorfahren hatten die Steine dafür aus den Mauern des Handelsvertreters Blackall entwendet, als der oben in Leinster war.
Und es mitten in eine Pfütze gestellt, ergänzte Doady, seine Vorfahren waren nämlich Frösche.
Ganga, ein kleiner und fast vollkommen runder Mann mit Augen, in denen stets ein Lachen lauerte, und buschigem Haar, das auf seinem Kopf saß wie eine kleine Perücke auf einem Fußball, hatte die großen Ohren, mit denen Gott alte Männer gemeinhin ausstattet, als Beleg dafür, wie viel Humor man für so eine Schöpfung braucht. Vielleicht ja angeregt durch seine körperliche Erscheinung, hing er der Philosophie an, das Leben sei eine Komödie. Wie eine jener Hartgummifiguren, die sich nach jedem Umstoßen wieder aufrichten, blieb diese Grundüberzeugung unanfechtbar in ihm. Er hielt, allen schwerwiegenden Gegenbeweisen, die das Leben führen mochte, zum Trotz an einer fröhlichen Unbeschwertheit fest, der es in den allermeisten Fällen gelang, das saure Aufstoßen der Ernüchterung in Schach zu halten. (Mag sein, dass er da ein wenig nachgeholfen hat; irgendwann entdeckte ich, dass sich in den Gräben rund um das Haus ein regelrechter Friedhof aus leeren blauen Fläschchen des bewährten Magenmittels Milk of Magnesia befand.)
Doady, einst ein junges Mädchen namens Aine O Siochru, war über Flüsse und Berge hinweg von der Halbinsel Iveragh in Kerry hergekommen. Auch wenn ich bis heute nicht begreif, warum.
»Ganga«, das war mir klar, entsprang meinen kindlichen Versuchen, »Grandfather« zu sagen. Er liebte diesen Namen, und ich nannte ihn bis an sein Lebensende so, während sich Doady, was sich, glaube ich, von »Doodie« herleitete, wie ich früher meinen Schnuller nannte, mit dem ihren nie so recht anfreunden konnte. Sie mochte zwar zwölffache Mutter sein, trotzdem war das Fürsorgliche in ihrem Wesen nicht sonderlich ausgeprägt. Aber Frauen besitzen mehr Tiefe als Männer, darum ist diese Aussage womöglich ungerecht. Tatsache ist aber, dass sie, um zu überleben, alles äußerlich Weiche an sich beschnitten hatte, dass sie so pragmatisch war wie ihr Mann weltfremd und nur wenig Geduld für die Torheiten, Träume und hochfliegenden Pläne von Männern im Allgemeinen und Ganga im Besonderen aufbrachte.
Doady hatte ein schmales, behaartes Kinn und einen bräunlichen Teint – ihre Mutter in Kerry war Pfeifenraucherin und hatte sieben tabakbraune Babys hervorgequalmt, alle kaum größer als Rauchringe. Und so glaubte Doady felsenfest an frische Luft. Frische Luft kurierte praktisch alles. Sie wanderte. Ihre Schuhe waren Schuhe wie aus alter Zeit, mit quadratischen Absätzen, Haken und Ösen und schwarzen, sorgsam über Kreuz gebundenen Schnürsenkeln. Die Schuhe aller Großeltern sind unauslotbare Geheimnisse. Hält man sie in der Hand, werden sie zu sonderbaren, zarten Gebilden, erst recht die ihren, blank geputzt und abgetragen, verschlammt, verpfützt und wieder blank geputzt mit genau der menschlichen Entschlossenheit, die mich stets auf unerklärliche Weise rührt. In diesen Schuhen wanderte sie, bis die Straße sich durchdrückte und auf ihren Fußsohlen zwei dunkle Striemen hinterließ. Dann wurden die Schuhe zu Jack, dem Schuster, gebracht, gleich unterhalb des Dorfes, und sie trug für drei Tage ein Paar von Gangas Stapfstiefeln und machte sich trotzdem jeden Abend auf zu einem Gang den Fluss entlang.
Damals gab es noch eine Welt der Heiligen, alle kannten ihren Namenstag, wussten, auf welches Datum wessen Fest fiel, und suchten sich aus der wohlgefüllten Galerie ihre persönlichen Favoriten aus. Doadys Gebetbuch quoll über von allen gängigen: Antonius, Judas Thaddäus, Josef und Franziskus. Aber auch einige weniger bekannte fanden sich dort, die heilige Rita etwa, die heilige Dymphna und der heilige Peregrinus sowie eine sehr persönliche Auswahl an Reserveheiligen für die äußersten Notfälle. Und ich gebe gern zu, dass ein paar Spuren davon, die die Flut nicht mit sich gerissen hat, auch noch in mir überdauern. Der heilige Antonius hat schon oft genug meine Brille, meine Brieftasche und meine Schlüssel wiedergefunden. Warum er sie mir immer wieder wegnimmt, das ist schon schwerer zu sagen.
Doady versammelte ihre Heiligen als Absicherung, ordnete ihnen allerdings Verstärkung durch weitaus ältere Fürsprecher bei, wie den Mond und die Sterne. Sie barg einen eisernen Hexenkessel aus Mittelchen und Zaubersprüchen in sich: Ein Husten ließ sich mit einem Frosch kurieren, Kopfschmerzen, indem man Weißdornrinde kaute; die Eberesche brachte Glück, eine Stange Lauch in der Küche verhinderte, dass das Haus abbrannte.
Insgeheim war sie voller Sorge um ihre verschwundenen Kinder, die sie an unbekannte Geschichten in einem damals noch viel ferneren Anderswo verloren hatte. Außerdem war sie von dem Schmerz geplagt, den alle aus Kerry Gebürtigen verspüren, wenn sie nicht in Kerry sind. Sie bekämpfte ihn allerdings mit einer ausführlichen Korrespondenz. Diese Briefe brauchten oft mehrere Tage, bis sie fertig waren. Die verlorene Kunst des durchkomponierten Textes war damals noch ein Grundprinzip der Höflichkeit, und die Stapel von Löschpapier mit ihren filigranen Handschriftspuren zeugten vom persönlichen Von-meiner-Hand-für-deine-Hand-Wesen des Ganzen. Bis zu ihrem Tod schrieb Doady Briefe, ihr Zeigefinger war immer tintenfleckig und trug die dauerhafte Delle des Federhalters. Sie hatte zahllose Korrespondenzpartner. Darunter Tante Nollaig, die nach Amerika gegangen war und nun jedes räumliche Gesetz aushebelte, indem sie ihre einseitigen Luftpostbriefe mit immer kleiner werdender Schrift befüllte, Buchstaben, die sich erst in dem Moment offenbarten, wenn Doady mit der Messerspitze sorgsam die gepunkteten Zeilen entlangfuhr und das Blatt ins Licht hielt. Doadys eigene Schreiben wiederum überquerten den Fluss und die Berge und brachten ihr Antworten ein, die mehrmals gelesen, dann wieder sorgsam gefaltet, in ihrem Umschlag verstaut und in einer mit Folie ausgeschlagenen Teekiste mit dem Stempel CEYLON verwahrt wurden. So blieb in Tinte, Papier und Schreibkunst etwas wie ein inneres Kerry erhalten, das leichter aufgesucht werden konnte als das echte.
Unlängst hatte Ganga mit großzügiger Geste, die teils aus Liebe entsprang, weil er wusste, wie ihr die Stimmen ihrer Heimat fehlten, und teils aus Eigeninteresse, weil er neumodischem Schnickschnack nur schwer widerstehen konnte, eine Kuh verkauft und heimlich den Anschluss eines Telefons in Auftrag gegeben. Es war das erste Telefon außerhalb der Dorfgrenzen, die Nummer lautete FAHA 4. Geliefert und angeschlossen wurde es von zwei schwer bestiefelten Fernmeldetechnikern aus Miltown Malbay, die auch den ersten Anruf bei Mrs Prendergast von der Vermittlung im Dorf tätigten. Als sie abnahm, meldete einer der beiden Ganga den Erfolg mit hochgerecktem Daumen und brüllte dabei seinen Teil der hölzernen Unterhaltung in den Hörer, wie man sie vielleicht eines Tages mit dem Mars führen wird. Das Telefon hatte eine Kurbel an der Seite, und vor ihm auf dem Boden lag eine große Blockbatterie, aus der lauter Drähte herausragten wie bei einer Bombe im Comicheft.
Gangas Plan ging nach hinten los. Als Erstes fragte Doady ihn, wovon sie das bezahlen sollten. Ganga reagierte mit seiner Standardantwort auf alle Unwägbarkeiten des Lebens: »Das sehen wir dann«, was sie noch mehr zur Weißglut brachte als die Begegnung mit Menschen aus Cork. Ferner war es ihr zuwider, dass der Hörer so stumm an der Wand hing wie ein schwarzes Ohr, das sie belauschte; sie reagierte darauf, indem sie ein Zierdeckchen darüberlegte und die ersten paar Wochen in der Nähe des Telefons bloß flüsterte. Und so erging der Erlass, dass der Apparat nur für absolut Unvermeidliches verwendet werden durfte, was in Doadys Sprache Todesfälle hieß. Als Pater Tom auf seiner Runde vorbeikam, bat sie ihn, das Telefon zu segnen, bevor er wieder ging. Um nicht zugeben zu müssen, dass die Wissenschaft Antworten bereithält, wo die Religion nur mit Geheimnissen aufwarten kann, improvisierte er einen Segen aus einer Anrufung des Erzengels Gabriel, des Schutzheiligen aller Botengänge, der jetzt, beteuerte Pater Tom, auch für Telefone zuständig sei. Doady schickte die Nummer per Brief nach Kerry, und als das Telefon mit halbersticktem Brummen zum ersten Mal klingelte, wusste sie, schon bevor sie zum Zierdeckchen griff, dass ihre hinfällige Tante Ei das Zeitliche gesegnet hatte. Die unheilvolle Aura blieb dem Telefon, bis es sich irgendwann im Hinterland herumgesprochen hatte, worauf nach und nach immer mehr Leute aus der Nachbarschaft und der weiteren Umgebung vor der Tür standen und baten, einen Anruf tätigen zu dürfen. Das Haus wurde zu einer inoffiziellen Außenstelle des Postamts, die durchgängig geöffnet blieb. Es kam gar nicht selten vor, dass jemand auf dem Hocker vor dem vorderen Fenster saß und die Nachricht von einem Todesfall oder einer erkrankten Kuh in den Hörer brüllte, während daneben am Kiefernholztisch eine Partie Karten oder Dame gespielt wurde. Die ersten Male, als jemand anbot – es mochten Muireann Morrissey oder Noirin Furey gewesen sein –, ein paar Pence für den Anruf dazulassen, winkte Ganga noch ab und sagte, wer würde denn fürs Reden Geld verlangen? Aber schon in der zweiten Woche hatte Doady ein großes Marmeladenglas auf die Fensterbank gestellt und ein paar ihrer eigenen Dreipenny-Münzen hineingelegt. Die Anrufwilligen verstanden den Wink, und als die Rechnung kam, war sie längst gedeckt.
Mit Sicherheit kann ich über meine Großmutter sagen, dass sie ein Paradebeispiel für die Unergründlichkeit des Menschen war. Sie war klein, aber drahtig, und hatte eisengraues Haar, das ich immer nur zum Dutt gesteckt gesehen habe, bis zu dem Tag, als sie den heldenhaften Kampf gegen die Schwerkraft schließlich verlor und ihr das Haar lang ausgekämmt wurde, was sie auf einen Schlag dreißig Jahre jünger machte. Sie lag im Wohnzimmer aufgebahrt, ein leichtes, aber deutlich erkennbares Lächeln auf den Lippen. Vielleicht ja, weil Ganga, der in einem schwarzen Anzug aus Bourkes Beständen am Sarg saß, die Schuhe blank, das Silberhaar annähernd gekämmt, wie Spencer Tracy aussah und ihr klar wurde, dass sie ihn sich nach vierzig Jahren Ehe beinahe zurechtgezogen hatte. Sie hatte große, aber geschickte Hände und magere Beine, denen sie mit dicken Strumpfhosen Substanz gab. Stets trug sie eine ärmellose Kittelschürze, die blaue oder die rote, und eine runde Brille, die ihre Augen riesengroß erscheinen ließ, sodass sie mitunter aussah wie eine Märchengestalt. Um sich gegen die Verzweiflung zu wappnen, hatte sie schon früh beschlossen, jederzeit mit dem größten Unheil zu rechnen, eine geniale Taktik, denn wenn sie damit rechnete, trat es nie gänzlich ein. Sie war zu gleichen Teilen Christin und Heidin, sprach nie ohne einen Hauch von Ironie vom lieben Gott und schenkte mir nicht nur mein erstes Skapulier, sondern erklärte mir im selben Atemzug, der púca werde mich holen, wenn ich es nicht immer bei mir trüge.
Alles, was sie sagte, war mit irischen Ausdrücken gespickt und mit Wörtern, die irgendwo zwischen zwei Sprachen schwebten, in der Mischung aufgingen und doch so fremdartig wirkten wie Schlehenbeeren. So sprach sie nicht nur von Maßeinheiten, einem gabháil Torf etwa oder einem beart Heu, oder von einem Himmel, der irgendwie mehr als nur bewölkt war, wenn sie ihn als scamallach bezeichnete. Nein, sie verfügte auch über eine ganze Palette beschreibender Begriffe, so lautmalerisch und treffend, dass ich, obwohl ich nicht wusste, was sie genau hießen, irgendwie doch gleich begriff, dass Hanley, der bodachán, ein schauderhafter kleiner Mann war und das Gesicht von Gerry Colgan, das sie als brocky beschrieb, pockennarbig und schattiert war wie das eines Dachses, dass der große, behäbige Liam O Leary ein echter liúdramán war und Marian Boylan eine hochnäsige smuilceachán und dass Sheila Sullivan ein kleines, feuchtes prislin von Söhnchen hatte, das immerzu sabberte.
Die Ehe meiner Großeltern war weit vom Idyll entfernt; das hatte vielfältige Gründe, darunter den, dass Ganga nur eine recht rudimentäre Vorstellung von Geld besaß. Man kann auch sagen: Er glaubte nicht daran, dass es überhaupt existierte, denn, erklärte er mir, sein ganzes bisheriges Leben habe keinen handfesten Beweis des Gegenteils erbracht.
»Andere Männer würden sich schämen, so was zu sagen«, kommentierte Doady, »nicht so dein Großvater. Dein Großvater hat eben keine Prinzipien.«
»Herrje, Noe, natürlich hab ich die.« Das runde Gesicht mir zugewandt, die Hände um die Hosenträger geschlossen, lächelte er ein gequältes Lächeln. »Aber ich schreibe meine Prinzipien nun mal nicht so groß. Schließlich will ich meine Mitmenschen auch weiter lieben können.« Er zwinkerte mir zu, und Doady schnaubte entnervt und rückte mit ihrem altehrwürdigen Gänsefederstaubwedel der Anrichte zuleibe.
Ihre Zwistigkeiten hielten die beiden am Leben, und weil häufig mehrere gleichzeitig im Gange waren, musste man höllisch aufpassen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. »Wasser!« bedeutete etwa, dass Ganga schon wieder nach dem Waschen die Hände tropfen ließ, anstatt sie sich am Handtuch abzutrocknen. »Stiefel!« hieß, er solle gefälligst den Fußabstreifer verwenden, und »Kasten!«, dass er erneut vergessen hatte, eine Schranktür zu schließen – »Soll’s vielleicht gar keine Türen geben? Willst du mir das damit sagen? Steht die Tür auf, heißt das: Willkommen, lieber Schmutz, lieber Staub, liebe Mäuse, immer rein mit euch! Dieser Mann ist erst zufrieden, wenn alle unsere Kleider von sciatháns nur so wimmeln.«
Im Großen und Ganzen aber gelang es Ganga, sich den Gleichmut des Gerechten zu bewahren, er ließ sich weder reizen noch aufstacheln. Und darin vollzog sich das Schauspiel ihrer Ehe, das in Faha längst zum Publikumssport geworden war, sodass an vielen Abenden Bat, Martin oder Jimmy den Riegel der Hintertür hoben und hereinschauten, sich vor einen Becher mit ungenießbar starkem Tee hockten, um der Vorstellung beizuwohnen, und ihre Zigarettenstummel grob in Richtung Herdfeuer schnippten, wenn zur Pause geläutet wurde.
Ganga, der sich selbst Welt genug war, hegte keine politischen Überzeugungen. Mit seiner silbernen Lupe las er auf seinem Platz nahe dem Fenster, die Seiten so gedreht, dass genug Tageslicht darauf fiel, ein Buch pro Jahr, die jeweils aktuelle Ausgabe des Old Moore’s Almanac, und fand darin alle Erklärungen, die das Universum ihm abverlangte.
Er war, wie Doady sagen würde, ein unmöglicher Mensch. Und obwohl sie das, wie ich glaube, ganz ernst meinte, obwohl sie ihn häufig aufforderte, ihr endlich aus den Füßen zu gehen, oder solle sie ihn vielleicht auch noch wegfegen, und ebenso häufig erklärte, jetzt habe er ihr endgültig das Herz gebrochen, würde ich doch behaupten, nie ein Paar erlebt zu haben, das mehr miteinander verheiratet war. Ein Bild ihrer Ehe: Jeden Morgen rüttelte Ganga die verbliebene Glut aus der Asche des großen Herdfeuers und legte ein paar frische Torfsoden nach. Eine halbe Stunde später, wenn er schon draußen dabei war, das Vieh zu versorgen, griff Doady zur Feuerzange und sortierte alle Soden so um, wie es sein sollte. Sie verlor kein Wort darüber, er auch nicht. Und das Feuer brannte tapfer weiter.
Natürlich hatte ich damals keine Vorstellung von den wirtschaftlichen Gegebenheiten ihres Lebens, begriff nicht, dass vier Kühe noch kein Einkommen sind und Hühner und ein Gemüsegarten kein ländlicher Zeitvertreib, oder auch, dass es Gründe gab, warum Ganga all die windschiefen Türen und Fenster selbst gezimmert und eingesetzt hatte. Warum alles auf eine Weise repariert wurde, die weder vorschrifts- noch sonderlich zweckmäßig war, und warum Ganga seine Lösungsversuche immer weiter verfolgte, obwohl sie zwangsläufig neue, unvorhergesehene Probleme nach sich zogen. Warum die längst vergessene Kunst des Stopfens in ihrer Welt unerlässlich war. Als könnte das Leben jedes Vorhaben ständig schädigen und durchlöchern. Weswegen Doady, erst ohne Brille, dann mit, dann wieder ohne, beim Licht der Petroleumlampe mit Wolle und Garn in wenig passenden und oftmals schreienden Farben Ellbogen, Knie, Hosenböden und Aufschläge ausbesserte.
Kurzum, ich kam erst spät im Leben zu der Einsicht, wie vieler Ausflüchte und Opfer es bedurfte, sich von den Zwängen der Realität unabhängig zu machen und sich ihnen nicht geschlagen zu geben.
4
Es stimmt schon, was Doady sagte: Das Haus schien wie gemacht für Frösche. Bis auf das Areal vor dem Herdfeuer war es zu großen Teilen ständig feucht. Es konnte vorkommen, dass am Fuß der Anrichte mit einem Mal bleiche Pilze sprossen, dass die Fensterbänke tränten. Nach Mitternacht, wenn die Flammen des großen offenen Feuers allmählich kleiner und die Deckenbalken zusehends vom feinen Gewebe der Spinnenfäden umhüllt wurden, hatte man den Eindruck, dass sich diese ganzen um die fünf Zimmer nach dem Fluss sehnten, der nur ein Feld weit entfernt lag.
Als kleines Kind war ich häufig dort zu Besuch gewesen, anfangs noch in Begleitung meiner Eltern. Aus dieser Zeit erinnere ich mich an lange, chaotische Mahlzeiten mitten am Nachmittag, mit einer gebratenen Gans und einem Schinken, einer riesigen Schüssel voll unansehnlich mehliger Kartoffeln, die noch in ihren geborstenen Pellen steckten – in Dublin wurden Kartoffeln immer geschält –, mit Milch, die nicht aus der Flasche, sondern sämig, cremeweiß und am Rand noch schaumig aus der von Doady so genannten Kanne kam (dabei war es eigentlich ein Emaillekrug, der im Behelfskühlschrank, einem gekachelten, aber nie brennenden Kamin im Wohnzimmer, kalt gestellt wurde). Karotten, Pastinaken – in der Marlborough Road hatten wir nie Pastinaken –, Butter, die in nichts an das erinnerte, was wir unter Butter verstanden – es war ein regelrechtes Gelage, das jeden Millimeter des Tisches füllte und sich bis auf die Anrichte erstreckte. Und Doady rannte hin und her, schaffte alles heran, was Ganga vergessen hatte, und setzte sich selbst praktisch nie hin. Gewürzt wurde das Mahl durch Hinzufügen der unverwüstlichen Minze, die wie der Bart eines alten Mannes zwischen den rissigen Steinplatten hinter dem Haus wucherte, oder jenen immerwährenden Zwiebeln, die Gott, ob nun aus Erbarmen oder als Botschaft, in Faha sprießen ließ. Dabei war Doady, sei es, weil sie sich zu sehr bemühte oder von ihrer eigenen Mutter keine entsprechenden Kniffe gelernt hatte oder weil es dem Leben eben einfach gefällt, noch den größten Aufwand zu entkräften, eine entsetzlich schlechte Köchin. Ein Umstand, den Ganga nicht nur prinzipiell unerwähnt ließ, sondern auch verhehlte, indem er die verschmurgelten Schweinekoteletts, den zähen Schinken und das staubtrockene Brathuhn über den grünen Klee lobte.
Aber wenn wir dort zu Besuch waren, war uns ja auch jede Möglichkeit genommen, anderswo essen zu gehen. Ganz West-Clare sah sich dem Gebrechen, sich Gästen gegenüber großzügig zu zeigen, hilflos ausgeliefert, und obwohl im Westen zu jener Zeit große Not herrschte, die Häuser sich leerten und das Leid der Scheidenden in allen Straßen hing, blieb es doch eine Art kategorischer Imperativ, es den Gästen möglichst behaglich zu machen. Meine Großeltern hielten diese uralte Aufmerksamkeit am Leben, so wie damals all die alten Leute in Faha. Von den Kosten oder davon, wie sie in den Tagen nach unserer Abreise leben würden, war nie auch nur die Rede, und mir kamen sie kein einziges Mal in den Sinn.
~
Später, nachdem meine Mutter in Dublin das erste Mal gefallen war, wurde ich dann zum ersten von vielen weiteren Malen wie ein Päckchen bei den alten Leutchen abgeliefert. Das war nicht weiter ungewöhnlich. Im ganzen Land herrschte ein reger Kinderverschickungsverkehr. Säuglinge mit besonders erschöpften oder jugendlichen Müttern sollten bei alleinstehenden Tanten aufwachsen. Andere wurden, um den Verheerungen von Armut oder Alkohol zu entkommen, vorübergehend an Pflegefamilien überstellt, die sie dann teilweise für ihre Eltern hielten. Alle hegten seinerzeit den Ehrgeiz, ganz nach den Lehren der Kirche zu leben, aber unter Menschen ist die Begierde nun mal stärker als die Enthaltsamkeit, und so kamen immer mehr Kinder. Ich war sieben Jahre alt. An meiner Jacke war mit einer Sicherheitsnadel ein weißes Stück Pappe befestigt, auf dem mein Name, NOEL CROWE, und meine Anschrift standen. Begleitet wurde ich von Mutter Aquinas, einem gewaltigen, schwarz-weißen Albatross, der nach Pfefferminzbonbons roch. Mutter Aquinas war über meine Mutter mit mir verwandt. Auf dieser Seite der Familie gab es etliche Priester, Nonnen und Missionare, die irgendwo in Afrika verschollen waren und für die wir, so sagte es meine Mutter, zu beten hatten, denn sie beteten ja auch für uns. Und weil ihr Blick sanft war und ihre Stimme lammweich, hegte der kleine Junge, der ich war, keinerlei Zweifel daran.
In Mutter Aquinas’ Stimme lag nichts Lammweiches. Sie hätte sich ohne Weiteres dafür qualifiziert, das stellvertretende Kommando über die Alliierten zu führen. Ihr Ziel war das Meer, um dort bei den Barmherzigen Schwestern die gute Seeluft zu atmen. Davon kann anschließend nicht mehr viel übrig gewesen sein, möchte ich behaupten. Im Zugabteil umgab sie uns mit einem Wall aus Gebeten, als lägen erhebliche Gefahren vor uns, die schwarzen Perlen ihres Rosenkranzes hielt sie wie einen Harnisch um die verhornten Finger geschlungen. Der Schaffner warf nur einen Blick herein und verzog sich umgehend wieder.
Die Reise von Dublin nahm einen ganzen Tag und mehrere ratternde Züge in Anspruch, die mit jedem Mal kürzer wurden, und so erschien die Ankunft ebenso ungewiss wie das Land gewaltig. Man war immer nach Westen unterwegs, und allen Gesetzen der Naturwissenschaft und der Geografie zum Trotz musste man immer noch weiter. Alle kleinen Jungen waren damals versiert in Cowboy-Geschichten. Heute hat man ja keine Spielzeugpistolen mehr, aber in meinem Pappmachékoffer steckten ein kleiner silberner Colt 45 und eine schwere schwarze Mustang. Das Winchester-Gewehr hatte ich zu Hause lassen müssen. Und so drückte ich, als Mutter Aquinas das Abteil verließ, um nachzusehen, welche Sorte Unfähigkeit das Servieren des Nachmittagstees derart verzögerte, die Stirn an die Scheibe und überlegte, wie schnell die Apachen wohl reiten müssten, bis es einem ihrer Krieger gelänge, sich vom Pferd zu schwingen, zu unserem Abteilfenster hinaufzuklettern und sich mit erhobenem Tomahawk auf Mutter Aquinas zu stürzen.
In Ennis kam es zu einer langen Verzögerung. Wir sollten dort in die Kleinbahn der West Clare Railway umsteigen. Lok und Waggon standen auch bereit, nur der Lokführer fehlte.
Wir stiegen ein und setzten uns. An Bord waren noch fünf weitere Passagiere, darunter ein Huhn.
Mir scheint, die ausdruckslosen schwarzen Augen dieser Henne hielten Mutter Aquinas davon ab, die Freudenreichen Geheimnisse anzustimmen.
Draußen fiel Regen, der eigentlich gar nicht fiel. Das hatte zur Folge, dass der Kohlenqualm nicht aufsteigen konnte, sondern sich in den Waggon hineinringelte, wo er den anderen Passagieren schon ganz vertraut zu sein schien. Mutter Aquinas schob das Fenster zu, aber die Luft war bereits von beißendem Gestank erfüllt, und als sie sich wieder setzte, waren ihre Finger schwarz.
»Fass bloß nichts an.«
Unsere Mitreisenden, alle schon reichlich verdreckt, legten die natürliche Scheu derjenigen an den Tag, die sich im Beisein einer Ordenstracht befinden.
So saßen wir in diesem Zug auf seinem Weg nach Nirgendwo.
Er setzte die Fahrt dorthin noch recht lange fort.
Schließlich packte Mutter Aquinas, die Geduld für eine überschätzte Tugend hielt, mich am Arm, wir stiegen aus dem Zug und marschierten den Bahnsteig entlang.
»Sie da«, sagte sie zu einem kurzgewachsenen Schaffner in der Uniform eines deutlich größeren Mannes. Es war eine schwarze, vielleicht auch inzwischen schwarze Uniform, die Hose beulte an den Knien und warf über den Stiefeln Ziehharmonikafalten. Trotz des schäbigen Anzugs saß seine Mütze aber fest, und der Kinnriemen war blank gewienert. Auf diese Mütze war er über die Maßen stolz.
»Warum geht es nicht weiter?«
»Wir warten auf den Lokführer, Ma’am«, sagte der Schaffner und tippte sich an die Mütze, um deren Autorität geltend zu machen.
»Ist der eventuell eine Ausgeburt der Fantasie?«, fragte Mutter Aquinas.
Dem Schaffner waren keinerlei Fahrgastanfragen fremd, und für einen Moment erwog er die Möglichkeit. »Nein, keineswegs«, sagte er.
»Und wo steckt er dann?«
»Das ist es ja«, sagte der Schaffner und fasste rasch wieder an seine Mütze. »Genau das ist es ja, Schwester.«
»Mutter«, entgegnete sie und bedachte ihn mit dem Albatrossblick. Er senkte den Kopf, bis wir nur noch die Mütze sahen. »Gibt es einen anderen Lokführer?«
Der Kopf schnellte hoch. »Einen anderen Lokführer?«
»Nachdem dieser ja offensichtlich nicht verfügbar ist.«
»O doch«, kam die Antwort. »Er ist durchaus verfügbar.«
Mutter Aquinas musterte den Mann. Er schob seine Mütze noch etwas mehr zurecht. »Wie spät ist es jetzt?«, fragte sie und deutete auf die Uhrenkette, die sich wie ein Lächeln über seine Jacke zog.
Er freute sich sichtlich, ihr das beantworten zu können. »Viertel nach vier.«
»Und wann soll der Zug laut Fahrplan abfahren?«
»Nach neuer oder alter Zeitrechnung?«, fragte der Mann zurück.
Mutter Aquinas sah ihn nur schweigend an. Womöglich war der Schaffner schon drauf und dran, ihr auseinanderzusetzen, was Ganga auch mir einmal erklärt hatte, dass nämlich Irland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr im Gleichtakt mit der Welt war. Die Briten hatten, mit atemberaubender Befehlsgewalt, eine sogenannte doppelte Sommerzeit eingeführt und die Uhren gleich zwei Stunden vorgestellt, um die tägliche Arbeitszeit zu verlängern. Die Iren zogen nicht mit, und tatsächlich hinkt Dublin damals, heute und immerdar genau fünfundzwanzig Minuten und einundzwanzig Sekunden hinter Greenwich her, und da West-Clare zwangsläufig noch weiter hinterher sein musste, leuchte es, so Ganga, doch völlig ein, dass Uhren als Messwerkzeug für die wahre dortige Zeit nicht taugten.
Der Schaffner also schien drauf und dran, diese verworrenen Zustände zu erläutern, aber in dem Moment tauchte der Lokführer auf.
An einem Strick führte er ein weißes Pony.
»Ist das nicht eine Schönheit?«, sagte er, als er an der Stelle vorbeikam, wo Mutter Aquinas mich mit ausgestrecktem Arm an die Wand des Bahnhofsgebäudes drückte, um mich zu schützen.
Das Pony war tatsächlich äußerst ansehnlich, wenn auch mindestens so nervös wie meine Großtante Tossie. Der Lokführer seinerseits nahm von den Tritten, Sprüngen und der generellen Anspannung des Tieres keinerlei Notiz. Er öffnete nur die Waggontür, und hopp-hopp, schon war es hufeklappernd eingestiegen, wurde festgemacht und streckte den Kopf aus dem wieder heruntergelassenen Fenster wie jeder andere neugierige Fahrgast.
»Wir würden dann jetzt fahren, Schwester, wenn Sie so weit sind«, sagte der Lokführer, als er wieder an uns vorbeikam, und schwang sich auf seine Lokomotive.
Und für einen langen Augenblick war meine Wächterin sprachlos.
»Mutter«, sagte der Schaffner leise, zur Verbesserung und Entschuldigung, dann fasste er an seine Mütze und marschierte davon, um sich seiner offiziellen Pflicht des Signalgebens zu widmen.
~
Zwei Barmherzige Schwestern erwarteten Mutter Aquinas unter den traurigen schwarzen Blütendächern ihrer Schirme an der Moyasta Junction, einem Bahnhof ohne Dorf oder Ortschaft in der Nähe, von dem man am Ende der kurvenreichsten Bahnstrecke der Welt in eine wahre Prärie hinaustritt, wie in Wyoming, nur feuchter. Der Regen fiel, falls man das denn so nennen wollte. In Clare hatte sich der Regen dem Verkehr mit dem Wind verschrieben, in allen Stellungen, da war er nicht zimperlich und kam, wie er nur konnte, zügellos.
Im ersten Moment müssen die Schwestern wohl erschrocken sein angesichts des kleinen Jungen-Päckchens, das die Mutter mit sich führte. Aber Barmherzigkeit war ja ihr Spezialgebiet. Sie ließen mich auf einem Mehlsack sitzen und verschwanden.
Ganga sollte mich abholen. Er hielt es für spaßig, sich versteckt zu halten, als der Zug einfuhr.
Schließlich schleppte sich der Zug, mit dem Pony als einzig verbliebenem Passagier, wieder von dannen. Von seinem Führerstand aus salutierte der Lokführer zu mir herunter und rief: »Pony-Express!«, dann war er verschwunden und mit ihm auch der unverbrüchliche Eindruck einer rundum heiteren Welt.
Als der Zug fort war, kletterte ich von meinem Mehlsack und marschierte den Bahnsteig entlang, hinaus in den Regen, den wir einmal sanft nennen wollen. Kurze Hose, weiße Socken, Sandalen, Stirnlocke, so ging ich samt meinem blauen Pappmachékoffer mit den Pistolen und sechs Ausgaben des Hotspur darin hinaus auf die Straße nach Kilkee. Ich bin mir nicht sicher, wohin ich wollte, aber genau dahin machte ich mich auf.
Mein Großvater freute sich daran, wie sich, trotz aller Vorsicht seitens meines Vaters, hier die jüngste Ausprägung des eigensinnigen Familiengens offenbarte.
Wahrscheinlich gibt es in jeder Kindheit Nischen, in denen man die Freiheit entdeckt. Ich ging einfach weiter auf das große graue Meer des Himmels zu. Ich kann mich nicht erinnern, auch nur einen Anflug von Sorge empfunden zu haben.
Mir kam es vor, als wäre ich schon weit gegangen, als ich hinter mir eine Fahrradklingel hörte.
»Kann ich Sie vielleicht ein Stück mitnehmen, junger Mann?«
Und Ganga deutete mit großer Geste auf seinen Fahrradlenker, als handelte es sich um die offene Tür eines Rolls-Royce. Neben ihm stand Joe.
Ganga besaß keinen Gepäckträger, und so nahm er meinen Koffer in die linke Hand, während ich auf die Lenkstange kletterte. Um das Gleichgewicht zu halten, lehnte ich mich nach hinten gegen seine Brust.
Seine Stiefel mit den gelben Schnürsenkeln brachten uns in Bewegung. Das Fahrrad tickte minutiös wie eine Hundertschaft winziger Uhren, und unter dem Schlingern und Schwanken der einhändigen Fahrt segelten wir nicht über die Straße landeinwärts zurück nach Faha, sondern nach Westen, zur Küste hin, denn Ganga begriff in seiner Herzensweisheit, dass für einen Jungen, dessen Mutter erkrankt ist, das beste Heilmittel auf ewig darin besteht, ihm das Meer zu zeigen.
~
Aus der Kindheit, ganz weit oben, wo rührselige alte Männer das verwahren, was sie aufrecht hält, hier ein Hut voll Faha-Erinnerungen:
Faha, das war dort, wo ein unschuldiger Großvater mit einem kleinen Jungen zusammensaß und endlose Partien Dame spielte, »Dann schlag mich mal, Freundchen!«, mit glitzernden Augen und warmherzigem, aber nur angedeutetem Lächeln, denn er hatte fast all seine Zähne an Plunkett, den ziehfreudigen Zahnarzt im Dorf, verloren. Es war dort, wo ich mit ihm und Joe zu kühnen Missionen aufbrach, um Hector, Downes’ Stier, wieder einzufangen und das Tier dann mithilfe eines verknäulten Stücks Schnur an seinem Nasenring die Straße entlang nach Hause zu führen; der Stier ging gemächlich und mit dem Schritt eines vom Leben ermatteten und weitgereisten Herrn und zeigte nicht das leiseste Interesse an den Vorgängen, bis er wieder am Tor war und sah, wie die Färsen mit ausschlagenden Hinterbeinen die Flucht ergriffen.





























