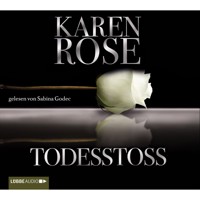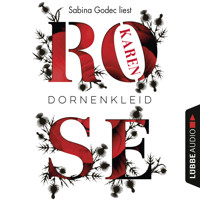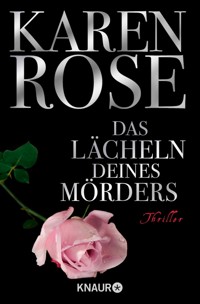
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Chicago-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein packender romantischer Thriller von Bestseller-Autorin Karen Rose - wenn Liebe auf tödliche Obsession trifft ... Ein Serienkiller hat es auf junge Mädchen mit langen dunklen Haaren abgesehen. Special Agent Steven Thatcher aus Raleigh, North Carolina, setzt alles daran, den brutalen Mörder zu fassen. Doch die Zeit wird knapp und sein Sohn braucht ihn jetzt mehr denn je. Bei Jenna Marshall, der attraktiven Lehrerin seines Sohnes, findet Steven nicht nur Verständnis, sondern auch eine tiefe Verbindung. Aber der Killer hat bereits sein nächstes Opfer im Visier - und seine Falle ist gelegt. Jenna schwebt in höchster Gefahr ... Karen Rose´ unwiderstehliche Mischung aus atemloser Spannung und prickelnder Romantik macht süchtig! »Das Lächeln deines Mörders«, ein USA-Today-Bestseller, ist Teil 2 der lose verknüpften Chicago-Reihe. Ein nervenaufreibender Thriller, in dem ein gnadenloser Serienmörder auf eine leidenschaftliche Liebe trifft. Die Chicago-Thriller der Bestseller-Autorin Karen Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Eiskalt ist die Zärtlichkeit« (Band 1) - »Das Lächeln deines Mörders« (Band 2) - »Des Todes liebste Beute« (Band 3) - »Der Rache süßer Klang« (Band 4) - »Nie wirst du entkommen« (Band 5) - »Heiß glüht mein Hass« (Band 6)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Karen Rose
Das Lächeln deines Mörders
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Packende Spannung gewürzt mit prickelnder Erotik«
Sie alle verschwinden in der Nacht, sie alle sind hübsch, haben lange dunkle Haare, und sie alle werden wenig später tot aufgefunden. Special Agent Steven Thatcher hat sich geschworen, den Serienmörder zu stellen, der die jungen Frauen auf dem Gewissen hat. Die Zeit drängt …
Wie soll sich Steven in dieser Situation um seinen schwierigen Sohn kümmern? Bei dessen höchst attraktiver Lehrerin Jenna Marshall findet er Verständnis – und mehr. Was die beiden nicht ahnen: Der Mörder hat sein nächstes Opfer gewählt. Er hat seine Fallen ausgelegt. Er wartet bereits … auf Jenna.
»So packend wie eine kalte Hand im Nacken.«
Publishers Weekly über Karen Rose’ Bestseller »Eiskalt ist die Zärtlichkeit«.
Inhaltsübersicht
Gewidmet den beiden Karens – [...]
Prolog
Seattle,
1. Kapitel
Raleigh, North Carolina,
2. Kapitel
Donnerstag, 29. September, 8.55 Uhr
Donnerstag, 29. September, 23.00 Uhr
3. Kapitel
Freitag, 30. September, 12.30 Uhr
Freitag, 30. September, 14.45 Uhr
Freitag, 30. September, 15.50 Uhr
4. Kapitel
Freitag, 30. September, 16.20 Uhr
Freitag, 30. September, 16.30 Uhr
Freitag, 30. September, 16.40 Uhr
5. Kapitel
Freitag, 30. September, 16.45 Uhr
Freitag, 30. September, 17.00 Uhr
Freitag, 30. September, 17.45 Uhr
6. Kapitel
Freitag, 30. September, 18.45 Uhr
Freitag, 30. September, 19.30 Uhr
Freitag, 30. September, 19.30 Uhr
7. Kapitel
Freitag, 30. September, 20.30 Uhr
Freitag, 30. September, 23.00 Uhr
Freitag, 30. September, 23.55 Uhr
8. Kapitel
Samstag, 1. Oktober, 7.45 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 12.30 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 14.30 Uhr
9. Kapitel
Samstag, 1. Oktober, 18.00 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 19.00 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 21.30 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 22.30 Uhr
Samstag, 1. Oktober, 22.45 Uhr
10. Kapitel
Sonntag, 2. Oktober, 9.00 Uhr
Seattle, Washington
Raleigh, North Carolina
Sonntag, 2. Oktober, 16.45 Uhr
11. Kapitel
Sonntag, 2. Oktober, 18.15 Uhr
Seattle, Washington
Raleigh, North Carolina
Sonntag, 2. Oktober, 22.00 Uhr
12. Kapitel
Montag, 3. Oktober, 7.35 Uhr
Montag, 3. Oktober, 9.30 Uhr
Montag, 3. Oktober, 12.15 Uhr
Montag, 3. Oktober, 12.45 Uhr
Montag, 3. Oktober, 17.15 Uhr
Montag, 3. Oktober, 17.30 Uhr
13. Kapitel
Dienstag, 4. Oktober, 8.03 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 9.00 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 17.00 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 18.30 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 18.45 Uhr
14. Kapitel
Dienstag, 4. Oktober, 20.00 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 20.45 Uhr
Dienstag, 4. Oktober, 22.45 Uhr
15. Kapitel
Mittwoch, 5. Oktober, 00.15 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 5.45 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 7.40 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 9.15 Uhr
16. Kapitel
Mittwoch, 5. Oktober, 10.30 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 10.30 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 15.45 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 17.30 Uhr
17. Kapitel
Mittwoch, 5. Oktober, 18.00 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 18.30 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr
Mittwoch, 5. Oktober, 20.00 Uhr
18. Kapitel
Donnerstag, 6. Oktober, 1.30 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 5.45 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 6.15 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 7.45 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 9.45 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 11.00 Uhr
19. Kapitel
Donnerstag, 6. Oktober, 16.15 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 18.25 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 19.30
Donnerstag, 6. Oktober, 20.45 Uhr
20. Kapitel
Donnerstag, 6. Oktober, 21.10 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober, 23.30 Uhr
Donnerstag, 6. Oktober 23.50 Uhr
21. Kapitel
Freitag, 7. Oktober, 00.30 Uhr
Freitag, 7. Oktober, 6.00 Uhr
22. Kapitel
Freitag, 7. Oktober, 8.00 Uhr
Freitag, 7. Oktober, 13.15 Uhr
Freitag, 7. Oktober, 17.30 Uhr
Freitag, 7. Oktober, 18.10 Uhr
23. Kapitel
Samstag, 8. Oktober, 12.55 Uhr
Samstag, 8. Oktober, 18.15
Samstag, 8. Oktober, 21.30 Uhr
24. Kapitel
Samstag, 8. Oktober, 22.15 Uhr
25. Kapitel
Sonntag, 9. Oktober, 6.30 Uhr
Sonntag, 9. Oktober, 8.05 Uhr
Sonntag, 9. Oktober, 20.25 Uhr
Sonntag, 9. Oktober, 22.25 Uhr
26. Kapitel
Montag, 10. Oktober, 1.00 Uhr
Montag, 10. Oktober, 1.43 Uhr
Montag, 10. Oktober, 8.00 Uhr
Montag, 10. Oktober, 8.00 Uhr
Montag, 10. Oktober, 8.15 Uhr
Montag, 10. Oktober, 13.50 Uhr
Montag, 10. Oktober, 14.20 Uhr
Montag, 10. Oktober, 15.00 Uhr
27. Kapitel
Dienstag, 11. Oktober, 1.00 Uhr
Dienstag, 11. Oktober, 8.00 Uhr
Dienstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr
28. Kapitel
Mittwoch, 12. Oktober, 00.30 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober, 00.45 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober, 8.00 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober, 8.50 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober, 15.30 Uhr
29. Kapitel
Donnerstag, 13. Oktober, 8.00 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 9.15 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 15.00 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 16.30 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 18.00 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 18.00 Uhr
30. Kapitel
Donnerstag, 13. Oktober, 18.30 Uhr
Donnerstag, 13. Oktober, 18.45 Uhr
31. Kapitel
Freitag, 14. Oktober, 9.45 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 11.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 15.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 15.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 15.50 Uhr
Freitag, 14. Oktober 15.45 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 16.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 16.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 17.00 Uhr
32. Kapitel
Freitag, 14. Oktober, 17.30 Uhr
Freitag, 14. Oktober 17.45 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 18.15 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 18.15
Freitag, 14. Oktober, 18.25 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 19.00 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 19.00 Uhr
33. Kapitel
Freitag, 14. Oktober, 19.45 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 21.00 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 22.00 Uhr
Freitag, 14. Oktober, 23.30 Uhr
34. Kapitel
Samstag, 15. Oktober, 1.00 Uhr
Samstag, 15. Oktober, 1.30 Uhr
Samstag, 15. Oktober, 2.15 Uhr
35. Kapitel
Samstag, 15. Oktober, 2.20 Uhr
36. Kapitel
Sonntag, 16. Oktober, 10.00 Uhr
37. Kapitel
Freitag, 28. Oktober, 9.00 Uhr
Epilog
Sonntag, 25. Dezember, 10.30 Uhr
Dank an …
Gewidmet den beiden Karens – Solem und Kosztolnyik –, die ihr an mich geglaubt und meine Träume wahr gemacht habt.
Terri Bolyard für deine offenherzige Großzügigkeit und deine unbezahlbare Freundschaft.
Sarah und Hannah – ihr seid das Licht meines Lebens.
Und wie immer meinem Mann Martin, der mich genau so liebt, wie ich bin. Ich liebe dich auch.
Prolog
Seattle,
vor drei Jahren
Sie hätten dieses verfluchte Schwein auf dem elektrischen Stuhl grillen sollen«, sagte der erste Mann verbittert. Er brach damit das Schweigen, das sich in seiner Intensität zu einer hochexplosiven Stimmung aufgeladen hatte.
Ein Murmeln hitziger Beifallsbekundungen ging durch die kleine Truppe, die sich versammelt hatte, um zuzusehen, wie der Umzugswagen beladen wurde. Gott allein wusste, was die Leute hier wollten. Es gab nichts zu sehen. Sofas, Stühle, Antiquitäten aller Größen und Formen. Vasen, die vermutlich so viel kosteten, wie ein Arbeiter im Durchschnitt im Jahr verdiente. Ein Flügel. Es gab nichts zu sehen außer den Habseligkeiten einer reichen Familie, die vor dem Zorn einer aufgebrachten Nachbarschaft fliehen musste.
Und den Bodyguards, die die Familie engagiert hatte, um den Mob auf Abstand zu halten. Das war alles.
Etwas abseits der kleinen Menschenmenge stand eine weitere Gestalt. Der Cop in Zivil – er trug alte Jeans und ein Seahawks-Sweatshirt – wusste selbst nicht genau, warum er hier im kalten Nieselregen Seattles wartete und zusah. Vielleicht, um sich zu vergewissern, dass dieser Hurensohn von Mörder wirklich die Stadt verließ. Vielleicht, um noch ein letztes Mal sein Gesicht zu sehen, bevor er auf Nimmerwiedersehen verschwand.
Vielleicht.
Wahrscheinlicher war jedoch, dass er einer masochistischen Neigung nachging. Dass er sich selbst quälen wollte, weil dieser Kerl davongekommen war. Weil dieses grausame, sadistische Dreckschwein davongekommen war. Und das wegen einer verdammten Formsache.
Die Hinterbliebenen der Opfer und die Menschen, die mit ihnen trauerten, standen noch immer unter Schock; sie hatten keine Gerechtigkeit erfahren. Man hatte ihnen die Genugtuung einer Verurteilung verwehrt. Aber was nicht ist, kann noch werden, dachte er.
Eine ältere Frau, die einen Regenhut aus Plastik trug, schüttelte den Kopf, während die Packer weitere Kisten in den LKW einluden. »Der elektrische Stuhl wäre nicht genug gewesen. Nicht für das, was er getan hat.«
Ein alter Mann straffte die Schultern, die einst sicher stark gewesen waren, und starrte verächtlich auf das Haus. »Sie hätten mit ihm das machen sollen, was er den armen Mädchen angetan hat!«
Seine Frau, die ihren Schirm über beide Köpfe hielt, schnalzte angewidert mit der Zunge. »Aber welcher halbwegs anständige Mensch würde so etwas tun?«
»Vielleicht die Väter der Mädchen«, erwiderte ihr Mann. Seine Stimme zitterte vor hilflosem Zorn.
Erneut zustimmendes Gemurmel.
»Ich begreife nicht, wieso sie ihn einfach abhauen lassen«, sagte ein jüngerer Mann wütend. Er trug eine Baseball-Kappe der Mariners.
»Es war ein Formfehler«, antwortete der erste Mann genau
so bitter wie zuvor.
Wegen eines Fehlers. Einer Formsache. Wegen einer gottverdammten Kleinigkeit!
»Die Bullen kriegen ihn, und die Rechtsverdreher lassen ihn frei«, sagte der Mann, der den Schirm mit seiner Frau teilte. »O nein«, warf der Mann mit der Base-Cap ein. »Für den Formfehler war allein die Polizei verantwortlich. Es stand in jeder Zeitung. Die Cops haben Scheiße gebaut, und das Monster ist frei.«
Ja, es stimmte. Aber er wusste, dass es nicht »die Cops« gewesen waren. Nur einer hatte Schuld.
»Richard.« Die Frau an der Seite des Kappenträgers nahm beruhigend seinen Arm. »Kein Grund, ausfallend zu werden.« Richard Base-Cap schüttelte die Hand der Frau ab. »Der Mistkerl vergewaltigt und tötet vier Mädchen, und ich bin ausfallend?« Er starrte sie ungläubig an. »Mach mal halblang, Sheila.«
Sheila senkte den Blick. Ihre Wangen glühten. »Tut mir Leid.«
»Ja, schon okay.« Richard blickte zum Haus hinauf. »Es kotzt mich nur an, dass reiche Leute die richtigen Anwälte bezahlen können, um sogar mit Mord durchzukommen.«
Erneut war sich die Menge einig, und man begann, über die Tücken moderner Rechtsprechung zu diskutieren, bis die Packer den letzten Karton in den Wagen schoben und die großen Türen verriegelten. In einem Hagel aus Buhrufen und wüsten Beschimpfungen startete der LKW und fuhr davon. Die Wartenden brüllten ihm hinterher, bis sie ihn nicht mehr sehen konnten. Aber was hätten Worte schon bewirken können?
Die kleine Menschenansammlung verstummte, als sich eins der drei Garagentore lautlos öffnete und ein schwarzer Mercedes herausfuhr. Keiner sagte ein Wort, bis die Limousine sie passierte und auf die nasse Straße rollte. »Mörder!«, schrie Richard Base-Cap, und die anderen nahmen den Ruf auf.
Nur einer blieb stumm. Der Cop außer Dienst in Jeans und mittlerweile durchweichtem Sweatshirt blickte schweigend dem Wagen entgegen, der nun auf ihn zufuhr und neben ihm zum Stehen kam.
Wieder verstummte die Menge, als das getönte Fenster nach unten glitt und das Gesicht zum Vorschein kam, das den Cop bis in seine Träume verfolgte. Das Gesicht eines Ungeheuers. Kalte, dunkle Augen voller Hass und Zorn und ein Mund, der sich häufig zu einem selbstgefälligen Grinsen verzog. Wie in diesem Augenblick. Der Cop verspürte das überwältigende Bedürfnis, diesem Ungeheuer das Grinsen aus dem Gesicht zu schneiden. Nicht zum ersten Mal. Der Mund öffnete sich. »Fahr zur Hölle, Davies«, sagte er.
Ich habe es verdient. »Dann treffen wir uns dort«, erwiderte Davies durch zusammengebissene Zähne.
Die Frau auf dem Beifahrersitz murmelte etwas, und der Mörder fuhr das Fenster wieder hoch. Der Motor heulte auf und die Reifen quietschten auf dem nassen Asphalt, als der Mercedes einen Satz machte und davonschoss. Zurück blieb eine Abgaswolke, die ihm in der Nase brannte.
Weg sind sie, dachte Davies. Sie flüchten, um sich irgendwo eine neue Existenz aufzubauen. Was für eine Ungerechtigkeit! Ein grausamer Mörder nahm vier jungen Mädchen das Leben und kam frei, um sein Leben weiterzuführen. Aber für wie lange?
Nur allzu bald würde die Mordlust erneut die Oberhand ge
winnen, wieder würden junge Mädchen dem Mörder in die Hände fallen. Weitere würden sterben müssen, denn dieses Ungeheuer kannte keine Gnade.
Aber das nächste Mal bin ich da. Das nächste Mal würde es keinen Formfehler geben. Das nächste Mal würde dieses sadistische Schwein für seine Taten büßen.
Neil Davies beobachtete, wie der Mercedes am Ende der Straße um die Ecke bog und verschwand. Das nächste Mal, schwor er den vier Mädchen. Schwor er sich. Ich kriege ihn. Er wird dafür büßen. Das verspreche ich.
1
Raleigh, North Carolina,
Montag, 26. September, 10.00 Uhr
Die Tatsache, dass er im Laufe seiner Karriere schon weit scheußlichere Szenerien gesehen hatte, hätte es ihm leichter machen müssen, diese hier mental zu verarbeiten.
Hätte.
Aber so war es nicht.
Special Agent Steven Thatcher lockerte seine Krawatte, aber es änderte nichts daran, dass die Luft nur mühsam in seine Lungen strömte. Es änderte auch nichts an dem, was er auf dieser Lichtung gefunden hatte, nachdem er einem anonymen Hinweis gefolgt war, der beim State Bureau of Investigation von North Carolina eingegangen war.
Und es änderte ganz sicher nichts daran, dass die arme Frau tot war.
Steven richtete den Knoten seiner Krawatte, bis dieser über dem Kloß saß, der in seiner Kehle steckte. Behutsam trat er einen Schritt vor und kassierte prompt einen mahnenden Blick von dem jungen Mann, den die Spurensicherung an den Tatort geschickt hatte. Der Junge war neu, ein echter Frischling. Normalerweise hätte sich die Chefin des Neulings für einen Fall wie diesen selbst herbequemt, aber sie hatte sich ausgerechnet die Woche, in der sie einen brutalen, grausigen Mord entdecken mussten, für ihre Karibikkreuzfahrt ausgesucht. Wie schön. Und während Steven auf den geschundenen Körper blickte, dem die Kreaturen des Waldes heftig zugesetzt hatten, wünschte er sich nichts sehnlicher, als ebenfalls auf irgendeinem Schiff fern jeglicher Zivilisation dahinzudümpeln.
»Passen Sie auf, wo Sie hintreten«, warnte der junge Forensiker verärgert. Er hockte auf allen vieren neben der Leiche im Gras. Kent Thompson war angeblich recht gut in seinem Job, aber Steven war entschlossen, sich sein Urteil selbst zu bilden. Die Tatsache, dass Kent sich noch nicht übergeben hatte, sprach allerdings für ihn.
»Danke für die Lektion in Tatortsicherung«, gab Steven trocken zurück.
Kents Gesicht rötete sich. Er hockte sich auf die Fersen und blickte zur Seite. »Tut mir Leid«, sagte er leise. »Aber ich bin wirklich vollkommen frustriert. Ich habe mir die Umgebung drei Mal ganz genau angesehen. Wer immer die Leiche hier hingelegt hat, war enorm vorsichtig. Hier ist nichts.«
»Vielleicht findet das Labor etwas auf dem Körper.«
Kent seufzte. »Auf dem, was davon übrig ist.« Er musterte die Leiche mit einem Ausdruck professioneller Distanziertheit, doch Steven entging nicht das kurze Aufflackern in seinen Augen, das von Mitgefühl zeugte. Steven war zufrieden. Kent würde seinen Job erledigen, aber das Opfer darüber nicht vergessen. Noch ein Punkt, der für ihn sprach.
»Tut mir Leid, Steven«, sagte eine gepresste Stimme hinter ihm. Steven drehte sich zu Agent Harry Grimes um, der noch immer heftig atmete. Sein Gesicht war blass, doch die grünliche Färbung war verschwunden, seit er seinen Magen um das kürzlich eingenommene Frühstück erleichtert hatte. Harry war neu beim SBI und noch in der Ausbildung. Er war Steven zugewiesen worden und entwickelte sich sehr vielversprechend. Das einzige Problem war sein empfindlicher Magen. Aber Steven konnte es ihm nicht verdenken. Auch er hätte sich wahrscheinlich übergeben müssen, wenn er sich die Zeit genommen hätte zu frühstücken. »Schon gut, Harry. So was kommt vor.«
»Haben wir etwas gefunden?«
»Noch nicht.« Steven hockte sich mit einem Stift in der behandschuhten Hand neben die Leiche. »Nackt, keine Papiere oder Kleider in der Nähe. Es ist gerade noch genug von ihr da, um sie als weibliche Person zu identifizieren.«
»Weibliche, jugendliche Person«, fügte Kent hinzu. Stevens Kopf fuhr hoch.
»Was?«
»Weibliche, jugendliche Person, würde ich vermuten.« Kent deutete auf die Bauchregion der Leiche. »Gepiercter Nabel.« Harry schluckte hörbar. »Woher wissen Sie das?«
Kents Mund verzog sich. »Wenn Sie ein bisschen näher rangehen, können Sie’s sehen.«
»Nein, danke«, gab Harry mit erstickter Stimme zurück. »Okay, ein weiblicher Teenager«, sagte Steven und verlagerte sein Gewicht auf die Fußballen, »sie liegt schon mindestens eine Woche hier. Wir müssen die Vermisstenanzeigen durchgehen.« Behutsam rollte er den toten Körper auf den Bauch, und sein Herz setzte einen Schlag aus. Gleichzeitig stieß Harry einen leisen Fluch aus.
»Was ist?« Kent schaute fragend von Steven zu Harry und wieder zu Steven. »Was denn?«
Steven deutete mit dem Kugelschreiber auf das, was von der linken Gesäßhälfte des Mädchens noch übrig war. »Sie hatte eine Tätowierung.«
Kent beugte sich vor und richtete sich dann blinzelnd wieder auf. »Sieht nach einem Peace-Zeichen aus.«
Steven schaute zu Harry auf, dessen Miene von bitterer Gewissheit zeugte. »Lorraine Rush«, sagte Steven, und Harry nickte.
»Wer war Lorraine Rush?«, fragte Kent.
»Lorraine ist vor ungefähr zwei Wochen als vermisst gemeldet worden«, erklärte Harry. »Als ihre Eltern sie morgens zur Schule wecken wollten, war ihr Bett zwar benutzt, aber leer.«
»Keinerlei Anzeichen für das gewaltsame Eindringen einer fremden Person ins Haus.« Steven musterte den Leichnam erneut. »Die logischste Erklärung war, dass sie von zu Hause ausgerissen war. Ihre Eltern behaupteten allerdings steif und fest, dass sie so etwas niemals getan hätte. Sie waren der Meinung, dass man sie entführt hat.«
»Eltern behaupten immer, dass ihre Kinder niemals abhauen würden«, sagte Harry. »Wir können aber noch nicht sicher sagen, dass sie es nicht doch getan hat. Kann doch sein, dass sie irgendeinem bösen Buben begegnet ist.«
Steven sah vor seinem inneren Auge das Bild einer lächelnden Lorraine Rush, wie er es auf dem Foto im Wohnzimmer der Eltern gesehen hatte. »Sie war sechzehn. Ein Jahr jünger als mein ältester Sohn.« Steven erlaubte sich einen kurzen Moment an Brad zu denken, der sich im letzten Monat so radikal verändert hatte, schüttelte die Sorge aber vorübergehend wieder ab. Er würde sich mit Brad und den Problemen, die sie beide miteinander hatten, auseinander setzen müssen, aber nicht jetzt. Zuerst musste er sich Zeit für Lorraine Rush nehmen. So viel sie brauchte.
»Eine Schande«, murmelte Kent.
Steven erhob sich und starrte hinab auf das, was von der ehemals hübschen, lebendigen jungen Frau übrig geblieben war. Heißer Zorn auf diese Bestie, die brutal andere Leben raubte, stieg in ihm auf, doch er drängte ihn zurück. »Wir müssen die Eltern benachrichtigen.« Auf diese Aufgabe freute er sich nicht.
Eigentlich hätte es ihm nach all den Jahren leichter fallen müssen, Angehörigen die schreckliche Nachricht zu überbringen.
Eigentlich.
Tat es aber nicht.
2
Donnerstag, 29. September, 8.55 Uhr
Hallo, Steven. Alles okay?«
Steven blickte auf. Sein Chef, Special Agent in Charge Lennie Farrell, betrachtete ihn mit besorgter Miene, und Steven hätte am liebsten gestöhnt. Wenn Lennie Farrell wissen wollte, ob alles okay war, dann bedeutete das, dass er mit Steven ein längeres Gespräch beginnen wollte. Und das würde ziemlich sicher irgendwann auf »den Vorfall« zusteuern, der sich vor sechs Monaten ereignet hatte. Aber Steven hatte nicht die Kraft, schon wieder darüber zu reden. Nicht jetzt.
Nicht nach dem Streit, den er am Abend zuvor wieder einmal mit seinem ältesten Sohn gehabt hatte. Der Auslöser war Brads Verhalten gewesen, das dem Ausdruck »Flegelalter« eine völlig neue Dimension gab. Sie hatten hitzig diskutiert und sich angebrüllt, aber Steven wusste noch immer nicht, worum es eigentlich gegangen war oder wer den Streit gewonnen hatte.
Der Morgen hatte nicht viel angenehmer begonnen, als der Abend zu Ende gegangen war. Beim Frühstück hatte er sich mit seiner Tante Helen auseinander setzen müssen, die ihm für dieses Wochenende eine ganze Reihe Verabredungen mit »netten, jungen Frauen« beschafft hatte. Helen wollte einfach nicht verstehen, dass Steven Witwer bleiben wollte – jedenfalls in nächster Zukunft und wenigstens so lange, bis die Jungen erwachsen waren.
Steven presste die Fingerspitzen auf seine pochenden Schläfen. Am meisten deprimiert aber hatte ihn die kleine Szene, die sich abgespielt hatte, als er ins Büro fahren wollte … als er versucht hatte, seinen jüngsten Sohn Nick zum Abschied in den Arm zu nehmen, und ihn der Siebenjährige erneut weggedrückt hatte. Nicky und »der Vorfall« waren untrennbar miteinander verschweißt. Nein, Steven hatte im Augenblick wirklich keine Kraft, darüber zu reden.
Aber Lennies Gesichtsausdruck machte deutlich, dass er genau das Thema ansprechen wollte, und obwohl Steven klar war, dass sein Chef sich nicht davon abbringen lassen würde, wusste er doch, dass er durchaus vorübergehend abgelenkt werden konnte. Also erwiderte er auf Lennies Frage, ob alles okay sei: »Das kommt drauf an, wie okay alles ist, wenn man Bilder von verstümmelten und angefressenen Mädchenleichen betrachten muss.« Er schubste den Ordner mit den Fotos über den Tisch.
Lennie griff nach den Bildern. Während er sie betrachtete, zeigte sein zerfurchtes Gesicht keine Regung. Doch Steven sah, dass er schluckte, bevor er die Akte zuklappte. »Verdächtige?«
»Nicht viele. Lorraine Rush war beliebt, Cheerleader auf der High Point High School. Sechzehn. Keinen Freund, jedenfalls keinen, von dem ihre Eltern wissen. Ihre Freunde sind wie vom Donner gerührt.«
»Und die Lehrer?«
»Da ist auch nicht viel zu holen. Als die Vermisstenanzeige einging, haben wir jeden Tag in den vorangegangenen drei Wochen überprüft und nichts gefunden, was irgendwie auffällig gewesen wäre. Lorraine war ein sauberer, typisch amerikanischer Teenager.«
»Mit einer Tätowierung auf dem Hintern«, bemerkte Lennie.
Steven zuckte die Achseln. »Sie war ein Teenie, Lennie. Die lassen sich eben piercen und tätowieren. Als ich in dem Alter war, haben wir uns die Haare grün gefärbt und Sicherheitsnadeln in die Nase gesteckt.« Er deutete auf den Ordner. »Wir haben sie auf Drogen überprüft, aber keine Rückstände der üblichen Partyzutaten gefunden.«
»Mit anderen Worten – wir haben keinen Verdächtigen.«
»Richtig.«
»Und der Bericht aus der Gerichtsmedizin?«
»Sie ist auf der Lichtung umgebracht worden. Ihr Blut ist acht Zentimeter tief in die Erde gesickert.«
»Die letzten Wochen war es verdammt trocken«, murmelte Lennie. »Der durstige Boden hat sie wie ein Schwamm aufgesogen.«
Steven beäugte den erkaltenden Kaffee mit plötzlichem Abscheu. »Tja. Todesursache waren wahrscheinlich Messerstiche, aber die Gerichtsmedizin will es nicht beschwören. Es war einfach nicht mehr genug von ihrem Körper da, um es mit Sicherheit sagen zu können. Sie hat fünf Tage dort gelegen, wie das Larvenstadium der Maden verrät, die sich eifrig über das hergemacht haben, was die Waldtiere übrig gelassen haben. Wahrscheinlich wurde sie vergewaltigt, aber auch darauf will die Gerichtsmedizin keinen Eid ablegen.«
Lennie kniff die Lippen zusammen. »Und worauf können sie einen Eid ablegen?«
»Dass sie tot ist.«
Lennies Mund zuckte. Bei all dem Schrecken, dem sie Tag für Tag ausgesetzt waren, mussten sie Wege finden, den Stress erträglich zu machen. Humor war ein probates Mittel, doch selbst derbe Scherze waren immer nur wie eine leichte Decke, die den Schrecken für einen Augenblick verhüllen konnte, bevor er sich wieder in voller Größe offenbarte.
Steven seufzte und schlug die Akte erneut auf. »Kent hat auf der Kopfhaut des Mädchens etwas gefunden, das wie eine relativ frische Tätowierung aussieht. Wer immer sie getötet hat, hat ihr den Kopf geschoren und seine Signatur auf ihr hinterlassen.«
Lennie beugte sich herab und betrachtete blinzelnd das Foto. »Und was ist das?«
»Keine Ahnung. Es war nicht mehr genug davon da. Kent untersucht es noch. Sie ist übrigens nicht auf der Lichtung rasiert worden. Oder aber der Kerl war unglaublich penibel. Wir haben zwei Tage lang jeden Grashalm mit der Pinzette gewendet und kein einziges Haar gefunden.« Frustriert schüttelte Steven den Kopf. »Nichts.«
Nun war es an Lennie zu seufzen. »Tja, dann habt ihr jetzt einen neuen Ansatzpunkt.«
Steven richtete sich auf seinem Stuhl auf. »Was soll das heißen?«
Lennie zog ein gefaltetes Blatt aus seiner Tasche. »Wir haben hier einen Anruf von Sheriff Braden drüben in Pineville bekommen. Seine Schwester wollte heute Morgen ihre Tochter wecken, aber …«
Furcht bildete einen festen Klumpen in Stevens Magen. Zwei Opfer. Zwei legten das S-Wort nahe. Serienmörder. »Aber das Mädchen war weg«, beendete er hölzern den Satz. »Das Bett benutzt, kein Anzeichen von gewaltsamem Eindringen, das Fenster nicht verriegelt.«
»Könnte ein Zufall sein«, sagte Steven.
Lennie nickte ernst. »Beten wir darum. Okay, das ist dein Fall. Aber ich muss fragen, ob du denkst, dass du damit klarkommst.«
Ärger stieg in Steven auf, und dieses Mal erlaubte er sich, ihn auch zu zeigen. »Natürlich tue ich das, Lennie. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mir so was nicht ständig anhören müsste.«
Lennie schüttelte den Kopf. »Ich darf gewisse Ereignisse nicht einfach ignorieren, und das weißt du. Ich kann mir nicht leisten, dass einer meiner besten Leute mitten in einer Untersuchung, die sich womöglich zu einer Fahndung nach einem Serienmörder entwickelt, zusammenbricht. Wenn du keine Parallelen siehst – ich schon. Steven, anscheinend ist dies ein Fall, in dem Kinder aus ihren Betten entführt werden.«
Wie es vor sechs Monaten mit Nicky geschehen war, als ein brutaler Cop und Mörder Stevens Sohn als Geisel genommen hatte. Nicky war körperlich unversehrt zurückgekehrt, was zum größten Teil der mutigen Einmischung der Frau des Täters zu verdanken war, doch er war seitdem nicht mehr derselbe. Aus einem fröhlichen, zutraulichen Kind mit einem ansteckenden Lachen war ein in sich gekehrter Junge geworden, der keine Zärtlichkeiten mehr zuließ. Er schlief nicht mehr in seinem Bett, und er schlief keine Nacht mehr durch. Und Steven wusste das, weil auch er seitdem keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen hatte.
Lennie riss ihn aus seinen Gedanken. »Steven. Kriegst du das hin oder nicht?«
Steven betrachtete das Bild des verstümmelten Körpers, der einmal Lorraine Rush gewesen war, und dachte an das andere Mädchen, das vermisst wurde. Der Täter musste gefasst werden. Er blickte zu Lennie hoch und verzog die Lippen zu einem Lächeln, das er nicht fühlte. »Ja, Lennie. Ich krieg das hin.«
Lennie reichte ihm eine Akte, doch sein Blick war noch immer besorgt. »Sie heißt Samantha Eggleston. Ihre Eltern warten auf deinen Anruf.«
Donnerstag, 29. September, 23.00 Uhr
Donner rollte aus dem Osten heran. Oder war es Westen? Im Grunde war es egal, dachte er und kratzte sich mit der Breitseite der Messerklinge im Nacken. Sein schönes, scharfes Messer. Er grinste. Ein kleiner Ausrutscher, und er war erledigt. Er blickte zu Boden und zog nachdenklich eine Augenbraue hoch. Ein kleiner Ausrutscher, und auch sie wäre erledigt. Aber nicht schon jetzt, nicht schon beim ersten Mal – das wäre zu schade. Er hatte sich solche Mühe gegeben. Jede Bewegung musste geplant sein. Und genossen werden. Er krempelte seinen linken Ärmel hoch, legte das Messer in die andere Hand und krempelte methodisch den rechten Ärmel auf, während sie mit weit aufgerissenen Augen zusah. Sie hatte Todesangst.
Das war gut. Allein der Anblick des Mädchens, das gefesselt, verängstigt – und nackt – vor ihm lag, ließ seine Haut vor Erwartung prickeln. Sie war ihm ganz und gar ausgeliefert. Es war wie … wie Elektrizität. Pure Elektrizität. Und er hatte sie geschaffen. Energie. Wie ein gewaltiger Stromstoß.
Wie bei Lorraine Rush. Lorraine war als Probelauf ideal gewesen. Sie hatte ihm den Einstieg ins Spiel nach den vielen Jahren der Zurückhaltung erleichtert. Oh, er hatte beinahe vergessen, wie verdammt gut es sich anfühlte.
Die Neue da, sie hatte noch kein einziges Geräusch von sich gegeben. Nun ja, das lag natürlich daran, dass sie einen breiten Streifen Klebeband über dem Mund hatte. Aber er würde es wieder lösen, und dann würde sie Laut geben. Sie würde es zu unterdrücken versuchen. Sie würde sich auf die Lippe beißen und weinen. Aber gegen Ende würde sie dann doch aus vollem Hals schreien. Wie alle anderen auch. Nützen würde ihr das natürlich gar nichts. Das war das Gute an Hicksville; hier gab es Fleckchen, an denen man sich die Seele aus dem Leib brüllen konnte, ohne dass jemand es hörte.
Ein weiterer Donnerschlag brachte den trockenen Untergrund zum Rascheln, und er schaute verärgert in den Nachthimmel hinauf. Vielleicht würde es regnen. Und was dann? »Die ganze Planung dahin«, murmelte er. Jetzt würde er sie nehmen müssen und … Er grinste, als ihm die Doppeldeutigkeit des Satzes bewusst wurde. Ja, er würde sie nehmen, aber erst einmal musste er sie hochheben und wegbringen. Sein Grinsen verlosch, als der Wind plötzlich drehte. Ausgerechnet heute musste es regnen.
Er verschränkte die Arme vor der Brust, sodass die fünfundzwanzig Zentimeter lange Klinge unter seinem Arm hervorragte, und runzelte die Stirn. Er konnte jetzt sofort Schluss machen, aber dann brachte er sich selbst um die Vorfreude, die er bis ins Letzte auskosten wollte. Er hatte schon eine ganze Weile vorgehabt, sich dieses Püppchen hier zu schnappen, aber lange auf sie warten müssen. Sie hatte sich so geziert. »Ich weiß nicht«, hatte sie immer wieder geflüstert. Auch dieses Mal war sie ängstlich darauf bedacht gewesen, ihre Eltern nicht zu wecken, aber er hatte ihre Erregung hören können. Im Stillen hatte er sich über ihre keuschen Ausreden lustig gemacht. Wenn ihre Eltern wüssten, dass ihr kleiner Schatz in Wahrheit eine elende Schlampe war, die sich mitten in der Nacht mit Fremden traf. Und besonders klug war sie auch nicht. Eine Schlampe und eine dumme Kuh dazu.
Er schloss die Augen und beschwor das Bild einer anderen herauf. Er konnte ihr Gesicht vor seinem inneren Auge sehen. So wunderschön, so … rein. Eines Tages würde er sie kriegen. Bald. Aber bis es so weit war …
Er blickte auf die Gestalt zu seinen Füßen. Bis es so weit war, würde die da es eben tun.
Es donnerte wieder. Er musste sich entscheiden. Entweder sich beeilen und Schluss machen oder sie in den Kofferraum packen und irgendwo zwischenlagern, bis sich das Wetter besserte. Er ging ein Risiko ein, wenn er im Regen hier draußen war. Auf aufgeweichtem Grund hinterließ man Fußabdrücke und Reifenspuren, und die Cops waren heutzutage gar nicht schlecht, wenn es darum ging, dieser Art von Spuren nachzugehen. Verdammte Techniker. Aber egal. Er war genauso klug. Nein – klüger.
Himmel, selbst ein Schimpanse war klüger als ein Cop. Wenn er darauf gewartet hätte, dass sie Lorraine von alleine fanden, wäre nichts mehr von ihr übrig gewesen, über das man sie hätte identifizieren können.
Aber er wollte, dass sie identifiziert wurde. Er wollte, dass alle Bescheid wussten. Und sich fürchteten.
Fürchtet mich. Eure Töchter sind nicht einmal in ihren eigenen Betten sicher. Fürchtet mich.
Er würde warten, beschloss er. Beim letzten Mal hatte er es überstürzt; es war zu schnell vorbei gewesen. Wie in einem Vergnügungspark: zwei Stunden Schlange stehen für eine Fahrt, die dreieinhalb Minuten dauerte. Nun – natürlich hatte es bei ihm länger als dreieinhalb Minuten gedauert, aber es war dennoch zu schnell vorbei gewesen. Doch durch das große Finale zu hetzen war sein einziger Fehler gewesen; alles andere hatte perfekt geklappt. Und er hatte nicht die kleinste Spur hinterlassen.
Vorsichtig schob er das Messer in die Scheide zurück und verbarg es unter dem Fahrersitz des Autos. Als er zu der Stelle zurückging, wo sie lag und ihn noch immer mit weit aufgerissenen Augen anstarrte, öffnete er im Vorbeigehen den Kofferraumdeckel.
»Komm, Herzchen«, sagte er, hob sie auf und warf sie sich über die Schulter. »Kurven wir ein bisschen durch die Gegend.« Er ließ sie in den Kofferraum fallen und tätschelte ihren nackten Po. Sie wimmerte, und er nickte zufrieden. »Keine Sorge, wir kommen morgen wieder. Amüsier dich in der Zwischenzeit ein bisschen. Du kannst zum Beispiel an mich denken.« Er strahlte sie an. »Du weißt doch, wer ich bin, hm?« Sie schüttelte heftig ihren kahl geschorenen Kopf, um zu leugnen, was so offensichtlich war, und er musste lachen. »Och, komm schon, Samantha. Du musst es wissen. Siehst du denn keine Nachrichten?« Er beugte sich zu ihr herab und flüsterte: »Hast du denn keine Fantasie?«
Sie kniff die Augen zu und machte sich so klein, wie sie konnte. Ihr ganzer Körper zitterte. Zwei Tränen rannen über ihre Wangen.
Er nickte wieder und ließ krachend den Kofferraumdeckel zufallen. »Braves Mädchen. Ich wusste es doch.«
3
Freitag, 30. September, 12.30 Uhr
Siebenundzwanzig erledigt, blieben noch drei. Und Brad Thatchers Arbeit würde eine der drei letzten sein. Du bist ein Feigling, schalt sich Jenna Marshall. Du hast Angst vor einem Blatt Papier. Genauer gesagt fünf Blatt Papier, säuberlich gestapelt, die Kanten an der linken oberen Ecke ausgerichtet. Mal drei Schüler, deren Arbeiten sie noch zu bewerten hatte. Sie starrte auf den purpurnen Ordner, der die noch nicht benoteten Chemietests enthielt.
Du bist ein Feigling und drückst dich vor dem Unausweichlichen. Plötzlich seufzte sie. Ihr Blick wanderte über den verschrammten alten Tisch, der mitten im Lehrerzimmer stand, und blieb an einer Mauer windschiefer Ordnerstapel hängen, hinter der sich Casey Ryan verbarg und gerade die Arbeiten ihres Englischkurses korrigierte. Die armen Kinder. Dostojewski stand auf dem Programm, und die Schüler mussten nicht nur Verbrechen und Strafe lesen, sondern auch noch einen Aufsatz darüber schreiben. Jenna verdrehte die Augen.
Jetzt mach dich endlich an die Arbeit, Jen. Hör auf, Ausreden zu suchen, und nimm dir Brads Arbeit vor. Sie griff nach ihrem Rotstift, starrte einen Augenblick unversöhnlich auf den Hefter, dachte an Brad Thatcher und den Test, den er mehr als wahrscheinlich in den Sand gesetzt hatte, und schaute sich verzweifelt nach etwas um, mit dem sie sich stattdessen beschäftigen konnte. Der einzige andere Anwesende im Lehrerzimmer war Lucas Bondioli, Vertrauenslehrer am Tag, Topgolfer in seinen Träumen. Lucas war mit allen Sinnen darauf konzentriert, in einen umgekippten Plastikbecher zu putten. Und da der Mann immer sehr ungehalten wurde, wenn man ihn dabei störte, wandte Jenna ihre Aufmerksamkeit wieder Casey zu.
Caseys Hand erschien über den wackeligen Türmen aus Ordnern und grabschte den nächsten Aufsatz. Der Stapel begann, gefährlich zu schwanken, und Jennas Hände schossen instinktiv vor und packten ein paar Arbeiten, um den Turm zu stabilisieren und ein größeres Unglück zu verhindern.
»Hände weg«, knurrte Casey, ohne von ihrer Korrektur aufzuschauen.
»Verdammt!«, stieß Lucas hervor.
»Leg sie einfach zurück, und es wird nichts geschehen«, fuhr Casey fort, als hätte Lucas nichts gesagt.
Jenna schaute auf und sah gerade noch, wie Lucas’ Putt weit danebenging, zog den Kopf ein, legte die Ordner zurück und setzte sich wieder. »Tut mir Leid, Lucas.«
»Schon okay«, gab er düster zurück. »Wäre sowieso nichts geworden.«
»Und ich?« Casey blickte über ihre Mauer aus Heftern.
»Dir hab ich doch nichts getan. Ich wollte bloß verhindern, dass hier alles zusammenbricht.« Sie deutete mit einer fahrigen Handbewegung auf die Stapel. »Du bist eine durch und durch chaotische Person.«
»Und du bist unentschlossen und zögerlich«, sagte Lucas freundlich und setzte sich neben Jenna.
Casey griff nach der nächsten Arbeit. »Was gibt es denn zu zögern, Jen? Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
Lucas ließ sich auf seinem Stuhl abwärts rutschen. »Sie will Brad Thatchers Chemietest nicht korrigieren, weil sie genau weiß, dass er durchgefallen ist und weil sie eigentlich seinen Vater anrufen müsste, da Brad sich in letzter Zeit völlig anders verhält als üblich, aber leider traut sie sich nicht so recht, schon wieder Eltern anzurufen, weil sie am Mittwoch von Rudy Lutz’ Vater übel beschimpft wurde, da sie« – er holte tief Luft – »seinen Sohn im Förderkurs Chemie durchfallen lassen und dafür gesorgt hat, dass er vorübergehend aus dem Football-Team ausgeschlossen wird.« Er atmete aus.
Jenna sah ihn halb verärgert, halb bewundernd an. »Wie machst du das?«
Lucas grinste. »Ich habe eine Frau und vier Töchter. Wenn ich nicht schnell rede, komme ich nie zu Wort.«
Caseys Stuhl schrammte über den gefliesten Boden, sie stand auf, und ihr blonder Kopf spähte über die Mauer aus Arbeiten. Auf Zehenspitzen nur knapp über eins fünfzig groß, sah man sie nur vom Kinn aufwärts. »Brad Thatcher hat den Chemietest versiebt?« Ihr Gesicht legte sich in Falten, sodass sie aussah wie eine verdatterte, körperlose Elfe. »Reden wir hier über den Brad Thatcher, das Wunderkind?«
Jenna senkte ihren Blick auf den Hefter. Ihre Miene war wieder ernst. »Ja. Nur, dass er nicht mehr derselbe Brad ist. Im letzten Test hatte er ein F. Und ich würde mir diesen hier am liebsten gar nicht ansehen.«
»Jenna.« Lucas schüttelte den Kopf und wurde wieder zu dem in sich ruhenden, nachdenklichen Menschen, der für Lehrneulinge wie sie selbst ein so wunderbarer Mentor war.
»Tu es einfach. Danach können wir darüber reden, was wir unternehmen sollen.«
Jenna griff also entschlossen ein weiteres Mal nach ihrem Rotstift, schlug den Ordner auf und fand Brads Test ganz unten in dem dünnen Stapel. Ihr Mut sank, während sie eine Frage nach der anderen mit einem »x« markierte. Brad war ihr vielversprechendster Schüler gewesen; klug, redegewandt, ein sicherer Kandidat für das prestigeträchtige Stipendium, das eine Gruppe von Firmen aus Raleigh vergab. Er hatte diese einzigartige Gelegenheit im Grunde bereits verschenkt. Noch einen Test wie diesen, und er würde den Kurs nicht bestehen. Dann waren seine Chancen vertan, von den Colleges, die er sich ausgesucht hatte, angenommen zu werden. Wie war das bloß geschehen? Sie wusste es nicht. Wieder seufzte sie, als sie auf die erste Seite oben und unten ein »F« schrieb. Eine glatte Sechs. Sie schaute auf und sah, dass Lucas und Casey schweigend warteten.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich auf einer Arbeit von Brad Thatcher mal ein F sehen würde.« Sie legte den Stift auf den Tisch. »Was ist bloß los mit ihm?«
Lucas nahm die Blätter und überflog den Test mit besorgter Miene. »Keine Ahnung, Jen. Manchmal haben die Kids Probleme mit der Freundin, manchmal Probleme zu Hause. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hätte auch nie erwartet, dass Brad sich so ändern könnte.«
»Glaubst du, dass es mit Drogen zusammenhängt?«, sprach Casey aus, was alle im Stillen fürchteten.
»Es ist bekannt, dass es auch bei Jugendlichen aus so genanntem gutem Haus passieren kann«, sagte Jenna und schob Brads Test zurück in die Mappe. »Ich werde wohl oder übel seinen Vater anrufen müssen, aber ich bin wirklich nicht erpicht darauf. Der Grund dafür, wie Lucas ganz richtig festgestellt hat, ist die Reaktion von Rudy Lutz’ Vater, als ich ihm mitteilte, dass sein Sohn den letzten Test nicht bestanden hat und kein Football spielen darf, bis seine Noten sich gebessert haben.«
Casey kam um den Tisch herum und hockte sich auf die Tischkante neben Jennas Stuhl. »Mr. Lutz hat es dir so richtig gegeben, was?«
Bei dem Gedanken an das Telefonat zogen sich Jennas Eingeweide erneut zusammen. »Ich habe ganz neue Schimpfwörter gelernt«, sagte sie mit einem matten Grinsen. »Sehr inspirierend. Aber was Brad angeht, fühle ich mich furchtbar hilflos. Es kommt mir vor, als ob er sein Leben wegwirft. Wenn ich nur wüsste, was ich tun kann.«
Casey verengte die Augen. Mit ihrer schmalen Hand griff sie nach Jennas Kinn. »Das werde ich dir sagen. Du rufst seine Eltern an, sagst ihnen, dass sie mit deiner Unterstützung rechnen können, und wartest erst einmal ab. Du bist nicht die Retterin der Welt, Jen. Der Junge ist keiner von deinen süßen verlassenen Welpen, die du davor bewahren kannst, eingeschläfert zu werden. Er ist ein Schüler im Abschlussjahr mit genügend Hirn, um eigene Entscheidungen zu treffen. Du kannst ihn nicht zu seinem Glück zwingen. Und das sind leider die harten Fakten. So ist das Leben, klar?«
Schon in ihrer Collegezeit auf der Duke hatte Casey es sich zur Aufgabe gemacht, auf Jenna aufzupassen. Was nicht der Komik entbehrte, da Jenna Caseys kleine Gestalt um einiges überragte. Die beiden waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht: Jenna war groß und dunkel, Casey klein und blond. Casey, ewiger Cheerleader und auf jeder Party anzutreffen, Jenna dagegen ruhig und distanziert. Selbst jetzt noch, da beide die Dreißig erreicht hatten, spielte Casey die Löwenmutter mit echter Hingabe. Jenna hatte es schon vor langer Zeit aufgegeben, sie davon abzubringen. »Jawoll, Ma’am. Du kannst mich jetzt loslassen.«
Casey tat es, ohne jedoch den Blick von ihr zu wenden. »Sag mir, wie das Gespräch gelaufen ist.«
Jenna suchte die Liste, auf der die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler eingetragen waren. »Brad hat nur noch den Vater.«
»Seine Mutter ist vor vier Jahren umgekommen«, erklärte Lucas. »Bei einem Autounfall.«
Casey schürzte nachdenklich die Lippen. »Das allein würde ausreichen, um ein Kind aus der Bahn zu werfen. Und dann noch die Sache mit seinem Bruder, der gekidnappt worden ist. Hör mal, ich muss jetzt los. Meine Vierte nimmt Macbeth durch, und ich muss noch den Kessel aufsetzen.« Sie ging zur Tür und drehte sich dort noch einmal um. Ihre Miene war ernst. »Sieh zu, dass sie sich nicht zu sehr in Brads Probleme hineinziehen lässt, Lucas. Sie muss immer alles unter Kontrolle haben.«
Lucas’ Lippen zuckten. »Ich weiß, Casey. Danke«, sagte er trocken. »Ich pass auf.«
Als die Tür wieder zu war, verdrehte Jenna die Augen. »Ich muss immer alles unter Kontrolle haben?«
»O ja, und ob«, sagte Lucas freimütig. »Genau wie sie. Und du bist sicher, dass ihr zwei nicht verwandt seid?«
»Ganz sicher. Siehst du denn nicht, wie unterschiedlich unsere Augenfarbe ist?« Jenna wandte sich wieder der Telefonliste zu. »Brads Vater arbeitet bei der Polizei. Den kriege ich bestimmt nicht so leicht an die Strippe.«
»Gut möglich.«
»Bestimmt sagt er, dass er keine Zeit hat. Zu viel zu tun.«
»Kann sein.«
Jenna warf ihm einen finsteren Blick zu. Er lächelte sie freundlich an.
»Du machst mich wahnsinnig, Lucas.«
»Das sagt Marianne mir seit fünfundzwanzig Jahren.«
Jenna verschränkte die Arme vor dem Körper und sog die Wangen ein. »Als Mentor bist du wirklich daneben. Obi Wan hat Luke Skywalker immer einen klugen Rat mit auf den Weg gegeben.«
Lucas’ ergrauender Schnurrbart bebte. »Lausche der Macht, die in dir steckt«, sagte er mit tiefer Stimme. »Was wirst du tun, junger Jedi?«
Jenna seufzte. »Ja, ja, ich rufe seinen Vater ja schon an«, gab sie verärgert zurück. »Und wenn der Kerl mich genauso runterputzt wie der Vater von Rudy Lutz, dann komm ich und heul mich an deiner Schulter aus.«
Lucas stand auf und tätschelte ihren Kopf. »Meine Taschentücher sind deine Taschentücher.«
Im wahrsten Sinne des Wortes. Dr. Jenna Marshall stand quer über der Kleenex-Schachtel, die Lucas ihr nun hinhielt. Sie lächelte traurig. Marianne konnte sich glücklich schätzen, ihr Leben mit einem so liebevollen Mann zu teilen.
Ihr Lächeln verschwand, als ihre Gedanken unweigerlich abdrifteten. Wenn Adam und sie bloß ein wenig mehr Glück gehabt hätten … Aber es hatte wohl nicht sein sollen. Sie konzentrierte sich und versuchte, sich an die Zeit zu erinnern, in der Adam noch gesund war, aber wie immer drängten sich die Bilder seiner letzten Tage auf. Sie atmete tief durch, richtete sich kerzengerade auf, straffte die Schultern und schüttelte den Kopf, als ob sich die Erinnerungen dadurch vertreiben ließen.
Aber natürlich funktionierte es nicht.
Also zwang sie sich aufzustehen. Die Pause war gleich vorüber, und sie musste Brads Vater anrufen. Noch heute. Bevor der Junge ihr noch weiter entglitt.
Freitag, 30. September, 14.45 Uhr
Jetzt also zwei, dachte Steven, während er die Siebzig-Quadratmeter-Fläche musterte, die sie mit dem leuchtend gelben Band abgesperrt hatten.
Ein zweites Mädchen verschwunden. Eine zweite Familie auseinander gerissen.
Dank eines vier Jahre alten Labradors namens Pal, seines achtzigjährigen Besitzers und Sheriff Bradens, der die Fläche abgesperrt und ohne Umschweife das SBI angerufen hatte, würden sie im Fall von Samantha Egglestons Verschwinden möglicherweise einen großen Schritt weiterkommen. Steven sah zu, wie Kent wieder einmal auf Händen und Knien den Boden absuchte. Dieses Mal trug er einen Apparat auf dem Kopf, mit dem er Steven halb an einen Schweißer, halb an einen Spion aus einem alten Schwarzweißfilm erinnerte. Kent hatte eine Pinzette und säuberlich beschriftete Plastiktüten dabei. Harry Grimes durchkämmte den äußeren Rand an der Baumgrenze genauso sorgsam. Keiner würde sich auch nur den kleinsten Hinweis entgehen lassen. Möglicherweise würde es keine solche Chance mehr geben, ihrer Beute näher zu kommen.
Steven musterte die Szenerie mit sachlichem Blick. Es war eine Lichtung genau wie die, auf der sie Lorraine Rush gefunden hatten. Die Kiefern, die die Fläche säumten, hatten diesem Vorort von Raleigh den Namen gegeben. Pineville, North Carolina. Bald schon würde dieses hübsche, kleine Kaff nicht mehr nur wegen seiner Weihnachtsbaumzucht bekannt sein. Bald würde man es in den Nachrichten mit dem Jagdrevier eines Serienkillers in Verbindung bringen.
Lorraine Rush war vor vier Tagen gefunden worden. Samantha Eggleston gestern Morgen als vermisst gemeldet. Beide Mädchen waren hübsche Schülerinnen der High School. Beide waren am Abend wie üblich schlafen gegangen und irgendwann in der Nacht verschwunden. In beiden Fällen keinerlei Anzeichen für gewaltsames Eindringen einer fremden Person. Die Fakten, die sie bisher in der Hand hatten, deuteten darauf hin, dass beide Fälle zusammenhingen. Steven durfte nichts anderes annehmen, bis sie Beweise für das Gegenteil fanden.
Die Lichtung lag nun verlassen da, aber in den letzten Stunden war hier etwas geschehen. Man sah platt gedrücktes Gras auf einer Fläche, die etwa die Größe eines Frauenkörpers hatte. Möglicherweise hatte hier jemand gelegen. Auf der einen Seite der Stelle war Blut verspritzt worden, und es stammte vermutlich von dem Hund, der dem Besitzer dieses Grundstücks gehörte, aber selbstverständlich würde Kent erst ausschließen müssen, dass nicht auch menschliches Blut darunter zu finden war. Die Blutspur führte von der Lichtung quer durch den Wald bis zu dem Haus des Besitzers, etwa eine Meile von hier entfernt, wo der Hund vor ungefähr einer Stunde aus mehreren Stichwunden blutend aufgetaucht war. Der alte Mann hatte nicht gezögert und war der Spur bis zur Lichtung zurück gefolgt. Trotz seines Alters hatte er gute Augen und entdeckte sofort den weißen Stofffetzen, der an einem der Kiefernzweige flatterte. Es war Damenunterwäsche, dieselbe Größe, dasselbe Modell, dieselbe Marke, die Samantha Eggleston gewöhnlich trug. Der alte Mann hatte sofort den Sheriff benachrichtigt, der wiederum Steven angerufen hatte.
Kent setzte sich auf seine Fersen und schob das Vergrößerungsglas aus seinem Sichtfeld. Er schaute kurz auf. »Ich habe ein Haar gefunden. Dunkel. Glatt.« Seine Stimme klang zutiefst zufrieden.
Stevens Herzschlag beschleunigte sich, und er bewegte sich mit vorsichtigen Schritten auf das flach gedrückte Gras zu, das Kent noch immer untersuchte, und mied dabei die blutbespritzten Stellen. Samantha Eggleston hatte dunkle Haare, aber sie waren lang und lockig. Dass das einzelne Haar dem Täter gehörte, war beinahe mehr, als er zu hoffen wagte. »Unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass du überhaupt etwas hast finden können.«
Kent grinste, bevor er die Lupe wieder vors Auge klappte und sich erneut auf Hände und Knie niederließ. »Ich bin eben gut.«
Steven schüttelte den Kopf. Sie arbeiteten jetzt erst zum zweiten Mal zusammen, aber ihr Verhältnis war bereits persönlicher geworden. Ein solcher Fall ließ keinen Raum für Formalitäten. »Und bescheiden. Vergiss bescheiden nicht.«
»Und bescheiden«, sprach Kent den Boden an.
»Bullshit«, sagte Steven freundlich. »Sag mir, dass das Haar noch eine Wurzel hat, und ich gebe zu, dass du tatsächlich gut bist. Kannst du das nicht, bist du auch bloß ein Fachidiot mit Schweißermaske.«
Kent lachte leise. »Das wär’s. Wahrscheinlich würde ich dann wenigstens anständig verdienen.«
Steven verschränkte die Arme vor der Brust. »Komm schon, Schweißerbursche. Haarbalg oder nicht?«
Kents Lächeln verschwand. »Nein. Tut mir Leid.«
»Verdammt!« Ohne Haarbalg gab es auch keine DNS-Analyse.
»Hooo, Fury«, sagte Kent beruhigend. »Vielleicht kriegen wir dennoch einen genetischen Abdruck hin.«
Steven knirschte mit den Zähnen. »In wie vielen Tagen?«
»Sieben bis zehn.« Kent setzte sich wieder auf die Fersen. »Wo ist der Hund?«
Steven wandte den Kopf und sah zum Sheriff hinüber, der dem Hundebesitzer einen Arm um die Schulter gelegt hatte. »Wahrscheinlich zu Hause. Der Tierarzt sollte eigentlich schon unterwegs sein, um ihn zusammenzuflicken.« Er hoffte für den Alten, dass das Tier durchkommen würde, aber der Labrador hatte viel Blut verloren. Zu schade, dass er nicht erzählen konnte, was sich hier auf der Lichtung abgespielt hatte. »Wieso?«
»Ich will seine Zähne sehen.«
Steven zog die Brauen hoch. »Aha. Und warum?«
»Falls der Hund den Täter gebissen hat, könnten noch Hautreste zwischen seinen Zähnen stecken.«
Steven konnte nicht anders; er sah den jungen Mann, der erst vor wenigen Monaten zum SBI gestoßen war, einen Moment lang staunend an. »Okay, ich erstarre in Ehrfurcht. Du bist gut. An die Zähne des Hundes hätte ich nicht gedacht.«
Kent grinste wieder. »Leider nicht auf meinem Mist gewachsen. Hab’s in Law & Order gesehen.«
Steven verdrehte die Augen. »Oh, na klar. Wir sollten uns die Akademie sparen und die Jungs stattdessen vor die Glotze setzen und Cop-Serien sehen lassen.«
»Zumindest würde uns das Steuergelder sparen.« Kent hatte den Blick nicht vom Boden genommen.
Steven lächelte gegen seinen Willen. Er musste zugeben, dass er Kents lockere Art weit mehr mochte als die Reizbarkeit seiner Chefin. Gewöhnlich hätte Diane eine Untersuchung von dieser Größenordnung geleitet, doch sie sonnte sich noch immer auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffs. Das war Kents Chance, sein Können unter Beweis zu stellen, und alle anderen in der Abteilung begrüßten es, Dianes knurrige Art eine Weile nicht ertragen zu müssen. »Ich sorge dafür, dass der Tierarzt nichts macht, was das Hundegebiss beeinträchtigt.«
»Danke. Und sag dem alten Mann, dass ich seinem Hund nichts tue.« Kent senkte den Kopf und konzentrierte sich wieder voll auf die Suche.
Steven schaute sich nach dem Alten um, der mit dem Sheriff hinter dem gelben Absperrband stand und schweigend zusah. »Das hat schon ein anderer erledigt«, murmelte er. Sheriff Bradens Blick begegnete seinem, und Steven sah in den Augen des anderen eine Mischung aus Furcht, Entsetzen und Hilflosigkeit. Samantha Eggleston war Bradens Nichte.
Während Steven den Sheriff musterte, spürte er eine emotionale Verbindung zu dem Mann, die über das höfliche Mitgefühl, das Gesetzeshüter dem Opfer gewöhnlich entgegenbringen, hinausging und auch nichts mit Kollegialität zu tun hatte. Steven wusste genau, wie Braden sich fühlte. Oder wie Bradens Schwester sich fühlte. Er wusste, was für ein Alptraum es war, wenn man befürchten musste, dass ein Verrückter das eigene Kind festhielt.
Steven ging zu den beiden Männern, die ihm entgegensahen. »Vielleicht haben wir was«, sagte Steven. Braden nickte, die Lippen zu einem Strich zusammengepresst. »Sie haben bei der Absicherung des Tatorts gute Arbeit geleistet. Außerdem haben wir Glück, dass es noch nicht zu regnen angefangen hat.« Der Sheriff sagte nichts. Vielleicht konnte er einfach nicht, was Steven ihm nicht verübelte. Der Mann hatte die Stichwunden des Hundes gesehen, und seine Fantasie zog zweifellos Schlüsse, was seiner Nichte in den Händen eines Irren zustoßen könnte. Impulsiv streckte Steven den Arm aus und berührte kurz Bradens Schulter. »Es tut mir Leid«, murmelte er. »Ich weiß, wie Sie sich fühlen.«
Braden schluckte. Räusperte sich. »Danke«, brachte er hervor. Dann straffte er die Schultern, hob den Kopf und nahm den Arm von den Schultern des alten Mannes. »Meine Leute brennen darauf, etwas tun zu können. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie’s nur.«
Steven blickte über die Schulter. Kent kroch noch immer im Gras umher, während Harry den Waldrand absuchte. »Hier sollten so wenig Leute wie möglich herumlaufen. Aber Sie könnten anfangen, eine Suchmannschaft zusammenzustellen. Wie viel Hektar haben wir hier?«
Braden sah den alten Mann an. »Bud?«
»Dreihundertzweiundsechzig«, erwiderte der Alte ohne zu zögern. Seine Stimme war kräftiger, als sein Zustand vermuten ließ; immer wieder erzitterte er in kurzen Abständen am ganzen Körper. Eine knorrige Hand hielt einen Stock umklammert, die andere streckte er Steven zur Begrüßung hin. »Bud Clary. Das Land hier gehört mir.«
Steven nahm die Hand. »Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennen gelernt, Mr. Clary. Aber ich hätte eine besondere Bitte. Es geht um Ihren Hund.«
Der Mann zog eine graue Braue hoch. »Um Pal?«
»Ja, Sir. Wir würden uns gerne seine Zähne ansehen, wenn der Tierarzt seine Wunde genäht hat. Wenn Pal seinen Angreifer gebissen hat, könnten wir vielleicht etwas finden.«
»Hoffentlich hat er’s getan«, murmelte Clary. »Hoffe, er hat dem Mistkerl ein großes Stück rausgebissen.«
»Ja, das hoffe ich auch«, sagte Steven grimmig. »Sheriff – könnten Sie dem Tierarzt bitte sagen, dass er Pals Schnauze nicht anrühren soll?«
Braden bewegte sich bereits auf seinen Wagen zu. »Mach ich.«
Steven wandte sich wieder an den Eigner des Landes. »Möchten Sie sich vielleicht setzen, Mr. Clary? Ich habe einen Campingstuhl im Kofferraum.«
Clary nickte, und Steven holte den Stuhl und stellte ihn auf dem Waldboden auf. Auf diesem Ding hatte er schon an jedem Flüsschen zwischen Raleigh und William’s Sound gesessen und geangelt, was immer der Köder hergab. »Könnte ein bisschen fischig riechen«, sagte er entschuldigend, als Mr. Clary sich darauf niederließ.
»Schon gut, mein Junge.« Er lächelte müde. »Das tue ich auch.« Als er endlich saß, holte er tief Luft. »Ich habe Parkinson, und das Zittern wird schlimmer, wenn ich mich aufrege.« Er warf Kent einen Blick zu, der noch immer auf allen vieren durchs Gras kroch, dann wandte er sich wieder Steven zu. Seine alten Augen waren klar und durchdringend. »Werden Sie Samantha finden, Agent Thatcher?«
Unwahrscheinlich, dachte Steven. Jedenfalls nicht lebend. Die Wunden des Hundes und der Zustand des ersten Opfers sprachen dagegen. Trotzdem zwang er sich, zuversichtlich zu klingen. »Das hoffe ich, Mr. Clary.«
Clary schüttelte den Kopf. »Nennen Sie mich Bud. Bei ›Mis
ter‹ fühle ich mich so alt.«
Steven lächelte. »Okay, dann also Bud.« Doch dann wurde er wieder ernst. »Können Sie mir sagen, was genau passiert ist?« Bud seufzte. »Pal rennt gerne mal hinter einem Vogel oder einem Karnickel her, wissen Sie. Manchmal ist er ein paar Stunden am Stück weg, deswegen hab ich mir auch nichts dabei gedacht, als er heute Morgen gegen zehn verschwand.«
»Und mit der Zeit sind Sie sich sicher, Sir?«
Bud nickte. »Meine Frau musste in die Stadt, ein paar Besorgungen machen, und ich hab sie gefahren. Wir sind um zehn los. Pal kam mit nach draußen, rannte dann aber hinter einem Eichhörnchen her.« Er schaute auf und blinzelte in der Nachmittagssonne. »Müssen Sie wissen, wo wir überall hingegangen sind?«
»Im Moment noch nicht, Sir. Wann waren Sie zurück?«
»Ungefähr um Viertel nach zwölf. Pal lag hinten auf der Veranda, und alles war voller Blut. Meine bessere Hälfte hat die Blutspur gesehen und sofort den Sheriff angerufen.«
Steven lächelte innerlich über den Stolz in Buds Stimme. »Mrs. Clary ist eine kluge Frau.«
»Das ist sie.« Bud nickte zufrieden. Er deutete mit dem Daumen über seine Schulter. »Ich bin mit dem Trecker an der Blutspur entlang über die Felder gefahren, bis ich auf die Lichtung kam. Von uns aus habe ich so um die zwanzig Minuten gebraucht.« Er hob die knochigen Schultern. »Ich bin sofort wieder umgekehrt und hab Sheriff Braden noch mal angerufen. Und der hat dann, glaube ich, Sie benachrichtigt.« Anschließend waren Steven und die anderen hinausgefahren und über einen Feldweg, der von der Straße abzweigte, zur Lichtung gelangt. Genau wie Samanthas Entführer.
»Was genau haben Sie gesehen, als Sie hier ankamen?«, frag
te Steven leise.
Bud schluckte. »Ich wusste, dass ich Blut vorfinden würde – so wie Pals Wunden aussahen! Aber ich hab wohl nicht erwartet, so viel Blut zu sehen. Ich bin vom Trecker gestiegen, um mir alles genauer anzusehen, und da hab ich was Weißes bemerkt.«
»Samanthas Unterwäsche?« Sie befand sich bereits in einer Plastiktüte auf dem Weg ins Labor.
Die Kiefer des alten Mannes spannten sich an. »Ja. Das Zeug war zur Seite geweht worden, unter die Kiefernzweige dort.«
»Haben Sie irgendetwas angefasst?«
»Nein. Ganz sicher nicht.« Bud sah ihn indigniert an. »Ich bin zwar alt, junger Mann, aber nicht dumm.«
»Entschuldigung. Ich muss diese Frage stellen.«
Bud lehnte sich zurück und kreuzte, etwas besänftigt, die Arme vor der Brust. »Na schön.«
»Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen, als Sie hier ankamen?«
Bud nickte. »Das Blut war noch warm.«
Steven runzelte die Stirn. »Aber Sie haben doch gesagt, Sie hätten nichts angefasst.«
»Habe ich auch nicht. Ich konnte es riechen. Ich habe fünfzig Jahre lang Schweine geschlachtet, Junge. Ich weiß, wie warmes Blut riecht.«
Steven sog scharf die Luft ein und stieß sie wieder aus. Nur knapp verpasst. Bud Clary war weniger als eine Stunde nachdem sein Hund niedergestochen worden war zu dieser Lichtung gekommen. Wenigstens konnten sie den Zeitpunkt jetzt ziemlich genau festlegen. Rechnete man die zwanzig Minuten Fahrtzeit hinzu, war Bud um fünf nach halb eins hier gewesen. Samantha musste daher um halb zwölf noch hier gelegen haben. »Danke, Bud, das hilft uns weiter.« Er zog eine Visitenkarte aus der Tasche. »Bitte rufen Sie mich an, falls Ihnen sonst noch etwas einfällt.«
Bud nahm die Karte. »Werde ich machen. Bitte finden Sie Samantha, Agent Thatcher. Wir leben hier in einer kleinen Stadt. Jeder kennt und liebt Samantha und ihre Eltern. Das Mädchen passt manchmal auf meine Urenkel auf.« Dann fügte er den einen Satz hinzu, den Steven schon so oft gehört hatte: »Ich verstehe das einfach nicht. Pineville ist doch ein friedliches Städtchen.«
Nur leider können selbst in friedlichen Städtchen grausame Menschen leben, dachte Steven. Seine Arbeit wäre um vieles einfacher gewesen, wenn sich all die Schurken und Killer an einem bestimmten Ort versammelt und gegenseitig umgebracht hätten.
Steven kehrte gerade zu dem abgesperrten Bereich zurück, als sein Handy klingelte. Ein Blick auf das Display verriet ihm, dass seine Assistentin anrief. »Nancy. Was ist los?«
Nancy Patterson war seine Sekretärin, seit er auf dem jetzigen Posten saß. Sie hatte für seinen Vorgänger gearbeitet und für dessen Vorgänger ebenso. Sie war ein Computer-Crack mit enormem Erfahrungsschatz, und er vertraute ihr.
»Brads Lehrerin hat zweimal angerufen.«
Ihr Tonfall und seine eigene Sorge um seinen ältesten Sohn verursachten ihm ein flaues Gefühl im Magen. Vor etwa einem Monat hatte sich sein warmherziger, fröhlicher Junge in einen trotzigen, mürrischen Teenager verwandelt. Jeder Versuch, die Mauer aus Sarkasmus und Zorn, die Brad um sich errichtet hatte, zu durchbrechen, war gescheitert. Er und Steven hatten durchaus schon einige Pubertätskämpfe durchgestanden, dies hier war jedoch etwas ganz anderes. Und seine Lehrer schienen das auch so zu sehen. Er versuchte, ruhig zu bleiben. »Was ist denn los?«
»Das wollte sie mir nicht sagen. Sie will unbedingt mit dir selbst sprechen. Und sie ist da sehr … hartnäckig.«
Steven schaute sich um. Noch immer wurden Beweise und Spuren eingesammelt, und er konnte nicht weg. Andererseits brauchte sein Sohn ihn auch. »Hat sie eine Nummer dagelassen, damit ich sie zurückrufen kann?«
»Nur die Nummer der Schule. Das erste Mal hat sie in ihrer Mittagspause angerufen, das zweite Mal zwischen zwei Schulstunden. Sie meinte, vor vier könntest du sie nicht erreichen.«
Steven sah auf die Uhr. Er konnte die Untersuchung hier also durchaus noch zu Ende bringen und um vier an Brads Schule sein. »Könntest du bitte im Sekretariat anrufen und eine Nachricht für die Frau hinterlassen, dass ich sie um vier unten in der Aula treffe?«
»Reichlich knappe Sache, findest du nicht, Steven?«
»Da ist ja für mich nichts Neues«, erwiderte er grimmig.
»Steven!«, rief Harry. »Komm mal her.«
Steven sah sich um und entdeckte Harry an der Straße. »Nancy, ich muss jetzt Schluss machen. Sag Brads Lehrerin, dass ich um vier da bin. Wenn das nicht geht, ruf mich bitte kurz zurück. Oh, und Nancy? Wie heißt die Lehrerin?«
»Dr. Marshall. Chemie. Steven, ist alles okay mit dir?«
Steven presste die Lippen zusammen. »Sag Lennie, es geht mir gut. Ich habe keineswegs vor, auszurasten und die Ermittlung zu vermasseln.«
»Davon geht er auch nicht aus, Steven«, sagte Nancy nachsichtig, und plötzlich kam er sich vor wie ein dummer Junge. »Er macht sich nur Sorgen um dich. Genau wie ich.«
Steven seufzte. »Es geht mir gut, wirklich. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir irgendwas über den Kopf wächst, dann geh ich zu Meg, okay? Ich versprech’s.« Meg war die Polizeipsychologin, die ihm nach der Sache mit Nicky so lange zugesetzt hatte, mit ihr zu reden, bis er es tatsächlich getan hatte. Nur um sie ein für alle Male loszuwerden. Aber sie hatte ihm tatsächlich helfen können. Ein wenig zumindest. Sein Angebot, im Notfall mit Meg zu sprechen, würde Lennie Farrell glücklich machen.
»Okay. Ich rufe die Lehrerin an. Dr. Marshall«, wiederholte sie. Sie kannte ihn gut.
»Danke.« Er versuchte sich den Namen einzuprägen, während er sein Telefon in die Tasche schob und anschließend zu Harry hinüberging. Sein Partner hielt ihm die Hand entgegen, auf der eine Spritze lag.
»Verdammt«, murmelte Steven und blickte zurück zu der flach gedrückten Grasfläche, deren Umriss deutlich erkennbar war. »Das würde erklären, warum wir keine Anzeichen für einen Kampf gefunden haben.«
»Warten wir ab, was das Labor herausfindet.« Harry deutete auf Kent, der die Blutspur untersuchte. »Vielleicht hat unser Neuer ja auch mit dem Hundegebiss Glück.«
Steven seufzte. »Ich hoffe bloß, dass wir schnell etwas Brauchbares finden. Uns rennt die Zeit weg.«
Freitag, 30. September, 15.50 Uhr
»Und? Hast du mit Brads Vater gesprochen?«
Jenna, die gerade die Tische im Labor abwischte, schaute auf und entdeckte Casey im Türrahmen. »Ja. Nein. Er war außer Haus tätig, sodass ich nur mit seiner Sekretärin reden konnte. Aber wir haben einen Termin, und zwar in« – Jenna blickte auf die Uhr – »zehn Minuten.«
Casey zog die Brauen zusammen. »Außer Haus tätig?«
»Er ist Polizist.«
»Hm.«
Jenna hatte wieder zu wischen begonnen, hielt aber nun erneut inne. Casey wirkte nachdenklich, und das war immer gefährlich. »Was ist?«
Casey lächelte, was Jenna einen Schauder über den Rücken jagte. »Ich weiß nicht. Polizist. Witwer. Brad ist ein hübscher Junge, sein Vater könnte also durchaus ein paar gute Gene haben …« Sie hob die Schultern. »Da stecken Möglichkeiten drin.«
Jenna schüttelte den Kopf und spürte den vertrauten Druck hinter den Augen. Eines von Caseys erklärten Zielen war es, für Jenna einen Partner fürs Leben zu finden. Jenna ging auf Casey zu und richtete sich neben ihr zu voller Größe auf. »Du wirst nicht zufällig auftauchen, Casey«, warnte sie. »Versprich mir, dass du keinen Blödsinn machst.«
Casey schaute trotzig zu ihr hoch. »Du bist größer heute.«