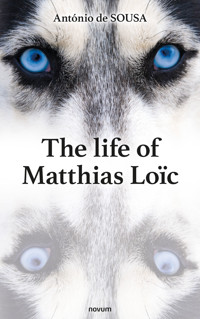22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum premium Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Matthias Loïc sucht durch sein Interesse an Geschichte in seiner näheren und weiteren Vergangenheit nach Erklärungen für das Heute in seinem Leben, in Deutschland und der Welt. In einer Kleinstadt in der Südheide aufwachsend, führen ihn sein Leben und seine Wege nach Tübingen, Kassel, Portugal und Schottland. Der brutale Tod seines Vaters am Tag seiner Geburt, seine Jugendliebe, der Einfluss eines Priesters – einer Zufallsbekanntschaft –, das Leben in der Gesellschaft der Kleinstadt mit seinen Wirren, Schmerzen und Freuden führt zu einem ungewöhnlichen Heiratsantrag bei einer charmanten alten Dame, die ihre eigene Geschichte zu bewältigen hat. Bei der Hochzeitsfeier wird Matthias überrascht von unerwarteten Gästen, die das Finale einleiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-99130-344-2
ISBN e-book: 978-3-99130-345-9
Lektorat:CB
Umschlagfotos:António de Sousa; Benjamin Gelman | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
1. Die Ursprünge
Mein Vater starb an dem Tag, an dem ich geboren wurde. So hat meine Mutter es mir erzählt. Er starb bei einem Autounfall, als er auf dem Weg zur Entbindungsklinik war, um uns zu besuchen. Gerade aus dem Ausland auf dem Flughafen Hannover eingetroffen und auf die Autobahn A 7 gefahren, die Hannover mit Hamburg verbindet, war er in diesen Unfall verwickelt worden.
Heute feiere ich meine siebenundzwanzig Jahre. Geradewar ich auf dem Friedhof in Bergen, um das Grab meines Vaters zu besuchen. Einige Jahre später wurden auch meine Großeltern mütterlicherseits hier begraben. Der Ort ist nicht so düster wie viele der Friedhöfe, die wir in anderen Ländern im Vorbeifahren von Weitem sehen.
Die kleine Kapelle am Eingang wurde mit kleinen roten Ziegeln gebaut, die ihren Bögen und Fenstern exakte geometrische Formen verleihen und die schöne blassrote Farbe des Ziegels beibehalten, die uns an mittelalterliche Kirchen erinnert.
Die Hauptzufahrt besteht aus grauen Pflastersteinen, die sich harmonisch in geraden Formen kreuzen. Die leuchtenden Blumen, die zwischen den Gräbern und entlang der verschiedenen Wege gepflanzt wurden, lassen den Ort friedlich, schön und einladend wirken.
Einige der Wege sind mit gepflegtem Gras gesäumt, ebenso wie die Büsche um sie herum, die so sorgfältig getrimmt sind, dass nicht ein einziger Zweig, ein einziges Blatt die Höhe eines anderen überragt. Die großen und wunderschönen Bäume verschiedener Arten, die zwischen den Gräbern gepflanzt sind, spenden uns vor allem an sonnigen und heißen Sommertagen außerordentlich viel Schatten.
Die Bäume sehen im Herbst genauso feierlich aus wie im Winter, aber dann sie sind anders gekleidet. Unter ihnen stehen die dunkelgrün gestrichenen Gartenbänke und laden zum Lesen, Meditieren oder Ausruhen ein und fügen sich im Frühling und Sommer in das grüne und blumige Dekor ein.
Der Ort, verschönert durch die Blumen, Sträucher, Rasen, Bäume, der Duft der verschiedenen noblen Blumen, der Gesang der Vögel lassen uns vergessen, an welchem Ort wir sind. Wir fühlen uns, als würden wir spazieren gehen oder lesen und irgendwo in einem schönen öffentlichen Garten sitzen.
Letztes Jahr bin ich mit dem Zug nach Portugal, nach Lissabon, gefahren. Anschließend habe ich die kleine Stadt Sertã besucht, in der meine Großmutter väterlicherseits geboren wurde. In dieser Stadt hatte mein Vater bei seinen Großeltern gelebt, seine Schulausbildung absolviert und das Technische Institut besucht. Es gab immer noch ein paar Freunde aus seiner Schulzeit, vom Fußball. Sie erzählten mir von den Abenteuern, die sie zusammen erlebt hatten, und sagten mir, ich sähe aus wie er. Aber wenn ich ihn mir auf Fotos genau ansehe, kann ich diese Ähnlichkeit nicht feststellen, obwohl meine Mutter sie auch hin und wieder erwähnt.
Als ich in Begleitung eines Onkels meines Vaters auf den dortigen Friedhof ging, um einige Gräber verstorbener Verwandter zu besuchen und mir so ein Bild oder eine Verbindung zur Vergangenheit zu verschaffen, insbesondere durch den Besuch des Grabes desjenigen, dessen Namen ich trage, und bei dieser Gelegenheit auch das Mausoleum des anderen Urgroßvaters besuchte, stellte ich fest, dass dieser Friedhof nichts mit dem schönen Park des Friedhofs in Bergen gemein hatte, auf dem mein Vater begraben wurde. Hier, wie auf allen Friedhöfen Südeuropas, ist die charakteristische Kälte des Todes deutlich spürbar.
Das blasse Weiß des Marmors, der fast alle Gräber und Mausoleen bedeckt, erinnert auf eine makabre Weise an unser gemeinsames Schicksal. Der Mangel an natürlichen Blumen auf den Gräbern, die, wenn sie da sind, meistens aus Plastik bestehen, um die Abstände zwischen den Besuchen der Verstorbenen zu vergrößern, macht den Ort morbide.
Nur die Hecken und Sträucher, die die Wege zwischen den Gräbern säumen, sowie die großen Zypressen mit ihren scharfen Spitzen verleihen dem Ort ein wenig Natürlichkeit. Einen leichten Kontrast zu diesem Dekor bildet das Elfenbeinweiß des Marmors. Selbst die Privilegierten in ihren Mausoleen können sich nicht der Regel entziehen, die ihnen durch die Einheitlichkeit des Steins vorgegeben ist.
Zypressen sieht man in dieser Gegend nur selten an einem anderen Ort. Man sieht sie meistens nur, wenn man einen Friedhof besucht. Von der Straße aus sichtbar, auf einer Anhöhe gelegen und von weißen, mit Branntkalk gestrichenen Mauern umgeben, weisen sie auf das Vorhandensein eines Friedhofs hin. Als wären es Bäume, die den Tod ankündigen. Anders ist es in Italien, wo sie an Straßenrändern und in der Umgebung der Ortschaften zu finden sind.
Der Körper meines Vaters wurde in die Erde gelegt. Auf dem Friedhof von Bergen gibt es keine Mausoleen. Reiche und Arme werden in die Erde zurückgebracht. Auf riesigen unförmigen Granitsteinen, fast im Rohzustand, sind zwischen den schönen Naturblumen die Namen der Verstorbenen sowie ihre Geburts- und Sterbedaten zu lesen. Kaum jemand hat sein Foto auf dem Stein, um die Neugier der Passanten zu befriedigen und ihnen zu zeigen, wie er oder sie zu Lebzeiten aussah.
Falls doch, wird in diesem Fall immer das schönste Foto ausgewählt, um an den Verstorbenen zu erinnern. Ein Erscheinungsbild, das meist nicht dem seiner letzten Tage entspricht. Auf dem Friedhof von Bergen sind Fotos nur selten oder gar nicht vorhanden. Familien halten oft die Erinnerung an ihre Angehörigen anders wach.
Leider bleibt uns immer das letzte Bild, das wir von einer Person haben, in Erinnerung, und das ist nicht immer das auf dem Grab. Es gibt einige Grabsteine, auf denen nicht einmal die beiden Jahreszahlen eingemeißelt sind. Auf dem Granitstein meines Vaters steht, dass er am 28. Juli 1993 starb.
Das Schicksal hält solche Überraschungen für uns bereit. Es schenkte mir an diesem Tag das Leben und nahm seines am selben Tag mit, an einen Ort, den niemand kennt. Es hat uns einfach sein Andenken hinterlassen, damit wir uns an ihn erinnern, durch seinen Namen und die wichtigsten Daten seines Lebens, die sichtbar auf diesem Grabstein mit seinen glitzernden rostfarbenen Kristallen eingraviert sind. Um sie herum lächeln uns Büsche in verschiedenen Grüntönen und mit unterschiedlichen Blumenarten an. Die Zuneigung und Liebe, die ich mit der Erinnerung an meinen Vater empfinde, wird durch dieses Datum, das uns verbindet, weitergegeben. Es markiert den Beginn meines Lebens und das Ende seines Lebens.
Es waren meine Geschwister, Carolina und Carlos, die meine Mutter in dem Leiden um den Tod meines Vaters begleiteten. Der Schmerz meiner Mutter ist immer noch gegenwärtig, wenn sie von ihren Erinnerungen an ihr gemeinsames Leben erzählt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht von ihm spricht. Ich kann die Gegenwart meines Vaters in ihren melancholischen Augen sehen. Als ich ein junger Student war und für einen kurzen Aufenthalt von der Universität nach Hause kam, gab es Nächte, in denen ich so manche Seufzer und ein verhaltenes Weinen aus ihrem Zimmer hörte.
Die Einzigen, die nicht unter dem Tod meines Vaters gelitten haben, waren meine Schwester Andrea und natürlich ich. Andrea war fast ein Jahr alt, als er starb. Meine Schwester Carolina und mein Bruder Carlos waren zwölf und zehn Jahre alt. Meine Mutter wurde sehr jung, im Alter von zweiunddreißig Jahren, Witwe.
Sie hat nie wieder geheiratet. Vielleicht, weil sie nicht noch jemanden in unser Leben bringen wollte. Oder weil sie trotz ihrer vielen Auslandsaufenthalte, und selbst als sie noch bei uns wohnte, nicht den Richtigen gefunden hat. Bei einer Gelegenheit sahen wir sie in galanter Gesellschaft. Ein alter Bekannter aus ihrer Teenagerzeit. Als mein Vater starb, arbeitete sie als Krankenschwester in der amerikanischen Botschaft in Kongo-Kinshasa.
Nach dem Tod meines Vaters hatte sie weiter für die Amerikaner gearbeitet, indem sie abwechselnd für Kollegen in verschiedenen diplomatischen Vertretungen einsprang, die ihren Urlaub verbrachten. Sie arbeitete einige Monate lang im Irak, in Afghanistan, Jordanien, Südafrika, der Türkei und Thailand. Sie hatte kürzere Aufenthalte in Japan und in afrikanischen Ländern. Mehrere Male war sie im Kongo, um Kollegen zu vertreten.
In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sie ihre Zeit zwischen Deutschland und diesen Ländern aufgeteilt, wobei sie nie länger als zwei Monate von uns weg war und dies zwei- bis dreimal im Jahr.
Während ihrer Abwesenheiten in unserer Kindheit lebten wir bei Hilde und Ruben, unseren Großeltern mütterlicherseits. Jahre später wurde meine ältere Schwester in ein Internat in Kassel aufgenommen und mein Bruder ging in eine andere Schule in Freiburg.
Andrea und ich sind in Bergen in die Grundschule gegangen. Dann ging sie auf das Christian-Gymnasium in Hermannsburg und ich auf das Gymnasium in Celle. Zwei Orte in der Nähe von Bergen und Wietzendorf, wo meine Großeltern lebten. Celle ist unsere Kreisstadt. Wir sind jeden Morgen mit dem Bus dorthin gefahren und am Nachmittag zurück nach Hause.
Meine Mutter erzählte mir, dass mein Vater im Kongo geboren war und vier Brüder und Schwestern hatte. Einer der Brüder ist Arzt und als Einziger der Geschwister in Portugal. Mein Großvater väterlicherseits wurde ebenfalls in diesem Land geboren. Sein Vater, mein Urgroßvater, der nach seinem Tod in dem Marmormausoleum beigesetzt wurde, das ich letztes Jahr in Portugal besuchte, ging im Alter von sechzehn Jahren nach Afrika, um bei einem Onkel zu arbeiten.
Dort heiratete er eine Afrikanerin. Ich hatte also eine afrikanische Urgroßmutter. Das hat meine Mutter mir erzählt und war amüsiert über meine Überraschung. Die Mischung meiner Gene sei ein Vorteil für meinen Organismus, abgesehen davon, dass ich kulturell interessant sei, ein Weltbürger, so ihr Fazit.
Sie sagte es mir und reagierte mit diesem leichten Lachen, das nur sie konnte und leider so selten zeigte. Sie sagte mir, ebenfalls amüsiert, dass ich, wenn ich eines Tages eine Europäerin heiraten würde, auf ihr Wort vertrauen müsste, wenn ich zufällig bemerken würde, dass unser Kind eine etwas dunklere Haut hätte, wie jemand, der gerade aus dem Urlaub in Palma de Mallorca gekommen wäre.
Auf eine dieser kurzen Reisen in den Kongo während unserer großen Ferien hatte meine Mutter Andrea und mich mitgenommen. Wie die Hitze und die stickige Luft uns den Atem nahmen, als wir aus dem Flugzeug stiegen, obwohl wir erst am Abend ankamen, hat mich sehr beeindruckt.
Am nächsten Morgen waren wir geblendet vom intensiven Sonnenlicht, von den prachtvollen und vielfältigen Farben, die durch diese Strahlen zu leuchten begannen, und umgeben von den Gerüchen, die ganz anders waren als die der Kiefern und Tannen, die die kalten Brisen in Europa um unsere Nasen wehten.
Hier sind die verschiedenen Aromen eher würzig. Anders auch die ungeheure Bewegung von Hunderten von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, die die mit Autos überquellenden Alleen überqueren, in die überfüllten Taxis mit gelben Farben, die ständig hupen, steigen oder auf Motorradtaxis, all diese Bewegungen und Farben der Kleidung der Passanten, die von der Sonne zum Leben erweckt werden und gute Laune und Freude bringen, zwischen fröhlich ausgetauschten Gesprächen, als ob sie von allen Passanten gehört werden sollten, als ob sich alle kennen würden.
Carolina und Carlos wurden ebenfalls im Kongo geboren. Dort hatten sie ihre Vorschulzeit verbracht. Sie waren zurückgekehrt, um bei unserer Mutter in Deutschland zu leben. Sie wollte sie bis zum Ende ihrer Grundschulzeit begleiten und hatte darauf gewartet, dass sie in die Internate privater weiterführender Schulen aufgenommen wurden. In der Zwischenzeit besuchte sie mein Vater alle zwei Monate für ein paar Tage.
Mein kürzlich abgeschlossenes Geschichtsstudium an der Universität Tübingen, das historische Fächer zu den Epochen Antike, Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart umfasste, hat mich dazu veranlasst, den Wurzeln meiner Familie auf den Grund zu gehen.
Ich schaue mir gedankenverloren die Ahnengalerie zu Hause an. Das Schwarz-Weiß-Bild eines ernst schauenden Ehepaares mit vier fast erwachsenen Kindern. Ruben der Älteste.
Mein Großvater Ruben wurde 1913 in Romanowka, einem kleinen Dorf in der Ukraine, geboren. Sein Vater und seine Mutter ebenfalls. Sie waren die Nachkommen der Deutschen aus Russland. Diejenigen, die von Zarin Katharina der Großen nach Russland gerufen worden waren.
Ab Juli 1763 begannen germanische Bevölkerungsgruppen, hauptsächlich lutherische, aber auch katholische, aus dem Südwesten Deutschlands, aus Hessen, dem Rheinland, der Pfalz und dem Elsass, sich auf Einladung der russischen Kaiserin Katharina II. in der Wolgaregion um die westrussische Stadt Saratow anzusiedeln, um diese weiten und fast unbewohnten Steppengebiete zu kolonisieren.
Die Kaiserin war eine in Deutschland geborene Prinzessin namens Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, die in der Stadt Stettin in Pommern, einer heute polnischen Region, geboren wurde. Hervorzuheben ist, dass Polen im Laufe seiner Geschichte einen großen Teil seines Territoriums von den Russen und den Deutschen besetzt sah als Ergebnis der vielen Kriege, die geführt wurden.
Sophie Friederike Auguste hatte von ihren Eltern eine strenge, rigide, protestantische Erziehung erhalten, die durch eine französische Erziehung bei einem hugenottischen Lehrer ergänzt worden war. Hugenotten waren Protestanten, die zur Zeit der sogenannten Religionskriege im 16. Jahrhundert aus Frankreich und dem Baskenland geflohen waren, wo sie von den Katholiken verfolgt wurden. Sophies Lehrer brachte ihr die guten Sitten des französischen Adels und der Gesellschaft, aus der sie stammte, bei. Zugleich brachte er sie auf den Geschmack der französischen Literatur jener Zeit. Die Prinzessin entwickelte sich sehr bald zu einer kulturell gebildeten Person mit einer Leidenschaft für Literatur und Wissenschaft. Von ihrer Mutter an den Hof des preußischen Königs eingeführt, wurde sie bald für ihr Charisma bekannt.
Die ehrgeizige Kaiserin Elisabeth Petrowna von Russland sah in ihr die ideale Ehefrau für ihren Neffen, den künftigen Peter III. von Russland, an den sie das Reich abtreten wollte. Zudem war die junge Sophie in der Politik unerfahren. Sie stellte offenbar keine Gefahr für den russischen Thron dar. Sophie ihrerseits verstand, was auf dem Spiel stand. Sie war sich des Prestiges und der Macht, die mit ihrem zukünftigen Status als Kaiserin verbunden sein würden, durchaus bewusst. Die anfänglichen Bedenken ihrer Mutter gegen die Verbindung schob sie beiseite.
Ihr Aufstieg zur Großfürstin von Russland verlief reibungslos, da sie mit großem Pomp zur orthodoxen Kirche konvertierte. Bei dieser Gelegenheit sprach sie auf Russisch zu einem Volk, das sie zur Zufriedenheit von Kaiserin Elisabeth Petrowna in sein Herz schloss. An diesem Tag nahm sie offiziell den Namen Katharina Alexeyevna an.
Nach acht Jahren Ehe blieb Katharina immer noch kinderlos. Kaiserin Elisabeth, die selbst kinderlos war, wollte unbedingt, dass Katharina einen Erben bekam. Sie vermutete, dass ihr Neffe aufgrund einer Geschlechtskrankheit impotent war. Sie schlug Katharina vor, sich einen Geliebten zu nehmen, und empfahl ihr Graf Sergej Saltykow. So wurde der zukünftige Kaiser Paul I. geboren.
Nach einem Staatsstreich im Palast, der von ihrem Geliebten unter Mitwirkung anderer Hofbeamter verübt wurde, wurde Kaiser Peter III. wegen einer Kolik für tot erklärt. So wurde dieser Tod den westlichen Kanzleien auf jeden Fall präsentiert. Gerüchten zufolge starb er durch Strangulation unter Mitwirkung seiner Frau, der späteren Zarin Katharina II., genannt „die Große“.
Während ihrer mehr als dreißigjährigen Herrschaft entriss sie dem Osmanischen Reich durch ihre brillanten militärischen Eroberungen etwas mehr als fünfhunderttausend Quadratkilometer Territorium, das in der heutigen Ukraine liegt.
Diese neuen Gebiete wurden langsam von einer zahlenmäßig unzureichenden russischen und ukrainischen Bevölkerung besiedelt und verfügten nur über sehr wenig bebautes Land. Daraufhin veröffentlichte Katharina II. im Juli 1763 ein Manifest, in dem sie Menschen aus Westeuropa, darunter auch ihre ehemaligen deutschen Landsleute, einlud, nach Russland auszuwandern und im Gegenzug Privilegien wie Steuerbefreiung für dreißig Jahre, Abschaffung des Militärdienstes, Religionsfreiheit und die Möglichkeit, relativ unabhängig von der russischen Autorität zu leben, zu erhalten. Diese auf dem Papier attraktiven Bedingungen veranlassten Tausende von deutschen Bauern, die von der Zersplitterung ihres ererbten Landes in immer kleinere Parzellen betroffen waren, das feudale Deutschland in Richtung Russland mit seinen großen landwirtschaftlichen Flächen zu verlassen.
Die zweite Einwanderungswelle deutscher Siedler fand während der Regierungszeit von Zar Alexander I. statt. Nach seinem Sieg über die osmanischen Armeen im Jahr 1812 zwang Russland die Osmanen im Rahmen des Vertrags von Bukarest, sich aus Bessarabien, das zwischen den Flüssen Dnjestr und Prut liegt, bis zum Schwarzen Meer zurückzuziehen. Die Region war damals weitgehend von türkischsprachigen Nomadenstämmen besiedelt. Viele von ihnen flohen nach der Niederwerfung der osmanischen Truppen, die anderen wurden auf die Krim gebracht.
Das Russische Reich brauchte wieder einmal Pioniere, um die neu eroberten Gebiete zu besiedeln. Westeuropa war zu dieser Zeit durch die napoleonischen Kriege verwüstet. Die Bevölkerung war hungrig. Hinzu kam der religiöse Druck, den die Katholiken auf die protestantischen Minderheiten ausübten, insbesondere im heutigen Süddeutschland.
Diesmal kamen die meisten deutschen Siedler aus Schwaben und Preußen. Die Schwaben reisten mit behelfsmäßigen Flößen, den sogenannten Ulmer Schachteln, auf der Donau, Einwegboote, deren Planken bei der Ankunft zum Bau von Häusern oder als Brennholz wiederverwendet werden sollten. Sie erreichten das Donaudelta am Schwarzen Meer um 1816–1817. In den beiden Jahren davor waren die Preußen auf dem Landweg über Warschau gekommen.
Die Protestanten betrachteten beruflichen Erfolg als eine Belohnung Gottes für ein frommes Leben. Sie blieben auch offen für den technischen Fortschritt in den Bereichen Landwirtschaft und Handwerk. Ihre Anfänge in der ukrainischen Steppe waren jedoch alles andere als einfach. Das schwarze und fruchtbare Land benötigte viel Bewässerung. Also mussten Brunnen gegraben werden. Die aus Deutschland eingeführten Rinder mussten mit den einheimischen Rassen gekreuzt und die Tiere an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst werden. Es war auch notwendig, Mühlen für den Grundbedarf an Öl und Mehl zu bauen und Dachziegel herzustellen, um einen ähnlichen Lebensstandard wie in ihrem Herkunftsland zu erreichen.
Dies waren einige der unerwarteten Schwierigkeiten und Herausforderungen. Versprochene Dinge sind nicht immer selbstverständlich und die ersten Ankömmlinge fanden in ihren ersten Jahren sehr harte Lebensbedingungen vor. Einige von ihnen konnten es nicht ertragen und kehrten frustriert nach Deutschland zurück.
Die verbliebenen Siedler, die dem technischen Fortschritt gegenüber aufgeschlossen waren, profitierten von der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Die ersten dampfgetriebenen Mähdrescher wurden auf den Feldern eingesetzt. Die neuen Veterinärbehandlungen und Düngetechniken ermöglichten es ihnen, den Viehbestand zu erhöhen, Schädlinge besser zu bekämpfen und einen größeren Ertrag auf ihren Flächen zu erzielen.
Sie kümmerten sich auch um das Wohlergehen ihrer Gemeinschaft und bauten Schulen, Waisenhäuser, Altenheime und Krankenhäuser. In den Dörfern wurden viele kleine evangelische Kirchen mit ihrer typisch deutschen Architektur gebaut. Ein Beispiel ist der Bau der Paulskirche in Odessa, dem Sitz der Deutsch-Lutherischen Kirche in der Ukraine, die mehr als tausend Gläubige aufnehmen kann.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte alles auf den Kopf und der Niedergang schien unabänderlich. Deutsche und Österreicher wurden als der zu bekämpfende Feind verstanden und der Ton gegenüber ihrer Minderheit verschärfte sich rasch. Es gab Gerüchte, dass sie ein Komplott schmiedeten. Die Zarin, die Gattin von Zar Nikolaus II., deren eigentlicher Name Alix von Hessen Darmstadt war, ein Deutsch klingender Name, war auf den viel russischeren Namen Alexandra getauft worden.
Die Revolution und der Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 1917 stürzten das Land ins Chaos. Die Bauern gerieten zwischen die Fronten der „Roten“ und der „Weißen“. Beide Seiten verfolgten eine rücksichtslose Politik mit Hinrichtungen im Schnellverfahren und willkürlichen Landbeschlagnahmungen. Das Land stand in Flammen. Zu allem Überfluss war auch noch eine Hungersnot ausgebrochen.
Das Ende des Bolschewismus und der Kriege, die er mit sich gebracht hatte, brachte eine kleine Atempause und ermöglichte den Beginn einer neuen Wirtschaftspolitik zu Beginn der 1920er-Jahre. Lenin hoffte, dass die teilweise Wiederherstellung des privaten Kleinunternehmertums zu einer wirtschaftlichen Erholung des Landes führen würde, das sich am Ende seiner Kräfte befand.
Die Machtübernahme durch Stalin nach Lenins Tod und die langen internen Kämpfe um die Übernahme des Parteiapparats, bei denen einige konkurrierende Genossen ausgeschaltet wurden, beendeten die „Laxheit“, die er Lenin bei der Verwaltung der vorangegangenen Jahre vorwarf.
Stalin ordnete mit Gewalt die strikte und brutale Kollektivierung an. Die Jagd auf die inzwischen zu Volksfeinden erklärten Kleingrundbesitzer entwickelte sich bald zu einer Hexenjagd. Die wohlhabendsten Bauern wurden ihres Landes beraubt und mit ihren Familien in ferne und oft feindliche Länder deportiert.
Die Folgen waren dramatisch. Nachdem die schwache, auf kleinen Familienbetrieben basierende Wirtschaft zerstört worden war, kam es in der Sowjetunion zu Engpässen, insbesondere bei Lebensmitteln. Dies führte zu einer noch nie da gewesenen Hungersnot, die die Ukraine schwer traf und Millionen von Menschen das Leben kostete. Viele der deutschen Siedler in Russland flohen in den Westen und versuchten, ihr Heimatland zu erreichen.
So erging es auch meinem Großvater Ruben und seinem Vater, meinem Urgroßvater Rudolph, die in den Gebieten des Russischen Reiches in der Ukraine geboren wurden. Sie waren die Nachkommen jener germanischen, hauptsächlich lutherischen Bevölkerung, die aus Preußen kam und sich vor fast zwei Jahrhunderten in dieser Region niederließ. Das sind die Geschichten, die mir mein Großvater und Pfarrer an der evangelischen Kirche in Wietzendorf, ein wirklich kultivierter Mann, geduldig erzählte.
Das nächste Foto in der Galerie zeigt eine junge Frau mit langen Zöpfen, ebenfalls schwarz-weiß – Hilde Christel. Meine Großmutter Hilde wurde 1924 in Dinslaken geboren, einer kleinen Stadt unweit der heutigen Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Sie war eine Nachfahrin derjenigen, die einige Jahrhunderte zuvor von Frankreich nach Deutschland gekommen waren. In ihrem Fall handelte es sich um Protestanten, sogenannte Hugenotten, die vor der Verfolgung in Frankreich geflohen waren.
Der Protestantismus hat seinen Ursprung im sechzehnten Jahrhundert. Der deutsche Augustinermönch und Theologe Martin Luther veröffentlichte die 95 Thesen, in denen er die Unzulänglichkeiten und Missstände der römisch-katholischen Kirche anprangerte und forderte, dass die Bibel die einzige Autorität sein sollte, auf die sich der Glaube stützt. Unter dem Schutz des Herzogs von Sachsen verbrannte er 1520 die Bannandrohungs-Bulle zusammen mit einem Exemplar des päpstlichen Rechts, das ihm die Exkommunikation androhte.
Im darauffolgenden Jahr weigerte er sich, abzuschwören, da er sich nur der Autorität der Bibel und seines Gewissens unterstellt sah. Zum ersten Mal rief er auf, sich direkt an Gott zu wenden, und erklärte das individuelle Gewissen. Für ihn war die Bibel nicht länger ein heiliges Buch, das ausschließlich für die Elite bestimmt war. Sie sollte allen zugänglich sein, ohne soziale Diskriminierung, und die Gleichheit aller Menschen verkünden. Seine Ideen hatten großen Einfluss auf die überwiegend bäuerliche Bevölkerung, so sehr, dass sie im Heiligen Römischen Reich Aufstände auslösten.
Um diesem Ausbruch von Gewalt gegen die herrschende Klasse ein schnelles Ende zu setzen, trafen sich die Fürsten und beschlossen, dass jedes Fürstentum die Religion wählen sollte, die in seinem Staat praktiziert werden sollte. Der sächsische Prinz hatte bereits die Institutionalisierung des Luthertums eingeleitet.
In Abwesenheit dieser von den Kurfürsten gebildeten Versammlung beschloss Kaiser Karl V., der vom Heiligen Stuhl beschuldigt wurde, Luther zu unterstützen, die Verbreitung der lutherischen Thesen zu unterbinden. Er widerrief alle Zugeständnisse, die die Fürsten an die Bauern gemacht hatten. So führte er den katholischen Gottesdienst und die lateinische Messe wieder ein, die nicht mehr in dieser Sprache gehalten worden war.
Die Fürsten reagierten sofort unter der Führung von Johann von Sachsen und protestierten. Sie wurden seither „die Protestanten“ genannt, woraus die Begriffe „Protestanten“ und „Protestantismus“ entstanden.
Der lutherische Protestantismus verbreitete sich über die nördlichen Handelswege in ganz Europa. Viele deutsche Fürsten übernahmen ihn im Rahmen ihres Strebens nach Unabhängigkeit von den äußeren Mächten des Heiligen Römischen Reiches, das dem Heiligen Stuhl unterstellt war und von Kaiser Karl V. regiert wurde.
Dieser kämpfte gegen die Osmanen, die seit dem Fall von Konstantinopel immer mehr europäische Gebiete eroberten und den Osten seines Reiches bedrohten. Er konnte jedoch nicht gegen die protestantisch gewordenen Fürsten einschreiten. Das Luthertum wurde zur Staatsreligion in Schweden und dann in Dänemark. Frankreich wiederum verfiel nach einer Periode der Toleranz unter dem Edikt von Nantes, das die Protestanten schützte, in die „Religionskriege“.
Fast ein Jahrhundert lang waren die hugenottischen Protestanten in Frankreich einer schweren Verfolgung ausgesetzt. Das schwerste Massaker erfolgte am Bartholomäus-Tag, dem 24. August 1572, dem Gedenktag des Heiligen Bartholomäus, in Paris. Unterschiedlichen Berichten von Historikern zufolge wurde dieses Massaker von König Karl IX. oder seiner Mutter Katharina von Medici in Auftrag gegeben. Es dauerte mehrere Tage und breitete sich in den folgenden Wochen und sogar Monaten von der französischen Hauptstadt auf mehr als zwanzig Provinzstädte aus.
Der Einfluss der katholischen Kirche war so groß, dass Frankreich unter der Führung von Ludwig XIV. die Verfolgung mit der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 offiziell vollzog. Von da an wurden die Repressionen immer schärfer. Viele Hugenotten wurden gefoltert, inhaftiert und geächtet und waren gezwungen, das Land zu verlassen. Mehr als zweihunderttausend Menschen flüchteten in gastfreundlichere fremde Länder wie England, Holland, die Schweiz und die protestantischen Staaten des Heiligen Römischen Reiches, darunter in Deutschland die Pfalz, Brandenburg, Württemberg, Hessen.
Es sind diese außergewöhnlichen Mischungen von Geschichten, die sich in mir selbst widerspiegeln. Sie erinnern mich an das Wasser jener Flüsse und Bäche, die fließen und sich vermischen und in einen großen See münden. Wie die kleine Straße, die wir nehmen, die uns immer ein Stückchen weiterführt, ohne zu wissen, dass nach ihr eine andere und dann noch eine andere uns in neue und unbekannte Welten führt.
Wie die Materie mit ihren kleinen Einheiten, den Atomen, die ihr ihre Form, ihr Gewicht, ihre Widerstandsfähigkeit geben. In ihrem Zentrum befindet sich ein Kern, der klein, aber dicht ist und aus Protonen und Neutronen besteht. Das Atom ist so klein, dass es etwa zehn Millionen aneinandergereihte Atome braucht, um einen Millimeter zu erreichen.
All diese Elemente, die Flüsse und Bäche, die kleinen Straßen, die miteinander verbunden sind, das Atom, seine Elektronen und Protonen, sind Beispiele für die Vielfalt meiner Ursprünge. Genauso wie die Herkunft vieler von uns, die sich nie die Mühe gemacht haben, sie zu ergründen. Die Suche nach meinen Ursprüngen hat nicht auf der Seite meiner Großeltern mütterlicherseits aufgehört. Ich habe auch bei meinen Großeltern väterlicherseits geforscht.
Ein kongolesischer Historiker und Freund meines Onkels, Vikar der Gemeinde Saint-Anne, hatte mir auch die Geschichte der ethnischen Herkunft meiner Urgroßmutter väterlicherseits erzählt, als wir uns im Haus meiner Cousine Irene in der Algarve trafen, während ich auf Einladung meines Großonkels Celso Portugal besuchte.
Der freundliche Historiker begleitete meinen Onkel Jorge, den jüngeren Bruder meines Vaters, als dieser seine Tochter besuchte. Er machte ein paar Tage Urlaub im Süden Portugals, während ich an den Strand von Nazaré fuhr, um mich mit einem Surferfreund aus Deutschland zu treffen, der die großen Wellen nutzen und gleichzeitig einen anderen Freund besuchen wollte, der in der Nähe wohnte.
Der Ursprung aufseiten meiner Urgroßmutter ließ mich in die Tiefen der Zeit und Afrikas eintauchen. Er geht zurück auf diese Frau, Tochter eines großen traditionellen Chefs der Mbala-Ethnie, eine der zweihundertsiebzig ethnischen Gruppen, die in diesem riesigen kontinentalen Land, der D. R. Kongo, leben.
Wie Pater Bechia erklärte, liegen die Ursprünge des Volkes der Mbala weit vor 1482, das heißt, vor der Ankunft des Seefahrers Diogo Cão, einem der ersten portugiesischen „Entdecker“ der afrikanischen Küste.
Also auch vor der Kolonisierung des Kongo-Volkes durch die belgischen Siedler. Die unbestreitbaren Ähnlichkeiten zwischen dem „Mbala“-Volk und dem „Kongo“-Volk beweisen, dass die Mbala ihren Ursprung in der heutigen kongolesischen Provinz Zentralkongo und in Nordangola haben.
Die Mbala waren dann wegen des Sklavenhandels und der Misshandlungen, denen sie ausgesetzt waren, überstürzt aus dieser Region geflohen. Sie hatten weiter nördlich an den Ufern des Kwangu-Flusses Zuflucht gefunden und beschlossen, aus Sicherheitsgründen mit dem Volk der Yaka zusammenzuleben, da dieses aus großen Kriegern bestand, stärker als die des Kongo-Königreiches.
Doch auch hier wurden sie Opfer von Angriffen, weil die Yakas sie an Sklavenhändler verkaufen wollten. So begann für die Mbala eine neue Phase der Flucht. Entmutigt verließen sie ein weiteres Mal ihre Ernten, Behausungen, Savannen und Wälder und setzten ihre Reise in Richtung Nordosten, d. h. zum Kwilu-Fluss, fort, um den hundert Jahre zuvor begonnenen Exodus wieder aufzunehmen.
Diese neue Migration hat sich schrittweise und über einen längeren Zeitraum vollzogen. Bei dieser Gelegenheit trennten sich viele Mbala-Familien. Einige gingen nach Norden oder Süden, andere nach Westen, wieder andere nach Osten und ließen sich an vielen Orten nieder. Infolgedessen sind Mbala-Familien heute in verschiedenen Dörfern vom Kwango- bis zum Kwilu-Fluss zu finden, eine Entfernung von fast zweihundertvierzig Kilometern in der Region des Südwestens des Landes. Demografisch gesehen sind die Mbala zahlreicher als andere ethnische Gruppen und bewohnen ausgedehntere Gebiete in der Region Kwango-Kwilu.
Die Gesellschaft der Mbala ist traditionell in Gruppen organisiert, wobei jede jeweils den Namen ihres Chefs trägt, den seine Vorfahren ihm hinterlassen haben. Eine Gruppe ist eine Ansammlung von Dörfern, deren Anzahl je nach Gebiet variiert. Ausdehnung und Grenzen wurden von den Vorfahren bestimmt.
Die Dörfer haben eine gewisse interne Autonomie, aber ihre Häuptlinge sind politisch und hierarchisch dem jeweiligen Oberhaupt der Gruppe untergeordnet. Sie müssen dem Leiter der Gruppe regelmäßig über alles berichten, was in ihrem Dorf passiert. Die Dorfvorsteher sind für das Leben und die Sicherheit aller Einwohner ihres Dorfes verantwortlich und müssen sie vor allen Gefahren und bösen Mächten, sowohl von innen als auch von außen, schützen.
Die traditionelle Machtposition ist erblich und endet erst mit dem Tod des Inhabers. Die Nachfolge wird hauptsächlich zwischen dem Gruppenleiter und dem Häuptling des Dorfes geregelt. Wenn einer von ihnen stirbt, tritt an seine Stelle der älteste Sohn der ältesten Schwester des Verstorbenen. In Ermangelung eines solchen Erben tritt der jüngere Bruder des Häuptlings die Nachfolge an.
Bei der Inthronisierung des neuen Häuptlings und vor der Übergabe der Häuptlingsinsignien klettert der Kandidat, umgeben von den Ältesten und dem Magier, auf das Dach der Hütte des verstorbenen Häuptlings, während die Honoratioren der Gruppe und des Dorfes das Haus umringen. Der Stellvertreter des verstorbenen Chefs nimmt zusammen mit dem Chefkandidaten einen lebenden Hahn mit auf das Dach des Hauses. Sobald der Magier den Befehl gibt, schneidet der Stellvertretende den Kopf des Hahns ab, öffnet den Brustkorb und entnimmt das noch schlagende Herz, um es dem Nachfolgekandidaten zu übergeben.
Währenddessen warten fünf mit Gewehren bewaffnete Männer ungeduldig auf den Moment, in dem der neue Häuptling, nachdem er das Herz des Hahns geschluckt hat, einen Schrei ausstößt, der das Krähen imitiert. Sobald dies geschehen ist, werden fünf Schüsse abgefeuert, begleitet von dem Ausruf der Menge, die den neuen Häuptling als stark und fähig, über sie zu herrschen, bejubelt.
Sobald der neue Dorfvorsteher-Chef vom Dach herabsteigt, wird er von allen Honoratioren, Magiern und Chefs der umliegenden Dörfer, die zu diesem Anlass eingeladen wurden, ehrfürchtig begrüßt. Sie begleiten ihn zum Haus des verstorbenen Chefs, wo er Anweisungen über seine Macht und die dazugehörigen traditionellen Insignien erhält.
Wenn der neue Dorf-Chef das Haus verlässt und das Ende der Zeremonien ankündigt, beginnen die großen Feierlichkeiten. Mehrere Ziegen, die für die ausgiebige Mahlzeit geschlachtet wurden, sorgen für das Essen, getrunken wird Palmwein, Kolanüsse werden gekaut und der Tanz beginnt.
Mein Urgroßvater väterlicherseits, der bei seinem Tod in dem Marmormausoleum beigesetzt wurde, das ich letztes Jahr auf dem Friedhof von Sertã in Portugal besuchte, war mit sechzehn Jahren nach Afrika gegangen und hatte die Tochter eines traditionellen Mbala-Chefs geheiratet, ein schönes afrikanisches Mädchen. Er wurde auch in dieser kleinen portugiesischen Stadt geboren, die im geodätischen Zentrum des Landes liegt, und ist nach der Überlieferung ein Nachkomme der Lusitaner.
Die Geschichte der Gründung von Sertã verliert sich in den Geheimnissen des Nebels der Zeit. Die ursprüngliche menschliche Besiedlung des Gebiets, in dem sich die Stadt heute befindet, geht mit Sicherheit auf die vorrömische Zeit zurück. Verschiedene archäologische Überreste zeugen vom hohen Alter der Siedlung.
Der Legende nach lässt sich ihr Name zurückführen auf Sertorius, einen römischen Soldaten, der von den römischen Truppen aus politischen Gründen von der iberischen Halbinsel vertrieben wurde. Nach einigen Jahren des Exils kehrte er zurück und ließ sich in der Region Lusitania nieder, an der Stelle, an der später die Burg der Stadt Sertã errichtet wurde. Er verbündete sich mit dem dort lebenden Volk, den Lusitanern, um die römischen Invasionen zu bekämpfen.
Während der Kämpfe um die römische Eroberung Lusitaniens wurde die Burg angegriffen und Sertorius starb. Als seine Frau Celinda die Nachricht hörte und erkannte, dass der Feind die Burgmauern erreicht hatte, kletterte sie mit einer riesigen „sertage“, einer viereckigen Pfanne mit kochendem Öl, in der sie Eier briet, auf die Festungsmauern. Sie schüttete das kochende Öl auf die Angreifer, die sich daraufhin zurückziehen mussten. So blieb Zeit, um Verstärkung aus den benachbarten lusitanischen Dörfern zu holen. Auf diese Weise entstand der Name Sertã für den Ort, der bis dahin einen bis dato unbekannten Namen hatte.
Historisch gesehen ist der Tod von Sertorius auf andere Umstände zurückzuführen. Er soll von einem römischen Soldaten namens Marco Perpenna, der eine Verschwörung gegen ihn angeführt hatte, getötet worden sein.
Im Jahr 83 v. Chr. war General Sertorius von Rom als Prokonsul auf die iberische Halbinsel geschickt worden, wo er die Regierung der Provinzen Hispania Ulterior und Hispania Città übernahm.
Drei Jahre später begann Sertorius mit Unterstützung der Lusitaner auf der iberischen Halbinsel einen Kriegszug, um seine Provinzen zurückzuerobern und die neue Ordnung zu stürzen, die durch die Macht der „Optimisten“, der konservativen Fraktion des Senats, entstanden war.
Während der Rückeroberung seiner Provinzen befand sich der tapfere Sertorius in der Gegend von Sertã und ließ seine Burg errichten. Es ist auch wahrscheinlich, dass Sertã während des Römischen Reiches als Sartago bekannt war. Die Überlieferung schreibt die Gründung der Burg Sertorius dem Jahr 74 v. Chr. zu. Archäologische Funde in der Gegend zeugen von der Anwesenheit der Römer.
Die Lusitaner hatten Sertorius ihre Unterstützung zugesagt und ihn gebeten, ihr Anführer zu werden. Er war ein intelligenter und geschickter General und besiegte in der Folge die römischen Armeen, die gegen ihn eingesetzt worden waren. Allerdings war er auch ein Politiker und ein kluger Verwalter, dem es gelang, sich nach und nach bei den verschiedenen Stämmen einzubringen, indem er römische Bräuche einführte.
Die römischen Senatoren in Spanien beschlossen, dass Marco Perpenna eine Verschwörung gegen ihn anführen sollte. Nachdem er das Vertrauen von Sertorius gewonnen hatte, ermordete Marco Perpenna ihn bei einem Bankett.
Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Urgroßvater lusitanischer, ja sogar römischer Abstammung war. Zumindest was seinen Mut betrifft. Dass er sich im Alter von sechzehn Jahren in ein unbekanntes Land begab, weit weg von seiner Heimat, seiner Familie und seinen Freunden, und dass er in einem afrikanischen Land heiratete, war der unwiderlegbare Beweis für mich.
Er war nicht der einzige von lusitanischer Herkunft. Die Eltern meiner Großmutter väterlicherseits wurden ebenfalls im Dorf der tapferen Celinda und ihrer berühmten Pfanne geboren.
Im Gegensatz zu mir, in dem sich das Blut der Preußen, Gallier, Hugenotten, Lusitaner und Mbala, der Volksgruppe meiner afrikanischen Urgroßmutter kreuzt, der ein Mosaik von Ursprüngen ist.
Der lusitanische Zweig meiner Familie wies nicht den Reichtum dieser außergewöhnlichen Mischung von Ursprüngen auf. Er lief eher Gefahr, zu eng verwandt, sogar miteinander blutsverwandt zu sein. Es sei denn, die Nachbarvölker oder andere fremde Völker, die durch Lusitanien zogen, hätten mitgemischt.
Meine Leidenschaft für die Geschichte der Völker des Altertums und des Mittelalters entstand an der Universität Tübingen durch das Wissen, das ich dank meiner Professoren in den letzten sechs Jahren erworben habe. Sie haben mich dazu gebracht, mit großem Enthusiasmus Bücher und alte Chroniken zu studieren, die von Historikern geschrieben wurden, die manchmal andere und verschiedene Meinungen vertraten.
Kürzlich las ich in der französischen Zeitschrift „Histoire et Culture“ einen Artikel mit dem Titel „Die Lusitaner sind vielleicht nicht unsere direkten Vorfahren“, der auf einem Interview mit einem gewissen Luis Almeida Martins, einem portugiesischen Schriftsteller, Historiker und Journalisten, beruht.
Er erläutert, dass bereits vor Tausenden von Jahren afrikanische, südamerikanische und europäische Völker auf der Suche nach einladenden Orten waren, um sich niederzulassen. Dies war auch in dem Gebiet geschehen, das heute portugiesisches Hoheitsgebiet ist und in dem damals die Menschen aus Mittel- und Osteuropa angekommen waren.
Andere Völker kamen aus der Region des heutigen Libanon, und zwar schon tausend Jahre vor Christus. Die Phönizier aus dem Nahen Osten hatten das Mittelmeer überquert und sich entlang der gesamten Mittelmeerküste niedergelassen. Sie waren beides, Seeleute und Händler. Auf jeden Fall konnten sie alle vom Letzteren überzeugen.
Die bekannte portugiesische Geschichte erwähnt hauptsächlich die Ursprünge durch die Lusitaner, wie auch der Historiker und Schriftsteller Martins in seinem Artikel erläutert. Als ob die Apachen vor der Gründung Amerikas nie existiert hätten und auch nur als Amerikaner betrachtet würden oder die Italiener als die direkten Nachfahren des römischen Kaisers Julius Cäsar.
Die Lusitaner waren nicht die einzigen, die die iberische Halbinsel bewohnten. Bereits im sechsten Jahrhundert v. Chr., um das Jahr 400, lebten mehrere Volksstämme in dieser Region und kämpften tapfer gegen die römischen Invasoren. Sie besetzten die Gebiete zwischen den Flüssen Tejo und Douro in der zentralen Region Portugals, die als Beira bekannt ist, sowie in den luso-spanischen Grenzgebieten.
Nach der Eroberung dieser zentralen Region durch die Römer gaben sie ihr den Namen „Provinz Lusitania“ mit der Stadt Merida als Hauptstadt. Ihre Bewohner erhielten den römischen Namen Lusitaner, Bewohner von Lusitanien.
Dem Historiker Martins zufolge waren die Vorfahren der Lusitaner Kelten aus Mitteleuropa. Es ist bekannt, dass sie ein Getränk mochten, das dem heutigen Bier ähnelte. Sie verstanden die lateinische Sprache nicht, die von den römischen Invasoren gesprochen wurde.
Heute sind Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Katalanisch, Galizisch und Rumänisch Sprachen mit lateinischen Wurzeln. Würde ein Einwohner der neuen Provinz Lusitanien heute in seiner Muttersprache zu uns sprechen, würde ihn niemand verstehen. Das Latein in den romanischen Sprachen geht zurück auf die Sprache der römischen Besatzer und nicht, wie im Falle des Portugiesischen, auf eine Mischung beider Sprachen.
Die Kelten, die zu Lusitanern wurden, nahmen gerne Dampfbäder und salbten ihre Körper mit parfümierten Ölen. Einmal am Tag aßen sie Brot aus Eichelmehl. Sie brachten den Göttern Menschenopfer dar und waren monogam. Die Frauen waren ebenso kriegerisch wie die Männer.
Dies waren ungewöhnliche Bräuche im kaiserlichen Rom, abgesehen von der Sauna. Fraglich ist, ob die Sauna nicht eine Mode war, die von den Generälen der Militärlegionen aus Lusitanien, insbesondere aus der Region Beira, in Rom eingeführt wurde.
Es gab auch Nachbarstämme, die als Keltiberer bekannt waren. Ihre Vorfahren stammen wahrscheinlich aus dem Kaukasus – einer Region zwischen dem heutigen Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Russland und der Türkei, die in der Antike als Iberien bekannt war. Dies könnte der Grund für den Namen sein, den man der iberischen Halbinsel gegeben hatte. Sie hatten sich mit den Kelten vermischt, wodurch ein neuer Volksstamm entstand, der als Keltiberer bekannt wurde.
Alle diese Völker, einschließlich der Kelten, waren nach dem Willen Roms als Lusitaner getauft worden. Sie lebten in kleinen Dörfern mit Steinhäusern, die den traditionellen Gebäuden, wie wir sie heute in Nord- und Zentralportugal kennen, sehr ähnlich waren.
Einige Häuser waren quadratisch, andere an den Ecken abgerundet und wieder andere waren komplett rund. Der Boden bestand aus Erde und das Dach aus Ziegeln. Die Dörfer wurden „citânias“ genannt. Jedes Dorf hatte einen Vorsteher und eine familiäre Sozialstruktur. Die Dorfbewohner waren Viehzüchter und bauten bereits Gemüsegärten an. Diejenigen, die in Küstennähe lebten, fischten. Sie liebten die frische Luft.
Tote wurden eingeäschert und ihre Asche in Urnen aufbewahrt, die in der Nähe der Häuser aufgestellt wurden, um so die Bedeutung der Familie zu unterstreichen. Die Toten sind bis heute sehr präsent in der portugiesischen Kultur.
Die Portugiesen waren in der Tat eine Mischung aus verschiedenen Völkern – iberischen, keltischen, phönizischen, römischen, germanischen usw. Man könnte meinen, dass sie ebenso sehr Lusitaner waren, wie die Franzosen Gallier oder die Engländer Angelsachsen sind. Zu diesem Schluss kommt letztendlich Luis Almeida Martins.
Meine Großmutter väterlicherseits und ihre Eltern sowie ihr Schwiegervater, der nach Afrika ging und Jahre später mit seinem Sohn, der ihr Ehemann werden sollte, zurückkehrte, hatten ebenfalls unterschiedliche Ursprünge, obwohl sie alle in der kleinen Stadt Sertã geboren wurden.
2. Bergen und meine Großeltern
Meine Tante Eva, die ältere Schwester meiner Mutter, verbrachte ihre Schulferien immer bei uns in Bergen. Sie war Rektorin an einer Grundschule. Begleitet wurde sie von unserem Cousin Marlos, der so alt war wie mein Bruder. Sie war geschieden. Den Grund für Tante Evas Scheidung habe ich nie erfahren. Zu Hause wurde wenig über meinen Onkel geredet. Ich wusste nur, dass er Journalist für irgendeinen regionalen oder nationalen Radiosender war.
Sie sprach fließend Portugiesisch. Sie hatte es in Brasilien gelernt, wo mein Großvater Ruben während seiner Tätigkeit als evangelisch-lutherischer Missionar acht Jahre lang gelebt hatte. In dieser Zeit hatte sie sogar zwei Jahre lang die Grundschule dort besucht. Deshalb sprach sie mit mir immer auf Portugiesisch, ebenso wie mit meiner Schwester Andrea.
Tante Eva hatte eine außergewöhnliche Begabung, Sprachen zu sprechen. Wenn wir alle zu Hause waren, waren meine Großeltern von unserer Unterhaltung mehr oder weniger ausgeschlossen. Französisch, Deutsch, Portugiesisch und neuerdings auch Italienisch, alle diese Sprachen flogen pausenlos hin und her, ohne Unterbrechung. Wenn es jemanden gegeben hätte, der keine dieser Sprachen gesprochen hätte und unfähig gewesen wäre, sie zu unterscheiden, hätte dieser jemand sicher geglaubt, dass wir alle uns nur in ein- und derselben Sprache unterhielten. Die italienische Sprache kam als letzte dazu, sie wurde uns durch einen Freund meiner Tante beigebracht. Er war Küchenchef in einem italienischen Restaurant in Köln. Zu jener Zeit unterrichtete meine Tante an einer Schule in Pulheim, einem kleinen Ort dort in der Nähe.
Meine Mutter sprach ebenfalls Portugiesisch, allerdings mit deutlich mehr Schwierigkeiten. Ich bemerkte den Unterschied, wenn ich meine Tante mit ihr reden hörte. Ich habe es immer geliebt, die Verlegenheit meiner Mutter zu sehen, wenn meine Tante ihr auf Deutsch erklärte, sie verwende nicht das richtige Wort, und ihr dann den korrekten Ausdruck wiederholte. Das brachte beide jedes Mal dazu, sich vor Lachen auszuschütten. Meine Mutter hatte ein wunderschönes Lachen, spontan, unschuldig, anders als das Lachen der meisten Menschen. Es war dasselbe Lachen, das ich bei meiner Schwester Andrea sah und hörte.
Als junger Schüler konnte mich die Freundin und Schulkollegin meiner Schwester nicht ausstehen, ohne dass ich den Grund dafür kannte. Sie streckte mir oft die Zunge heraus, sobald niemand in der Nähe war, der sie verraten konnte. Kimberly Noelle, so hieß sie, machte es, wenn wir uns auf dem Weg zur Schule begegneten, und auch, wenn sie zum Lernen zu uns nach Hause kam. Ständig streckte sie mir die Zunge heraus. Bei derselben Gelegenheit taufte sie mich auf den Namen „Husky“. Ein Hund, der Schlitten zog.
Huskys sind einzigartige Tiere, ursprünglich stammen sie aus den eisigen Regionen Sibiriens in Russland. Diese intelligenten Hunde mittlerer Größe haben ein elegantes und robustes Aussehen. Gezüchtet wurden sie von den Tschuktschen-Indianern, die als Erste ihre Hunde mit Wölfen kreuzten.
Ihre Ähnlichkeit mit Wölfen wird mit der Legende in Verbindung gebracht, dass die sibirischen Huskys der Liebesbeziehung zwischen einem Wolf und dem Mond entstammen. Das lässt sich, so die Erzählung, am Schwanz der Huskys ablesen, der die Form einer Mondsichel hat. Ihre klare, helle Augenfarbe ermöglicht es den Huskys, auf den gleißenden, schneebedeckten Ebenen Sibiriens besser zu sehen. Sie sind hyperaktive Hunde, die traditionell dazu gebraucht werden, Schlitten zu ziehen.
Kimberly Noelle ging mir auf die Nerven und war zu jener Zeit diejenige Person, die ich am wenigsten leiden konnte. Ich schaffte es nicht, gegen dieses Gefühl anzukommen. Sie und meine Schwester Andrea waren beste Freundinnen. Sie steckten die ganze Zeit zusammen, in der Schule, beim Lernen daheim und wenn sie mit dem Fahrrad spazieren fuhren.
Kimberly Noelle hatte Sommersprossen auf der Nasenspitze und unter ihren schönen hellen Augen. Diese hatten die Farbe des Honigs, mit dem meine Mutter ihre Milch süßte. Ihr rotes Haar, das auf dem Rücken mit einem geblümten Gummiband zusammengebunden war, mit zwei kleinen Kugeln auf jeder Seite, als handele es sich um reife rote Kirschen, betonte noch die Blässe ihres Teints, als hätte sie Reispuder aufgetragen. Die Iris ihrer ausgesprochen hellen Augen machte sie noch hübscher, nicht zuletzt wegen des Kontrasts zu ihren schwarzen Pupillen.
Eines Tages erzählte ich Andrea, wie es mich nervte, wenn sie mich „Husky“ nannte. Meine Schwester brach in Lachen aus. Andrea, die Glückliche, hatte das wunderbar spontane Lachen meiner Mutter geerbt. Erstaunlicherweise lachten beide auf dieselbe Weise. Ich hätte ihr besser nicht von Kimberly erzählen sollen. Denn nun fing sie ebenfalls an, mich „Husky“ zu nennen. Nach und nach kannte man mich zu Hause nur noch unter dem Spitznamen „Husky“, dieses sibirischen Hundes, eines Verwandten desjenigen, der in Alaska vorkam.
Der Grund, sagte Kimberly Noelle meiner Schwester, warum sie mir diesen Namen gegeben hatte, waren meine Augen, die entweder grün oder blau leuchteten, je nachdem, wie intensiv die Sonne schien. Ich hatte nicht das herrliche Lachen meiner Mutter geerbt, aber dafür die wunderschönen Augen von Hilde, meiner Großmutter mütterlicherseits.
Meine Mutter hatte mir lediglich ihre schwarzen, lockigen Haare vererbt. Ich hasste es, sie zu kämmen, weil sie stets verknotet waren und wegen des Widerstands, den sie jeden Morgen in mir hervorriefen. Die Bürste hatte Mühe, sich durch die Strähnen zu kämpfen. Schließlich gab ich das Kämmen auf und überließ sie den Kapriolen des Windes und dem Tadel meiner Mutter.
Sogar mein Bruder strich mir einmal, als er mich auf dem Sofa sitzend überraschte, mit seinen Fingern durch meine verwuschelten Locken und fragte mit seinem charmanten und fröhlichen Lachen, wie es „Husky“ gehe, um sich dann über meine Verblüffung lustig zu machen.
In anderen Momenten war er still, was mich an den distanzierten, abgelenkten Blick meiner Mutter erinnerte, wenn sie an die Abwesenheit unseres Vaters dachte. Ich habe meinen Bruder immer bewundert. Er hat fast drei Jahre lang Politikwissenschaften in Frankreich studiert, an der Universität von Lyon. Ihm zufolge hatte unser Vater ihm dazu geraten. Er hatte ihm gesagt, die Politik stünde leider in den Diensten der Wirtschaft. Sie bräuchte Menschen, die ihre Interessen verträten. Die Welt wäre in zwei Lager geteilt. Die Eliten und die anderen, die dazu da wären, Ersteren dienlich zu sein. Wir müssten uns entscheiden.
Allzu häufig hatte er ihm eingetrichtert, wenn er seine eigene Freiheit entwickeln wollte, selbst Verantwortung übernehmen wollte, seine eigenen Entscheidungen treffen wollte, würde das nur gelingen, wenn er Erfolg hätte. Er müsste sich darüber im Klaren sein, welche Entscheidung er zu treffen hätte, dass er die Geisteshaltung, die Gedanken und Gewohnheiten derjenigen überwinden müsste, die in ihrem Leben keine neuen Herausforderungen haben wollten.
Der Erfolg meines Bruders beruhte auf der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Er lag in seiner Person, nicht außerhalb davon. Er selbst war es, der seine Ziele definierte, je nachdem, was er für sein Leben als wichtig befand. Andere nachzuahmen, kam ihm nicht in den Sinn. Plötzlich hatte mein Bruder beschlossen, sein Studium an der Handelshochschule fortzusetzen, um einen Abschluss in Betriebswirtschaft zu machen.
Nach seinem Studium arbeitete er einige Jahre lang für eine internationale Unternehmensgruppe, deren Büros sich in Paris befanden und bei der er den Posten eines Controllers innehatte. Jahre später wechselte er die Firma und heute arbeitet er für einen anderen internationalen Konzern, wo er dieselbe Funktion ausübt, diesmal allerdings in Sri Lanka.
Was meine älteste Schwester betraf, so hat sie es geschafft, über die Abwesenheit meines Vaters hinwegzukommen. Bei den Gesprächen mit meiner Mutter habe ich sie einmal bei der Aussage überrascht, mein Vater sei ständig gegenwärtig und um sie herum. Diese Präsenz half ihr, ihr Leben besser zu bewältigen. Das Blut ihrer Ahnen, das in ihren Adern floss, ermutigte sie, in dem Land zu leben, in dem mein Vater das Licht der Welt erblickt hatte. Dasselbe Land, in dem auch sie geboren wurde. Sie lebte dort weiterhin, um dann jedes Jahr in den Weihnachtsferien mit ihrem Sohn bei uns aufzutauchen. Ein freundlicher Neffe, der dank des Unterrichts am amerikanischen Gymnasium in Kinshasa fließend Englisch sprach, Französisch und sogar Deutsch.
Meine Schwester Andrea hatte kürzlich die Bekanntschaft von Julia gemacht, einer neuen Klassenkameradin. Auch sie hat begonnen, zu uns nach Hause zu kommen, um mit meiner Schwester zusammen lernen zu können. Ich weiß nicht, ob Andrea und Kimberly Noelle ihr von dem Spitznamen erzählt haben, den sie mir gegeben hatten. Ihre Schüchternheit faszinierte mich und ich war sehr neugierig, was ihre Person betraf. Eines Tages erzählte mir Andrea im Vertrauen, spontan loslachend, wie es ihre Gewohnheit war, dass Julia es sehr mochte, wie sehr mein Aussehen dem eines sibirischen Hundes ähnelte.
In den Tagen darauf begann auch ich, mit den Augen eines Dreizehnjährigen, Julia auf andere Weise zu betrachten. Sie hatte die gleichen fantastischen hellbraunen, kastanienfarbenen Haare wie meine Schwester und ebenfalls schwarze Augen. Gleichzeitig bemerkte ich, dass Kimberly Noelle ihre Haltung mir gegenüber verändert hatte. Sie streckte mir nicht mehr die Zunge heraus und rief mich nicht mehr bei dem Namen, der alle bei uns zu Hause amüsierte und zum Lachen brachte.
Wenn ich das Wort an Julia richtete, schwieg Kimberly Noelle nun, ganz entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, mich zuweilen zu unterbrechen, um mir zu widersprechen, und betrachtete mich aufmerksam mit ihren braunen, unglaublich hellen Augen, die hin und wieder die Farbe wechselten. Ich konnte spüren, dass sie nervös und durcheinander war. Das unruhige Klopfen mit den schmalen Fingern ihrer rechten Hand auf dem Esstisch, so als spiele sie Klavier, verriet ihre Nervosität.
Auch mich überkam bei ihrem Anblick unerklärlicherweise ein leichtes Erstickungsgefühl, als ob mir die Luft ausginge. Es verstärkte sich noch, wenn unsere Blicke sich kreuzten. Ich bemerkte ihre langen Finger, einen nach dem anderen. Beim Klavierspiel. Verstört wich ich ihrem Blick aus, der, unterstützt durch die wunderschönen schwarzen Pupillen, womöglich versuchte, meine Gedanken zu lesen, mein Herz zu erforschen, sich fragend, worin der plötzliche Grund für meine Verlegenheit lag.
All das brachte mich dazu, meine Gespräche mit Julia zu verstärken und auf diese Weise zu versuchen, meine Verwirrung zu verbergen. Doch ohne dass es mir bewusst war, und auch nicht etwa, weil ich Kimberly Noelle wirklich eifersüchtig machen wollte, steigerte sich dadurch ihre Angespanntheit ebenso wie die Intensität ihres Blickes auf mich, was ihrem Gesicht eine rosige Farbe verlieh. Und plötzlich begriff ich, dass meine „Husky“-Augen, ebenso wie meine Person, Kimberly Noelle keineswegs gleichgültig waren.
Die ungewöhnliche Farbe ihrer roten Haare hatte sie von ihrem Vater geerbt, einem Engländer schottischer Herkunft. Er war ein Militäroffizier, der für die NATO auf der Militärbasis stationiert war, die sich ganz in der Nähe von Bergen befand. Ihre Mutter, im selben Alter wie meine, arbeitete als Angestellte bei einer Versicherungsgesellschaft. Sie war es auch, die sich um die Entschädigung kümmerte, die meine Mutter von der Versicherung für den Unfalltod meines Vaters erhielt.
Menschen mit roten Haaren sind in Nord- und Osteuropa ausgesprochen häufig anzutreffen. Diese Haarfarbe verbindet man insbesondere mit den Einwohnern des Vereinten Königreichs und Schottlands. Ebenso ist sie bei germanischen und keltischen Völkern anzutreffen.
Rothaarige Menschen machen etwa 4 % der europäischen Bevölkerung aus. Schottland hat den weltweit größten Anteil an Rothaarigen. Elisabeth die Erste von England hatte rote Haare. Ihre Augen waren blau, sie hatte scharfe Gesichtszüge und, glaubt man den Geschichtsschreibern, ein sinnliches und kokettes Benehmen.
Seit jeher hat man in zahlreichen Kulturen Rothaarige mit einem gewissen Misstrauen betrachtet. Die Ägypter glaubten, sie seien vom Gott Seth gesandt. Dieser Gott war der Herr über Donner und Blitz, er übte seine Macht an den verschiedenen Flussarmen und in den Ebenen des Nils aus. Er galt als streitbare Gottheit.
In der Antike waren die Römer überrascht und zugleich fasziniert, wenn sie auf Menschen mit hellen Augen und blonden oder roten Haaren stießen. Stets hoben sie die Schönheit der rothaarigen keltischen Frauen hervor. Dies veranlasste die römischen Frauen, als sie sich über ihre Männer und deren Geliebte sowie die Schönheit der keltischen Rothaarigen klar wurden, Perücken mit dieser Haarfarbe zu fertigen.
Im Mittelalter galten rote Haare als Zeichen für den Bund mit dem Teufel, ebenso wie für Hexerei. Tatsächlich glaubte man, die Seele sowie der Körper rothaariger Frauen wären von Dämonen besessen und ihre Haare hätten die Farbe der Glut angenommen, weil sie im Höllenfeuer gebrannt hätten. Möglicherweise entspringt diesem Glauben das Sprichwort: „Die Rothaarigen haben keine Seele.“ Zu jener Zeit einer Rothaarigen zu begegnen, war erschreckend, denn viele Menschen glaubten, es handele sich bei ihnen um Zauberinnen oder Hexen. Sie besaßen Haare, die an das Fell von Bestien erinnerten und zugleich Stärke und Kraft symbolisierten. Die Farbe des Feuers verband man häufig mit einem leidenschaftlichen Temperament oder einem starken Charakter.
Den italienischen Malern der Renaissance dienten sie als Modell, um venezianische Frauen mit roten Haaren zu malen. In jener Epoche waren Sommersprossen eines der charakteristischen Merkmale der Schönheit in der Malerei.
So wie viele Menschen in der Vergangenheit war auch ich fasziniert und angezogen von den feuerroten Haaren, der Spontaneität und der Charakterstärke von Kimberly Noelle. Und auch wenn ich nicht rothaarig war, hatte ich doch, ebenso wie sie, kühne und tapfere Vorfahren unter den germanischen Sachsen in Deutschland.
Um das Ende des 8. Jahrhunderts wurde die Region, in der ich zur Welt kam, Niedersachsen, das seinerzeit von den germanischen Sachsen bevölkert war, in ein Herzogtum eingegliedert und von Karl dem Großen, jenem christlichen König der Franken, der durch Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt worden war, in Sachsen umbenannt. Es handelte sich um einen kriegerischen König, der sein Reich unter dem Deckmantel der Christianisierung durch eine Reihe von militärischen Eroberungen vergrößert hatte, besonders, indem er den Kampf gegen die Sachsen intensivierte, die von den Römern als heidnisches Volk betrachtet wurden.
Nach Beendigung der Militärfeldzüge, die er zwischen 772 und 804 führte, stülpte er ihnen das Christentum über und zwang sie dazu, sich taufen zu lassen. Die sächsischen Herrscher, ebenso wie ihre Untertanen, konvertierten wahrscheinlich auch deshalb zum Christentum, um auf diese Weise den Frieden wieder herzustellen, mit Ausnahme allerdings des Berühmtesten unter ihnen, eines gewissen Widukind, lange Zeit ein vehementer Gegner der Christianisierungswelle des Frankenkönigs.
Widukind oder Witikind – beides sind alte sächsische Worte, die man mit „weißes Kind“ oder „Kind des Waldes“, also Wolf, übersetzen kann – war einer der berühmtesten Helden des alten Germaniens. Einige Chroniken aus dem Mittelalter schrieben ihm als Vater einen Fürsten zu, der einer der Hauptanführer der Nation der Sachsen war. Eine mächtige Nation, die auf einem Gebiet zwischen den Flüssen Rhein und Elbe angesiedelt war und sich sogar in Richtung des Flusses Oder ausdehnte.
Als junger Mann musste Widukind mitansehen, wie sein Land von den Truppen des fränkischen Königs verwüstet wurde. Später dann als Fürst von Engern widersetzte er sich aufs Schärfste den Truppen Karls des Großen, der den Sachsen einen Krieg aufzwang, der 32 Jahre dauern sollte. In Wahrheit ging es nur darum, unter dem Vorwand der Christianisierung eine Million Bauern zu versklaven.
Die als Rebellen angesehenen Sachsen wurden massakriert. Die als Externsteine bekannte heidnische Kultstätte im Teutoburger Wald wurde 772 auf Befehl Karls des Großen zerstört.
Als der Frankenkönig 775 in Lodbad kampierte, einer Ortschaft an der Weser, lockten die westfälischen Krieger unter der Führung von Widukind die fränkischen Soldaten in einen Hinterhalt und töteten viele von ihnen, um bei dieser Gelegenheit Karl dem Großen eine enorme Kriegsbeute vor der Nase wegzuschnappen. Dabei handelte es sich um den ersten großen Erfolg von Widukind und seinen Männern.
Entsprechend den Forderungen, die Karl der Große den Völkern der eroberten Territorien auferlegte, mussten die Sachsen einen Tribut zahlen. Außerdem mussten sie ihrem Eroberer Truppen stellen. Widukind diente dieser Tribut als Vorwand, seine Brüder davon zu überzeugen, ihre Revolte aufrechtzuerhalten. Er übte weiterhin Widerstand gegen die Truppen Karls des Großen.
Dass Widukind bei einer Versammlung der von den Franken unterworfenen Sachsen, die von Karl dem Großen einberufen wurde, fehlte, blieb keineswegs unbemerkt. Die Sachsen, die nunmehr in ihrer Eigenschaft als Vasallen zusammenkamen, waren einverstanden, zum Christentum zu konvertieren. Widukind war allerdings nach dem Sieg des Königs der Franken nach Dänemark geflohen, ein Land mit ‚heidnischer‘ Bevölkerung.
Im Jahr 778, als der Hauptteil der Armee Karls des Großen, in Fortführung seiner territorialen Expansionspolitik, Richtung Spanien mobilisiert wurde, organisierte Widukind, zurück in Sachsen, den sächsischen Widerstand. Unter seinem Einfluss bedrohten die Heiden den Abt von Fulda und zwangen die Mönche zur Flucht. Sämtliche Reliquien des Bonifatius von Mainz mussten sie mitnehmen, um sie zu retten.
Widukind konnte von der auf die iberische Halbinsel gerichteten Expansionspolitik Karls des Großen, die ihn von Sachsen fernhielt, profitieren und verstärkte seine revolutionären Anstrengungen.