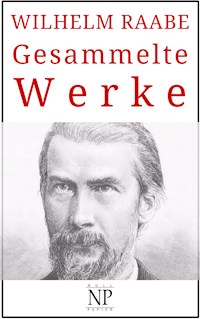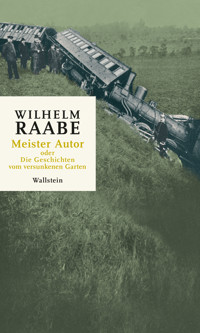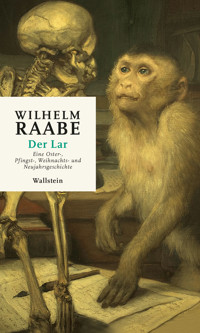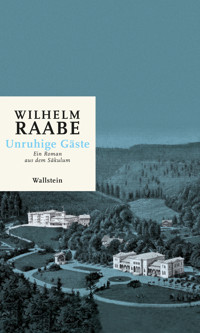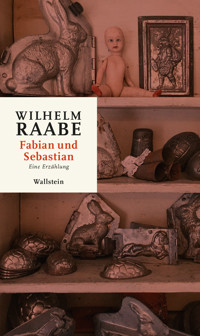Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das letzte Recht ist ein historischer Kurzroman von Wilhelm Raabe und handelt von einem rücksichtslosen Scharfrichter im Jahre 1704. Auszug: Wenn man die kleine Stadt so im Sonnenschein des Augusts 1704 in ihrem Thal am Ausgange der Berge liegen sah, halbversteckt durch Weinranken und Obstbäume, so hätte man es wirklich nicht für möglich halten sollen, daß es so viel Unglück, Haß, Zwietracht und tollen, blindwüthigen Ehrgeiz und Geiz in der Welt geben konnte. Es war leider aber doch damit also bestellt, und Eigennutz, Haß, Streit und Neid gab es nicht nur zwischen den grausam hohen Potentaten, zwischen Kaiser und Reich, der Königin von England, den hochmögenden Generalstaaten und dem allerchristlichsten König: auch in den engen morschen Mauern der kleinen Reichsstadt gingen dieselben bösen Geister um und schufen Wirrsal und Trübsal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das letzte Recht
12345678AnmerkungenImpressum1
Als das heilige römische Reich noch aufrecht stand, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, waren, wie der geschichtskundige, großgünstige Leser weiß, im Südwesten des armen, blutenden, knochenkranken Deutschlands die freien Städte so häufig wie die Pilze, und die unmittelbare Reichsritterschaft war noch häufiger. Mit letzterer beschäftigen wir uns vielleicht später einmal, wenn uns Gott das Leben schenkt; heute wollen wir eine Geschichte erzählen, welche in einer jener Städte vorging, die der arggerupfte kaiserliche Adler mit seinen kraftlosen Flügeln überschattete, in einem winzigen, lieblich gelegenen Ding mit uralten moosigen Mauern, Thürmen und Thoren, zwei alten Kirchen, wenig Nahrung und Verkehr, aber viel schwarzbemäntelten, gravitätischen, perrückentragenden Rathsherren und Patriziern und einem Bürgermeister, der an gravitas natürlich Geschlechter und Plebejer weit und hoch übertraf.
Rothenburg im Thal wollen wir das Städtlein nennen, obgleich es nicht so hieß; Hindernisse, die wir nicht aus dem Wege räumen können, versperren uns den Pfad zu dem wahren Namen desselben. So mußten wir uns bescheiden, nur leise den Schauplatz, auf welchem unsere Tragödie spielt, anzudeuten, ehe wir dramatis personae, die Figuren unserer Geschichte einführen und agiren lassen.
Klein ist unser Schauplatz im Vergleich zu dem des großen Trauerspieles, welches zur selbigen Zeit die Weltgeschichte aufführte. Der spanische Erbfolgekrieg ist im vollen Gange; zu Frankreich stehen Baiern und Köln; aber das Reich hält zu Oesterreich, und am dreißigsten November Siebenzehnhundertzwei ist auch zu Rothenburg im Thal unter Trommelschlag der Krieg gegen Ludwig den Vierzehnten bekannt gemacht worden.
Nun ritt vor acht Tagen ein Bote in die Stadt, dem Rath den Sieg des Prinzen Eugenius und des Herzogs von Marlborough bei Höchstedt und Blenheim zu notificiren. Unabsehbare Züge unglücklicher verwundeter, halbverhungerter gefangener Franzosen wurden durch die Stadt geschleppt, und die gutmüthigen barmherzigen Seelen, die deutschen Reichsstädter und Reichsstädterinnen, hatten tausendfach Gelegenheit, ihre mitleidigen Herzen zu zeigen. Durch die Stadt wurde auch der Marschall Tallard in einer wohlverwahrten, von Dragonern und Musquetirern umringten Kutsche geführt, und Bürgermeister und Rath mochten mit Recht frohlocken, daß sie nicht zu Baiern und Köln sich geschlagen hatten.
Wenn man die kleine Stadt so im Sonnenschein des Augusts 1704 in ihrem Thal am Ausgange der Berge liegen sah, halbversteckt durch Weinranken und Obstbäume, so hätte man es wirklich nicht für möglich halten sollen, daß es so viel Unglück, Haß, Zwietracht und tollen, blindwüthigen Ehrgeiz und Geiz in der Welt geben konnte. Es war leider aber doch damit also bestellt, und Eigennutz, Haß, Streit und Neid gab es nicht nur zwischen den grausam hohen Potentaten, zwischen Kaiser und Reich, der Königin von England, den hochmögenden Generalstaaten und dem allerchristlichsten König: auch in den engen morschen Mauern der kleinen Reichsstadt gingen dieselben bösen Geister um und schufen Wirrsal und Trübsal.
Zwischen zwei Bergen, die ziemlich schroff gegen die Ebene hin abfielen, lag, wie gesagt, die kaiserliche freie Reichsstadt Rothenburg. Auf der äußersten Bergspitze zur Linken, auf der Römerschanze stand ein alter Wartthurm, der »Lug in's Land,« höchst wahrscheinlich auf römischem Fundament; gegenüber auf dem Vorsprung des Herrenberges lag die Scharfrichterei, und zwischen dieser und dem Wartthurm lief im Thal unten die Stadt gegen das Römerthor zu aus. Dicht neben dem Römerthor an einem kleinen freien Platz stand ein altes, dunkles, einst jedenfalls sehr stattliches Gebäude, welches sich jetzt aber im höchsten Verfall befand. »Zur Silberburg« wurde es genannt, und um die Silberburg, die Scharfrichterei und den Lug in's Land streift auf Eulenflügeln unsere Geschichte.
In der Silberburg wohnte im Jahre 1704 Christian Jacob Heyliger, einstiger Zinsmeister der Stadt, mit seiner Tochter Laurentia nun schon lange Jahre in tiefster Zurückgezogenheit. Auf dem Lug in's Land hauste als Wächter Friedrich Martin Kindler, dessen Sohn Georg, genannt der schwarze Jürg, vor einem Jahre mit wundem Arm und wunder Brust aus dem Franzosenkriege heimgekehrt war. Auf der Scharfrichterei saß, ebenfalls seit einem Jahre, der neue Henker der Stadt, Wolf Scheffer.
Da in jener Zeit, welche einige Leute ihres Glaubens, ihrer deutschen Biederkeit, Einfachheit, Treue und Gottesfurcht wegen willens sind, für die »gute alte« zu nehmen und sie uns Kindern des Tages solchergestalt bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit vor die Nase zu halten, das Amt eines Scharfrichters keine Sinecure war und da Uebung den Meister macht; so gab es damals die vortrefflichsten Meister in der schrecklichen Kunst, die Mitbürger dieser Welt auf die schmerzhafteste Weise zum Geständniß oder zum Tode zu bringen, und vor Allem konnte die freie Stadt Rothenburg stolz sein auf ihren Henker und war es auch. Wolf Scheffer war ein Schah, ein Künstler in seinem Fach. Stets wurden Galgen und Rad auf das Kunstgerechteste versorgt, und wahrhaft meisterlich die blinde Göttin Themis und ein hochweiser Rath in dem Peinigkeller unter dem Rathhause unterstützt. Wie aber die Stadt in den Besitz dieses Schatzes kam, wie der vorige Scharfrichter mit Tode abging und Wolf Scheffer sein Nachfolger wurde, muß jetzt erzählt werden.
Vor ungefähr einem Jahre waren die Herren Scabini von Rothenburg in die unangenehme Notwendigkeit versetzt worden, dem eigenen Nachrichter wegen eines nicht von Amtswegen geschehenen Todtschlags im hochnothpeinlichen Blutgericht das Urtheil sprechen zu müssen, und nur ein Postreiter vom Kriegsschauplatze her konnte die Stadt in eine ähnliche Aufregung bringen, wie dieser unerhörte Fall. Man konnte doch unmöglich von dem armen Sünder verlangen, daß er sich selbst, eigenhändig, an den vorhandenen eben so schönen als dauerhaften Galgen hänge! In vollkommener Rathlosigkeit rathschlagte man über dies Unicum; Briefe wurden an alle benachbarten Städte, welche sich des Blutbannes rühmten, um freundnachbarliche Aushilfe geschrieben; aber das Unheil und der Zufall wollten, daß dem Bitten des Rathes von Rothenburg aus dem einen oder andern Grunde nirgends Folge gegeben werden konnte. Da gab es viel Kopfschütteln, und mehrere Tage hindurch war das Städtlein von dem aus den Perrücken aufsteigenden Puderstaub in einen leichten Duftschleier gehüllt. Da gab es viel Raisonniren und Schwadroniren zu Haus und in den Schenken, und zuletzt mußte ein hochedler Rath in den letztern ein Mandat anschlagen lassen, durch welches den witzigen Köpfen verboten wurde, die »Fatalität« zum Thema ihrer Untersuchungen zu machen.
Seinen Bürgern konnte der Rath nun wohl das Spotten und Lachen verbieten; was aber den armen Sünder selbst betraf, so ging das doch nicht an. In seinem Gefängniß über dem Römerthor lachte und spottete der Meister Hämmerling nach Herzenslust und brachte seine letzten Lebenstage so heiter und vergnügt als möglich zu. Die Durchpassirenden konnten bis tief in die Nacht hinein vernehmen, wie er Hohnlieder sang auf eine gute Stadt und einen hochweisen und hochverlegenen Rath. Kein Schöffe mochte zuletzt mehr durch das Römerthor gehen; denn jedesmal, wenn solches geschah, zwängte sich durch das enge Gitterfenster des Kerkers ein wildes, grinsendes, rothhaariges Menschenhaupt, und eine gefesselte Hand drehte dem Herrn eine höhnische lange Nase. Nicht zu ertragen war das Aergerniß, und das Schlimmste war, daß zu allem Andern der Kerl auch sehr schwer auf dem Stadtseckel lag. Ein altes Gesetz verordnete, daß wenn ein Urtheil Jemandem zuerkannt war, bis zur Ausführung des Richterspruches dem Verurtheilten an Speise und Trank gegeben werden solle, was er verlange, und zwar auf Stadtkosten. Nun war der jetzige Delinquent in seiner unschuldigen Jugend Küchenjunge bei einem dicken, nahrhaften holländischen Gesandten am Hofe zu Wien gewesen, wußte, was das Herz erfreute, und war gar nicht blöde, das Erfreuliche zu fordern. So herrschte denn zu jeder Tageszeit ein sehr leckerer Duft von Gesottenem, Geschmortem und Gebratenem um das Römerthor. Selbst die Mauergewächse schienen in dieser Atmosphäre ein gedeihlicheres Ansehen zu gewinnen und frischer zu grünen; der Stadtkoch aber kam nicht aus dem Schweiß, der Rathskellermeister nicht aus dem Trab, und der Stadtkämmerer hätte blutige Thränen weinen mögen.
So standen die Sachen, und im Geheimen war man bereits halb einig im Rath, dem Kerl im Thurm ein Loch zu öffnen und ihn entwischen zu lassen, um so endlich dem Elend und Aergerniß ein Ende zu machen. Da verlangte eines Abends, als der regierende Bürgermeister sich eben zu einem Nachtessen, welches lange nicht so gut war, als das des Gefangenen im Thurm, seufzend niederlassen wollte, ein Fremder, den ehrbaren Herrn zu sprechen, und ward vorgelassen. Er erschien als ein Mann von gar absonderlichem Ansehen; hager, sehnig, gelb, mit einem spanischen Bart und einem großen schwarzen Pflaster über dem linken Auge. Nicht sehr groß, war er doch mit ungemein langen Armen begabt, bewegte sich gar nicht unzierlich, verbeugte sich sehr höflich, rückte mit seinem Anliegen so strack hervor wie ein Reiterangriff und that an Seine Gnaden die Frage: Hier in löblicher Stadt sei man ja wohl, dem Gerede nach, eines Scharfrichters bedürftig? – Und ehe der Bürgermeister zur Antwort kam, fuhr der Fremdling fort:
»Will ich mich in Bescheidenheit hiermit präsentiret haben zu diesem Amt und verhoff', mit Rath und Bürgerschaft auf's Trefflichste auszukommen und Jedermann im Nothfall auf's Beste zu bedienen, kunstgerecht, wie man's von einem wackern gelernten Meister verlangt.«
Wäre dem regierenden Bürgermeister von Rothenburg ein Engel erschienen, er hätte nicht einen größern Eindruck hervorgebracht. Wenig fehlte, daß der würdige Herr in seinem Jubel dem Fremden um den Hals gefallen wäre. Aus seinem Lehnsessel flog er in die Höhe und jauchzte:
»Der Himmel sei gepriesen! Endlich! Endlich! Victoria!«