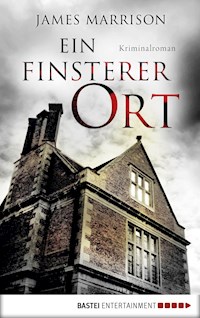9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Leichenfund in den Cotswolds. Der Tote wurde vor zehn Jahren verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden zweier Mädchen zu tun zu haben, doch die Ermittlungen verliefen damals im Sande.
Als nun im Haus des Opfers ein Feuer ausbricht, werden die Überreste einer stark verwesten Mädchenleiche freigelegt. Die Polizei glaubt, das Schicksal der verschwundenen Mädchen endlich aufklären zu können, doch die Obduktion erstickt diese Hoffnung im Keim: Die Tote ist deutlich älter ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Zitat
Prolog
Teil Eins
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Teil Zwei
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Teil Drei
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Kapitel Achtundvierzig
Kapitel Neunundvierzig
Kapitel Fünfzig
Kapitel Einundfünfzig
Kapitel Zweiundfünfzig
Kapitel Dreiundfünfzig
Kapitel Vierundfünfzig
Kapitel Fünfundfünfzig
Kapitel Sechsundfünfzig
Über den Autor
James Marrison studierte Geschichte in Edinburgh, bevor er 1996 nach Buenos Aires zog. Noch heute lebt er in der südamerikanischen Metropole, wo er als freier Journalist für verschiedene Zeitungen arbeitet. Er hat bereits ein Sachbuch über die berüchtigtsten Mörder aller Zeiten veröffentlicht, für das er namhafte Psychologen und Kriminalisten interviewte. DAS MÄDCHENIM FENSTER ist sein erster Roman.
James Marrison
DASMÄDCHENIM FENSTER
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonRainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by James Marrison
Titel der englischen Originalausgabe: »The Drowning Ground«
Originalverlag: Michael Joseph, an imprint of Penguin Books Ltd,
London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Titelillustration: shutterstock/Honza Krej; © shutterstock/KN
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0658-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Clarisa
DANKSAGUNG
Zu allererst möchte ich meiner Agentin Helen Heller von der Helen Heller Agency danken, ohne deren Hilfe, Führung und untrüglichen Instinkt dieses Buch nie möglich gewesen wäre. Auch danke ich Rowland White und Emad Akhtar von Michael Joseph, Hope Dellon von St. Martins Press und Camilla Ferrier sowie Jemma McDonagh von Marsh Agency. Von ganzem Herzen danke ich auch sowohl meiner englischen als auch meiner argentinischen Familie für ihre unerschütterliche Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Romans.
Kleines Dorf, große Hölle.
– Argentinisches Sprichwort
PROLOG
Sorgfältig vor den Blicken verborgen, um die schöne Symmetrie des Gartens nicht zu ruinieren, lag Frank Hursts Swimmingpool auf einer leicht erhöhten Terrasse am Rand des Grundstücks. Er war von allen Seiten von einem schwarzen Zaun umgeben, der von Lavendel überwuchert war. Das Geräusch unserer Schritte hallte am Rand des Pools entlang, als wir um die Handtücher herumgingen, die in kleinen Haufen rot auf dem Granit leuchteten. Die beiden Sanitäter standen über die Leiche gebeugt, und als sie uns sahen, traten sie rasch beiseite, damit wir uns ein besseres Bild machen konnten. Das Wasser glitzerte im Sonnenlicht, und auf den angrenzenden Feldern schrie ein Vogel. Es war ein trostloser Klang.
Die Haushälterin hatte es geschafft, Mrs Hurst an Land zu ziehen, bevor sie ins Haus gelaufen war, um Hilfe zu holen. Eine Strähne langen blonden Haars bedeckte die Hälfte von Mrs Hursts Gesicht, und die Spitzen ihrer schlanken Finger berührten das Wasser, als deuteten sie auf etwas im Pool. Unter einem Liegestuhl flatterten die Seiten einer Zeitschrift im Wind.
Kurz schaute ich mich um. Der Swimmingpool war tief und solide gebaut. Er war antik und durch Zaun und Hecken vom Rest des Grundstücks getrennt, als wäre ein Pool etwas Unanständiges, das man verstecken musste. Powell rauchte damals noch und steckte sich gerade eine Zigarette an, während er aufmerksam auf das Blut starrte, das sich an der Wasseroberfläche kräuselte.
Auf dem Grund des Swimmingpools war das Mosaik eines Speerfischs zu sehen. Ich ging näher an den Beckenrand heran. Dort deutete ein großer roter Fleck darauf hin, dass Mrs Hurst hier ausgerutscht war und sich den Kopf angeschlagen hatte.
Hinter den Bäumen hielt auf dem knirschenden Kies ein Wagen, und nur wenige Sekunden später sahen wir einen Schatten, als Frank Hurst über den Rasen sprintete. Powell stellte sich ihm am Tor in den Weg. Hurst war wie ein langgliedriger Mittelgewichtsboxer gebaut, und als er die Leiche seiner Frau auf der Terrasse sah, entwickelte er eine schier unglaubliche Kraft, sodass ich Powell helfen musste. Hursts sandfarbenes Haar war kurzgeschnitten, in den grauen Augen spiegelte sich das Grauen, und der Mund war unter dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart vor Entsetzen verzerrt.
Ich ließ Powell am Swimmingpool zurück, sagte ihm, er solle Brewin holen, und führte Hurst zum Haus. Es roch nach frischgemähtem Gras, und an den Wänden eines alten Schuppens flimmerte die Hitze. Selbst unter den Birken war es heiß. Über einen Absatz gelangte man zu einer großen Terrassentür, von der aus man eine hervorragende Aussicht auf die riesige Rasenfläche hatte. Ich führte Hurst die Stufen hinauf und durch die Tür ins Wohnzimmer. Dann schloss ich die Vorhänge, damit er nicht zusehen musste, wie man die Leiche seiner Frau über den Rasen und zum Leichenwagen trug.
Inzwischen war auch seine Tochter aus der Schule gekommen, und ich hörte, wie die Haushälterin sie tief im Inneren des Hauses zu trösten versuchte. Irgendwo schlug eine Uhr, als draußen der Abend anbrach, und ich stellte meine Fragen, die Hurst mir allesamt und ohne Zögern beantwortete. Als ich Dashwood Manor schließlich verließ, war es schon spät, doch anstatt mich von Hurst zur Haustür bringen zu lassen, schlüpfte ich zur Terrassentür hinaus und ging über den Rasen.
Es war noch immer warm, als ich an dem großen Gasgrill und ein paar Gartenstühlen vorbeiging, die unter einer grünen Plane gestapelt waren. Ich ging weiter den Hang hinunter, und bevor ich den Garten endgültig verließ, drehte ich mich noch einmal zum Haus um.
Oben brannte Licht. Die Silhouette von Hursts Tochter Rebecca war im gelben Licht des Schlafzimmerfensters zu sehen. Sie war erst vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Sie war hübsch, hatte langes schwarzes Haar und ungewöhnlich blaue Augen. Sie starrte auf das Wasser des Swimmingpools, und als sie mich sah, lächelte sie süß. Dann drehte sie sich weg, und ich wusste, dass sie weinte.
Powell wartete in der Einfahrt auf mich. Der Leichenwagen war bereits weggefahren. Es war das Ende eines langen, trockenen Sommers, und man konnte förmlich spüren, wie die Pflanzen dem ersten Regen entgegenfieberten. Alles war still. Und in dieser Stille stieg ich in den Wagen und schlug die Tür zu, dann machten wir uns auf die lange Fahrt zum Revier.
TEIL EINS
Fünf Jahre später
KAPITEL EINS
Dezember 2002
Graves traf um 9:53 Uhr mit dem Zug aus Oxford in Moreton ein. Überrascht stellte er fest, wie viel in dem kleinen Ort los war. Es war gerade Markt, und überall im Ortszentrum waren Stände aufgebaut, zwischen denen man auf breiten Wegen hindurchflanieren konnte. Es gab so gut wie alles hier: billigen Modeschmuck, Uhren, Lederwaren, Besen, Hüte, Badematten und Müllsäcke. Sportkleidung hing an Ständern mit leuchtend bunten Schildern, auf denen in großen roten Buchstaben »ZWEI FÜR EINS« oder »JEDES TEIL EIN PFUND« stand.
Mit seinem Gepäck im Schlepptau versuchte Graves, sich einen Weg durch die Menschen zu bahnen, und verlor langsam die Geduld, als immer mehr Leute ihn anrempelten, weil sie so schnell wie möglich zu den Ständen wollten. Immer wieder hörte er Gesprächsfetzen. Die Leute sprachen einen anderen Akzent, der irgendwie freundlicher, weniger distanziert klang.
Rasch überquerte Graves die Straße. Durch den Haupteingang des Reviers kam man in einen kleinen Wartebereich, wo ein rundlicher, aufmerksamer Sergeant an der Rezeption saß und Graves empfing. Nachdem er sich angemeldet hatte, schob Graves sein Gepäck unter eine Bank, und ein paar Minuten später kam ein freundlich aussehender Beamter herein und stellte sich als Constable Burton vor. Ein Schlüsselbund baumelte an Burtons Gürtel, als er zur Tür ging, um sie für Graves zu öffnen. Auf dem Weg durch einen gut beleuchteten Flur blies Burton kräftig in sein Taschentuch.
»Ich dachte, es wäre eine gute Idee, Sie erst einmal ein wenig herumzuführen, bevor Sie sich an die Arbeit machen«, sagte Burton. »Das heißt, wenn Sie nichts dagegen haben, Sir. Ich habe gesehen, dass Sie Ihr Gepäck draußen gelassen haben. Haben Sie schon eine Wohnung?«
»Nein, noch nicht. Vorläufig wohne ich im Hotel. Ich glaube, es heißt ›The Manor‹.«
»Ah, das Manor House.« Burton war beeindruckt.
»Es ist nur für ein paar Tage, bis ich eine Wohnung oder ein Zimmer gefunden habe. Außerdem war es das einzige Hotel, das ich finden konnte«, verteidigte sich Graves. »Sie kennen nicht zufällig was anderes, oder? Vor meiner Abfahrt hatte ich nämlich keine Zeit mehr, mich darum zu kümmern.«
»Ich fürchte nein. Aber hören Sie sich doch einfach mal um«, antwortete Burton. »Vielleicht hat ja sogar einer der Jungs ein Zimmer zu vermieten. Oder hängen Sie ein Mietgesuch ans Schwarze Brett in der Kantine.«
Sie gingen den Flur hinunter. Entlang der blauen Wände waren Notizen an roten Filz gepinnt, und auf der linken Seite konnte man durch ein langes Fenster in ein Großraumbüro sehen. Sie gingen daran vorbei, und Graves hörte gedämpfte Stimmen durch das Glas und sah ein paar Gestalten an Schreibtischen, die durch graue Absperrwände voneinander getrennt waren.
Burton hatte es nicht sonderlich eilig. Er führte Graves in einen weiteren Gang und öffnete dann fast ehrfürchtig die Tür zu einer kleinen, aber gemütlichen Kantine. Dort saß ein stämmiger Mann in zerknittertem Anzug und blätterte in einer Boulevardzeitung, während er sein Frühstück aß. Alles war sauber, ordentlich und ruhig – das genaue Gegenteil von Graves’ altem Revier.
»Und, Morris? Wen haben wir denn hier?«, rief der Mann über seine Zeitung hinweg.
Burton stellte Graves vor.
Der Mann musterte ihn von Kopf bis Fuß und wandte sich dann wortlos wieder seiner Zeitung zu. Graves wollte schon weitergehen, als der Mann es sich doch anders überlegte und die Zeitung beiseitelegte. »Graves«, sagte er. »Wir haben Sie schon erwartet. Sie übernehmen also den Job vom alten Len.«
»Len?«
»Len Powell«, erwiderte der Mann.
»Oh … ja«, bestätigte Graves.
Der Gesichtsausdruck des Mannes war schwer zu deuten. Vielleicht war es ja Sorge, was da in seinen Augen stand, doch bevor Graves sich eine Meinung darüber bilden konnte, wandte der Mann sich wieder seiner Zeitung zu.
»Ich soll mich zwar erst morgen früh bei meinem neuen Chief Inspector melden«, sagte Graves zu Burton, als sie den Raum verließen, »aber ich hatte gehofft, er wäre hier.«
»Er kommt erst später«, erwiderte Burton in beiläufigem Ton. »Keine Ahnung, wo er steckt, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Er neigt dazu, seine Dienstzeiten selbst zu definieren«, erklärte Burton. »Er taucht hier immer erst dann auf, wenn er das Gefühl hat, es ist wirklich notwendig.« Er zuckte mit den Schultern. »Das macht den Chief natürlich wahnsinnig«, fügte er hinzu. »Aber sie muss sich wohl oder übel damit abfinden.«
Graves verbrachte den Rest des Morgens damit, seinen Schreibtisch einzuräumen, sich mit den Abläufen im Revier vertraut zu machen und schließlich eine lange Liste von Telefonnummern auf seinem Handy zu speichern. Um ein Uhr war Graves dann wieder in der Kantine. Beinahe sofort gesellten sich zwei Männer zu ihm. Sie waren ungefähr genauso alt wie er und stellten sich als Edward Irwin und Robert Douglas vor, während sie ihre Tabletts mit dem Essen neben seines stellten. Irwin hatte schmale Schultern, war ungewöhnlich schlank und besaß einen scheinbar unendlichen Appetit. Douglas wiederum war deutlich sportlicher, hatte eine freche, fast unverschämte Art zu reden und starrte Irwin mit resigniertem Staunen an, während dieser sein Essen in sich reinstopfte. Schließlich drehte er sich zu Graves um, blähte die Wangen und deutete auf den wachsenden Müllberg vor Irwins Tablett. Irwin trank einen Schluck von seiner Cola. Als Graves ihnen sagte, wer er war und mit wem er zusammenarbeitete, senkte sich kurz Schweigen über den Tisch. Irwin schob sein Tablett beiseite und strich sich das Haar zurück. Er lächelte breit, und Douglas beugte sich vor.
Graves spießte bedächtig eine Kartoffel auf und wartete.
»Shotgun«, sagte Douglas schließlich.
»Wie bitte?«
»Shotgun. Sie werden mit Shotgun arbeiten.«
»Wer ist Shotgun?«
»Downes natürlich.« Irwin lachte und senkte die Stimme. »So nennen wir ihn hier … allerdings nicht in seiner Gegenwart. Ins Gesicht sagt ihm das nur Dr. Brewin.«
»Seltsamer Spitzname«, bemerkte Graves leise. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. »Wie hat er sich den denn verdient? Hat er jemanden erschossen?«, fügte er ein wenig nervös hinzu.
Douglas zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht«, antwortete er nachdenklich, »aber er wäre durchaus in der Lage dazu.« Er lachte. »Bei Downes weiß man nie. Im Gegensatz zu den anderen hier ist er lieber alleine«, sagte er laut und ließ seinen Blick durch die Kantine schweifen. »Aber so nennen wir ihn eben … und zwar solange ich denken kann.«
»Glaubst du, der hier hält mal länger durch?«, fragte Irwin seinen Kollegen und musterte Graves eingehend.
»Schwer zu sagen«, antwortete Douglas und lächelte wieder.
»Durchhalten?«, hakte Graves nach.
»Sie sind schon der Dritte, seit Len krank geworden ist«, erklärte Irwin. »Und Len ist erst wie lange krank? Zwei Monate?«
»Drei.«
»Downes wollte sie also alle nicht«, sagte Graves. »Und warum?«
Irwin zuckte mit den Schultern. »Dabei waren das gute Jungs … zumindest dieser Mark. Verdammt witzig, der Typ.« Er schaute zu seinem Kollegen.
»Ja, er war ganz in Ordnung«, antwortete Douglas wenig begeistert.
»Das habe ich nicht gewusst«, sagte Graves leise. Langsam wurde er nervös. »Das hat mir niemand gesagt.« Er legte die Gabel auf den Teller. Der Appetit war ihm vergangen. Beinahe sofort dachte er an Oxford zurück. Der Superintendent musste das doch gewusst haben, als er ihn in sein Büro bestellt hatte. Das hier war kein guter Rettungsplan. Trotzdem lächelte Graves und schüttelte den Kopf. Das war alles so glatt gelaufen, erstaunlich glatt sogar, denn wenn Downes ihn auch abschoss, dann … Nun, dann gute Nacht. Eine Degradierung war das Mindeste, was ihm drohte.
»Okay«, sagte Graves. Er hatte beschlossen, dass es an der Zeit war, auf den Punkt zu kommen. »Gibt es da irgendetwas, das ich wissen sollte, damit es mir nicht so ergeht wie den beiden anderen?« Es folgte eine kurze Pause.
Irwin lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Dann sagte er: »Nun, ja … Downes ist immer sehr formell und ausgesprochen höflich. Aber wenn ihm danach ist, kann er auch durchdrehen … Er ist … Ach, ich weiß nicht. Wie schon gesagt, ist er lieber alleine. Hier in der Kantine sehen wir ihn nur selten.« Erneut ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen. »Und er war mal richtig berühmt.«
»Berühmt?« Neugierig hob Graves die Augenbrauen.
»Also ›berühmt‹ ist jetzt wohl übertrieben«, korrigierte Douglas seinen Partner. »›Bekannt‹ ist wohl der bessere Ausdruck.«
»Das war drüben in London«, erzählte Irwin. »Aber natürlich ist das lange her, es war, bevor er zu uns gekommen ist.«
»Aber das müssen Sie doch wissen«, sagte Douglas und schaute Graves an. »Sie müssen doch wissen, dass er nicht von hier ist, oder?«
»Na ja, ich habe da so was gehört«, antwortete Graves.
»Er stammt irgendwo aus Südamerika«, erzählte Douglas weiter. »Er ist ein Argie oder so.« Das sagte er ohne bösen Unterton.
»Argentinier?«
»Jaja, ein Argentinier«, bestätigte Douglas ungeduldig.
»Aber wie zum Teufel ist er dann hier gelandet? Ausgerechnet hier …«
»Mitten im Nirgendwo«, vervollständigte Douglas den Satz. Er wirkte nicht im Mindesten beleidigt. »Keine Ahnung.«
»Wenn er will, kann er verdammt hinterfotzig sein.« Irwin griff nach seinem Jackett, das er über den Stuhl gehängt hatte. »Sie wissen ja, wie die sind. Schauen Sie sich doch Maradona an.«
»Dieser Bastard«, sagte Douglas automatisch.
Nein, dachte Graves, er wusste nicht, wie die sind, und für Fußball hatte er nicht das Geringste übrig, noch nicht einmal während einer Weltmeisterschaft. Jetzt bereute er, überhaupt gefragt zu haben, denn er hatte keine Ahnung, wovon die beiden sprachen. Aber Argentinien … Graves versuchte, im Geiste irgendein Bild heraufzubeschwören, doch sein Kopf war leer. Das Einzige, was ihm zu Argentinien einfiel, waren Tango und die Falkland-Inseln.
Nach dem Mittagessen ging er wieder an seinen Schreibtisch, um sich mit dem Dienstplan vertraut zu machen und weitere Nummern auf seinem Handy zu speichern, einschließlich der der Pathologie in Cheltenham, der Opferbetreuung, der Krankenhäuser in der Umgebung und der Kriminaltechnik. Inzwischen war es nach vier, und er wartete noch immer auf seinen neuen Chief Inspector. Da er nicht wusste, was er sonst noch tun sollte, schaute er sich erst einmal den Tisch gegenüber an.
Der Schreibtisch war voller Akten und Papiere, und dazwischen stand ein Plastikbecher, der zur Hälfte mit kaltem schwarzem Kaffee gefüllt war. Auf den meisten Schreibtischen fand man allerlei Persönliches – Fotos, Maskottchen, Erinnerungsstücke –, hier jedoch nicht. Zumindest wirkte es zunächst so, bis Graves um den Tisch herumging und genauer hinsah. An der dem Fenster zugewandten Seite der Trennwand hing ein Foto. Neugierig beugte Graves sich vor.
Das Bild war bunt und recht groß, vermutlich die Titelseite einer Zeitschrift. Es zeigte einen schlanken und eindeutig ausländischen Fußballspieler in einem rot-schwarzen Trikot mit schwarzer Hose. Mit bemerkenswerter Eleganz sprang er gerade über das ausgestreckte Bein eines Gegenspielers hinweg. Sein Blick fixierte den Ball. Der Rasen war von weißen Flocken bedeckt, vielleicht Konfetti, und an der Seitenlinie lagen bunte Bänder. Das Stadion im Hintergrund war ein wahrer Hexenkessel. Die Hälfte der Fans sprang mit freiem Oberkörper auf und ab und ließ die Schals kreisen. Vor ihnen stand eine Reihe extrem hart aussehender Polizisten mit Waffen am Gürtel, und oben auf dem Metallzaun, der die Fans von den Beamten trennte, hockte ein schlanker, junger Mann. Gelassen ließ er die Beine auf beiden Seiten herunterbaumeln. Überall war Rauch von den Bengalos, aus roten Flammen sprühten Funken auf die Zuschauer.
Die Schlagzeile war in demselben Dunkelrot gehalten wie die Streifen auf dem Trikot des Spielers, andere Schlagzeilen waren gelb, und sie waren auf Spanisch verfasst. Graves versuchte, die Schlagzeile, so gut es ging, zu entziffern. Bei dem Versuch, sie laut auszusprechen, brach er sich jedoch fast die Zunge. »La Revancha Esperada« … was auch immer das heißen mochte. Graves versuchte es erneut. Beim zweiten Mal klang es noch viel schlimmer.
»Die ersehnte Revanche«, sagte eine leise Stimme direkt hinter ihm.
Graves schloss kurz die Augen und drehte sich dann um. Er hatte ihn nicht gehört. Der Mann schien sich zu amüsieren. Er deutete auf das Bild.
»Das steht da.« Sein Finger wanderte zu dem Stürmer. »Und der Spieler da … Wissen Sie, wer das ist?«, fragte er erwartungsvoll. »Erkennen Sie ihn vielleicht?«
»Ich fürchte nicht«, antwortete Graves.
»Das ist Enzo Francescoli«, erklärte der Mann. »Man nennt ihn den Prinzen. Er hat fünf Meisterschaften und 1996 die Copa Libertadores mit River Plate gewonnen«, sagte er und nickte zufrieden.
»Oh«, sagte Graves. »Äh …« Er bemühte sich, angemessen beeindruckt zu wirken. »Die Copa de …«
»Libertadores«, vervollständigte der Mann für ihn.
Graves schaute ihn an. Das Erste, was ihm auffiel, war die Narbe. Sie begann oben an seiner Stirn und lief dick und weiß direkt am Ansatz seines kurzgeschnittenen schwarzen Haars entlang. Das waren sicher sehr viele Stiche gewesen, dachte Graves und versuchte, sie nicht anzustarren. Er fragte sich, woher der Mann sie wohl hatte, der trotz der Kälte ungewöhnlich braun war. Er musste so Mitte vierzig sein und war um einiges größer als Graves, gut über eins neunzig.
Der Mann deutete wieder auf das Bild. »Sehen Sie das hier?« Er deutete auf eine Flagge, die aus so vielen Laken zusammengenäht zu sein schien, dass man damit ein kleines Krankenhaus hätte versorgen können. Darauf stand Los Borrachos del Tablon. »Barra Brava. Ultras«, erklärte der Mann. Graves glaubte so etwas wie Zuneigung in der Stimme des anderen zu hören.
Dann seufzte der Mann, wandte sich von dem Bild ab und schaute Graves in die Augen. Von einem Augenblick auf den anderen hatte sein Gesicht einen professionellen Ausdruck angenommen. Sein Blick wirkte irgendwie distanziert. Es ging so schnell, dass Graves das Gefühl hatte, eine Maske zu sehen.
Der Mann streckte die Hand aus. »Ich bin Downes«, sagte er.
KAPITEL ZWEI
Draußen war es kalt, und wie immer fror ich, als ich auf die einladenden Lichter des Pubs zuging. Ich stieg die Stufen hinauf, hörte das vertraute, gedämpfte Murmeln der Gäste im Schankraum und fuhr mir rasch mit den Fingern durchs Haar. Ich war froh, hier zu sein. Am Dorfplatz fuhr ein großer, amerikanischer Wagen an mir vorbei: ein Plymouth, wie es auf den ersten Blick aussah. So einen hatte ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Eigentlich hatte ich an meinen neuen Sergeant gedacht, doch als ich den Wagen sah, vergaß ich ihn und alles andere auch. Da waren die elegante Silhouette und dann das funkelnde Chrom. Der Wagen glitt durch die Nacht. Qualm stieg aus dem Auspuff auf. Dann bremste er ab und blieb stehen. Die Kälte und alles andere waren vergessen, als ich sah, wie er grummelnd und bebend auf der Straße stand.
Ja, es war ein Plymouth. Ein Valiant. Als er sich wieder in Bewegung setzte, stieß sein riesiger Motor ein heiseres Brüllen aus, und die Heckflossen schnitten durch die kalte Winterluft. Der Wagen drehte, rollte erneut an mir vorbei und musste dann wieder an einer Ampel halten. Ich konnte weder das Gesicht des Fahrers noch das des Beifahrers erkennen, doch es waren eindeutig zwei Männer. Wieder grollte der Motor, und die lange, schlanke Motorhaube des Wagens zitterte leicht. Mein Herz schlug immer schneller, und ich ballte instinktiv die Fäuste, blinzelte und rieb mir den Nacken.
Langsam, ganz langsam schaltete die Ampel um, und der Plymouth fuhr weiter. Ich hielt die Luft an und rührte keinen Muskel, bis der Wagen schließlich außer Sicht war. Ich grunzte und verzog den Mund. Dann öffnete ich die Tür.
In der gegenüberliegenden Ecke des Schankraums saßen die üblichen Verdächtigen am Billardtisch. Ihre Mäntel und Schals lagen auf der Bank neben der Dart-Scheibe. Ich winkte beiläufig und suchte mir dann rasch einen Weg um die Tische herum zu dem Kamin neben den Fenstern.
Eine Weile starrte ich einfach nur in die Flammen. Meine Gedanken gingen auf Wanderschaft, und ich dachte wieder an den Wagen draußen. Es war schon eine ganze Weile her, dass ich so einen Wagen gesehen hatte. Es machte mich ein wenig nervös, denn ich musste an zu Hause denken und an den Ford Falcon, der vor all den Jahren auf der Suche nach mir durch die Straßen gerollt war.
Mit einiger Mühe gelang es mir, die Erinnerung zu verdrängen, und nach und nach verblasste das Bild des Wagens, während ich mich am Feuer wärmte. Schließlich erhob ich mich und stapfte zum Tresen. Endlich war mir wieder warm, sodass ich zufrieden seufzte, als ich meinen Mantel auszog. Ich bestellte mir ein Pint, plauderte kurz mit Des, dem Barkeeper, und spendierte ihm einen Drink. Dann ging ich zu den drei Männern am Billardtisch und zog mir einen Stuhl heran.
»Wir haben gerade über nächsten Donnerstag nachgedacht«, sagte Richard auf seine typisch zögernde Art, wedelte mit seinem Glas und schaute mich an. »Glaubst du, du schaffst das, Will? Wir wären dann so um sieben, halb acht bei dir.«
Einen Augenblick lang war mein Kopf vollkommen leer, was man mir ansehen musste, denn Gavin warf ein: »Netter Versuch, Richard, aber darauf fällt er nicht rein. Er lässt niemanden in sein Haus, nicht mal den Postboten.«
»Er hält sich dort nämlich einen eigenen Harem«, sagte Henry von der anderen Seite des Tisches aus und zwinkerte mir lüstern zu. »Stimmt doch, Will, oder?«
Ich lächelte und wechselte das Thema. Immerhin hatten sie sich inzwischen an mich gewöhnt. Wenn ich jemandem ein Essen schuldete, dann lud ich ihn in ein Restaurant ein. Ich war kein guter Koch. Und die Jungs schienen kein Problem mit meiner nicht vorhandenen Gastfreundschaft zu haben. Manchmal war ich fest davon überzeugt, dass sie mich vor ihrem geistigen Auge mit einer Rose im Mund Tango tanzen sahen. Dabei war das, was sie sich darunter vorstellten, Flamenco und hatte nicht das Geringste mit Tango zu tun, dem Tanz, der seinen Ursprung in den Slums meiner Heimat hatte. Er wurde in den Bars an den Docks geboren, inmitten des größten Chaos der Stadt.
Ich saß da und beobachtete meine Freunde. Ich fragte mich, wie lange sie es in meiner Heimat wohl aushalten und was sie dann darüber denken würden. Ich nehme an, sie würden verrückt werden. Hier draußen, in dieser endlosen ländlichen Ruhe, kann man sich ein Leben jenseits davon nur schwer vorstellen. Von außen betrachtet ergibt alles einen Sinn. Alles hat seinen Platz.
Meine Freunde sind offenherzig und ahnungslos. Keiner von ihnen hegt das typische Misstrauen, das Argentiniern angeboren scheint. Es war so ziemlich das Erste, was mir an ihnen auffiel: Ihnen fehlt die Angst, überfallen, zusammengeschlagen oder ausgeraubt zu werden, wenn man einen Moment lang nicht aufpasst. Für mich ist das immer noch schwer nachzuvollziehen. Wenn hier etwas nicht funktioniert, dann zucken die Leute nur mit den Schultern und kommen später wieder. Wenn in meiner Heimat etwas nicht funktioniert, dann kommt es fast zu einem Aufstand. Die Leute fangen an zu schreien und an Bürotüren zu hämmern. In meiner Heimat muss man verdammt viel Lärm machen, wenn man möchte, dass etwas getan wird. Es hat Jahre gedauert, bis ich mich vor dem Betreten meines eigenen Hauses nicht mehr vorsichtig umschaute, aus Angst, irgendjemand könne in den Schatten lauern und mich überfallen. Solche Gewohnheiten aufgeben zu können ist natürlich sehr angenehm, doch es fällt mir nach wie vor schwer, ruhig zu bleiben, wenn etwas schiefgeht oder mir jemand in die Quere kommt. Instinktiv will ich ihm dann an die Kehle springen und ein wenig Dampf ablassen – auch in der Öffentlichkeit.
Zu Hause gibt es einen Begriff für dieses ständige Chaos: Quilombo. Ursprünglich bezeichnete man damit die Slums der brasilianischen Flüchtlinge in meinem Land. Heute meint es das unauflösbare Gewirr der kleinen und großen Katastrophen, die meine Heimat plagen, ein unlösbares Problem. Que quilombo! Was für ein Chaos. Es ist ein alter Ausdruck, der immer noch ständig gebraucht wird. Für ein persönliches Desaster, einen politischen Skandal oder die Hyperinflation. Stromausfall. Que quilombo!
Der Argentinier weiß aus Erfahrung, dass viele Dinge schiefgehen. Er vertraut weder dem Mechaniker noch dem Klempner, dem Elektriker oder dem Polizisten. Er rechnet ständig damit, dass man ihn über den Tisch ziehen will. Das ist ein Naturgesetz. Die Polizei ist dabei die schlimmste Räuberbande der Welt, da ist man mit einem echten Räuber besser dran. Einem Polizisten darf man nicht vertrauen. Vor allem sollte man keinen ins Haus lassen, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Polizisten sind Coimeros, korrupt. Sie stehen mit Gangstern im Bunde, manchmal sogar mit Killern. Und was die Politiker betrifft … Nun, wenn es ums Stehlen geht, ist die Polizei ein Kindergarten dagegen.
Ich griff nach meinem Pint, trank einen kräftigen Schluck und genoss es, meinen Freunden einfach nur beim Reden zuzusehen. Pubs gehören zu den Dingen, die ich in England am meisten liebe. In meiner Heimat gibt es so etwas nicht, jedenfalls nichts, was einem echten englischen Pub gleichkäme.
Einer der Einheimischen, ein dürrer, alter Farmer, bückte sich, nahm sich ein Holzscheit und warf es ins Feuer. Dann trat er mit dem Stiefel dagegen, bis es fest auf dem Rost lag. Langsam fing das Scheit Feuer, und draußen rauschten die Bäume in der hereinbrechenden Dunkelheit, während der Wind stärker wurde und um die alten Mauern fegte.
KAPITEL DREI
Am nächsten Morgen weckte mich das Telefon. Zitternd griff ich nach dem Hörer und starrte durch die Lücke zwischen den Vorhängen. An den Rändern der Fensterscheiben hatte sich Frost gebildet, und der nahegelegene Wald strahlte eine merkwürdige Stille aus, so dunkel und tief, dass man sie förmlich greifen konnte. Ich murmelte irgendetwas ins Telefon, schrieb mir eine Adresse auf, zog mich schnell um, schnappte mir einen Kaffee und fuhr dann direkt nach Lower Quinton.
Es war eine kurze Fahrt, doch es dauerte eine Weile, bis ich den Eingang zum Feld gefunden hatte, was mir erst gelang, als ich das rot-gelbe Licht des Rettungswagens über den Bäumen sah. Ich parkte meinen Wagen hinter einem der beiden zivilen Vans. Dann stieg ich aus, öffnete den Kofferraum, nahm meine Gummistiefel heraus und zog sie rasch an, bevor ich mich auf den Weg über den verschlammten Pfad machte.
Das erste Licht des Morgens drang durch die dichten Wolken, und eine steife Brise wehte über das Feld. Das Dorf schlief noch. Rasch ging ich zum Tor, doch als ich den Krankenwagen erreichte, blieb ich dort stehen. Seine Hecktüren standen auf, und eine dünne, alte Lady saß auf der Trage. Verloren klammerte sie sich an den grünen Mantel auf ihrem Schoß, und ein schmales Rinnsal Blut lief ihr über die Stirn zum linken Auge. Einem Reflex folgend ging ich auf sie zu, um ihr zu helfen, hielt aber inne, als ich sah, dass ein Sanitäter bereits nach Verbandsmaterial suchte.
Ich sah mir die Frau genauer an. Ja, das war in der Tat eine üble Wunde, die da unter dem grauen Haar zu erkennen war. Die Frau würde genäht werden müssen, und wie es aussah, war es nicht mit ein paar Stichen getan.
Ich steckte den Kopf in den Wagen. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte ich die Frau.
Sie schaute mich an, als hätte sie mich erst jetzt bemerkt. Dann lächelte sie, sagte aber nichts. Die arme Frau, dachte ich. Offenbar stand sie noch unter Schock. Doch dann verwandelte sich das Lächeln langsam in eine ungeduldige, sarkastische Grimasse.
»Natürlich ist nicht alles in Ordnung. Was denken Sie sich eigentlich?«, fauchte sie. »Sehe ich etwa so aus, als wäre alles in Ordnung? Mir ist kalt, ich bin vollkommen durchnässt, und ich will einfach nur nach Hause.« Die Worte »nach Hause« unterstrich sie mit einem Nicken, sodass noch mehr Blut aus der Wunde floss. »Aber dieser schreckliche, kleine Mann hier« – sie funkelte den Sanitäter an –, »will mich einfach nicht gehen lassen, und ich weiß nicht, wo meine Jacky ist.«
»Ihre was?« Kurz war ich verwirrt.
Die Frau schaute mich an, als hätte ich gerade die dümmste Frage gestellt, die sie je gehört hatte. »Meine Jacky. Mein Hund!«
Ich war bereits im Begriff zu gehen. »Ich bin sicher, Ihrem Hund geht es gut«, sagte ich, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte weiter zum Tor. Blöde, alte Schachtel, dachte ich und suchte automatisch nach einem spanischen Äquivalent: Vieja Bruja – Alte Hexe.
Als ich das Tor erreichte, sah ich, dass sich ein junger Constable namens Varley um den Hund der alten Frau kümmerte. Sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch fielen mir jede Menge Wörter ein, um Varley zu beschreiben, doch da keines sonderlich schmeichelhaft war, verbannte ich sie aus meinem Kopf. Stattdessen beobachtete ich wenig überrascht, dass der Hund ihm bereits Ärger machte.
Varley tätschelte den Hund hinter den Ohren und versuchte, ihn ohne großen Erfolg zu beruhigen. Also hockte er sich auf die Fersen und probierte es mit einem »Sitz«, während er versuchte, die Hinterläufe des Tieres auf den Boden zu drücken.
»Jacky«, bettelte er den Hund an. »Komm schon. Mach Sitz. Lieber Hund. Sei artig, Jacky.« Doch der Hund, ein wilder, noch sehr junger Foxterrier, schien fest entschlossen, den Hügel hinaufzurennen. Mit aller Kraft warf er sich in die Leine und jaulte laut in dem verzweifelten Versuch, dieses seltsame und aufregende Phänomen zu untersuchen, das er soeben auf Meon Hill entdeckt hatte.
Varley hob den Blick, als er mich näherkommen hörte, wobei er kurz nicht aufpasste und den Griff um die Leine lockerte. Der Hund riss sich los, Varley geriet ins Wanken und fiel in den Schlamm, als er versuchte, die Leine noch zu erwischen. Erfolglos. Jacky begann bereits unter dem Tor hindurchzukriechen.
Ich machte ein paar große Schritte, und es gelang mir, gerade noch rechtzeitig auf die Hundeleine zu treten, sodass ich den Hund wie einen Fisch mit der Angel zurückholen konnte. Varley schaute mich an, als erwarte er einen Anschiss von mir, doch dafür war es noch viel zu früh. Außerdem war mir kalt, und ich schlief noch halb. Stattdessen schaute ich mir den Hund der Frau bewundernd an und kraulte ihm die Ohren, während Varley, so gut es ging, den Schlamm von seiner Jacke wischte.
Wenigstens schien der Hund sich zu beruhigen, jetzt da er wusste, dass er keine Chance mehr bekommen würde, den Hügel hinaufzulaufen. Zwar sah er von Zeit zu Zeit noch verstohlen hinauf, doch schließlich schaute er nur noch freundlich zwischen mir und Varley hin und her.
»Ich nehme an, der kleine Kerl gehört der Frau im Krankenwagen«, sagte ich. »Der alten Dame, die uns angerufen hat.«
»Ja, Sir.«
»Sie sieht ziemlich mitgenommen aus«, sagte ich. Inzwischen hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich sie im Geiste eine alte Hexe genannt hatte.
»Ich glaube, sie ist okay, Sir«, erklärte Varley. »Die Wunde sieht schlimmer aus, als sie ist. Trotzdem wird man sie in die Notaufnahme bringen, um ihren Schädel zu röntgen. Sie ist gestolpert, als sie versucht hat, den Hügel hinunterzusteigen, und dabei hat sie sich den Kopf angeschlagen. Sie hatte es wohl ein wenig zu eilig, ans Telefon zu kommen.«
»Ja«, erwiderte ich. »Das kann ich mir vorstellen. Da will man nur ein wenig durch die Gegend spazieren und dann das.«
»Oh ja, Sir«, sagte Varley in einem Tonfall, als hätte ich gerade etwas furchtbar Unsensibles gesagt. »Ich werde das auch nicht so schnell vergessen.«
»Sie waren oben?«, fragte ich überrascht.
»Ja, Sir. Ich war der Erste hier, und da das, was die alte Dame erzählt hat, nicht allzu viel Sinn für mich ergab, dachte ich mir, ich sollte lieber selbst mal nachsehen. Sie hat ständig irgendetwas von einem Hund gefaselt. Sie sagte, dass sie wisse, wer da oben liegt, sie habe seinen Hund erkannt.«
»Seinen Hund?«, hakte ich nach. »Dann ist der Hund noch da oben?«
»Muss wohl so sein«, antwortete Varley, als sei ihm dieser Gedanke bisher gar nicht gekommen. »Doch er ist wohl weggelaufen, ich habe ihn nicht gesehen.« Plötzlich wirkte er verwirrt. »Aber ich habe eine Leiche gesehen … Da oben ist definitiv eine Leiche … Der Hund der alten Lady hat sie gefunden. Sie hat mir erzählt, dass Jacky sofort den Hang hinaufgerast sei, als sie ihn losgemacht habe. Er muss die Leiche gerochen haben. Und als sie selbst oben ankam, hat Jacky wie wild mit dem Schwanz gewedelt und daran geschnüffelt.« Varley schaute den Hund entrüstet an.
Ich zog den Mantel enger um die Schultern und schaute den Hügel hinauf, der sich hinter dem Tor erhob. »Abgesehen von Dr. Brewin und seinem Team, war sonst noch jemand da oben?«
»Nur ein paar Dorfbewohner mit ihren Hunden. Der Hügel ist bei Hundebesitzern sehr beliebt, weil sie ihre Tiere dort laufen lassen können. Ich habe ihnen gesagt, es habe einen Unfall gegeben, und sie nach Hause geschickt.«
»Gut«, sagte ich. »Bleiben Sie bei dieser Version.«
Neben dem Pfad lag ein Garten, an dessen anderem Ende ein hübsches Cottage stand. Draußen war es eiskalt. Ich schaute zu Varley hinüber, dessen Jacke voller Schlamm war. Er hatte einen verdammt langen Tag vor sich – wie wir alle.
»Dr. Brewin hat Ihnen das vermutlich schon gesagt«, fuhr ich fort und musterte Varley aufmerksam. »Aber ich werde es Ihnen lieber nochmal sagen, nur für den Fall. Ohne meine ausdrückliche Erlaubnis darf niemand durch dieses Tor. Niemand! Das ist ein Tatort, und einzig Dr. Brewin und ich entscheiden, wer hier reindarf und wer nicht. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
»Jawohl, Sir«, antwortete Varley. »Aber Sie …« Er hielt kurz inne. »Nun, ja … Ihr Sergeant hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, Sie möchten das Feld von dem Garten aus betreten.« Varley deutete auf den Garten neben dem Pfad. »Er hat den Besitzer informiert und Anweisung gegeben, dass alle dort durchgehen, Sir, um mögliche Beweise auf dem Pfad nicht zu zerstören.«
Kurz war ich verwirrt. Vor meinem geistigen Auge sah ich Powell, doch dann erinnerte ich mich. Powell war krank, schwer krank.
»Oh … Hat er?«, sagte ich und kniff die Augen zusammen.
»Ja, Sir.«
»Und ich soll den anderen Weg nehmen, ja?«
»Das hat er gesagt.«
Ich grunzte und schaute den Pfad hinauf. Ein Kriminaltechniker machte gerade ein paar Fotos vom Schlamm unmittelbar unter der Hügelkuppe. Auf der Kuppe selbst stand ein Schild mit einer recht unfreundlichen Mitteilung des Besitzers in Großbuchstaben: DIESES FELD IST KEIN HUNDESPIELPLATZ. Irgendjemand, vermutlich der Witzbold im Dorf, hatte das K mit einem dunklen Marker durchgestrichen.
Ich tätschelte den Hund ein letztes Mal, dann ging ich zu dem Garten. Dabei hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich sah mich um und entdeckte schließlich einen kleinen, blassen Jungen am Küchenfenster des Cottages. Er trug noch seinen Spiderman-Schlafanzug und beobachtete mich aufmerksam. Ich winkte dem Jungen zu, und instinktiv winkte der Junge zurück.
KAPITEL VIER
Auf Meon Hill befanden sich die Überreste einer eisenzeitlichen Siedlung, deren Umrisse an den sanften Bodenwellen noch deutlich zu erkennen waren. Die Felder hier oben wurden auf allen Seiten von dichten, dunklen Hecken begrenzt, und auf der Anhöhe stand eine Hand voll uralter Eichen. Ich hatte Meon Hill ab und zu vom Auto aus gesehen, war jedoch noch nie dort gewesen. Der Hügel war still und leer, was irgendwie traurig wirkte. Ich ging am Rand des Feldes entlang. Schlammklumpen klebten an meinen Stiefeln. Ich rieb mir die Handschuhe, während ich von wärmeren Ländern träumte, und steckte dann die Hände in die Taschen. Die Kälte ist etwas, an das ich mich nie gewöhnt habe. Sie dringt tief in meine Knochen ein, und egal wie viele Schichten Kleidung ich auch anziehe, der Wind dringt immer durch meinen Kragen. Schals, Handschuhe und Hüte scheinen bei mir nichts zu nützen. Und die Kälte lässt mich so heftig zittern und mit den Zähnen klappern, dass ich manchmal kaum noch denken oder atmen kann, und jeden Winter lande ich irgendwann für mindestens eine Woche mit einer Erkältung im Bett. Und dann diese Dunkelheit hier draußen auf dem Land.
Ich schaute nach oben. Dr. Brewin hatte gelbes Absperrband um die alten Eichen gespannt. Ich beschleunigte meinen Schritt. Einen Augenblick lang war die Kälte vergessen, und ich wollte es einfach nur hinter mich bringen. Also zog ich den Kopf zwischen die Schultern, um mich gegen den Wind zu schützen, und überquerte rasch das Feld. Als ich kurz aufschaute, sah ich Graves den Hang hinunter auf mich zukommen, ich blieb stehen und wartete auf ihn.
Ein wenig von Graves’ blondem Haar ragte unter der dicken Wollmütze hervor, die er sich tief ins Gesicht zog, als er mich sah. Um den Hals trug er einen passenden Schal. Er hatte ihn sorgfältig gebunden und vorsichtig in den Kragen gesteckt. Und er trug einen Anzug. Bei jedem anderen hätte ein schwarzer Anzug mit einer Wollmütze lächerlich ausgesehen, doch bei Graves funktionierte diese Kombination. Er sah elegant und verschmitzt zugleich aus. Ich konnte nicht anders, als an meinem zerschlissenen Trenchcoat hinunterzuschauen und meine Krawatte zurechtzuziehen. Graves hingegen sah absolut makellos aus, und auch die Kälte schien ihm nicht das Geringste anhaben zu können. Allerdings wirkte er ein wenig nervös.
»Morgen, Graves«, sagte ich. Graves … welch passender Name für einen Polizisten. Wie bei Agatha Christie. Das hatte ich schon gedacht, als ich ihn zum ersten Mal in der Akte gelesen hatte.
»Morgen, Sir. Wir wissen bereits, wer das Opfer ist«, verkündete Graves. Er war ein wenig außer Atem, aber offensichtlich zufrieden mit sich selbst. »Dr. Brewin hat ihn wiedererkannt. Offenbar handelt es sich um den Besitzer dieses Feldes. Er heißt Frank. Frank Hurst.«
Sofort als ich den Namen hörte, musste ich an einen Swimmingpool im Sommer zurückdenken und an eine tote Frau, die mit dem Gesicht nach unten am Beckenrand gelegen hatte.
»Er lebt irgendwo auf der anderen Seite des Hügels«, fuhr Graves fort und schaute sich um.
»Frank Hurst … Himmel! Was ist denn passiert?«
»Irgendjemand hat ihm eine Mistgabel in den Hals gerammt«, antwortete Graves und verzog das Gesicht, als wünschte er, er könne das irgendwie anders ausdrücken.
»Himmel«, sagte ich erneut.
»Kannten Sie ihn?«
»Das könnte man so sagen«, erwiderte ich grimmig. Ich dachte kurz nach und musterte Graves aufmerksam. Er sah ein wenig bleich aus, und er zitterte leicht in seinem Mantel, obwohl er versuchte, das nach besten Kräften zu verbergen, da der Grund dafür nicht die Kälte war, sondern das, was er oben auf dem Hügel gesehen hatte. Man versucht zwar immer, sich auf das vorzubereiten, was einen erwartet, doch manchmal ist das einfach nicht möglich.
»Nun, dann sollten Sie wohl mal jemanden zu seinem Haus schicken«, sagte ich. »Und Sie sollten auch so viele Constables wie möglich herbeordern. Wir werden sie brauchen. Das schaffen Sie doch Graves, oder? Das alles zu regeln?«
Graves lächelte. »Ich werde es versuchen.«
Ich nickte. »Na, dann mal los.«
Ich stieg weiter den Hügel hinauf. Frank Hurst. Plötzlich drehte ich mich noch einmal um. Graves war schon fast am Tor.
»Graves!«, rief ich, und Graves kam wieder zurück.
»Hurst hat eine Tochter«, sagte ich. »Sie lebt vielleicht noch in dem Haus, und es gibt da noch eine Haushälterin … zumindest war das früher so. Vielleicht ist die Haushälterin ja noch dort. Aber suchen Sie zuerst die Tochter. Es wäre gut, wenn wir sie informieren könnten, bevor die Presse davon Wind bekommt. Sie soll es nicht auf die harte Tour erfahren.«
Graves nickte und machte sich erneut auf den Weg nach unten, während ich ihm noch ein paar Augenblicke lang nachdenklich hinterherschaute. Graves wirkte mehr als nur ein wenig mitgenommen. Dann drehte ich mich wieder um und setzte meinen Weg fort. Plötzlich fühlte ich mich irgendwie fehl am Platze. Manchmal bin ich mir nur allzu bewusst, dass ich hier auf dem Land ein Fremder bin, und dies war einer dieser Momente. Kurz erschien mir der Hügel irgendwie unwirklich, als würden Tausende Risse die Landschaft durchziehen, und es brauchte nur einen Schritt, und alles würde zersplittern. Vielleicht waren die Kälte in meinem Kopf daran schuld und die Reste des Traums von meiner Heimat, die mir auch jetzt noch den Hang hinauf folgten. Ich schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, doch es nutzte nichts.
Je älter ich werde, desto öfter habe ich das: dieses Gefühl, an zwei Orten zugleich zu sein … oder anderswo. Wie bin ich nur hier gelandet? So weit weg von zu Hause? Einen Augenblick lang kam mir allein schon die Vorstellung absurd vor, im Winter hier auf diesem Hügel zu stehen.
Es ist ein seltsames, beunruhigendes Gefühl, das man nur schwer wieder loswird, wenn es sich erst einmal festgesetzt hat. Ähnlich wie die Kälte. Die spanische Stimme in meinem Kopf wird immer lauter und hartnäckiger, und sie lässt sich weder einschüchtern noch verdrängen. Je älter ich werde, desto häufiger denke ich an Buenos Aires. Dort ist jetzt Sommer, und die Hitze wabert durch den Lärm der Stadt. Es ist jetzt so heiß dort, dass man im wahrsten Sinne des Wortes ein Ei auf dem Asphalt braten könnte. Eigentlich konnte ich von Glück sagen, nicht mehr dort zu sein. Stromausfälle, Demonstrationen, überfüllte Busse und sinnlose Gewaltausbrüche, die sich wie Waldbrände in der ganzen Stadt verbreiten. Und selbst wenn man einen Brandherd löschen kann, flackern die Flammen in einer anderen Straße wieder auf. Wenn man sich nicht auskennt, verschlingt einen die Stadt. Ich schaute in die kalte Luft hinauf. Ja, in Buenos Aires war es so anders als hier. Während ich weiterging, kamen mir die Zeilen eines alten Tangos in den Sinn. Präzise und nachdrücklich und trotz des Zynismus fröhlich.
Wenn du nicht schreist, wirst du nicht satt.Und wenn du nicht stiehlst, dann bist du dumm.Mach schon! Immer weiter!Wir sehen uns in der Hölle.Denk nicht mehr.Mach, dass du verschwindest.Es kümmert niemanden,Ob du ehrlich geboren wurdest.
Ich lächelte und versuchte, die Erinnerung beiseitezuschieben. Oben auf dem Gipfel waren deutlich zwei Gestalten zu erkennen, und Absperrbänder wiesen den Weg zum Tatort. Es fiel mir schwer, wieder ins Hier und Jetzt zurückzufinden, doch das Licht der kalten Morgensonne, das die Konturen der alten Eichen deutlich hervortreten ließ, erleichterte es mir.
Dr. Brewin hockte über der Leiche. In jungen Jahren war er ausgesprochen sportlich und gutaussehend gewesen, doch inzwischen, mit Anfang fünfzig, wurde er allmählich fett. Er trug einen weißen Overall und war wie immer bei der Arbeit recht vergnügt. Im Augenblick zupfte er mit einer Pinzette an Hals und Gesicht des Opfers herum. Trotz des Fettes wirkte Brewin zäh. Er hatte breite Schultern und eine platte Nase, und seine großen, fleischigen Hände passten eher zu einem Schwergewichtsboxer als zu einem Arzt. Und dennoch wirkten seine Bewegungen erstaunlich anmutig, als er sich von dem Gesicht abwandte und den Mantel des Toten nach Spuren absuchte.
Neben ihm kniete Fiona, seine Assistentin. Sie lächelte mich kurz an, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Fingernägel des Toten und kratzte den Dreck unter ihnen hervor.
Schließlich drehte auch Brewin sich zu mir um.
»Morgen, Shotgun«, grüßte er gut gelaunt.
Ich nickte. Ich kannte Brewin schon lange. Manchmal imitierte er den schwarzen Humor der Pathologen im Fernsehen, die Sandwiches aßen, während sie in den Leichen herumstocherten und die anwesenden Polizisten sich der Reihe nach übergaben.
Deshalb überraschte es mich auch nicht, als Brewin sagte: »Zehn Pesos, wenn du die Todesursache errätst.« Er trat beiseite und machte eine theatralische Geste, als heiße er mich in einem Zirkuszelt willkommen.
Natürlich war die Mistgabel, die im Hals des Opfers steckte, nicht zu übersehen. Sie war mit solcher Wucht hineingerammt worden, dass zwei der vier Metallzinken auf der anderen Seite wieder ausgetreten waren und sich in den Schlamm gebohrt hatten. Es war, als hätte man dem Mann die Kehle mit unglaublicher Kraft aufgerissen. In der furchtbaren, klaffenden Wunde waren deutlich Knochen und zerfetzte Adern zu erkennen, denn der Stoß hatte den Kopf fast abgerissen, sodass man das Erdreich unter dem Hals erkennen konnte.
Die Mistgabel sah recht neu aus. Sie hatte einen leuchtend gelben Stiel und Zinken aus glänzendem, rostfreiem Stahl. Sie hatte sich tief im Opfer verkeilt, sehr tief. Aus irgendeinem Grund erinnerte mich die Mistgabel an den Sommer in meinem kleinen Garten, daran, wie der Rasensprenger die Rosen und das Gras benetzte. Kurz schloss ich die Augen, dann sah und roch ich plötzlich wieder die Feuchtigkeit der Leiche und hörte das Rauschen des Windes in den alten Eichen.
»Weißt du was?«, sagte Brewin. »Ich dachte schon, wir müssten für … für … wie heißt er nochmal? … eine Trage organisieren.«
»Graves«, ergänzte ich gedankenverloren.
»Der Mann ist richtig grün geworden. Stimmt’s, Fiona?«
»Ach, seien Sie nicht so hart zu ihm«, erwiderte Fiona und lächelte verträumt. »Der arme Kerl.«
Und schon hat Graves einen Fan, dachte ich. Ich steckte die Hände tief in die Taschen und stand einen Augenblick lang unentschlossen da, bevor ich mir die Leiche genauer anschaute. Ein überraschend großer Schlüsselbund sowie ein paar Münzen waren dem Mann aus der Tasche gefallen und lagen nun auf dem Gras neben einem Baumstamm, auf dem die Reste seiner letzten Mahlzeit standen.
Hurst hatte den typischen unersättlichen Appetit eines Farmers besessen. Da lagen ein Apfelgehäuse, eine leere Plastiktüte, in der wohl Speckchips gewesen waren, und ein weggeworfenes Schokoladenpapier schimmerte silbern im frühen Licht. Daneben lag ein kleiner Tetrapack. Eine tanzende Cartoon-Orange mit Hut starrte mich von der Verpackung an. Der Orangensaft war ungeöffnet, der Strohhalm klebte noch an der Rückseite. Ein Stück Brot war fest in die Erde getreten worden, und es roch nach zermatschtem Apfel.
Frank Hurst war noch immer schlank, obwohl sein kurzgeschorenes graues Haar verriet, dass er seine besten Jahre schon hinter sich hatte. Sein Kopf war leicht angewinkelt, und er starrte in den Himmel hinauf. Kurz spiegelte sich eine Wolke in seinen Pupillen.
»Oh Mann«, hörte ich mich selbst sagen. »Das ist wirklich Frank Hurst, nicht wahr?«
Brewin nickte.
Ich schaute auf Frank Hursts aufgerissenen Mund, und in diesem Augenblick erinnerte ich mich wieder an jenen Tag im August. Vor meinem geistigen Auge sah ich Franks Frau, wie sie mit dem Gesicht nach unten neben dem Pool gelegen hatte, und ihr Blut, das sich unter der Wasseroberfläche gekräuselt hatte. Jetzt war es Franks Blut, das im Schlamm versickerte. Ihres hatte sich damals langsam im klaren Wasser des Pools verteilt und war in kleinen Wirbeln an den Rand getrieben. Wasser und Schlamm. Schlamm und Wasser. Blut und der Geruch von Chlor gemischt mit Lavendel. Warum Lavendel? Plötzlich erinnerte ich mich wieder daran, dass der Pool von einem wahren Lavendelwald umgeben gewesen war, ein überwältigender, intensiver und fast unangenehmer Geruch.
»Er hat die ganze Nacht hier oben gelegen«, erklärte Brewin. »Heute Morgen hat ihn niemand gesehen. Also nehme ich an, dass es geschehen sein muss, kurz nachdem Hurst seine Arbeit beendet hatte, vermutlich bei Einbruch der Dunkelheit, als er sich gerade auf den Heimweg machen wollte.«
Hursts restliches Werkzeug und Material lehnten noch an dem Stamm: eine Heckenschere, ein Spaten und eine Hand voll Stacheldrahtrollen. Es sah aus, als hätte Hurst ein paar Reparaturarbeiten auf seinem Feld erledigen wollen: die Abflussgräben säubern, die Hecken schneiden oder die Zäune reparieren. Von hier oben hatte man eine hervorragende Aussicht. Also musste der Täter sich angeschlichen haben, und leicht konnte das nicht gewesen sein. Dann hatte er sich die Mistgabel geschnappt, die vermutlich ebenfalls am Stamm gelehnt hatte … Es sei denn, Hurst hatte den oder die Täter gekannt und ahnungslos auf sie gewartet.
Brewin strich mit den Fingern über den Kiefer des Toten und richtete sich dann auf. »Also …«, sagte er. »Natürlich muss ich die Leiche erst abschließend untersuchen, aber wie es aussieht, hatte er keine Zeit mehr, sich groß zu wehren. Soweit ich sehen kann, gibt es keinerlei Abwehrverletzungen an seinen Armen oder Händen. Wer auch immer das getan hat, muss stark und schnell gewesen sein. Er hat ihn zu Boden geschlagen«, erklärte Brewin und hob die Hände, als hielte er die Mistgabel, »und dann … rein damit.«
Fiona hatte aufgehört zu arbeiten und hörte zu. Ja, der Fall war übel, doch im Grunde auch nicht schlimmer als die Mehrheit der Morde, die ich bis dahin untersucht hatte. Morde sind immer übel, brutal und ekelhaft. Schon früh in meiner Karriere habe ich gelernt, dass die Täter so etwas nur selten planen, und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass auch mir etwas genommen wurde, wenn ich mir ein Opfer anschaue.
»Was ist mit dem Hund?«, fragte ich. »Die alte Lady hat irgendetwas von seinem Hund gesagt.«
»Der ist da drüben«, antwortete Brewin und deutete an der Leiche vorbei tiefer in das Wäldchen hinein. »Dahinten ist eine kleine Lichtung.« Aus irgendeinem Grund klang er plötzlich wütend.
Ich entfernte mich vom Tatort und durchquerte den kleinen Eichenhain. Unterwegs erhaschte ich durch eine Lücke in der Hecke einen kurzen Blick auf Frank Hursts großes, altes Haus. Es lag am Fuß des Hangs auf der anderen Seite und tief im Schatten des Hügels. Ein seltsamer Ort für ein Haus, dachte ich. Das war mir schon damals aufgefallen. Der Hügel schien dem Morgenlicht alle Kraft zu rauben, und das Haus wirkte grau und trostlos wie eine Irrenanstalt aus einem Horrorfilm. Ich konnte das gelbliche Cotswold-Dach sehen und sogar den Swimmingpool auf der Rückseite.
Ich wandte mich ab, setzte meinen Weg fort und blieb dann plötzlich stehen. Weiter vorne hing etwas Dunkles und Schweres im Geäst. Irgendetwas Großes verbarg sich in der Dunkelheit der Bäume. Langsam ging ich weiter, und als ich auf die Lichtung trat, war es nicht mehr zu übersehen.
Ein großer schwarzer Labrador baumelte an einem dicken, niedrigen Ast. Irgendjemand hatte seine Lederleine um den Ast gewickelt, das Tier hochgezogen und so stranguliert. Noch immer tropfte Speichel von der dicken Zunge, die ihm schlaff aus dem Maul hing. Träge bewegte sich der Hund im Wind und ließ den Ast knacken, während sein langer Schatten über die Lichtung tanzte. Obwohl er auf solch eine grausame Art gestorben war, wirkte er immer noch wild und bösartig.
Inzwischen war es noch einmal deutlich kälter geworden, und plötzlich fielen die ersten Schneeflocken. Ich schaute den Hügel hinunter zu den Dächern des Dorfs. Nicht mehr lange, und jeder dort unten würde wissen, was hier oben passiert war. Solche Dinge sprachen sich rasch herum. Einige würden sagen, Frank Hurst habe nur bekommen, was er verdient habe. Da war ich mir sicher. Und da niemand gesehen hatte, wie grausam das alles in Wirklichkeit war, würden sie zufrieden ihren Tee trinken, ihre Frühstückseier essen und ihre verschlafenen Kinder zur Schule scheuchen. Ja, die Dörfler würden froh sein, dass Frank Hurst nicht mehr unter ihnen war … zumindest einige von ihnen.
Ich stand in der Kälte und erinnerte mich plötzlich an etwas Seltsames: die verbogene, leicht verrostete Haarklammer eines Mädchens neben Hursts Swimmingpool. Ich erinnerte mich daran, wie ich sie aufgehoben und in der Hand gehalten hatte. Und wie sich meine Faust darum geschlossen und ich über die Mädchen nachgedacht hatte, während Hursts Haus groß und stumm hinter mir gelegen hatte.
Schließlich kehrte ich wieder zu Brewin zurück und stellte mir den kurzen, stummen Kampf vor, bevor Hurst hier oben auf Meon Hill seinen letzten Atemzug getan hatte. Wie immer war es der absurde Anblick der Leiche, der mich am meisten traf, die Hässlichkeit von Frank Hurst, den man mit einer Mistgabel an diesen Hügel genagelt hatte. Dieser eine Moment würde Hursts Andenken bestimmen. Alles andere würde man vergessen. Nur so würde man sich an ihn erinnern. So war das nun einmal, wenn man Opfer eines Mordes geworden war.
KAPITEL FÜNF
Douglas, Irwin und die Constables standen zusammen mit ein paar anderen Beamten, die Graves nicht kannte, auf dem Dorfplatz. Ihre Fahrzeuge parkten vor den Geschäften am Rand. Es schneite. Die Schatten der Autos bildeten breite Streifen auf der Straße, während es im Hinterhof eines kleinen Supermarkts geschäftig rumpelte. Dort wurde gerade ein Kleinlaster entladen. Eingeklemmt zwischen dem Supermarkt und einer Bäckerei lag die kleine Post. Die matronenhafte Besitzerin stand in der Tür und starrte die Beamten missbilligend an. Im Dorf herrschte helle Aufregung. Überall brannte Licht in den Cottages und Häusern. Kinder, die sich normalerweise über den Schnee gefreut hätten, waren nun vorsichtig und wurden von ihren Eltern an der Hand zu der kleinen Schule am Dorfrand gebracht.
Graves stand neben seinem Wagen. Er hatte an einer alten Telefonzelle geparkt und beobachtete die vorbeikommenden Fahrzeuge. Ein stämmiger Constable wuchtete sich keuchend aus dem Fahrersitz und schlug die Tür zu, während ein mürrischer, alter Mann das Treiben auf dem Platz von der anderen Straßenseite aus beobachtete. Einer der Männer rief nach einer Taschenlampe, doch die meisten Beamten sagten kein Wort, als sie sich auf dem Platz versammelten.
Downes stapfte bereits auf sie zu. Seine Schritte hallten von den Häusern wider. Als er den Blick hob und seine Kollegen sah, schien er die Kälte zu vergessen, und sein Schritt wurde entschlossener. Die Männer traten von einem Fuß auf den anderen und rückten zusammen. Ein Constable ging auf Graves zu, wobei er den Blick misstrauisch auf Downes gerichtet hielt.
»Oh Gott«, sagte er und schüttelte den Kopf.
Graves schaute ihn an. Der Mann stand kurz vor der Pension, war aber immer noch kräftig gebaut. Als eine Schneeflocke auf seinen breiten Schädel fiel, zuckte er unwillkürlich zusammen.
»Sie sind also sein neuer Sergeant, ja?«
Graves nickte.
»Mein Name ist Drayton«, stellte sich der Mann vor und schaute Graves mit unverhohlenem Mitleid an. Dann wandte er sich wieder ab. »Und das ausgerechnet an Ihrem ersten Tag«, sagte er und strich mit der flachen Hand über Graves’ neuen Wagen, als würde er ihm gehören. »Die nächsten Tage kommen wir hier nicht mehr weg«, seufzte er. »Und das in der Kälte. Und Weihnachten? Weihnachten können Sie vergessen.«
Graves zuckte mit den Schultern. Weihnachten hatte ihn ohnehin nie interessiert.
Als Downes den Platz betrat, schaute Drayton ihn verärgert an. Downes blieb erst einmal stehen, und es sah aus, als müsse er sich zunächst kurz von der Kälte erholen.
»Dieser verdammte Shotgun«, knurrte Drayton leise. »Er ist auf dem Kriegspfad. Davor haben die Jungs mich schon gewarnt. Oh Gott.«
»Natürlich ist er auf dem Kriegspfad«, erwiderte Graves und nickte zu dem Hügel hinter dem Dorf. »Was haben Sie denn gedacht?«
Drayton ließ sich mit der Antwort Zeit. »Es war doch Frank Hurst, oder?«, fragte er schließlich.
»Kannten Sie ihn?«
»Nein, aber ich habe von ihm gehört«, antwortete Drayton und wandte sich ab.