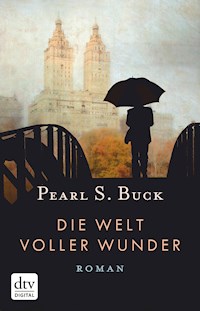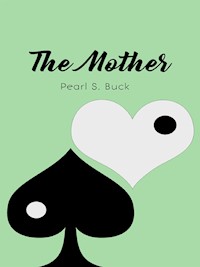4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie ist die einzige Frau in der Verbotenen Stadt, die es wagt, dem Kaiser direkt in die Augen zu schauen. Und sie ist es, die ihm schließlich den ersehnten Thronfolger schenkt. Mit Klugheit und Tatkraft gelingt es dem einfachen Bürgermädchen Tsu Hsi, von der kaiserlichen Konkubine zur Herrscherin über ein Weltreich emporzusteigen. Um den Preis ihrer einzigen und ersten Liebe, der Liebe zu ihrem Vetter Jung Lu … Die Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck hat aus dem Leben der Kaiserin Tsu Hsi ein atemberaubendes Panorama des alten China geschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Mit Klugheit und Tatkraft gelingt es dem einfachen Bürgermädchen Tsu Hsi, von der kaiserlichen Konkubine zur Herrscherin über ein Weltreich emporzusteigen – um den Preis ihrer einzigen und ersten Liebe. Die Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck hat aus dem Leben der Kaiserin Tsu Hsi ein atemberaubendes Panorama des alten China geschaffen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Pearl S. Buck (1892–1973) stammte von holländischen und deutschen Vorfahren ab. Ihre Eltern zogen mit ihr von den USA nach China, wo sie vierzig Jahre ihres Lebens verbrachte. Von 1922 bis 1932 arbeitete sie als Literaturprofessorin. 1938 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen.
Zur Webseite von Pearl S. Buck.
Hans B. Wagenseil (1894–1975) war im Ersten Weltkrieg wegen Kriegsdienstverweigerung inhaftiert. Er arbeitete als Autor und Übersetzer angelsächsischer Literatur.
Zur Webseite von Hans B. Wagenseil.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Pearl S. Buck
Das Mädchen Orchidee
Roman
Aus dem Englischen von Hans B. Wagenseil
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1956 unter dem Titel Imperial Woman bei J. Day Co, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1956 bei Desch, München.
Originaltitel: Imperial Woman (1956)
© 1956 by Pearl S. Buck
Copyright renewed 1984 by Janine C. Welsh, Henriette Welsh Wilson, Chieko Singer, Jean C. Lippincott, Carol Welsh Buck, Edgar Welsh, John S. Welsh and Richard S. Welsh
© für die deutsche Übersetzung: Langen Müller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: szefei
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30624-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 03:59h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS MÄDCHEN ORCHIDEE
VorwortI — YehonalaII — Tsu HsiIII — Die KaiserinmutterIV — Die KaiserinV — Der alte BuddhaMehr über dieses Buch
Über Pearl S. Buck
Über Hans B. Wagenseil
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Schmöker
Zum Thema China
Zum Thema Frau
Zum Thema Asien
Zum Thema Geschichte
Vorwort
Tsu Hsi, die letzte regierende Kaiserin von China, war eine so reich und verschiedenartig begabte Frau, eine so widerspruchsvolle, aber auch so vielseitige Persönlichkeit, dass es schwer ist, sie ganz zu verstehen. Sie lebte an einem Wendepunkt der Geschichte, als China sich gegen fremde Eingriffe zur Wehr setzen musste; während gleichzeitig Reformen unabweislich waren. In dieser Zeit bewahrte Tsu Hsi ihre konservative Gesinnung und ihre Unabhängigkeit. Ihre Gegner fürchteten und hassten sie, und sie waren beredter als die Freunde und Verehrer Tsu Hsis. Westliche Schriftsteller lassen sie, mit wenigen Ausnahmen, in ungünstigem Lichte erscheinen, ja manche ihrer Schilderungen sind sogar gehässig.
Ich habe versucht, in diesem Buche ein möglichst genaues Bild von Tsu Hsi zu entwerfen, und zwar sowohl nach den zur Verfügung stehenden geschichtlichen Quellen wie auch nach den Urteilen vieler Chinesen, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Für diese Chinesen war sie die große Kaiserin. Gute und böse Eigenschaften vereinten sich in ihr, aber immer in heroischem Ausmaße. Sie widersetzte sich den Neuerungen, solange sie konnte, denn sie hielt das Alte für besser als das Neue. Doch wenn sie sah, dass Änderungen unvermeidbar waren, fügte sie sich ihnen gutwillig.
Ihr Volk liebte sie, außer den Revolutionären und den Ungeduldigen, denen die Fortschritte zu langsam gingen. Diese hassten sie, und ihr Hass wurde von der Kaiserin ebenso gründlich erwidert. Die Bauern und Kleinstädter verehrten sie. Jahrzehnte nach ihrem Tode kam ich im Inneren Chinas in Dörfer, wo die Leute sie noch am Leben glaubten und erschraken, als sie hörten, dass sie tot war. »Wer wird sich jetzt unser annehmen?«, riefen sie.
Dies ist wohl das entscheidende Urteil über einen Herrscher.
I
Yehonala
Es war der vierte Monat des Sonnenjahres 1852, der dritte Monat des Mondjahres, das zweihundertachte Jahr der Mandschu-, der großen Tsching-Dynastie, und April in der Stadt Peking. Der Frühling ließ auf sich warten. Die Nordwinde, die aus der Wüste Gobi Wolken feinen gelben Sandes nach Süden führten, bliesen so kalt wie im Winter über die Hausdächer. Der Sand trieb wie Staubwirbel durch die Straßen und sickerte durch Türen und Fenster, häufte sich in Ecken, lag auf Tischen, Stühlen und in den Falten der Kleider, er verkrustete die Gesichter der Kinder, wenn sie weinten, und setzte sich in den Runzeln alter Leute fest.
Im Hause des Mandschu-Bannermanns Muyanga in der Zinngasse war der Sand noch lästiger als gewöhnlich, denn die Fenster schlossen nicht dicht, und die Türen hingen lose in ihren hölzernen Angeln. An diesem besonderen Morgen erwachte Orchidee, seine Nichte, das älteste Kind seines verstorbenen Bruders, durch das Geräusch des Windes und des knarrenden Holzes. Sie setzte sich auf in dem großen chinesischen Bett, das sie mit ihrer jüngeren Schwester teilte, und verzog das Gesicht, als sie den Sand wie gefärbten Schnee auf der roten Bettdecke liegen sah. Gleich darauf kroch sie vorsichtig aus dem Bett, um die noch schlafende Schwester nicht zu wecken. Unter den bloßen Füßen fühlte sie den Sand auf dem Boden und seufzte. Erst gestern hatte sie das Haus rein gefegt, und die ganze Arbeit musste nun von Neuem getan werden, sobald der Wind sich gelegt hatte.
Sie war ein hübsches Mädchen, diese Orchidee. Durch ihre Schlankheit und aufrechte Haltung erschien sie größer, als sie war. Sie hatte stark ausgeprägte, aber keine groben Gesichtszüge, eine gerade Nase, schön abgesetzte Augenbrauen, einen wohlgeformten und nicht zu kleinen Mund. Ihre große Schönheit lag in ihren Augen. Sie waren lang, groß und außergewöhnlich klar, das Weiße und das Schwarze war fein säuberlich getrennt. Doch diese Schönheit hätte bedeutungslos sein können, wenn ihre Natürlichkeit und Intelligenz nicht ihr ganzes Wesen belebt hätten. Obschon sie noch sehr jung war, hatte sie sich fest in der Gewalt. Ihre Kraft zeigte sich in der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen und in der ruhigen Gesetztheit ihres Auftretens.
In dem sandgrauen Licht des Morgens zog sie sich schnell und geräuschlos an. Sie schob die blauen Baumwollvorhänge, die als Tür dienten, beiseite, ging in das große Zimmer und von dort in die anstoßende kleine Küche. Aus dem großen Eisenkessel, der in den irdenen Ofen eingelassen war, stieg Dampf auf.
»Lu Ma«, grüßte sie die Dienstfrau, »du bist heute schon früh an der Arbeit.« Sie sprach absichtlich leise. Ihre schöne Stimme hatte etwas äußerst Reizvolles an sich, auch in ihr kam ihre Selbstbeherrschung zum Ausdruck.
Hinter dem Ofen erwiderte eine rasselnde Stimme: »Ich konnte nicht schlafen, junge Herrin. Was sollen wir tun, wenn du von uns gehst?«
Orchidee lächelte. »Du weißt ja noch gar nicht, ob mich die Kaiserinwitwe erwählt. Meine Kusine Sakota ist weit hübscher als ich.«
Sie blickte hinter den Ofen. Lu Ma hockte dort und stopfte trockene Grasbüschel in das Feuer, und zwar so, dass möglichst jeder Halm des knappen Brennmaterials voll ausgenützt wurde.
»Dich wird man erwählen.« Die alte Frau sagte das in einem bestimmten, aber traurigen Ton. Als sie sich jetzt aufrichtete, sah sie sehr elend aus, eine kleine bucklige Chinesin in einem verblichenen und geflickten Baumwollkleid; die gebundenen Füße waren nur noch Stummel, die braunen Runzeln ihres eingesunkenen Gesichts waren durch den eingedrungenen Sand deutlich abgezeichnet. Sand lag auch auf ihrem grauen Haar, überzog ihre Augenbrauen und den Rand ihrer Oberlippe wie mit Reif.
»Dieses Haus kann ohne dich nicht bestehen«, ächzte sie. »Zweite Schwester kann nicht einmal einen Saum nähen, weil du immer alles für sie getan hast. Und die beiden Jungen, deine Brüder, verschleißen jeden Monat ein Paar Schuhe. Was soll aus deinem Verwandten Jung Lu werden? Bist du nicht seit Kindesbeinen mit ihm so gut wie verlobt?«
»Ja, man könnte wohl sagen, wir sind verlobt«, erwiderte Orchidee mit ihrer schönen Stimme. Sie nahm ein Waschbecken vom Tisch und einen eisernen Löffel von der Ofenplatte und schöpfte aus dem Kessel heißes Wasser. Dann zog sie ein kleines graues Handtuch von der Wand, tauchte es in das Wasser, wrang es dampfheiß trocken und rieb sich damit Gesicht und Hals, Handgelenke und Hände ab. Ihr glattes ovales Gesicht wurde von der feuchten Wärme rot. Sie sah in den kleinen Spiegel, der über dem Tisch hing. Sie sah darin nur ihre außerordentlichen, lebhaften dunklen Augen. Sie war auf ihre Augen stolz, aber sie hütete sich sorgfältig, jemals eine Spur von diesem Gefühl zu zeigen. Wenn Frauen aus der Nachbarschaft von ihren nachtfaltergleichen Brauen und ihren blattförmigen Augen sprachen, tat sie, als hörte sie das nicht, aber sie hörte es doch.
Die Alte betrachtete sie. »Ah, ich habe immer gesagt, dass du eine große Zukunft hast. Man sieht sie in deinen Augen. Wir müssen dem Kaiser, dem Sohn des Himmels, gehorchen, und wenn du Kaiserin bist, mein Täubchen, wirst du an uns denken und uns helfen.«
Orchidee lachte leise. »Ich werde ja nur eine Konkubine werden, eine von Hunderten.«
»Du wirst werden, wozu dich der Himmel bestimmt«, erklärte die Alte. Sie wrang das Handtuch ganz trocken und hängte es an seinen Nagel. Dann brachte sie das Waschbecken nach draußen und goss das Wasser vorsichtig aus.
»Kämme dir die Haare, junge Herrin. Jung Lu wird bald kommen. Er sagte mir, es könnte sein, dass er dir heute die goldene Vorladung bringt.«
Orchidee sagte nichts darauf, sondern ging anmutig wie immer in ihr Schlafzimmer. Sie sah, dass ihre Schwester noch schlief. Sie war so schlank, dass man unter der Decke kaum ihre Gestalt sah. Ruhig löste sie ihr langes schwarzes Haar, kämmte es mit einem chinesischen Holzkamm und parfümierte es mit wohlriechendem Zimtbaumöl. Dann legte sie ihr Haar in zwei Zöpfen über die Ohren, und in jeden Zopf steckte sie eine kleine Blume aus Staubperlen, die mit Blättern aus dünnem grünem Nephrit eingefasst war.
Sie war noch nicht ganz fertig, da hörte sie die Schritte ihres Verwandten Jung Lu im anstoßenden Zimmer und dann seine Stimme, die selbst für eine Männerstimme sehr tief klang. Er fragte nach ihr. Zum ersten Mal in ihrem Leben ging sie ihm nicht gleich entgegen. Sie war ein Mandschu-Mädchen, und Gesetz und Sitte des alten China, die ein Zusammentreffen der Geschlechter nach Erreichung des siebenten Lebensjahres verboten, hatten die beiden nicht gehindert, sich dann und wann zu sehen. Sie waren in ihrer Kindheit Spielkameraden gewesen und hatten später als Vetter und Kusine freundschaftlich miteinander verkehrt. Er gehörte jetzt dem Garderegiment an, das die Tore der Verbotenen Stadt bewachte, und deshalb kam er jetzt nicht oft in Muyangas Haus. Aber an Feiertagen und Geburtstagsfesten fehlte er nie, und an dem chinesischen Fest Frühlings-Erwachen vor zwei Monaten hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht.
An jenem Tag hatte sie weder abgelehnt noch zugestimmt. Sie hatte mit ihrem bezaubernden Lächeln gesagt: »Du musst nicht mit mir, sondern mit meinem Onkel darüber sprechen.«
»Wir sind Vetter und Kusine«, entschuldigte er sich.
»Im dritten Grade«, hatte sie erwidert.
So hatte sie weder Ja noch Nein gesagt. Jetzt dachte sie daran, was sich an jenem Tag ereignet hatte, ja, bei allem, was sie tat, war es ihr immer in Erinnerung. Sie schob den Vorhang zurück. Groß und festgewurzelt, die Füße in geziemendem Abstand, stand er im Zimmer. An jedem anderen Tag hätte er seine Mütze aus rotem Fuchsfell und vielleicht sogar seinen Mantel abgenommen, aber heute stand er da, als wäre er ein Fremder, in der Hand ein in gelbe Seide eingewickeltes Päckchen. Sie sah es sofort, und er merkte es natürlich. Wie immer, errieten sie gegenseitig ihre Gedanken.
»Du erkennst die kaiserliche Vorladung«, sagte er.
»Da müsste man schön dumm sein, wenn man die nicht erkennen würde«, antwortete sie.
Sie hatten nie formelle Redensarten gebraucht oder höfliche Floskeln gewechselt. Sie kannten sich zu gut.
Er sah sie unverwandt an und fragte: »Ist mein Onkel Muyanga schon auf?«
Auch sie sah ihn an und erwiderte: »Du weißt, dass er nie vor Mittag aufsteht.«
»Heute muss er aufstehen«, entgegnete Jung Lu, »ich benötige seine Empfangsbestätigung, da er dein Vormund ist.«
Sie drehte den Kopf und rief: »Lu Ma, wecke meinen Onkel! Jung Lu ist hier und muss seine Unterschrift haben, bevor er zum Palast zurückkehrt.«
»Ja, ja«, seufzte die alte Frau.
Orchidee streckte die Hand aus. »Lass mich das Päckchen sehen.« Jung Lu schüttelte den Kopf. »Es ist für Muyanga.«
Sie ließ die Hand sinken. »Aber ich weiß, was es besagt. Ich muss heute in neun Tagen mit meiner Kusine Sakota in den Palast kommen.«
Unter den schweren Brauen blickten sie seine schwarzen Augen finster an.
»Woher weißt du das?«
Sie sah ihn nicht mehr an. Ihre länglichen Augen waren unter den geraden schwarzen Wimpern halb verborgen. »Die Chinesen wissen alles. Gestern sah ich auf der Straße Wanderschauspielern zu. Sie spielten: Die Konkubine des Kaisers, ein altes Stück, aber sie machten es neu. Im sechsten Monat, am zwanzigsten Tag, so erfuhr ich aus dem Stück, müssen die Mandschu-Jungfrauen vor der Kaiserinmutter und dem Himmelssohn erscheinen. Wie viele von uns sind es in diesem Jahr?«
»Sechzig«, sagte er.
Sie hob ihre langen schwarzen Wimpern von ihren schwarz-weißen Onyxaugen. »Ich bin also eine von sechzig?«
»Ich zweifle nicht, dass du schließlich die Erste sein wirst«, meinte er.
Seine tiefe, ruhige Stimme drang ihr mit prophetischer Kraft ins Herz.
»Wo ich bin, wirst auch du sein. Darauf werde ich bestehen. Bist du nicht mein Verwandter?«
Sie blickte ihn wieder an und vergaß im Augenblick alles, außer sich selbst. Er sagte förmlich, als hätte er ihre Worte überhört: »Ich bin mit der Absicht gekommen, deinen Vormund zu bitten, dich mir zur Frau zu geben. Jetzt weiß ich nicht, was er tun wird.«
»Kann er die kaiserliche Aufforderung ablehnen?«, fragte sie.
Sie blickte von ihm weg und ging dann mit besonderer Anmut und Geschmeidigkeit zu dem langen Rosenholztisch, der an der inneren Wand des Zimmers stand. Zwischen zwei hohen Messingleuchtern blühten unter dem Bild des heiligen Berges Wu Tai in einem Topf gelbe Orchideen.
»Sie haben sich heute Morgen geöffnet – die kaiserliche Farbe. Es ist ein Omen«, murmelte sie.
Ihre schwarzen Augen blitzten zornig auf, als sie sich ihm wieder zuwendete. »Ist es nicht deine Pflicht, dem Kaiser zu dienen, wenn ich erwählt werde?« Wieder blickte sie von ihm weg, und ihre Stimme wurde wieder sanft, wie sie gewöhnlich war. »Wenn ich nicht erwählt werde, erhältst du mich bestimmt zur Frau.«
Lu Ma kam herein. Sie blickte von dem einen jungen Gesicht zum anderen. »Dein Onkel ist jetzt wach, junge Herrin. Er will im Bett frühstücken. Inzwischen soll dein Verwandter hineinkommen.«
Dann ging sie wieder fort. Man hörte sie in der Küche mit dem Geschirr klappern. Das Haus erwachte jetzt zum Leben. Bei der Hoftür draußen stritten sich die beiden Jungen. Aus dem Schlafzimmer hörte Orchidee das klägliche Rufen ihrer Schwester.
»Orchidee – ältere Schwester! Ach, ich habe Kopfschmerzen.«
»Orchidee.« Jung Lu wiederholte den Namen. »Dieser Name ist jetzt zu kindisch für dich.«
Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Ich heiße immer noch so! Und warum gehst du nicht, tu deine Pflicht, und ich werde die meine tun.«
Dann wandte sie sich schnell um. Er sah ihr nach, als sie den Vorhang beiseitezog und ihn hinter sich niederfallen ließ.
Aber während dieses kurzen Streites hatte sie ihren Entschluss gefasst. Sie würde in den Kaiserpalast gehen. Die Wahl würde – musste – auf sie fallen. So beendete sie in einem Augenblick die Unschlüssigkeit, in der sie so lange gelebt hatte. Sollte sie Jung Lus Frau werden, die Mutter seiner Kinder – sie würden viele Kinder haben, denn sie waren beide leidenschaftlich –, oder sollte sie eine Konkubine des Kaisers werden? Er liebte nur sie, und sie liebte ihn – und noch etwas mehr.
Am einundzwanzigsten Tage des sechsten Monats erwachte sie im Winterpalast der Kaiserstadt. Der Gedanke, mit dem sie am Abend eingeschlafen war, beschäftigte sie jetzt wieder.
»Ich bin innerhalb der vier Mauern der Kaiserstadt.«
Die Nacht war vorüber. Endlich war der große und wichtige Tag da, auf den sie seit ihrer frühen Kindheit, seit Sakotas ältere Schwester ihr Haus für immer verlassen hatte, um eine Konkubine des Kaisers zu werden, im Geheimen gewartet hatte. Jene Schwester war gestorben, bevor sie Kaiserin hätte werden können, und kein Angehöriger ihrer Familie hatte sie jemals wiedergesehen. Aber sie, Orchidee, würde leben …
»Halte dich von den anderen abseits«, hatte ihre Mutter gestern gesagt. »Unter den Jungfrauen bist du nur eine von vielen. Sakota ist eine kleine zierliche Schönheit, und da sie die jüngere Schwester der toten Prinzessin ist, wird sie dir sicher vorgezogen werden. Aber was für einen Platz du auch erhältst, du kannst dich über ihn hinausheben.«
Anstatt liebevoller Abschiedsworte hatte ihre Mutter, die eine ernste Frau war, ihr diesen Rat mit auf den Weg gegeben, und Orchidee hatte ihn wohl beherzigt. Ihre Augen wurden nicht feucht, als sie in der Nacht andere weinen hörte, die sich fürchteten, vom Kaiser erwählt zu werden. Denn wenn die Wahl auf sie fiel, das hatte ihre Mutter ihr ganz klar gesagt, würde sie vielleicht nie ihr Haus und ihre Familie wiedersehen, ja, sie könnte nicht einmal zu Besuch nach Hause kommen, ehe sie nicht einundzwanzig Jahre alt wäre. Zwischen siebzehn und einundzwanzig lagen vier einsame Jahre. Aber musste sie denn einsam sein? Wenn sie an Jung Lu dachte, wäre sie es allerdings, aber sie dachte auch an den Kaiser.
In der letzten Nacht, die sie zu Hause zubrachte, hatte sie vor Aufregung nicht schlafen können. Auch Sakota war wach geblieben. In der Stille hatte Orchidee Schritte gehört und auch erkannt, wer da umhertappte.
»Sakota!«, hatte sie gerufen. In der Dunkelheit hatte sie die weiche Hand ihrer Kusine auf dem Gesicht gefühlt.
»Orchidee, ich hatte Angst. Lass mich zu dir ins Bett.«
Sie schob ihre jüngere Schwester, die im Schlaf wie ein Klotz im Bett lag, beiseite und machte für ihre Kusine Platz. Sakota kroch zu ihr. Ihre Hände und Füße waren kalt, sie zitterte.
»Hast du keine Angst?«, flüsterte Sakota und schmiegte sich unter der Decke an den warmen Körper ihrer Kusine.
»Nein«, sagte Orchidee. »Was kann mir geschehen? Und warum solltest du Angst haben, war doch deine ältere Schwester des Kaisers Erwählte?«
»Sie ist im Palast gestorben«, flüsterte Sakota. »Sie fühlte sich dort nicht glücklich – sie war krank vor Heimweh. Vielleicht muss auch ich sterben.«
»Ich werde dort bei dir sein«, sagte Orchidee. Sie schlang ihre starken Arme um den zarten Körper. Sakota war immer zu mager und zu zart, nie hungrig, nie stark.
»Wenn wir aber nicht in dieselbe Klasse kommen?«, hatte Sakota gefragt.
Und so war es geschehen. Sie waren getrennt worden. Als die Mädchen zum ersten Mal der Mutter des Himmelssohnes vorgeführt wurden, wählte diese achtundzwanzig aus. Weil Sakota die Schwester der verstorbenen Prinzessin war, wurde sie in die F’ei, in die erste Klasse, aufgenommen, während Orchidee zu den Kuei Jen, der dritten Klasse, kam.
»Sie ist von heftiger Gemütsart«, sagte die erfahrene Kaiserinwitwe, als sie Orchidee betrachtete. »Sonst würde ich sie in die zweite Klasse, die P’in, einreihen, denn es ist nicht angebracht, sie mit ihrer Kusine, der Schwester meiner Schwiegertochter, die zu den Gelben Quellen gegangen ist, in die erste Klasse zu tun. Sie soll in die dritte Klasse kommen, denn es ist besser, wenn mein Sohn, der Kaiser, sie nicht bemerkt.«
Orchidee hatte scheinbar sittsam und ergeben dieser Rede zugehört. Jetzt, da sie nur der dritten Klasse angehörte, erinnerte sie sich an die Abschiedsworte ihrer Mutter.
Durch den Schlafsaal drang die Stimme der ersten Kammerfrau, deren Aufgabe es war, die Jungfrauen auf die Vorstellung vorzubereiten.
»Meine jungen Damen, es ist Zeit zum Aufstehen. Es ist Zeit, sich schön zu machen. Heute ist euer Glückstag.«
Die anderen erhoben sich auf diese Mahnung hin sofort, nur Orchidee nicht. Sie wollte nicht dasselbe tun, was die anderen taten. Sie wollte für sich bleiben, abseitsstehen. Sie rührte sich nicht, lag fast ganz verborgen unter der seidenen Steppdecke und beobachtete, wie die jungen Mädchen unter den Händen der Dienerinnen, die sich ihrer annahmen, zitterten. Die Morgenluft war kühl, der nördliche Sommer hatte kaum begonnen, und aus den flachen, mit heißem Wasser gefüllten Holzkübeln stieg der Dampf wie Nebel auf.
»Alle müssen baden«, befahl die erste Kammerfrau. Sie saß dick und streng, an Gehorsam gewöhnt, in einem großen Bambussessel.
Die Mädchen stiegen jetzt nackt in die Kübel. Die Dienerinnen rieben ihnen den Körper mit parfümierter Seife ein und wuschen sie mit weichen Tüchern, während die erste Kammerfrau sich jede Einzelne ansah. Plötzlich rief sie: »Von den sechzig wurden achtundzwanzig auserwählt, ich zähle nur siebenundzwanzig.« Sie sah auf den Bogen Papier, den sie in der Hand hielt, und rief die Mädchen namentlich auf. Jede antwortete von ihrem Standort aus. Aber die Letzte gab keine Antwort.
»Yehonala!«, rief die alte Kammerfrau noch einmal.
Das war Orchidees Sippenname. Bevor sie gestern das Haus verlassen hatte, hatte ihr Onkel und Vormund Muyanga sie in sein Zimmer gerufen, um ihr einen väterlichen Rat zu geben.
Sie hatte vor ihm gestanden, während er in einem Lehnsessel saß, der fast überquoll von seinem großen, in himmelblauen Satin gekleideten Körper. Sie war immer gut mit ihm ausgekommen, denn er war von nachlässiger Güte, aber sie liebte ihn nicht, denn auch er liebte niemanden. Er war zu faul, um lieben oder hassen zu können. »Jetzt, da du die Stadt des Kaisers betreten wirst«, sagte er mit seiner öligen Stimme, »musst du deinen Kindernamen Orchidee aufgeben. Von heute an heißt du Yehonala.«
»Yehonala!« Wieder rief die Kammerfrau den Namen, aber Orchidee gab noch immer keine Antwort. Sie schloss die Augen und tat so, als ob sie schliefe.
»Ist Yehonala entwischt?«, wollte die Kammerfrau wissen. Eine Dienerin antwortete: »Herrin, sie liegt im Bett.«
Die erste Kammerfrau war entsetzt. »Was! Noch im Bett? Und sie kann schlafen?«
Die Dienerin trat ans Bett und schaute nach. »Sie schläft.«
»Sie hat ein Herz von Stein!«, rief die alte Kammerfrau. »Weck sie auf! Zieh ihr die Decke weg! Kneif sie in die Arme!«
Die Dienerin gehorchte. Yehonala tat so, als wachte sie gerade auf. Sie öffnete die Augen. »Was soll das heißen?«, fragte sie schläfrig. Sie setzte sich auf, fasste sich an die Wangen. »Oh … oh!«, stammelte sie mit taubensanfter Stimme. »Wie konnte ich das nur vergessen!«
»Ja, wie konntest du!«, sagte die erste Kammerfrau entrüstet. »Weißt du nichts von dem Befehl der Kaiserin? In zwei Stunden müsst ihr alle im Audienzsaal stehen, jede muss sich von der besten Seite zeigen – in zwei Stunden, sage ich, müsst ihr gebadet, parfümiert und angezogen sein, die Haare müssen geölt werden, und frühstücken müsst ihr auch noch.«
Yehonala gähnte hinter ihrer Hand. »Wie herrlich ich geschlafen habe! Die Matratze ist hier viel weicher als bei mir zu Hause.« Die alte Kammerfrau schnaubte: »Man kann sich kaum vorstellen, dass eine Matratze im Palast des Himmelssohnes so hart wäre wie dein Bett.«
»Viel weicher, als ich dachte«, sagte Yehonala.
Mit nackten kräftigen Füßen trat sie auf die Bodenfliesen. Die Mädchen waren alle Mandschus und keine Chinesinnen, und ihre Füße waren daher nicht gebunden.
»Vorwärts, vorwärts!«, rief die Kammerfrau. »Beeile dich, Yehonala. Die anderen sind schon fast angezogen.«
»Ja, Ehrwürdige.«
Aber sie hatte es gar nicht eilig. Sie ließ sich von einer Dienerin auskleiden und gab sich nicht die geringste Mühe, dieser zu helfen. Als sie nackt war, trat sie in den flachen Kübel mit heißem Wasser und rührte keine Hand, um sich zu waschen. »Du!«, fauchte die Dienerin leise. »Willst du mir nicht helfen, dich fertig zu machen?«
Yehonala schlug ihre großen schwarzen, glänzenden Augen auf.
»Was soll ich tun?«, fragte sie hilflos.
Niemand sollte merken, dass sie zu Hause nur eine Dienerin hatten, Lu Ma, die Küchenmagd. Sie hatte nicht nur immer sich selbst gebadet, sondern auch ihre jüngere Schwester und ihre Brüder. Sie hatte deren Kleider mit ihren eigenen gewaschen und sie als Babys auf ihrem Rücken getragen, wo sie mit breiten Tuchstreifen festgebunden wurden, während sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit half und sogar oft mit den Kindern auf dem Rücken in den Ölladen und auf den Gemüsemarkt lief. Ihr einziges Vergnügen war, auf der Straße einem Trupp umherziehender chinesischer Schauspieler zuzuhören. Ihr guter Onkel Muyanga ließ sie wohl mit seinen eigenen Kindern von dem Hauslehrer unterrichten, aber die Summe, die er ihrer Mutter für Essen und Kleidung gab, reichte nicht für Luxusausgaben.
Die Dienerin hatte auf die Frage keine Antwort gegeben. Dazu war keine Zeit mehr. Die erste Kammerfrau drängte zur Eile.
»Es ist am besten, wenn sie jetzt etwas essen«, erklärte sie. »Die Zeit, die dann noch verbleibt, kann auf ihre Frisur verwendet werden. Wir brauchen mindestens eine Stunde, um sie ordentlich zu frisieren.«
Die Küchenmädchen brachten das Frühstück, aber die jungen Mädchen konnten nichts essen. Sie hatten alle starkes Herzklopfen, einige weinten wieder.
Die erste Kammerfrau wurde wütend. Ihre tiefe Stimme schwoll zu einem Brüllen an: »Was weint ihr denn? Kann es ein größeres Glück geben, als vom Sohn des Himmels erwählt zu werden?«
Aber nun weinten die Mädchen erst recht. »Ich möchte lieber daheim sein«, schluchzte eine. »Ich will gar nicht erwählt werden«, wimmerte eine andere.
»Schändlich, schändlich!«, rief die alte Kammerfrau und fletschte die Zähne nach diesen verrückten Mädchen.
In einem solchen Wehklagen wurde Yehonala nur noch ruhiger. Mit vollkommener Anmut machte sie Schritt für Schritt der ganzen Prozedur durch, und als das Frühstück gebracht wurde, setzte sie sich zu Tisch und aß nach Herzenslust. Selbst die Kammerfrau war überrascht und wusste nicht, ob sie entrüstet oder entzückt sein sollte.
»Ein so hartes Herz habe ich wahrhaftig noch nicht gesehen«, sagte sie laut. Yehonala lächelte, die Essstäbchen in der rechten Hand. »Dieses gute Essen schmeckt mir«, sagte sie mit lieblicher Kinderstimme. »So gut habe ich daheim nicht gegessen.«
Die Kammerfrau entschloss sich, entzückt zu sein. »Du bist ein vernünftiges Mädchen«, verkündete sie. Aber nach einer Weile flüsterte sie einer Dienerin zu: »Schau nur, wie große Augen sie hat! Die hat ein wildes Herz –«
Die Dienerin verzog das Gesicht. »Ein Tigerherz«, stimmte sie zu, »wahrhaftig, ein Tigerherz.«
Als sie gefrühstückt hatten, kamen die Eunuchen, angeführt von dem Obereunuch An Teh-hai. Er hatte eine noch jugendliche Gestalt und trug ein blassblaues Satinkleid, das in der Mitte mit einer rotseidenen Schärpe gegürtet war: Sein Gesicht war glatt und breit, die Nase leicht gekrümmt, die Augen schwarz, der Blick stolz.
Ziemlich unbekümmert gab er den Jungfrauen den Befehl, an ihm vorbeizugehen, und zu diesem Zweck nahm er wie ein kleiner Kaiser in einem großen geschnitzten Rosenholzsessel Platz und sah sich jede genau an, die vorbeiging, wobei er ein ziemlich verächtliches Gesicht machte. Neben ihm auf einem Tisch lagen sein Merkbuch, sein Pinsel und sein Tuschkasten.
Mit halb geschlossenen Augenlidern betrachtete ihn Yehonala. Sie stand abseits von den anderen, halb verborgen hinter dem Türvorhang aus rotem Satin. Der Obereunuch vermerkte mit Pinsel und Tusche den Namen jeder Jungfrau, die an ihm vorbeiging.
»Eine fehlt«, rief er.
»Hier bin ich«, sagte Yehonala. Scheu, mit gesenktem Kopf und abgewandtem Gesicht trat sie vor. Ihre Stimme klang so leise, dass sie kaum zu hören war.
»Die war schon den ganzen Morgen die Letzte«, erklärte die erste Kammerfrau mit ihrer lauten, tiefen Stimme. »Sie schlief noch, als die anderen schon auf waren. Sie wollte sich nicht selbst waschen und anziehen und hat gegessen wie ein Bauernmädchen – drei Schalen Hirse hat sie vertilgt. Jetzt steht sie da, als könnte sie nicht bis fünf zählen. Vielleicht ist sie geistesschwach.«
»Yehonala«, las der Obereunuch mit hoher piepsender Stimme. »Älteste Tochter des verstorbenen Bannermanns Tschao. Vormund: Bannermann Muyanga. Vor zwei Jahren im Nördlichen Palast als Fünfzehnjährige registriert, jetzt siebzehn Jahre alt.«
Er sah auf und betrachtete Yehonala, die mit bescheiden gesenktem Kopf, die Augen, wie der Brauch es verlangte, auf den Boden geheftet, vor ihm stand.
»Bist du dieselbe, die ich soeben verlesen habe?«
»Ja, die bin ich«, sagte Yehonala.
»Weitergehen!«, befahl der Obereunuch. Aber seine Augen folgten ihr. Dann erhob er sich und befahl den Untereunuchen: »Führt die Jungfrauen in die Wartehalle. Wenn der Himmelssohn bereit ist, sie zu empfangen, werde ich sie selbst eine nach der anderen vor den Drachenthron führen und sie vorstellen.«
Vier Stunden warteten die Jungfrauen. Die Dienerinnen waren bei ihnen und schimpften, wenn ein Satinrock zerknittert war oder eine Haarlocke sich gelöst hatte. Dann und wann betupfte eine das Gesicht eines Mädchens mit Puder oder zog ihre Lippen nach. Zweimal durften die Mädchen Tee trinken.
Um Mittag hörten sie in fernen Höfen Hörnerklang und Trommelwirbel, dann wurde im Marschrhythmus ein Gong geschlagen. An Teh-hai, der Obereunuch, betrat mit seinen Untereunuchen wieder die Wartehalle. Unter diesen Eunuchen fiel Yehonala ein großer, hagerer junger Mann auf. Sein Gesicht war hässlich, aber es war so dunkel und raubvogelartig, dass Yehonalas Augen unwillkürlich darauf verweilten. Der Eunuch sah ihren Blick und erwiderte ihn in unverschämter Weise. Sie wandte den Kopf weg.
Der Obereunuch jedoch hatte diesen Blick bemerkt. »Li Lien-ying«, rief er scharf. »Was tust du hier? Habe ich dir nicht gesagt, dass du bei den Mädchen der vierten Klasse, den Tsh’ang Ts’ai, bleiben sollst!«
Ohne ein Wort zu erwidern, verließ der große, junge Eunuch die Halle. Dann hielt der Obereunuch eine Ansprache.
»Meine jungen Damen, Sie werden hier warten, bis Ihre Klasse aufgerufen wird. Zuerst werden die F’ei von der Kaiserinmutter dem Kaiser vorgestellt, dann die P’in. Erst wenn diese gemustert sind und der Kaiser seine Wahl getroffen hat, dürfen die von der dritten Klasse, die Kuei Jen, sich dem Throne nähern. Niemand darf dem Kaiser ins Gesicht sehen. Er schaut Ihnen ins Gesicht.«
Während dieser Ansprache standen die Mädchen mit gesenkten Köpfen da. Yehonala hatte sich ganz hinten aufgestellt, als wäre sie die Bescheidenste von allen, aber ihr Herz klopfte heftig. In den nächsten Stunden, ja vielleicht schon in einer Stunde oder in noch kürzerer Zeit würde der große Augenblick kommen, auf den sie so lange gewartet hatte. Der Kaiser würde sie anschauen, sie abschätzen, ihre Gestalt und Hautfarbe abwägen, und in diesem kleinen Augenblick musste sie ihre ganzen Reize zur Wirkung bringen.
Sie dachte an ihre Kusine Sakota, die sich jetzt gerade den Augen des Kaisers darbot. Sakota war ein liebes, sanftes und kindliches Mädchen. Da sie die Schwester der verstorbenen Prinzessin war, die der Kaiser als Prinz geliebt hatte, war es so gut wie sicher, dass sie erwählt wurde. Das war gut. Yehonala war drei Jahre alt gewesen, als ihre Mutter nach dem Tode des Vaters in ihr Elternhaus zurückgekehrt war, und seit dieser Zeit hatte sie mit Sakota zusammengelebt. Sakota hatte ihr immer nachgegeben, sich an sie gelehnt und ihr vertraut. Sakota könnte sogar dem Kaiser sagen: »Meine Kusine Yehonala ist schön und klug.« Es hatte ihr, als sie in der letzten Nacht zusammen schliefen, auf der Zunge gelegen, sie zu bitten: »Sprich für mich –« Aber ihr Stolz hatte das nicht zugelassen. Obschon Sakota sanft und kindlich war, hatte sie doch die reine Würde eines Kindes, die eine solche Vertraulichkeit verbot.
Ein Murmeln ging durch die Gruppe der wartenden Mädchen. Jemand hatte eine Nachricht aus dem Audienzsaal gehört. Die F’ei waren schon entlassen. Sakota war unter ihnen als erste kaiserliche Konkubine auserwählt worden. Der P’in waren nicht viele. Noch eine Stunde …
Bevor die Stunde um war, kehrte der Obereunuch zurück. »Jetzt kommen die Kuei Jen«, verkündete er. »Stellt euch auf, junge Damen! Der Kaiser wird schon müde.«
Die Mädchen stellten sich in Reih und Glied auf. Die Kammerfrauen sahen noch einmal Haar, Lippen und Augenbrauen nach. Es wurde still, das Lachen hörte auf. Ein Mädchen lehnte sich in einem Ohnmachtsanfall gegen eine Dienerin, die ihr in die Arme und in die Ohrläppchen kniff, um sie wieder zum Bewusstsein zu bringen. Im Audienzsaal rief der Obereunuch bereits Namen und Alter aus. Jede musste sofort eintreten, wenn sie ihren Namen hörte. Eine nach der anderen gingen sie an dem Kaiser und der Kaiserinmutter vorüber. Aber Yehonala verließ als Letzte ihren Platz, um noch einen kleinen Palasthund zu streicheln, der durch die offene Tür gelaufen kam. Es war ein sogenannter Ärmelhund, eines jener winzigen Tierchen, die bald nach der Geburt durch Hunger verzwergt werden, sodass sie in einem bestickten Ärmel Platz haben. An der Tür wartete der Obereunuch.
»Yehonala!« An Teh-hais Stimme dröhnte ihr in die Ohren, und sie stand schnell auf.
Er stürzte auf sie zu und fasste sie am Arm. »Hast du vergessen? Bist du wahnsinnig? Der Kaiser wartet. Er wartet, sage ich dir. Du hättest hierfür den Tod verdient –«
Sie riss sich los, er eilte an die Tür und rief wieder ihren Namen. »Yehonala, Tochter des verstorbenen Bannermanns Tschao, Nichte Muyangas aus der Zinngasse. Siebzehn Jahre, drei Monate und zwei Tage alt –«
Sie trat geräuschlos und ohne sich zu zieren ein und ging langsam durch den großen Saal. Ihr langer rosaseidener Satinrock fiel ihr bis auf die gestickten Schuhe, die dicke weiße Sohlen hatten, sodass sie sehr groß erschien. Ihre schmalen, schönen Hände trug sie gefaltet in Hüfthöhe. Sie drehte den Kopf nicht nach dem Thron, als sie langsam vorbeiging.
»Sie soll noch einmal vorbeigehen«, befahl der Kaiser.
Die Kaiserinmutter betrachtete Yehonala mit unwillkürlicher Bewunderung.
»Ich warne dich«, sagte sie. »Dieses Mädchen hat eine heftige Gemütsart. Ich sehe es an ihrem Gesicht. Für eine Frau ist sie zu kräftig.«
»Sie ist schön«, sagte der Kaiser.
Noch immer wandte Yehonala nicht den Kopf. Sie hörte die Worte wie Geisterstimmen.
»Was macht es, wenn sie von heftiger Gemütsart ist«, sagte der Kaiser. »Mit mir kann sie ja wohl nicht streiten.«
»Bleib stehen«, befahl er ihr. Sie stand still. Sie bot ihr Gesicht und ihren Körper im Profil dar. Sie hatte den Kopf hoch erhoben und schien in weite Ferne zu blicken, als wenn ihre Gedanken irgendwo anders wären.
»Dreh mir dein Gesicht zu«, befahl der Kaiser.
Langsam, wie wenn ihr alles gleichgültig wäre, gehorchte sie. Ein anständiges, bescheidenes Mädchen, war ihr immer gesagt worden, hebt ihre Augen nicht höher als bis zur Brust eines Mannes. Bei dem Kaiser aber durfte sie den Blick nicht über seine Knie erheben. Doch Yehonala blickte ihm voll ins Gesicht und sah ihn mit großer Eindringlichkeit an. Sie bemerkte, dass die Augen des Kaisers flach unter seinen knabenhaft dünnen Brauen lagen. Sie sah ihn an und ließ mit ihrem Blick die Macht ihres Willens in seine Augen strömen. Eine Weile saß er unbeweglich. Dann sagte er: »Diese wähle ich.«
»Wenn du vom Himmelssohn erwählt wirst«, hatte ihre Mutter ihr eingeschärft, »mache dich zuerst bei seiner Mutter, der Kaiserinwitwe, beliebt. Bring ihr die Überzeugung bei, dass du Tag und Nacht an sie denkst. Suche herauszubekommen, was sie gern hat, achte auf ihre Eigenheiten, vernachlässige sie nie. Sie wird nicht mehr lange leben. Du aber hast noch viele Jahre vor dir.«
An diese Worte erinnerte sich Yehonala. In der ersten Nacht nach ihrer Wahl lag sie schon in ihrem eigenen kleinen Schlafzimmer. Ihre Wohnung bestand aus drei Zimmern. Eine alte Kammerfrau wurde ihr vom Obereunuchen als Dienerin zugewiesen. In dieser Wohnung musste sie allein leben und durfte sie nur verlassen, wenn der Kaiser sie holen ließ. Das konnte oft oder auch nie sein. Manchmal lebte eine Konkubine innerhalb der Mauern der Kaiserstadt als Jungfrau bis zu ihrem Tode. Wenn sie sich nicht durch Bestechung der Eunuchen dem Kaiser in Erinnerung bringen konnte, geriet sie in Vergessenheit. Aber ihr, Yehonala, konnte das nicht passieren. Wenn er Sakotas müde wurde, die ihm ja als Schwester seiner verstorbenen Gemahlin näherstand, konnte er vielleicht, ja musste er an sie denken. Aber würde er sich erinnern? Er war an schöne Frauen gewöhnt, und wenn sie sich auch tief in die Augen gesehen hatten, konnte sie sicher sein, dass er an sie denken würde?
Sie lag auf dem Backsteinbett, das durch drei übereinandergelegte Matratzen wohlig weich war, und überlegte. Tag für Tag musste sie nun jeden Schritt, den sie tat, sorgfältig abwägen und durfte keinen Tag planlos vorübergehen lassen, sonst könnte sie ihr Leben als vergessene Jungfrau in Einsamkeit zubringen. Sie musste wach und schlau sein und die Kaiserinwitwe als Mittel zum Zweck benutzen. Sie würde sich ihr nützlich machen, sie liebevoll umhegen, es nie an kleinen Aufmerksamkeiten fehlen lassen. Darüber hinaus aber würde sie sich geistig weiterbilden und um Zuweisung von Lehrern bitten. Dank der Güte ihres Onkels konnte sie bereits lesen und schreiben, aber ihr Durst nach wirklichem Wissen war nie befriedigt worden. Sie wollte um Geschichts- und Gedichtbücher bitten, Musik und Malen lernen, die Künste, die den Ohren und den Augen schmeichelten. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie jetzt Zeit für sich, Muße, ihren Geist auszubilden. Sie wollte auch ihren Körper pflegen, die besten Speisen essen, ihre Hände mit Hammelfett weich reiben, sich mit getrockneten Orangen und Moschus parfümieren, ihre Dienerin bitten, ihr zweimal täglich nach dem Bade das Haar zu bürsten. Das wollte sie für ihren Körper tun, damit der Kaiser Vergnügen an ihr fände. Aber lernen wollte sie, um sich selbst Vergnügen zu machen, und zu diesem Zweck Schriftzeichen so kunstvoll wie Gelehrte pinseln und Landschaften malen, wie es Künstler tun, vor allem aber viele Bücher lesen.
Die Seide ihrer Steppdecke blieb an der rauen Haut ihrer Hände haften. »Ich werde nie mehr Kleider waschen«, dachte sie, »nie mehr heißes Wasser schleppen oder Korn mahlen. Bin ich nicht glücklich?«
Zwei Nächte hatte sie nicht geschlafen. Die letzte Nacht, die sie daheim zugebracht und die zarte Sakota getröstet hatte, und die vorige Nacht, als sie mit den Jungfrauen wartete. Wer konnte da schlafen? Aber heute Abend war alle Angst vorbei.
Sie war erwählt worden, und hier in diesen drei Zimmern war ihr kleines Heim. Die Zimmer waren zwar klein, aber prächtig ausgestattet, an den Wänden hingen Bildrollen, auf den Stuhlsitzen lagen rote Seidenkissen, die Tische waren aus Rosenholz und die Deckenbalken bunt bemalt. Der Boden war mit glatten Fliesen belegt, und die vergitterten Fenster öffneten sich auf einen kleinen Hof und einen runden Teich, in dem Goldfische in der Sonne schimmerten. Ihre Dienerin schlief auf einer Bambusbank vor der Türe. Sie brauchte keine Angst zu haben.
Vor niemandem? In der Dunkelheit sah sie plötzlich das schmale, böse Gesicht des jungen Eunuchen Li Lien-ying vor sich. Ah, die Eunuchen! Ihre kluge Mutter hatte sie vor ihnen gewarnt.
»Ich fürchte dich nicht«, sagte sie zu dem dunklen Gesicht Li Lien-yings.
Und gerade weil sie sich fürchtete, dachte sie plötzlich an ihren Verwandten Jung Lu. Sie hatte ihn nicht mehr gesehen, seitdem sie den Palast betreten hatte. Kühn wie sie war, hatte sie den Vorhang ihrer Sänfte ein wenig beiseitegeschoben, als sie sich den dunkelroten Toren näherte. Vor ihnen standen in gelbem Rock, mit gezogenen und hochgehaltenen Schwertern die kaiserlichen Wachsoldaten. Zur Rechten, am Haupttor, ragte Jung Lu über alle hinaus. Er blickte geradeaus auf die belebte Straße und verriet mit keinem Zeichen, dass für ihn nur eine Sänfte unter den vielen von Bedeutung war. Auch sie konnte ihm kein Zeichen geben. Leicht gekränkt hatte sie ihn aus ihren Gedanken entlassen. Auch jetzt wollte sie nicht an ihn denken. Sie konnten beide nicht wissen, ob sie sich je wiedersehen würden. In den Mauern der Verbotenen Stadt konnten ein Mann und eine Frau ein ganzes Leben zubringen, ohne sich ein einziges Mal zu begegnen.
Aber warum hatte sie plötzlich an ihn gedacht, als sie sich an das dunkle Gesicht des Eunuchen erinnerte? Sie seufzte und vergoss ein paar Tränen. Sie war selbst überrascht darüber, wollte aber nicht nach der Ursache ihrer Tränen fragen. Dann schlief sie, da sie jung und müde war, allmählich ein.
Die geräumige alte Palastbibliothek war selbst im Hochsommer kühl. Um Mittag wurden die Tore geschlossen, damit die Hitze nicht von draußen hereindrang. Die glitzernde Sonne schien nur trübe durch die Schildpattfenster. Kein Geräusch störte die Stille, nur Yehonalas Murmeln war zu vernehmen, als sie dem alten Eunuchen, der zu ihrem Lehrer bestellt war, vorlas.
Sie las aus dem Buch der Veränderungen und war so von dem Rhythmus der Verse bezaubert, dass ihr das lange Schweigen ihres Lehrers nicht auffiel. Als sie dann eine Seite umblätterte und aufblickte, sah sie, dass der alte Gelehrte eingeschlafen war. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken, der Fächer den Fingern der rechten Hand entglitten. Sie lächelte und las für sich selbst weiter. Zu ihren Füßen schlummerte ein kleiner Hund. Er gehörte ihr, denn sie hatte den Haushofmeister durch ihre Dienerin um ein Spieltier gebeten, das ihre Einsamkeit vertreiben sollte.
Sie war jetzt schon zwei Monate im Palast und hatte noch immer keine Aufforderung vom Kaiser erhalten. Keinen ihrer Familie hatte sie wiedergesehen, nicht einmal Sakota, und da sie immer innerhalb der Tore blieb, hatte sie auch Jung Lu nicht mehr erblicken können, der dort Wache stand. So ganz auf sich selbst angewiesen, hätte sie vielleicht unglücklich sein können, wenn sie sich nicht in Gedanken mit ihrer Zukunft beschäftigt hätte. Eines Tages würde sie vielleicht Kaiserin sein. Dann konnte sie tun, was ihr beliebte. Wenn sie wollte, konnte sie dann Jung Lu zu sich rufen und ihm einen Auftrag geben, vielleicht den Auftrag, ihrer Mutter einen Brief zu überbringen.
»Ich übergebe dir den Brief selbst«, würde sie sagen, »und du sollst mir einen Brief von ihr als Antwort zurückbringen.«
Nur sie beide würden wissen, ob der Brief für ihre Mutter bestimmt war. Aber jetzt musste sie noch warten, ob der Kaiser sie rief, und inzwischen konnte sie nichts anderes tun, als sich auf diesen Ruf vorzubereiten. Hier in der Bibliothek studierte sie jeden Tag mit ihrem Lehrer fünf Stunden. Der Eunuch war ein berühmter Gelehrter, der einstmals bekannte Achtzeiler im T’angstil geschrieben hatte. Wegen seines Ruhmes hatte er den Befehl erhalten, sich zum Eunuchen zu machen, um den jungen Prinzen, der jetzt Kaiser war, und späterhin des Kaisers Konkubinen zu unterrichten. Unter diesen seien alle mehr oder weniger lerneifrig gewesen, aber keine habe je einen solcher Eifer gezeigt, erklärte der alte Lehrer, wie Yehonala. Er sprach lobend von ihr zu den Eunuchen und gab gute Berichte über sie an die Kaiserinmutter, sodass diese sie eines Tages bei einer Audienz wegen ihres Fleißes lobte.
»Du tust gut daran, in den Büchern zu lernen«, sagte sie. »Mein Sohn, der Kaiser, ermüdet leicht, und wenn er schwach oder unruhig ist, musst du ihn durch den Vortrag von Gedichten und durch selbstgemalte Bilder unterhalten.«
Ergeben hatte Yehonala den Kopf gesenkt.
Sie dachte gerade über eine Seite nach, die sie soeben gelesen hatte, da fühlte sie sich an der Schulter berührt. Als sie den Kopf wandte, sah sie das Ende eines gefalteten Fächers und eine Hand, die sie schon vom Sehen kannte, eine große, weiche, mächtige Hand. Sie gehörte dem jungen Eunuchen Li Lien-ying. Sie hatte schon seit Wochen gemerkt, dass er sich bestrebte, ihr Diener zu werden. Es war nicht seine Pflicht, in ihrer Nähe zu sein, er war nur einer der vielen unteren Eunuchen, aber er hatte sich in vielen kleinen Dingen nützlich gemacht. Wenn sie Lust auf Obst oder Süßigkeiten hatte, stand er mit ihnen bereit. Besonders aber hörte sie von ihm, was in den vielen Hundert Hallen, Durchgängen und Höfen der Verbotenen Stadt geklatscht wurde. Nur Bücher zu lesen genügte nicht. Man musste auch bis ins Einzelne alle Intrigen, kleinen Begebenheiten und Liebesgeschichten kennen, Macht konnte nur gewinnen, wer über alles unterrichtet war.
Sie hob den Kopf, legte einen Finger an die Lippen und zog fragend die Brauen hoch. Er deutete mit seinem Fächer an, dass sie ihm in den Pavillon vor der Bibliothek folgen solle. Seine Stoffsohlen glitten geräuschlos über den Boden, sie folgte ihm ebenso leise in den Pavillon, wo der Lehrer sie nicht mehr hören konnte. Der kleine Hund erwachte und schlich ihr, ohne zu bellen, nach.
»Ich habe eine wichtige Nachricht«, sagte Li Lien-ying. Mit seinen mächtigen Schultern, seinem viereckigen großen Kopf und seinen groben Gesichtszügen überragte er sie, eine gewaltige und dräuende Gestalt. Sie hätte Angst vor ihm bekommen können, wäre sie nicht schon so weit gewesen, niemanden mehr zu fürchten.
»Was für eine Nachricht?«, fragte sie.
»Die junge Kaiserin hat empfangen!«
Sakota! Sie hatte ihre Kusine, seitdem sie zusammen den Palast betreten hatten, nicht mehr gesehen. Sakota war jetzt anstelle ihrer verstorbenen Schwester offizielle Gemahlin, während sie, Yehonala, nur eine Konkubine war. Sakota war ins Bett des Kaisers gerufen worden und hatte ihre Pflicht erfüllt. Wenn Sakota einen Sohn gebar, würde dieser Erbe des Drachenthrones sein, und Sakota würde den Rang einer Kaiserinmutter erhalten. Und sie, Yehonala, würde dann noch immer nichts als eine Konkubine sein. Um solch geringen Preises willen sollte sie ihr Leben und ihren Geliebten weggeworfen haben? Das Blut schoss ihr so zum Herzen, dass sie tief Atem holen musste.
»Ist es erwiesen, dass sie schwanger ist?«, fragte sie.
»Ja«, erwiderte der Eunuch. »Ihre Kammerfrau steht in meinem Sold. Dies ist der zweite Monat, in dem sich bei ihr kein Blut gezeigt hat.«
»So?«, sagte Yehonala ratlos. Dann gewann die Selbstbeherrschung, in der sie sich immer geübt hatte, die Oberhand. Niemand konnte ihr jetzt helfen. Auf sich selbst musste sie sich nun verlassen. Aber das Schicksal konnte ihr gnädig sein. Sakota konnte einem Mädchen das Leben schenken. Nur die Mutter eines Sohnes würde zur Kaiserin erhoben werden.
»Warum sollte ich nicht diese Mutter sein?«, dachte sie. Als sie dieses Hoffnungsfünkchen sah, wurde ihr Geist ruhig, und ihr Herz schlug wieder gleichmäßig.
»Der Kaiser hat seine Pflicht gegen seine verstorbene Gemahlin erfüllt«, fuhr der Eunuch fort. »Jetzt wird er sich nach einer anderen umsehen.«
Sie schwieg. Vielleicht war sie diese andere.
»Sie müssen sich nun bereithalten«, sagte der Eunuch. »Ich schätze, dass er in sechs oder sieben Tagen an eine Konkubine denken wird.«
»Wieso weißt du das alles?« Obschon sie sich vorgenommen hatte, sich nicht zu fürchten, beschlich sie doch Angst.
»Eunuchen wissen das«, erklärte er und sah sie dabei unverschämt an.
Würdevoll sagte sie: »Du vergisst dich vor mir.«
»Verzeihung, wenn ich Sie beleidigt habe«, entschuldigte er sich schnell. »Ich tue unrecht. Sie tun immer recht. Ich bin Ihr Diener und Ihr Sklave.«
Sie war so allein, dass sie sich zwang, die Entschuldigung dieses furchterregenden Gesellen anzunehmen. »Aber warum«, fragte sie jetzt, »willst du mir dienen? Ich habe kein Geld, mit dem ich dich belohnen könnte.«
Tatsächlich hatte sie nicht einen Pfennig Geld. Sie aß täglich die köstlichsten Gerichte, denn was die Kaiserinmutter übrig ließ, bekamen die Konkubinen, und Speisen jeder Art waren stets im Überfluss vorhanden. Die Schränke in ihrem Schlafzimmer waren mit schönen Kleidern gefüllt. Sie schlief unter seidenen Decken und wurde Tag und Nacht von ihrer Kammerfrau bedient. Aber sie konnte sich selbst nicht einmal ein Taschentuch oder eine Schachtel Süßigkeiten kaufen, und seitdem sie in der Verbotenen Stadt lebte, hatte sie noch kein Schauspiel gesehen. Die Kaiserinmutter trauerte noch um den verstorbenen Kaiser T’ao Kuang, den Vater ihres Sohnes, und gestattete nicht einmal den Konkubinen, sich an einem Theaterstück zu vergnügen, die Schauspielkunst aber entbehrte Yehonala mehr als ihre Familie. Wenn sie mit Arbeit überhäuft gewesen, ihre Mutter sie gescholten hatte und die Tage freudlos gewesen waren, hatte sie sich aus dem Haus geschlichen, um auf der Straße oder auf einem Tempelhof den Schauspielern zuzusehen. Wenn sie zufällig einmal ein Geldstück in die Hand bekam, sparte sie es für eine Theateraufführung, und wenn sie keines hatte, versteckte sie sich in der Menge, wenn gesammelt wurde.
»Glauben Sie, dass es mir um Geschenke zu tun ist?«, sagte Li Lien-ying. »Dann beurteilen Sie mich falsch. Ich weiß, dass Sie zu Hohem bestimmt sind. Sie haben eine Kraft in sich, die allen anderen fehlt. Habe ich das nicht gleich bemerkt, als mein Blick auf Sie fiel? Ich habe es Ihnen angesehen. Wenn Sie zum Drachenthron aufsteigen, werde ich mit Ihnen steigen, immer Ihr Diener und Sklave.«
Sie war klug genug, zu sehen, wie er ihre Schönheit und ihren Ehrgeiz für seine eigenen Zwecke benutzte, während er das Band der Dankbarkeit zwischen sich und ihr immer enger knüpfte. Wenn sie einmal den Thron besteigen sollte – und sicher würde das eines Tages geschehen –, würde er da sein und sie erinnern, dass er ihr geholfen hatte.
»Warum solltest du mir umsonst dienen?«, fragte sie, als ob sie ihn nicht durchschaute. »Jeder, der etwas gibt, erwartet eine Gegenleistung dafür.«
»Wir verstehen uns«, sagte er lächelnd.
Sie blickte weg. »Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten.«
»Warten wir«, sagte er, verbeugte sich und ging fort. Nachdenklich kehrte sie in die Bibliothek zurück, der Hund trippelte hinter ihr her. Der alte Lehrer schlief noch immer, sie setzte sich wieder und las weiter. Alles war wie zuvor, nur die Sanftmut einer Jungfrau war in dieser kurzen Zeit aus ihrem Herzen gewichen. Sie war nun eine Frau, bereit, ihr Schicksal selbst zu gestalten.
Wie konnte sie sich jetzt in die alten Gedichte vertiefen? Ihre Gedanken kreisten um den Augenblick, in dem der Ruf an sie ergehen würde. In welcher Form würde er erfolgen, und wer würde ihr die Botschaft überbringen? Würde sie noch Zeit haben, sich zu baden und ihren Körper zu parfümieren, oder musste sie gleich, so wie sie war, davoneilen? Die kaiserlichen Konkubinen tuschelten oft zusammen, und wenn eine geholt wurde und wieder zurückkam, wurde sie bis in die letzte Einzelheit über alles ausgefragt, was zwischen ihr und dem Kaiser vor sich gegangen war. Yehonala hatte keine Fragen gestellt, aber sie hatte die Ohren aufgemacht. Besser, man wusste alles.
»Der Kaiser wünscht nicht, dass man ihm etwas erzählt«, hatte eine Konkubine gesagt. Sie hatte einmal Gnade gefunden, aber jetzt lebte sie vergessen im Palast der vergessenen Konkubinen mit anderen, die der Kaiser nicht lange geliebt hatte. Auch die alternden Konkubinen seines verstorbenen Vaters wohnten dort. Obwohl sie noch keine vierundzwanzig Jahre war, hatte diese Konkubine ihre Liebeszeit schon hinter sich. Sie war erwählt, umarmt und verschmäht worden. Weder Frau noch Witwe, würde sie den Rest ihres Lebens vertrauern, und da sie nicht schwanger geworden war, hatte sie nicht einmal ein Kind als Trost. Sie war schön, faul und oberflächlich und sprach immer nur von dem einen Tag, den sie in den Privatgemächern des Kaisers hatte zubringen dürfen. Diese kurze Geschichte erzählte sie den neuen Konkubinen, die auf ihren Ruf warteten, immer wieder.
Yehonala hörte sich diesen Bericht an und sagte nichts. Sie würde den Kaiser zerstreuen. Sie würde ihn zum Lachen bringen, ihm etwas vorsingen und ihm Geschichten erzählen; sie würde ihn auch mit den Banden des Gesetzes an sich fesseln und sich nicht auf den Körper allein verlassen. Sie schloss das Buch der Veränderungen und legte es beiseite. Es gab noch andere, verbotene Bücher: Der Traum der roten Kammer, Pflaumenblüte in einer goldenen Vase, Die weiße Schnecke – diese würde sie alle lesen und Li Lien-ying beauftragen, sie ihr aus Buchläden in der Stadt zu holen, wenn es sie hier in der Bibliothek nicht geben sollte.
Der Lehrer erwachte plötzlich und ruhig, wie alte Leute erwachen, bei denen der Unterschied zwischen Schlafen und Wachen nur noch gering ist. Er betrachtete sie, ohne sich zu rühren. »Nun«, fragte er, »haben Sie Ihr Pensum für heute beendet?«
»Ja«, entgegnete sie, »aber ich möchte jetzt andere Bücher haben, unterhaltsame Geschichten und Zauberbücher.«
Er blickte ernst drein und strich sich das bartlose Kinn mit einer Hand, die so trocken und welk war wie ein abgefallenes Palmenblatt. »Solche Bücher vergiften das Denken, besonders bei Frauen«, erklärte er. »Hier in der kaiserlichen Bibliothek gibt es solche nicht, nein, unter den sechsunddreißigtausend, die in den Regalen stehen, ist nicht ein einziges Buch dieser Art zu finden. Sie sollten von einer tugendhaften Dame nicht einmal erwähnt werden.«
»Nun, dann werde ich sie nicht erwähnen«, versetzte Yehonala lächelnd.
Sie bückte sich, schob den kleinen Hund in ihren Ärmel und ging in ihre Wohnung.
Was sie am Nachmittag dieses Tages erfahren hatte, war bereits am nächsten Tag in aller Munde. Das Flüstern und Tuscheln ging von Hof zu Hof. Erregung lag in der Luft. Trotz seiner Gemahlin und seiner vielen Konkubinen hatte der Kaiser noch nie ein Kind gezeugt. Die großen Mandschu-Sippen waren bereits unruhig geworden. Wenn kein Erbe da war, musste einer aus ihren Reihen gewählt werden. Die Fürsten beobachteten sich gegenseitig eifersüchtig. Wessen Sohn würde wohl als Thronfolger in Betracht kommen? Da Sakota, die neue Gemahlin, jetzt empfangen hatte, blieb ihnen nichts anderes übrig, als weiter zu warten. Wenn sie eine Tochter anstatt eines Sohnes gebar, würde der Streit von Neuem beginnen.
Yehonala stammte aus einer der mächtigsten dieser Sippen. Drei Kaiserinnen waren schon aus ihrem Geschlecht hervorgegangen. Sollte sie nicht die vierte werden? Wenn sie vom Kaiser ins Bett gerufen, wenn sie sofort schwanger würde und Sakota nur eine Tochter bekäme, stände der Weg zu einer hohen Bestimmung offen – zu offen vielleicht, denn wer hatte ein solches Glück, dass ein erfolgreicher Schritt sogleich den nächsten nach sich zog? Doch möglich war alles.
Als Vorbereitung las sie von nun an regelmäßig die Hofberichte und studierte genau die Edikte, die der Kaiser herausgab. So konnte sie sich über den Zustand des Reiches informieren und bereit sein, wenn die Götter Großes mit ihr vorhatten. Langsam begriff sie die riesige Ausdehnung des Reiches und die Größe des chinesischen Volkes. Ihre Welt war bis jetzt die Stadt Peking gewesen, wo sie vom Kind zum Mädchen gereift war. Sie kannte die regierende Schicht, die Mandschu-Sippen, die seit dem Einbruch ihrer Vorfahren die Herrschaft über das große chinesische Volk ausübten. Zweihundert Jahre hindurch hatte die nördliche Dynastie sich hier in Peking ihr Herz, die Stadt innerhalb der Stadt, geschaffen. Sie hieß die Verbotene Stadt, weil nur ein einziger Mann, der Kaiser, nachts in ihren Mauern schlafen durfte. Denn bei Einbruch der Dämmerung ertönten auf jedem Hof und in jeder Straße die Trommeln, um alle Männer, die sich tagsüber im Palast aufgehalten hatten, zum Fortgehen zu mahnen. Der Kaiser blieb unter seinen Frauen und seinen Eunuchen allein.
Aber diese Hauptstadt und diese innere Stadt, so begriff sie nun, war nur der Mittelpunkt eines ewigen, mit seinen Bergen, Flüssen, Seen und Küsten, seinen unzählbaren Städten und Dörfern, seiner Hunderte von Millionen zählenden verschiedenartigen Bevölkerung von Bauern, Gelehrten und Handwerkern unerschütterlichen Landes. Ihre lebhafte Einbildungskraft schweifte weit über die Tore ihres Gefängnisses hinaus. Aus den kaiserlichen Edikten erfuhr sie noch mehr, nämlich, dass sich im Süden ein mächtiger Aufstand ausgebreitet hatte, der durch die hassenswerte Lehre einer fremden Religion entstanden war. Diese chinesischen Aufrührer nannten sich T’ai Ping und wurden von einem fanatischen Christen namens Hung angeführt, der sich für den leiblichen Bruder eines sogenannten Christus hielt. Dieser Christus war der Sohn eines fremden Gottes und einer Bäuerin. Diese Abstammung war nicht so sonderbar, denn in den alten Büchern standen viele solcher Geschichten. Eine Bauersfrau berichtete dort von einem Gott, der sie wie eine Wolke umhüllt hatte, als sie das Feld bestellte, und sie durch Zauberei so schwängerte, dass sie in zehn Mondmonaten einen göttlichen Sohn gebar. Oder es wurde von der Tochter eines Fischers erzählt, dass ein Gott aus dem Fluss gestiegen war, während sie die Netze ihres Vaters flickte, und sie schwängerte, obschon sie Jungfrau blieb.
Aber unter dem christlichen Banner der T’ai-Ping-Rebellen sammelten sich alle unruhigen und unzufriedenen Elemente, und wenn der Aufstand nicht unterdrückt wurde, konnten sie sogar die Mandschu-Dynastie beseitigen. T’ao Kuang war ein schwacher Kaiser gewesen, und sein ebenso schwacher Sohn, Hsien Feng, wurde von seiner Mutter wie ein Kind beherrscht.
Durch die Kaiserinmutter musste Yehonala Zugang zu ihm finden. Keinen Tag versäumte sie, dieser ihre Aufwartung zu machen, und immer brachte sie aus den kaiserlichen Gärten eine seltsame Blume oder eine besonders köstliche Frucht mit.
Es war jetzt die Jahreszeit, in der die Sommermelonen reiften. Die Kaiserinmutter aß leidenschaftlich gern die kleinen gelbfleischigen süßen Melonen. Yehonala ging täglich durch die Melonenreihen und suchte nach den ersten, unter Blättern verborgenen Früchten. An die fast reifen steckte sie Streifen gelben Papiers, auf die sie den Namen der Kaiserinmutter pinselte, damit kein gieriger Eunuch oder eine naschhafte Gärtnerin die Früchte stahl. Jeden Tag prüfte sie die Früchte mit Daumen und Zeigefinger. Es waren jetzt sieben Tage vergangen, seitdem ihr Li Lien-ying die Nachricht über Sakota mitgeteilt hatte. Da hörte sie beim Klopfen, dass eine Melone so hohl wie eine Trommel klang. Sie war reif. Yehonala löste sie vom Stängel und trug sie zu der Wohnung der Kaiserinmutter.
»Unsere ehrwürdige Mutter schläft«, sagte eine Dienerin. Sie war eifersüchtig auf Yehonala, weil ihre Herrin diese begünstigte.
Yehonala erhob ihre Stimme. »Wenn die Kaiserinmutter jetzt noch schläft, muss sie krank sein. Denn sonst ist sie schon immer um diese Zeit wach.«
Yehonala hatte, wenn sie wollte, eine drosselklare Stimme, die durch mehrere Zimmer klang. Die Kaiserinmutter hörte sie, denn sie schlief nicht, sondern saß in ihrem Schlafzimmer und stickte auf einen schwarzen Gürtel einen goldenen Drachen als Geschenk für ihren Sohn. Sie hätte diese Arbeit auch von anderen ausführen lassen können, aber sie konnte nicht lesen und stickte daher, um sich die Zeit zu vertreiben. Immer aber wurde sie der Arbeit bald überdrüssig, und als sie jetzt Yehonalas Stimme hörte, rief sie: »Komm herein, Yehonala, wer sagt, dass ich schlafe, lügt.«
Yehonala lächelte der erbosten Dienerin zu: »Ich habe mich nur verhört, Ehrwürdige, niemand hat gesagt, dass Sie schlafen.«
Mit dieser höflichen Lüge trippelte sie durch die Räume bis in das Schlafzimmer der Kaiserinmutter, wobei sie die Melone immer in beiden Händen hielt. Die alte Dame hatte wegen der Hitze ihr Obergewand abgelegt. Yehonala überreichte ihr die Frucht.
»Wie schön!«, rief die Kaiserinmutter. »Ich habe nämlich gerade an süße Melonen gedacht und hatte Lust auf eine. Du kommst im richtigen Augenblick.«
»Es wäre gut, wenn ein Eunuch sie zur Kühlung an der Nordseite des Hofes über einen Brunnen hinge«, sagte Yehonala.
Aber die Kaiserinmutter wollte davon nichts wissen. »Nein, nein!«, rief sie. »Wenn ein Eunuch diese Melone in die Hände bekommt, wird er sie heimlich essen und mir dann eine grüne bringen, oder er wird sagen, die Ratten hätten sie angenagt oder sie sei in den Brunnen gefallen und er habe sie nicht mehr herausholen können. Ich kenne diese Eunuchen! Ich will sie auf der Stelle essen, um ihrer sicher zu sein.«
Sie rief einer Dienerin zu: »Hole mir ein großes Messer!«
Drei oder vier liefen eilig nach einem Messer. Yehonala schnitt die Melone mit geschickten Händen in Scheiben, und die Kaiserinmutter aß Stück für Stück gierig wie ein Kind.
»Ein Handtuch!«, sagte Yehonala zu einer Dienerin, und als diese es brachte, band Yehonala es der alten Dame um den Hals, damit deren seidenes Unterkleid nicht feucht würde.