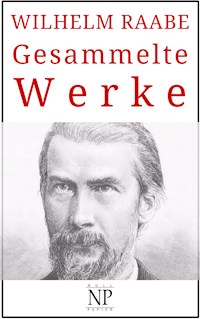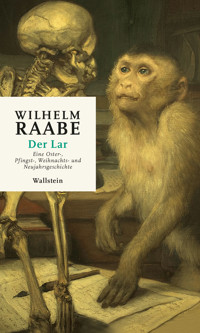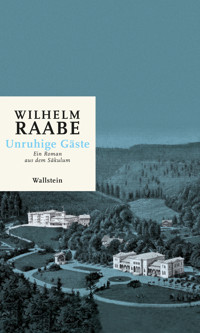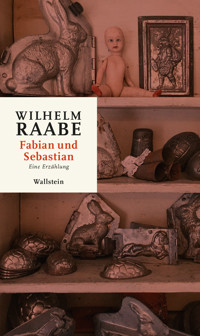Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Raabes Roman 'Das Odfeld' entführt den Leser in eine faszinierende Welt des 19. Jahrhunderts, in der historische Ereignisse und fiktive Charaktere aufeinandertreffen. Raabe präsentiert eine hochdetaillierte Darstellung des Lebens auf dem Land und in der Stadt, wobei er geschickt zwischen verschiedenen Handlungsebenen wechselt. Sein literarischer Stil zeugt von einer tiefen Kenntnis der gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit und von einer präzisen Charakterzeichnung. 'Das Odfeld' ist ein Meisterwerk des historischen Romans, das sowohl als Zeitdokument als auch als spannende Erzählung überzeugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Odfeld: Historischer Roman
Books
Inhaltsverzeichnis
So ist es also das Schicksal Deutschlands immer gewesen, daß seine Bewohner, durch das Gefühl ihrer Tapferkeit hingerissen, an allen Kriegen teilnahmen; oder daß es selbst der Schauplatz blutiger Auftritte war. Daß, wenn über die Grenzen am Oronoco Zwist entstand, er in Deutschland mußte ausgemacht, Canada auf unserm Boden erobert werden.
Holzmindisches Wochenblatt, 45. Stück, den 10. November 1787
Erstes Kapitel
Dicht am Odfelde, in der angenehmsten Mitte des Tilithi-oder auch Wikanafeldistan-Gaus, liegt auf dem Auerberge über dem romantischen, vom lustigen Forstbach durchrauschten, heute freilich arg durch Steinbrecherfäuste verwüsteten Hooptal das uralte Kloster Amelungsborn. Will man die Geschichten, die ich hiervon erzählen kann, anhören, so ist es mir recht. Wenn nicht, muß ich mir das auch gefallen lassen und rede von den alten Sachen, wie schon recht häufig, zu mir selber allein. Ist nämlich unter Umständen auch ein Vergnügen, einerlei, ob am sonnigen Sonntagmorgen, im abendlichen Alltagszwielicht, im Sommer oder im Winter; – nur in der richtigen Stimmung muß man sich dann mit sich selber allein finden!
Ach ja, wenn man so das Ohr an ein Bündel vergilbter Papiere, an ein würdig Pergamen, an einen Folianten in Schweinsleder, ja oder auch an eines der Büchelchen in Duodez mit abgegriffenem Sammeteinband, Goldschnitt und Kupfern von Daniel Chodowiecki legt! Oft hört dann kein Kind, das eine Muschel an sein Ohr hält, von ferne her ein geheimnisvolleres, tiefgründigeres Tönen, Sausen und Brausen.
Man kann dann und wann sogar, über seiner Materie, seinem gelehrten Rüstzeug auf beiden Armen liegend, gründlich gelangweilt einschlafen und beim Wiedererwachen zu seiner Verwunderung bemerken, daß man doch etwas gelernt habe zum Weitergeben an andere. Auch in dieser Hinsicht beschert es der Herrgott den Seinen nicht selten im Traum; und es ist oft nicht das Schlechteste, was so den Lesern zufällt – und auch dem Geschichts-und Geschichtenschreiber, falls er nur nachher eben bei seinem Niederschreiben die Augen offen und die Feder fest in der Hand behalten hat.
Schon Cajus Cornelius Tacitus soll die Gegend um den Ith gekannt haben, wenn auch nicht aus persönlicher Anschauung. Er soll von dem Odfelde – Campus Odini – und von dem Vogler – mons Fugleri – reden. Dieses lassen wir auf sich beruhen; aber die Gegend ist allzu fett und fein, als daß sie nicht gleichfalls als Tummelplatz vieler menschlicher Begehrlichkeit und als Walstätte weltgeschichtlicher Katzbalgereien hergehalten haben sollte.
Römer haben sich ziemlich sicher hier auf Wodans Felde mit Cheruskern gezerrt und gezogen, Franken mit Sachsen und die Sachsen sich sehr untereinander. Die alte Köln-Berliner Landstraße läuft nicht umsonst über das Odfeld, vorbei an dem Quadhagen: Ost und Westen konnten also, wenn sie sich etwas mit dem Prügel in der Faust zu sagen hatten, wohl aneinander gelangen, und daß sie bis in die jüngste Zeit ausgiebigen Gebrauch von der Weggelegenheit machten, davon wird der Leser Erfahrung gewinnen, wenn er nur um ein kleines weiterblättert.
Wie hübsch ist es, wenn Brüder friedlich beieinander wohnen, und wie selten ist es! Und da es so selten ist, so hat es zu allen Zeiten Leute gegeben, die ihrer Nerven wegen den Verkehr und Umgang mit ihrer Nachbarschaft nach Tunlichkeit mieden oder ihn wohl ganz abbrachen und sich auf sich selber zurückzogen. Ein solcher Einsiedler hätte im Jahre siebenzehnhunderteinundsechzig Magister Buchius im Kloster Amelungsborn wohl sein mögen, und ein solcher ist tausend Jahr früher der Gründer des Klosters unbedingt gewesen.
Das heißt, so unbedingt der Gründer kann der Mann Amelung, der vor undenklichen Zeiten im Tal unter dem Auerberge, oder diesmal genauer unterm Küchenbrink, den Born, der nachher seinen Namen trug, aufgrub, nicht genannt werden. Der Mann wollte nichts gründen, der Mann wollte sicherlich nichts weiter als endlich seine Ruhe vor der Brüder-und Schwesterschaft dieser Welt. Hoffentlich ist sie ihm zuteil geworden im Eichenschatten des Hooptals und ist der wilde Eber mit seinen Angehörigen auf der Eichelnsuche sein schlimmster Störenfried geblieben, bis, wie es im Märchen heißt, eines Morgens die frommen Rehe kamen und den lieben Freund und guten Greis aller Unlust durch seinesgleichen auf Erden enthoben fanden und so weiter.
»Und so weiter!« nämlich werden an dieser Stelle schon leider mehr als einer und eine sagen, denen es jetzt schon scheint, als ob der Historiograph wieder einmal imstande sei, ihnen die gewohnte Unlust zuzubereiten, und – hinter deren Rücken fahren wir fort in unserm Bericht.
Gegründet wurde das Kloster Amelungsborn im Anfang des zwölften Jahrhunderts von dem Grafen Siegfried dem Jüngern von Homburg, dem man seinen Vater Siegfried den Ältern totgeschlagen hatte. Aus dem ersten Zisterzienserkloster in Deutschland, Altenkamp bei Köln, holte er sich die Mönche, welche die Stelle der frommen Rehe und sonstigen lieben und betrübten Waldtiere über dem Grabe seines Erblassers versehen sollten. Sechs Mark Silber schenkte schon im Jahre 1125 Graf Simon von Dassel dem Konvent und fand willige Nehmer. Der erste Abt hieß Heinrich und stand mit dem heiligen Bernhard von Clairvaux in Briefwechsel, erhielt im Jahre 1129 auch ein Belobigungsschreiben von ihm für sein Kloster, worüber großer Jubel war, was mich nicht wundert, da es auch andern Vergnügen gemacht hat, mit dem heiligen Mann schriftlich oder persönlich in Verbindung zu kommen.
Im Jahre 1802 schreibt Schiller an Goethe:
»Ich habe mich dieser Tage mit dem heiligen Bernhard beschäftigt und mich sehr über diese Bekanntschaft gefreut; es möchte schwer sein, in der Geschichte einen zweiten so weltklugen geistlichen Schuft aufzutreiben, der zugleich in einem so trefflichen Elemente sich befände, um eine würdige Rolle zu spielen. Er war das Orakel seiner Zeit und beherrschte sie, ob er gleich und eben darum, weil er bloß ein Privatmann blieb und andere auf dem ersten Posten stehen ließ. Päpste waren seine Schüler und Könige seine Kreaturen. Er haßte und unterdrückte nach Vermögen alles Strebende und beförderte die dickste Mönchsdummheit, auch war er selbst nur ein Mönchskopf und besaß nichts als Klugheit und Heuchelei; aber es ist eine Freude, ihn verherrlicht zu sehen.«
»Zu der Bekanntschaft des heiligen Bernhard gratuliere ich«, schreibt Goethe. –
Auf Herrn Heinrich folgte Herr Werner, dann kam Hoiko, dann Eberhard, dann Gottschalk, dann Theodor, dann Arnold, dann Ratherius und so fort eine lange Reihe, deren Namen man wohl noch weiß, aber nicht mehr von ihren Gräberplatten aus Wesersandstein, die zerbröckelt und verstoben sind wie die Gebeine der alten Herren, welche unter ihnen zum Ausruhen kamen. Wir nennen von den frommen Vätern, die bis zur Reformation einander ablösten auf dem Abtstuhl, nur noch einen, nämlich Herrn Werner den Zweiten von Bodenwerder. Zehn Schuhe soll der Mann lang gewesen sein: der Freiherr von Münchhausen, der ja auch aus Bodenwerder war, erzählt seltsamerweise von ihm nichts, was das Ding freilich etwas verdächtig macht. Aber wie dem auch sei, wozu hilft alle Erdengröße, wenn in kritischen Zeiten der rechte Erdenverstand dabei mangelt?
Kritische Zeiten kamen mit dem wittenbergischen Augustiner auch für die Zisterzienser zu Amelungsborn und fanden ausnahmsweise den rechten Mann mit dem allerrichtigsten Verständnis an der Spitze der geistlichen Bruderschaft auf dem Auerberge. Andreas Steinhauer hieß er, hatte im Jahre 1512, von deutschen Eltern in London geboren, zum erstenmal aus schlauen Äuglein in die verworrene Welt hineingeblinzelt und sicherlich nicht ohne Gründe in Köln Theologie studiert. Von Bredelar aus beriefen ihn die Brüder in ihr Weserkloster als Prior, und Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig hatte bis zu seinem Tode Anno 1568 keinen getreuern Anhänger seines katholischen Glaubens als seinen Abt zu Amelungsborn, Andreas Steinhauer.
Was helfen einem die schönsten kritischen Zeiten, wenn man sie nicht zu benutzen versteht? Dominus Abbas Andreas Steinhauerius verstand’s; und wo andere unter plötzlich veränderten Umständen das Nest hätten räumen müssen, wußte er es noch wärmer auszufüttern und sich sogar ganz hausväterlich gemütlich drin einzurichten. Die grimmig-päpstische Faust im Eisenhandschuh des alten antischmalkaldischen Grimmbarts Herzog Heinrich löste sich vom Kragen des braunschweigischen Landes und sank, Staub zu Staub, hinunter in die Gruft der Kirche Beatae Mariae Virginis zu Wolfenbüttel. Julius hieß der Erbe und Nachfolger im Reich, der neuen Lehre zuerst sogar als Märtyrer zugetan, nun aber ihr mächtiger Gönner und Beförderer. Ich habe Gott Amor im Verdacht, daß er dem alten Herrn Andreas sein Märtyrertum des Übertritts zum Luthertum nach Möglichkeit erleichterte vor seinem Gewissen. Wie dem auch sei, der letzte katholische Abt von Amelungsborn legte sich sofort um auf die andere Seite und zog auch seinen ganzen Konvent mit hinüber. Und im Jahre 1572 freiete er, der Abt, nicht der Konvent, und führte heim ins Kloster Jungfrawen Margarethen Peinen, eines Bürgers zu Stadtoldendorf eheleiblich und hoffentlich auch lieblich Töchterlein. Ob Sankt Bernhard sich darob in seinem Grabe zu Clairvaux umgelegt habe, weiß keiner; eine Verleumdung aber ist es, daß Vater Andreas Steinhauer seiner Eheliebsten den Turm der Stadtkirche zu Stadtoldendorf als Heiratsgut verschrieben habe. Der Turm eignet heute noch dem Kloster Amelungsborn, und nur die daran hängende Kirche gehört löblicher Bürgerschaft. Im Jahre 1588 ist auch dieser werte Mann zu seinen Vätern versammelt und in der Klosterkirche beigesetzt worden. Sein Bild und Grabstein sind heute noch dort zu sehen, und der Magister Noah Buchius, der nicht einmal den Namen mit dem seligen Ahnherrn gemein hat, hat im währenden Siebenjährigen Kriege durch vorgeschobenes Gerümpel sein möglichstes getan, beides zu schützen, sowohl vor den roten Husaren des Generals Luckner wie vor den austrasischen Freiwilligen des Marschalls von Broglio und den Bergschotten Mylord Granbys.
Wie aber kam der Magister zu diesem großen Ahnherrn? Auf die einfachste Weise. Sein Urgroßvater Veit Buchius folgte dem alten Andreas nicht nur auf dem Abtstuhl, sondern auch im Ehebett. Und die Wittib war jung und angenehm, und er hatte Nachkommenschaft. Jared zeugete Henoch. Henoch zeugete Methusalah. Methusalah zeugete Lamech; und Lamech zeugete einen Sohn und hieß ihn Noah und sprach:
»Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf Erden, die der Herr verflucht hat!«
Möge der Trost, den wir persönlich aus dem alten Schulmeister, dem Magister Noah Buchius, gezogen haben, vielen andern zuteil werden. Dies ist unser herzlicher Wunsch, wie wir uns aufrichten von den Folianten, Quartanten, Pergamenten und Aktenbündeln, ob denen wir auf das Sausen und Brausen, das Getöne von Wodans Felde, vom Odfelde, kurz von ferne her gehorcht haben im Lärm der Gegenwart, im Getöse des Tages, der immer morgen auch schon hinter uns liegt, als ob er vor hunderttausend Jahren gewesen wäre.
Sollen wir nun noch viel reden von den Äbten, die noch nachher kamen? Im Grunde wäre es nicht nötig, da wir uns die zwei, auf welche es uns hauptsächlich ankam, aus ihrer Reihe hervorgelangt haben. Aber da ist noch der Dreißigjährige Krieg, der dem Siebenjährigen vorangeht, und über den kommt kein deutscher Autor in einem historischen Werke, wenn er wirklich etwas sagen will, hinweg, ohne etwas von ihm zu sagen. Herr Theodorus Berkelmannus aus Neustadt am Rübenberge hieß der Mann, der in das Elend hineinfiel, einerlei ob verheiratet oder unverheiratet. Daß er dem lutherischen Glauben anhing, genügte, um ihm die persönliche Bekanntschaft des Generals Tilly als durchaus nicht wünschenswert erscheinen zu lassen. Er suchte ihm aus dem Wege zu gehen, dem Herrn General; und der alte Tille suchte ihn natürlich höflich am Ärmel zurückzuhalten. Zwischen Einbeck und Northeim bekam der arme Doktor der lutherischen Theologie und Abt Berkelmann eine ligistische Kugel auf der Flucht in die Schulter, was vor ihm noch keinem andern Abte von Amelungsborn passiert war, und die Kaiserlichen reinigten hinter ihm den Tempel von ketzerischem Unrat auf ihre Weise. Gründlich! Aber freilich nicht auf lange.
Wer nun nach seiner Meinung einen Augiasstall zu reinigen hat, geht natürlich auf die Quelle zurück. In unserm Falle hielt sich die Liga sogar im wahrsten Sinne des Wortes an die Zisterne. Triumphierend zogen die Mönche des heiligen Bernhard unter Herrn Johannes von Meschede wieder ein im warmen Nest über dem Hooptal und gebrauchten geistlichen wie weltlichen Besen mit Kraft und bestem Willen – leider nur bis zum Jahre 1631.
Ich male es mir aus, wie nach der Schlacht bei Breitenfeld Herr Theodorus Berkelmann auf seinem Patmos sich aufhob, hinauskrähete und mit den Flügeln schlug, besonders mit dem lahmen Fittich! Unter dem Geleit schwedischer Reiter zog nun er wieder ein in Amelungsborn und soll den letzten Zisterziensermönch, den armen Bruder Philemon, am Ohr aus dem Klostertor geführt und auf die Kölnische Landstraße weserwärts hingewiesen haben. Wie noch die Fortun’ in dem großen Kriege wechseln mochte, in Amelungsborn wurde der reine Glaube von nun an nicht mehr behelligt, außer vielleicht durch zu leichte Kost und durch zu gewichtige Schulden. Herrn Theodoro folgte auf dem jetzt ziemlich unbehaglichen Stuhl noch Dr. Statius Fabricius, der im Grunde als der letzte wirkliche Abt von Amelungsborn zu rechnen ist; denn nach ihm hatte das herzogliche Konsistorium zu Wolfenbüttel einen der Zeitenklemme angemessenen Gedanken. Es schlug zwei schwarze Brummer mit einer Klappe. »Wozu brauche ich noch einen Abt zu Amelungsborn, wenn ich schon einen Generalsuperintendenten zu Holzminden sitzen habe?« fragte es, – und:
»Dich will ich belehnen mit Ring und mit Stabe, Dein Vorfahr besteige den Esel und trabe«,
summte es noch vor Gottfried August Bürger, und Herr Hermannus Topp rückte als der erste Generalsuperintendent in Holzminden und Abt von Amelungsborn auf die Prälatenbank der Lande Braunschweig-Wolfenbüttel. Die Güter, die liegenden Gründe der wackern, frommen und gelehrten Bruderschaft der Zisterzienser waren schon längst in ein Klosteramt verwandelt und einem landbauverständigen Klosteramtmann oder Drost untergeben worden, was zur Kenntnis der »Hausgelegenheit« dieser Geschichte jedenfalls mitzuteilen war. Doch die Hauptsache kommt, wie gewöhnlich, zuletzt.
Wie überall in braunschweigischen Landen gab die Deformation in sehr achtungswerter Weise mit der rechten Hand das, was sie mit der linken genommen hatte. Was die Mönche verloren, das bekamen die Wissenschaften. Fürsten wie Stände erhielten ihre Hände rein und können heute noch nüchtern-stolze Rechenschaft ablegen über die Anwendung der herrenlos gewordenen Güter und Besitztümer der römisch-katholischen Kirche. Da wurde die Universität Helmstedt errichtet, aus den Klöstern im Lande wurden »gelehrte Schulen« gemacht; und auch aus Amelungsborn, mitten im Walde, wurde solch eine »große« Schule; und wenn nicht alle, so hätten doch wohl manche der alten gelehrten Herren aus Cistercium her ihre Freude daran gehabt und gern auch ein Katheder darin vor der neuen Jugend bestiegen.
Diese Klosterschule kam sogar zu einem Ruf, besonders in der Mathematik. Zwei Jahrhunderte blühte sie in der Stille des Weserwaldes und trug gute Früchte. Dann aber war wieder die Welt eine andere geworden. Die Lehrerschaft versumpfte, das junge Volk verwilderte im Walde, die beiden ersten Schlesischen Kriege des jungen Fritz kamen dazu, und der dritte, der Siebenjährige Krieg des alten Fritze, schlug diesem gelehrten Wesen auf dem Auerberge über dem Hooptale völlig den Boden ein. Trotz Franzosen, Engländern und Schottländern im Lande behielt Karl der Erste zu Braunschweig-Lüneburg auch hierfür Zeit. Wahrscheinlich nach Rücksprache mit seinen trefflichen Männern von seinem erleuchten Collegio Carolino sah er, daß die Sache so nicht mehr ging.
»Eine hohe Schule der Wilddiebe konveniret weder Uns noch Unsern in Gott ruhenden Ahnen«, meinten Seine Hochfürstliche Durchlaucht und holten den Cötus weg aus dem Walde und die Lehrerschaft aus dem Sumpfe.
Wer heute auf der Weser zu Berg oder zu Tal fährt, der bemerkt bei der guten Stadt Holzminden ein stattlich Gebäude, an dessen Giebel die Worte stehen:
DEO ET LITTERIS.
In diesen Worten wächst heute noch weiter, was im Jahre 1124 von den Mönchen aus Cisteaux auf dem Auerberge über dem Hooptal und dem Brunnen des frommen Bruders Amelung in den Boden gelegt worden ist. Aus der Klosterschule von Amelungsborn ist ein berühmtes Gymnasium geworden, und der jedesmalige Rektor darf sich immer auch noch Prior von Amelungsborn nennen und unterschreiben. Der Schreiber dieses hat da, so ums Jahr eintausendachthundertundvierzig unterm alten, wackern Schulrat Kokenius, auch einmal eine Schulbank abgerieben. Er läßt es seine erlauchten Vorfahren in der Gelehrsamkeit, die klugen und ehrwürdigen Brüder Zisterzienser, durchaus nicht entgelten, wenn er wenig gelernt hat in Holzminden. Zur Tugend der Wahrhaftigkeit ist er jedenfalls dort angehalten worden, und wenn er mal bei einem Datum und Faktum sein Recht als Poete zu scharf nimmt, so sollen weder Cistercium bei Dijon noch Amelungsborn am Odfeld und auch nicht Holzminden an der Weser was dafür können und sollen sich bei ihrem Besserwissen beruhigen dürfen. Von dem heiligen Bernhard von Clairvaux redet er übrigens nicht ganz so schlimm wie Friedrich von Schiller und Wolfgang von Goethe. Daß Doktor Martin Luther den Mann »höher denn alle Mönche und Pfaffen auf dem ganzen Erdboden« hielt, spricht immer mit, wenn es sich darum handelt, in Kloster Amelungsborn Hausgelegenheit zu erkunden.
Zweites Kapitel
Die große Waldschule hatte wandern müssen, und der Klosteramtmann war geblieben und hatte, sich die Hände reibend, gemeint, nun sei endlich wohl für ihn die bessere, die ruhigere Zeit gekommen, und – hatte sich sehr geirrt, wie man sich eben bei seinen Hoffnungen und Wünschen dann und wann im Leben zu irren pflegt. Der Mann hatte für sein Teil Ruhe und Behagen in der Welt zu wenig mit den übrigen Zeitumständen gerechnet. Im Jahre 1761 gab es trotz des Abzuges des Cötus keine Ruhe in und um Kloster Amelungsborn, weder für den Herrn Amtmann noch die andern In-und Umsassen der Stiftung Siegfrieds von der Homburg.
Das Verhältnis zwischen der Schule und dem Amt war immer nicht das beste gewesen; aber im Verlaufe des achtzehnten Jahrhunderts hatte es sich derartig verschlechtert, daß es zuletzt gar nicht schlimmer mehr werden konnte. Zu verwundern war’s grade nicht. Sie saßen einander zu nahe und mit sich zu sehr widersprechenden Interessen auf dem Kasten. Ihre Anschauungen über Recht, Rechte, Berechtigungen, über Moral, Tugend, Sitte und Gewohnheit, ja im pursten, krassesten, blassesten Sinne über Mein und Dein waren allzu verschieden. Sitte, Gewohnheit, Recht liefen zwischen beiden Mächten allgemach nur darauf hinaus, sich gegenseitig den größtmöglichen Verdruß und Tort, ja das gebrannteste Herzeleid anzutun.
»Lieber die Franzosen, solange es ihnen beliebt, im Lande als diese gelehrte Kumpanei von Schlingeln, Lümmeln, Flegeln und Spitzbuben einen Tag auf dem Buckel!« hatte der Klosteramtmann schon seit Jahren geseufzt und geflucht. Ach, leider, ohne zu ahnen, wie bald und wie sehr ihn das Schicksal beim Wort nehmen werde!
Nun hatte er von der ganzen Schule nur noch den Magister Buchius im Hause, aber volle Gelegenheit, es auszuprobieren, ob es sich mit dem Herzog von Soubise, dem Marschall von Broglio, dem Marquis von Belsunce und dem Vicomte von Poyanne behaglicher Kirschen essen lasse als mit den gelehrten und ungelehrten, den jungen und alten Erbnehmern der Zisterzienser von Amelungsborn.
Wir reden mit ihm wohl noch einmal darüber oder hören seine Meinung aus der Vergangenheit. Fürs erste haben wir es vor allen Dingen mit dem Magister Noah Buchius zu tun, den die Klosterschule bei ihrer Auswanderung allein zurückgelassen hatte auf dem Auerberge, wie man beim Auszug, halb des Spaßes wegen, einen alten, zerrissenen Rock am Nagel, einen alten, bodenlosen Korb im Winkel, ein altes, vermorschtes Faß im Keller zurückläßt und das alles dem von seinen Nachfolgern schenkt, der es haben will oder es mit in den Kauf nehmen muß. Der Amtmann hatte den letzten Magister von Amelungsborn mit in den Kauf zu nehmen, nur auf allerhöchsten Spezialbefehl von Braunschweig aus auf Gutachten herzoglichen Consistorii zu Wolfenbüttel. Wir aber heute, wir würden wohl nicht nach dem Herrn Amtmann in die Tage der Vergangenheit zurückgehorcht haben, wenn dem nicht so der Fall gewesen wäre. Wir haben dann und wann eine Vorliebe für das, was Abziehende als gänzlich unbrauchbar und im Handel der Erde nimmermehr verwendbar hinter sich zurückzulassen pflegen. Wir nehmen manchmal das auch etwas ernster, was die Menschheit in ihrer Tagesaufregung nur für einen guten Spaß hält. Oh, wir können sehr ernsthaft sein bei Dingen, die den Leuten höchst komisch vorkommen. –
Ach Gott, ach Gott, sich in einer Welt zu finden, in der man sich gar nicht zurechtzufinden weiß! Das Los war dem armen letzten Magister von Kloster Amelungsborn im vollsten Maße zuteil geworden. Als Sohn des Pastors von Bevern war er geboren worden, in Helmstedt hatte er Theologie studiert, aber sich auf der Kanzel nimmer auf das besinnen können, was er der christlichen Gemeinde aus bestem Herzen sagen wollte. Auf drei oder vier adeligen Gütern zwischen der Weser und der Leine hatte er das bittere Brod des Präzeptorentums des achtzehnten Jahrhunderts gegessen und zuletzt – vor Jahren, Jahren, Jahren – sehr verhungert an die Pforte geklopft, durch die sein Ahnherr vordem in Würden ein und aus gegangen war.
Wohl mit seines Familiennamens und des Ahnherrn wegen hatte man ihm diese Tür nicht auch vor der Nase zugeschlagen, sondern ihn durch sie eingelassen und ihn zuerst auf Probe und sodann aus Gewohnheit, Mitleid, und um immer einen Sündenbock zur Hand zu haben, im Lehrerkonvent behalten. Der Cötus aber hatte ihn sofort bei seinem Taufnamen gefaßt und ihn als »Vater Noah« gewürdigt – wenn auch leider mehr im Sinn des bösen Ham als des braven Sem und des biedern Japhet. Daß die Generationen von Schulbuben, die während seiner Lehrtätigkeit im Kloster vor seinem Katheder in der Quinta vorübergingen, nicht auch so schwarz wurden wie die Nachkommen des schlimmen Ham ob ihrer Versündigungen an ihm, das war ein Wunder. Verdient hätten sie es sämtlich.
Als Dreißigjähriger war er gekommen, nun war er den Sechzigen nahe und hatte also ein Menschenalter im Dienst der hohen Schule zu Amelungsborn hingebracht. Seltsamerweise konnte man eigentlich nicht sagen, daß diese Jahre wie römische Feldzüge doppelt gezählt hatten. Er konnte trotz ihnen ein recht alter Mann werden und »der Menschheit bis ans Hundertste heran auf dem Halse liegen«. Solche Bosheit und Rücksichtslosigkeit hätte sogar ganz zu seinem Charakter gepaßt, der von seiner Mutter Brust an etwas Hinterhaltiges an sich gehabt hatte, etwas Sich-Anhaltendes, etwas Festklebendes, etwas auf keine Manier Wegzuekelndes.
Wenn er ein Held war, so war er ein vollkommen passiver, und diese pflegen es dann und wann vor allen andern Menschenkindern zu einem hohen Alter zu bringen, wenn auch nicht immer zu einem gesegneten.
Dreißig Jahre Schuldienst als der Sündenbock und Komikus der Schule! Der gute Mann mit dem ernsthaften Kinderherzen! Der von Mutterbrüsten an alte Mann mit der scheuen, glückseligen Seele der guten Kinder!
Wer in Kloster Amelungsborn hätte ihn missen mögen, da er einmal da war? Wer hätte nicht sein Behagen an ihm genommen? Wer hätte nicht seinen Ärger oder seinen Witz an ihm ausgelassen, und zwar ohne sich vorher nach seinen Stimmungen für beides ein wenig umzusehen? Im Lehrerkonvent wie im gesamten Cötus wußten sie, was sie an ihm hatten, und wußten ihn danach zu schätzen.
Und doch – doch hatten sie ihn bei ihrem Abzuge nicht mit sich genommen nach Holzminden, in die neue gelehrte Herrlichkeit, sondern ihn zurückgelassen am alten Ort, allein in den leeren Auditorien und Dormitorien, vor den jetzt so gespenstischen Subsellien und in seiner Zisterziensermönchszelle über dem Hooptale als das unnützeste, verbrauchteste, überflüssigste Stück ihres Hausrats! Man hatte einfach eben wieder einmal nicht gewußt, was man tat, – wer kann denn aber im Tumult des Lebens und eines Hauswechsels sich recht auf alles besinnen? Freilich hatte man von Wolfenbüttel aus auch sein Wort dazu gegeben. Dort wußten sie noch weniger, was der Magister Buchius wert war, und glaubten mit seiner Emeritierung ganz das Richtige zu treffen. Dreißig Reichstaler des Jahres ließen sie ihm und die Zelle des Bruders Philemon bis zu seinem Lebensende. Und mit Kost, Licht und Feuerung wiesen sie ihn leider Gottes auf das Klosteramt und den Klosteramtmann an. In Anbetracht, daß man sich mitten in den Kriegen des Königs Fritzen befand und Geld rar war, Kost, Licht und Feuerung auch nicht jedermann vom Heiligen Römischen Reiche garantiert wurden – hätte sich der Magister für den undankbarsten Kostgänger des allgütigen Herrgotts erachtet, wenn er darob, nämlich über die Verweisung an den Herrn Klosteramtmann, sich über einem Murren betroffen hätte. Herr Gott, wo bliebe Dein Titel Zebaoth, Herr der Heerscharen, wenn Du allen Deinen Kostgängern das Gemüte gegeben hättest, ihr Tischgebet und Nachtgebet so zu sagen wie Dein letzter Magister und Quintus von Amelungsborn, der alte Buchius? Du hast es nicht getan, und so ist es nicht meine Schuld, wenn auch diese Historie einmal wieder zum größten Teil vom Gezerr um die Brosamen handelt, so von Deinem Tische fallen, Herr Zebaoth.
Drittes Kapitel
»Diese Bewegung ließ uns mutmaßen, daß der Herr Herzog Ferdinand von Braunschweig sich dort lagern wollte, um die noch übrigen Lebensmittel in der Gegend aufzuzehren«, klagt ein französischer Feldbericht aus dem Spätherbst des Jahres 1761, ehe beide kriegsführenden Parteien zum vorletzten Male die Winterquartiere bezogen und sich häuslich und gemütlich darin einrichteten. Du barmherziger Himmel, die »noch übrigen Lebensmittel«! Was hatten diese scheuen, bescheidenen, schämigen, mit allem zufriedenen Verbündeten der Frau Kaiserin-Königin Maria Theresia, diese liebsten Gäste des deutschen Volkes Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht dem armen Herzog Ferdinand von Braunschweig noch viel übriggelassen an Nahrung für ihn selbst, seine Leute und sein Vieh, sowohl am linken wie am rechten Ufer der Weser, sowohl in Westfalen wie in Ostfalen? Und sie hatten doch wahrlich auch den Klosteramtmann zu Amelungsborn nicht gefragt, was ihm entbehrlich sei zum Unterhalt seiner selbst, seiner Leute und seines Viehs.
Wenn ein Mensch vom Sommer des Jahres an über ihr freundlich Zugreifen ohne Nötigung nachsagen konnte, so war das der Amtmann von Kloster Amelungsborn.
Aber Magister Buchius auch.
Jaja, was für Witterung für den Gelehrten allezeit sein mochte: für den Ökonomen war dazumal kein gutes Wetter. Kisten und Kasten, Scheunen und Ställe waren leer, ohne daß diesmal zu große Trocknis, zu arge Feuchte, Hagel, Rotz, Räude, Würme und Mäusefraß mit dem betrübten Faktum das mindeste zu schaffen hatten. Den Hagel, der die Saaten niederschlug, die Mäuse, welche die Scheunen und Vorratskammern leer machten, hatte sich das deutsche Volk, Fürsten und Untertanen in einem Bündel, selber dazu eingeladen. Es ist heute noch nicht von Überfluß, wenn man die zwischen Vogesen und Weichsel deutsch redende Bevölkerung mit der Nase auf ihre Dummheit stößt. Bis wir zu unserer Geschichte gelangen, hat sich der Herr von Belsunce schon verschiedene Male recht satt gefressen im Tilithi-Gau, und es hat dem General von Luckner wenig genützt, ihn heraus-und auf Göttingen hinzutreiben. Der teuere Erbfeind hat dort durchaus keine Kollegia über Humaniora belegt, sondern treibt von der neuen, berühmten deutschen Universitätsstadt nur in praxi deutsche Reichshistorie nach gewohnter Weise weiter. – –
Ein trüber Tag des Novembers siebenzehnhunderteinundsechzig neigte sich seinem Ende zu, als sie auf der alten Köln-Berliner Landstraße zusammentrafen, der Klosteramtmann von Amelungsborn und sein Hausgenosse, der Magister Buchius, der Ex-Kollaborator am alten Ort der alten Klosterschule.
Der Wind fuhr über die Stoppeln; aber die, welche das Korn gesäet hatten, hatten es wahrlich, wie gesagt, zum wenigsten Teil für sich selber geerntet. Die Waldungen trugen überall Spuren, daß Heereszüge sich ihre Wege durch sie gebahnt hatten. Überall Spuren und Gedenkzeichen, daß schweres Geschütz und Bagagewagen mit Mühe und Not über die Straße und durch die Hohlwege geschleppt worden waren! Zerstampft lagen die Felder und Wiesen. Kochlöcher waren überall eingegraben, Äser von Pferden und krepiertem Schlachtvieh noch unheimlich häufig unvergraben in den Gräben und Büschen und an den Wassertümpeln der Verwesung überlassen. Es war weder für den gelehrten noch den ökonomischen Mann ein Anblick zum Ergötzen, und sie machten beide die Gesichter danach, als sie an diesem Vierten des Wind-und Reifmonds an einer Wendung der Straße in der Nähe des Dorfes Negenborn plötzlich voreinander standen.
»Er auch noch hier draußen, Magister?« schnarrte der Amtmann, sein spanisch Rohr dem alten Herrn dicht vor den Füßen grimmig in den Boden stoßend. »Steht Er wieder da und gafft und seufzt Seiner vergangenen Herrlichkeit und Seinem passierten Elend nach? Wurmt es Ihm denn noch immer so sehr, Herr, daß Er einen um den andern Tag hier herauslaufen muß, um Seiner gottverdamm – Seiner Sauschule nachzubölken wie eine Kuh, der der Schlächter das Kalb abgeholt hat? Er sollte doch wahrhaftig Seinem Herrgott danken, daß Ihm noch niemand die Stubentür eingetreten hat und Er dahinter, wenn Er will, in Ruhe sitzen kann mit allen Seinen unturbierten Schrullen, Grillen und Phantasierereien. Wer doch in Seiner Haut steckte, Herr! Herr, nehme Er’s mir nicht übel, trifft man ihn so auf dem Spazierwege, so wird’s einem erst richtig klar, in welchem Elend man selber itzo seine Tage zu versorgen hat, einerlei, ob man das Haus voll hat von den Völkern Seiner Durchlaucht oder des Marschalls von Broglio. Hu, wer den Caraman und den Chabot schinden wollte, wie sie den Klosteramtmann von Amelungsborn geschunden haben!«
Der letzte Seufzer stammte noch aus den Tagen des Septembers und Oktobers des Jahres, wo der Generalmajor von Luckner wohl sein möglichstes getan hatte, um dem Grafen von Caraman und dem von Rohan Chabot den Aufenthalt in Amelungsborn zu verleiden, aber noch lange nicht genug, um der Stimmung des Amtmanns gegen die beiden Herren gerecht zu werden.
Die »Geschicklichkeit« des Herrn Generals von Luckner hatte leider nur für kurze Zeit »Mittel gefunden, den Feind aus der schönen Gegend, die er besetzet hatte«, zu vertreiben. Die streifenden Scharen der kriegführenden Parteien drangen schon von neuem auf einander in der »schönen Gegend«, und der Amtmann von Amelungsborn hatte heute nicht ohne seine Gründe dem eigenen Jammer zu Hause den Rücken gewendet, um mit den nächstgelegenen Bauern über den ihrigen Rücksprache zu nehmen. Daß sie das Beispiel des wackern Ostfriesen Hajo Cordes nachahmen und sich mit der Axt ihrer Haut wehren möchten, verlangte er wahrlich nicht. Eine Verordnung des Marschalls Duc de Broglio hatte er als »Baillif du lieu« ihnen von neuem einzuschärfen gehabt. Wer in den von den Truppen Seiner Allerchristlichsten Majestät in Besitz genommenen hannoverschen und braunschweigischen Landen sich mit seinen »Effekten, Pferden, Horn-und anderm Vieh« vor den hohen Alliierten der römischen Kaiserin in die Wälder flüchtete und nicht gleich zurückkam, wenn die Karabiniers und Husaren von Berchini, die Dragoner von Languedoc und Orleans, wenn Regiment Beaufremont, Regimenter Pikardie, Auvergne und Navarra oder gar die Freiwilligen von Austrasien und die Garde Lorraine ins Dorf rückten, dem wurde einfach das Haus angesteckt, die zurückgelassene Großmutter zu Tode geprügelt, er selber aber ohne Gnade vor seiner Tür gehängt, wenn man ihn mit seinen Habseligkeiten in den Schlüften und Klüften ertappte, aufgrub und ihn in sein Dorf zurückgeschleppt hatte.
»Und fünfzehn vierspännige Wagen für den Commissaire de guerre zu jeglicher Stunde bereit, Leute –«
»O du barmherziger Himmel!« hatten die Hohlenberger, die Golmbacher und die Negenborner geheult, und der Klosteramtmann von Amelungsborn hatte wohl einigen Grund für den Ton, mit welchem er seinen alten gelehrten Leibzüchter gröblich anschnauzte:
»Treibe Er sich nicht länger draußen unnützlich herum, wenn ich Ihm raten darf, Magister. Komme Er mit nach Hause. Wozu stehet Er da und starret in die Bestialität, da Er es nicht nötig hat? Was sieht Er wieder im Himmel und auf Erden, was andere Leute nicht sehen? Des Herrn Güte und der Menschen Wohlgefallen aneinander? Er übergelehrter Rab mitten im Dritten Schlesischen Kriege! Ho, ho, da, ich nehme Ihn unterm Arm, daß man doch einen auf dem Wege nach Hause hat, an den man sich halten kann. Was Er mir wert ist in seinem und meinem Leben, das weiß Er ja.«
Magister Buchius hatte einigen Grund, wenn auch aus andern Gründen, das Weiße im Auge zu zeigen wie die Negenborner, die Golmbacher und die Hohlenberger – auch die nächsten Nachbaren des Klosteramtmanns von Amelungsborn; – willenlos wendete er wie so oft in seinem Dasein um und ließ sich dem Belieben eines andern nachziehen.
Diesmal auf der aufgeweichten, zerfahrenen Landstraße, die von Hause her und nach Hause zurück führte und die er am Nachmittag wirklich nur beschritten hatte, um aus der unruhigen Gegenwart nach einer ebenso unruhigen Vergangenheit sich zurückzuträumen. Wie ihm sein unwirscher Begleiter seine bis dato uneingestoßene Stubentür rühmen mochte: das öde Feld und der ruinierte Handels-und Kriegspfad konnten nur zu oft doch auch als Zuflucht für ein vom Lärm der Zeit verwirrtes, betäubtes Menschen-und Homme-de-lettres-Gemüt vorzuziehen sein.
»Hat Er es denn wirklich noch immer nicht aufgegeben, Buchius, hier den Weg nach Holzminden hin zu laufen wie Seinem verlorenen Glücke nach? Glaubt Er denn immer noch, sie werden eine Abgesandtschaft schicken, um Ihn mit Lorbeerblättern, Pauken und Trompeten sich nachzuholen, weilen sie doch eingesehen haben, daß sie Ihn nicht missen und entbehren können?« fragte der Amtmann wiederum und setzte nochmal hinzu: »Er sollte doch wahrhaftig an Seinem vergangenen Pläsier und Ärger genug haben und sich Seines otium cum dignitate in Ruhe freuen.«
»Cum dignitate«, seufzte der alte Herr im schäbigen Schwarz und in Schnallenschuhen neben dem untersetzten, vierschrötigen Begleiter in Stulpenstiefeln und in grünem Flaus, und ein wehmütiges Kopfschütteln begleitete das Wort.
»Jaja«, lachte der Amtmann, »da mag Er wohl recht haben mit Seinem Stöhnen. Viel Glorie war nicht in der Art, wie man Ihn aufs Altenteil schob, und ich kann’s Ihm nicht verdenken, wenn Er auch noch eine Pike auf die saubere hochgelahrte Gesellschaft hat, die ihn so ganz und gar nicht mehr brauchen konnte, sondern Ihn hier bei uns ganz allein Seiner eigensten, angebotenen Dignität überließ. Nu, die hat Er aber ja auch sicher – das nimmt Ihm anjetzo keiner mehr, daß Er nun der Gelehrteste und Weiseste in ganz Kloster Amelungsborn ist. Da wende Er sich nur dreist an mich, wenn Ihm einer auf dem Amt, Mensch oder Vieh, dagegen anbocken will – ha, ha, ha, ho, ho, ho, ho.«
Es war ein ungeschlachtes Lachen, welches die Rede des Mannes beschloß, aber so ganz übel war sie doch nicht gemeint, die Rede nämlich. Der Amtmann von Amelungsborn wußte ganz genau, was er an seinem »letzten Ruderum« von seiner »verflossenen Klosterschulschande« hatte. Freilich, was er ihm bieten konnte, wußte er auch und machte in der übelsten Laune am liebsten Gebrauch von seiner Macht, einer armen, vor Weisheit unbrauchbaren Kreatur des Herrgotts das kümmerliche Leben noch mehr zu verkümmern.
»Der Herr Amtmann wissen, wie ich freilich mit meinem Leben und Frieden auf Dero Wohlmeinen und guten Rat in allen Dingen angewiesen bin«, sagte der Magister, doch sein Begleiter kam nicht zu einer zweiten Lache. Ein seltsam Phänomen und Naturspiel zog die Aufmerksamkeit beider Männer an und hielt sie dauernd fest.
Sie standen still und sahen beide auf.
Vom Südwesten her über den Solling stieg es schwarz herauf in den düstern Abendhimmel. Nicht ein finsteres Sturmgewölk, sondern ein Krähenschwarm, kreischend, flügelschlagend, ein unzählbares Heer des Gevögels, ein Zug, der nimmer ein Ende zu nehmen schien. Und vom Norden, über den Vogler und den Ith, zog es in gleicher Weise heran in den Lüften, wie in Geschwader geordnet, ein Zug hinter dem andern, denen vom Süden entgegen.
»Ich bitte Ihn, Herr«, rief der Amtmann. »Sie fliegen wohl ihrer Natur nach zu Haufen; aber hat Er je dergleichen Vergadderung des Gezüchts wahrgenommen?«
»Wahrlich nicht! O sehe der Herr doch, es ist, als würden sie von kriegserfahrenen Feldherren geführt. Sie halten an. Sie schwenken wie zur Schlachtordnung ein. Sie rüsten sich wie zur Bataille.«
»Bei uns! Herr, bei uns! Dort über dem Odfelde, über dem Quadhagen! So sehe Er doch, sehe Er doch, Magister! Soll man denn hier seinen leiblichen Augen trauen dürfen? Sie fahren wahrhaftig auf sich los, sie brechen auf einander ein, dort dem Quadhagen zu und über dem Odfelde!«
»Über dem bösen Gehege – dem Campus Odini, dem Wodansfelde! Man sollte es fast als ein Praesagium nehmen, daß sie sich gerade diese Stätte zur Ausfechtung ihrer Streitigkeiten auserwählt haben. O siehe, siehe, siehe, und immer mehr, immer neuer Zuzug von Mittag wie von Mitternacht. Ei wahrlich, da wird uns die Vergünstigung, einem seltenen, einem einzigen Schauspiele beizuwohnen.«
»Herr, das nennt Er eine Vergünstigung?« rief der Klosteramtmann von Amelungsborn, doch in diesem Moment, bei diesem wunderbaren, vor ihren Augen sich abspielenden Spektakulum war er dem letzten wirklichen, ortsangehörigen Magister der alten Kulturstätte in keiner Weise mit seinen Bemerkungen und dergleichen gewachsen.
Der alte Herr stand ihm und der ganzen gegenwärtigen Welt entrückt ob der »Vergünstigung«, die ihm hier und jetzt zuteil wurde, nämlich vielleicht dermaleinst von einem wirklichen Portentum aus eigener Erfahrung und vom persönlichen Aspekt her nachsagen oder gar auch schreiben zu dürfen.
Jetzt war er es, der den Arm seines tagtäglichen Leib-und Lebens-Despoten gefaßt hielt und den verstörten Mann mit ausgestrecktem Zeigefinger und mit glänzenden Augen hinwies auf das, was sich da in den Lüften zutrug.