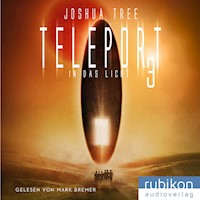4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöses Signal, ein Start-up, das die Welt verändern will und eine Zukunft, die nicht mehr uns gehört. Als in der Weite der finnischen Wälder ein Fremder mit einem High-Tech-Implantat gefunden wird, wittern der Neurochirurg Bill und sein Freund und Informatiker Steve die große Chance, ihrem Start-up zum Durchbruch zu verhelfen. Doch sie wissen nicht, mit welchen Mächten sie sich einlassen und müssen sich schon bald fragen, über welche Grenzen sie für ihren Erfolg bereit sind zu gehen. Zehn Jahre später hat sich die Welt verändert. Luftschiffe ziehen über den Himmel, fremde Pflanzen wachsen in den Wäldern und ganze Landstriche sind verlassen. Inmitten dieser fremden Welt kämpfen ein Vater und seine Tochter in den Bergen Montanas ums Überleben und darum, nicht von "den Anderen" entdeckt zu werden. Wenn sie noch eine Zukunft haben wollen, müssen sie herausfinden, was es mit dem mysteriösen Signal auf sich hat, das sie empfangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DAS SIGNAL
Joshua Tree
Philipp Tree
DAS SIGNAL
Science Fiction Thriller
Joshua Tree & Philipp Tree
Lektorat & Korrektorat: Gabriele Rögner
Besonderer Dank: Viktoria M. Keller
Cover: Elementi.Studio
Unter Verwendung von folgendem Bildmaterial:
Wald by JillWellington, pixabay.com, Sternenhimmel by StockSnap, pixabay.com, Hütte by Nathan Dumlao, unsplash.com
1. Auflage, 2019
© Alle Rechte vorbehalten.
Joshua Tree Ltd.
Kronou 70, App 202
1026 Nicosia
Zypern
www.weltenblume.de
www.philipptree.de
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort7
2. Prolog9
3. Helsinki, 11.01.202018
4. Die Falle33
5. Helsinki 12.01.202046
6. Der Schatten59
7. Helsinki 14.01.202072
8. Der Hirsch87
9. Helsinki 20.01.2020100
10. Die Tür113
11. Helsinki 11.05.2021127
12. Der Keller140
13. Helsinki 27.05.2021153
14. Das Signal166
15. Helsinki 28.05.2021179
16. Der Andere191
17. Helsinki 29.05.2021205
18. Die Flucht218
19. Helsinki 16.06.2021232
20. Das Implantat247
21. Unbekannt 17.06.2021261
22. Die Unschuld275
23. Helsinki 17.06.2021290
24. Die Neue Welt305
25. San Francisco 09.01.2022319
26. Die Metawelt333
27. San Francisco 05.03.2024348
28. Das Treffen358
29. Epilog378
30. Nachwort: Philipp und Joshua im Gespräch382
31. Glossar386
32. Personenverzeichnis395
Für Pea und Om.
1. Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
nanu, was steht denn da auf dem Cover? Joshua Tree und Philipp Tree? Ja, richtig gelesen. Es gibt zwei von unserer Sorte. Der eine schreibt seit 2017 Bücher, der andere kümmerte sich bisher als leitender Oberarzt um seine Patienten. Aber: Leser von Joshua Trees Büchern kennen Philipp Tree schon, ohne es zu wissen, und zwar hat er das eine oder andere Mal als Skriptdoktor ausgeholfen, wenn sein jüngerer Bruder nicht weiter wusste. Auch die vielen medizinischen Passagen bisheriger Bücher fanden seine helfende Hand. Ein wenig seiner Kreativität ist also seit geraumer Zeit zwischen den Zeilen in den Plots und Szenen der Joshua Trees zu finden. Aus dieser Kreativität ist jetzt eine lesbare Handschrift geworden, denn »Das Signal« ist unser erstes gemeinsames Buch, an dem wir schon seit etwa einem Jahr herumdoktern. Bislang haben wir allerdings zwischen Weltreise und Klinik keine Zeit gefunden. Im Januar 2019 sollte aber alles anders werden und wir haben uns zusammen eingeschlossen und den bereits vorformulierten Plot mit heißer Feder in ein fertiges Buch gegossen. Dabei hatten wir eine Menge Spaß, wie man an den ein oder anderen augenzwinkernden Referenzen erkennen kann. Wir haben uns einige Späße und pop- sowie nerdkulturelle Anspielungen erlaubt, die Ihnen hoffentlich häufiger ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Diese Verweise spiegeln sehr gut wider, was uns im Kreativen als Brüder verbindet: Wir sind mit denselben Serien, Computerspielen und Büchern aufgewachsen, haben so ziemlich denselben Geschmack, der sich erst bei Dr. Who trennt und sind das weltweit (anerkannt!) unschlagbarste Team wenn Tabu gespielt wird. Häufig reichen nur ein oder zwei Worte und wir wissen, was der jeweils andere sagen will. So ähnlich war es auch bei der Ausarbeitung und Umsetzung dieses Buches. Wir haben uns erstaunlich flüssig und einmütig die Bälle zugespielt und die Story zu Papier gebracht, die wir erzählen wollten. Mit »Das Signal« halten Sie nun den ersten Band einer Reihe in den Händen, die wahrscheinlich eine Trilogie werden wird. Wir hoffen, dass Ihnen dieser doppelte Tree gut gefällt, und freuen uns sehr über Rückmeldungen und Feedback. Das Schönste wäre nämlich, diese Zusammenarbeit in Zukunft noch vertiefen zu können.
Herzlich, Philipp & Joshua Tree
2. Prolog
Östliches Finnland, 11.01.2020
»Hooo!«, machte Mika und winkte Kimo vom Bug des kleinen Motorboots aus zu, damit der die Geschwindigkeit drosselte. Kurze Zeit später knirschte feiner Kies unter der Aluminiumhartschale und er reckte einen Daumen hoch. So flink, wie sein mittlerweile stattlicher Bauch es zuließ, sprang er auf den kleinen Strand und zog das Seil hinter sich her, das am Bug befestigt war, und machte es an einem vereisten Baum fest.
»Die Nacht ist wirklich erstaunlich klar«, meinte Kimo, als er den Motor gestoppt und die erste Kiste an den Strand getragen hatte. Mit zufriedenem Gesichtsausdruck starrte er in das endlose Schwarz mit den zahllosen, funkelnden Sternen hinauf. Sein Atem legte sich immer wieder als feiner Nebel über das Sternenband – passend zu dem weißen Schimmer der Milchstraße, die sich als heller Streifen von der Schwärze abhob.
»Kyllä! Einen besseren Blick kriegen wir wohl nicht.«
»Ich hoffe nur, dass die Fahrrinne nicht zufriert ehe wir wieder abfahren«, gab Kimo zurück und deutete auf den dunklen Streifen, der vom Strand durch die weiße Fläche des zugefrorenen Sees zum Parkplatz, an dem sie ihren Wagen abgestellt hatten, führte.
Mika nestelte an seinem Handgelenk, um Handschuhe und Ärmel voneinander zu trennen und auf die Uhr schauen zu können. »Minus zwölf Grad. Aber wir haben kaum Wind, ich denke, dass wir kein Problem haben werden.«
»Alles klar, nach Hause fahren wir jetzt sowieso nicht mehr. So ein wichtiges Ereignis mit einem so klaren Himmel kriegen wir alten Säcke wahrscheinlich nie wieder geboten.«
Nachdem beide einen Schluck heißen Ingwertee aus ihren Thermoskannen genommen hatten, machten sie sich daran, den Inhalt der beiden Kisten auszupacken: Zwei baugleiche Teleskope vom Typ Skywatcher BlackDiamond NEQ-5 – wuchtige Rohre in glänzendem Anthrazit mit kräftigen Dreibeinen, jedes zehn Kilo schwer.
Die Insel, die sie seit zwanzig Jahren für ihre Hobbyastronomie nutzten, diente ihnen mit dem relativ langen Strand und dem kleinen Wäldchen im Sommer für ausgedehnte Camping- und Grillausflüge mit ihren Familien. Jetzt im Winter war der flache Strand perfekt, um mit Teleskopen den Nachthimmel abzusuchen – vor allem in einer so klaren Nacht, tief in der Natur und fernab der Lichtverschmutzung durch Städte und Dörfer.
Der Aufbau dauerte eine knappe halbe Stunde, in der sich ihre Finger in Eiszapfen verwandelten, und die tief eingeschneite Umgebung immer kälter zu werden schien.
»Ich hoffe, dass sich die Flugbahn nicht mehr groß verändert«, meinte Mika irgendwann und blies sich warme Atemluft in die Hände, bevor er die letzten Stellschrauben festzog, nachdem er die Höhe des Stativs eingestellt hatte.
»Bisher waren die ESA-Daten zur Berechnung der Flugbahnen noch bei jedem Kometen extrem genau. Wieso sollte es diesmal anders sein?«
»Keine Ahnung, die NASA hat auch zwei Wochen lang gesagt, die Voyager 1 sei nicht verschwunden, sondern in einen geplanten Kommunikationsstopp getreten. Was haben sie gestern in der Pressemitteilung verlautbart?«
»Dass der Kontakt abgebrochen ist«, antwortete Kimo und sah seinen Freund von der Seite an. »Aber das ist was anderes als zu verschwinden. Das Ding ist über vierzig Jahre alt, ich halte es für ein Wunder, dass es überhaupt so lange durchgehalten hat da draußen.«
»Früher wurden die Sachen eben noch solide und für die Ewigkeit gebaut.«
»Stimmt.«
»Hullu!«, rief Mika plötzlich und deutete mit einem breiten Grinsen, das seinen gefrorenen Bart wackeln ließ, auf den kristallklaren Nachthimmel.
Kimo folgte seiner Geste und machte große Augen. Eine Kaskade heller Sternschnuppen blitzte oberhalb des Sternbilds Aquila auf.
»Mann, das fängt ja gut an! Hullu!«
»Wie lange noch, bis zum Vorbeiflug von Cassandra?«
»Zwölf Minuten«, gab Kimo nach einem kurzen Blick auf sein Smartphone zurück und kniff ein Auge zusammen, um durch sein Teleskop das Gestirn abzusuchen. Als er fortfuhr, klang seine Stimme nasal, weil sein gesamtes Gesicht zur Seite verzogen war: »Ich hoffe, dass die App präzise genug ist.«
»Du hast den Schweif doch in den Nachrichten gesehen. So ein riesiges Ding kann man gar nicht übersehen.«
»Ich hoffe, du hast recht.«
Die noch vorhandene Zeit verbrachten sie schweigend in der absoluten Stille der Abgeschiedenheit, die nur die östlichen Seengebiete Finnlands zu bieten hatten, und die sie beide so sehr liebten. Mika betrachtete für einige Zeit die Mondkrater, die ihn seit seiner Kindheit faszinierten. Für ihn sahen sie geradezu irdisch aus, was ihre extreme Entfernung zur Erde nur noch fantastischer wirken ließ. Alles am Mond war vertraut und gleichzeitig zutiefst fremd – ein Widerspruch, der ihn immer wieder zum kleinen Bruder der Erde zurückkehren ließ.
Irgendwann gab Kimos Smartphone einen hellen Dreiklang von sich und Mika lief ein Schauer der Aufregung über den Rücken. Der dichteste Vorbeiflug eines Kleinkometen in der Geschichte der Himmelsbeobachtung und sie hatten eine der klarsten Nächte erwischt, die sie sich für dieses kosmische Spektakel hatten wünschen können. Für einen Augenblick schien sich Mikas gesamtes Universum zu einer perfekten Synchronizität zusammenzufinden und er spürte eine Zufriedenheit, so vollkommen, wie er sie nur selten erlebt hatte.
Durch das Teleskop folgte sein rechtes Auge den eingeblendeten Bahnen der integrierten Sternenkarte, die den exakten Vorbeiflug von Cassandra vorhersagte. Er atmete einige Male ein und aus, vor lauter Vorfreude angespannt wie eine Sprungfeder, doch bis auf zwei kurz aufblitzende Sternschnuppen blieb der Himmel zwischen den funkelnden Sternen Schwarz.
»Hm, sind die Daten richtig?«, fragte er, das Gesicht noch immer zerknautscht und das Auge dicht an das kleine Rohr gepresst, damit er nicht Gefahr lief, doch noch etwas zu verpassen.
»Ich denke schon. Ich schaue mal auf die App, sag Bescheid, wenn du irgendwas siehst, ja?«, antwortete Kimo und es raschelte kurz, als er sein Smartphone aus der Tasche kramte.
»Und?«
»Paska!«, fluchte Kimo und Mika zog sich enttäuscht von seinem Teleskop zurück.
»Wir haben ihn verpasst, oder?«
»Nein, die App sagt, dass der Sichtkontakt verloren gegangen ist.«
»Was? Wie kann das sein?«
»Wahrscheinlich wieder wie vor zwei Jahren als der Komet Barb 22-1 vorbeifliegen sollte, über Südamerika auseinandergebrochen ist und als Sternschnuppenschauer geendet hat.« Kimo schnaubte frustriert und trat so heftig gegen einen der größeren Kieselsteine des Strands, dass der in den Tiefschnee auf dem See flog.
»So eine Scheiße! Ich dachte, dass diese Eierköpfe von den Raumfahrtbehörden wenigstens rechnen können«, grollte Mika und schüttelte enttäuscht den Kopf, als etwas in seinem Blickfeld aufflackerte und er sich zur Seite drehte. »Au Mann!«
»Was denn?«, fragte Kimo, der bereits begonnen hatte, sein Teleskop abzubauen. »Die ganze Scheiße umsonst rausgeschleppt.«
»Da hat schon wieder jemand sein Haus abgefackelt.« Mika deutete nach Osten, wo ein heller Lichtschein am Horizont über den Baumwipfeln aufleuchtete.
»Die Russen lernen einfach nicht dazu. Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder unseren Wald niederbrennen, weil deren Feuerwehr zu unfähig oder besoffen ist.«
»Paska Venäjä!«
»Das kannst du laut sagen«, brummte Kimo zustimmend und schloss seine Kiste ab. Kurze Zeit später hatten sie das Boot bepackt und fuhren durch die Dunkelheit auf dem See in Richtung Parkplatz. Mika leuchtete am Bug die schmale Fahrrinne aus, in der das Wasser wie Quecksilber im Sternenlicht schimmerte und irgendwie gruselig aussah.
Am Ziel angekommen, hievten sie das Boot auf den Anhänger von Kimos Toyota Landcruiser und deckten es mit einer Plane ab, bevor sie sich in jenen setzten und die Heizung aufdrehten.
»Das ist echt eine Kacke, Mann«, seufzte Kimo, als sie auf die kleine Landstraße abbogen, die vom Mekrijärvi See in ihr Dorf Putkela führte. Als im Radio Korpiklaani mit ihrem Lied Tapporauta ertönte, drehten sie laut auf und schmetterten den melodiösen Mix aus finnischem Folk und hartem Metal mit.
»SYNTY TAPPORAUTA!«, grölten sie den Refrain, als Kimo plötzlich auf die Bremse stieg, und Mika sich vor Schreck an der Armatur über dem Handschuhfach abstützte.
»Paska!«, fluchte er, als sie ins Rutschen kamen und der Lichtkegel ihrer Scheinwerfer in der undurchdringlichen Schwärze der verschneiten Straße hin und her wogte. Die kurz angestrahlten Baumreihen rechts und links mutierten zu wabernden Schatten inmitten der Schneemassen und für einen Moment fürchtete er, dass sie sich überschlagen und als eines jener Unfallfotos enden würden, die er jeden Sonntag in der Zeitung sehen musste.
Einen Herzschlag später standen sie heftig atmend quer auf der verlassenen Straße, vorne und hinten nichts als Dunkelheit und das einzige Geräusch war das Klickern des Warnblinklichts, das sich offenbar selbständig eingeschaltet hatte.
»Paska, bist du verletzt?«, fragte Kimo heiser und sah besorgt zu seinem Freund.
»Mhm«, machte Mika und schüttelte wie gelähmt den Kopf. »Was war denn los? Heilige Scheiße.«
»Ich habe irgendetwas über die Straße huschen sehen, ich hätte schwören können, dass das eine Person war.«
Mika lief es kalt den Rücken hinunter und mit einem Mal fühlte er sich wie in der Kulisse eines Horrorfilms, als sein Blick auf den Waldrand fiel, der von ihrem Scheinwerfer kaum durchdrungen wurde. Eine diffuse Angst legte sich schwer auf seine Glieder, als er sich ausmalte wie plötzlich etwas – oder jemand – durch das Scheinwerferlicht laufen könnte.
»Ich glaube, wir sollten mal nachsehen.«
»Bist du verrückt?«, fragte Mika und schüttelte entschieden den Kopf. »Man steigt nie nachts aus dem Auto.«
»Was? Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe!«
»Paska! Können wir wenigstens zurückfahren und nicht aussteigen?«
»Stell dich nicht so an. Du guckst zu viele Horrorfilme!«, meinte Kimo und deutete auf das Handschuhfach. »Gib mir mal die Taschenlampe.«
Mika öffnete die Klappe und reichte seinem Freund die lange MagLite, die der kurz prüfend an- und ausschaltete, bevor er seine Tür öffnete und der piepende Warnton der Bordelektronik ansprang und sie darauf hinwies, dass die Zündung noch angeschaltet war.
»Ich gehe nachsehen, bleib ruhig hier, wenn du willst.«
»Verdammter Mist!«, brummte Mika und stieg ebenfalls aus. Als Angsthase wollte er nicht dastehen, auch wenn sich alles in ihm dagegen sträubte, den Schutz ihres Fahrzeugs zu verlassen.
Im roten Rücklicht leuchtete der Schnee wie glühende Lava, während er Kimo hastig hinterherlief, der sich als schwarze Silhouette vor dem Lichtkegel seiner Taschenlampe abzeichnete. Als er ihn eingeholt hatte, blieb Kimo abrupt stehen.
»Paska!«
»Was ist denn jetzt?«, fragte Mika alarmiert und fühlte sich, als liefe Starkstrom durch sein Rückgrat.
»Sieh dir das an«, hauchte sein Freund und leuchtete den kleinen Schneestreifen zwischen Straße und Waldrand aus, hinter dem sie aus unendlich vielen Augen beobachtet zu werden schienen.
Mika schluckte schwer und trat an Kimos Seite, um herauszufinden, wovon der sprach, als er wie vom Schlag getroffen stehenblieb. Mitten im knietiefen Schnee lag eine blasse Gestalt mit aufgerissenen Augen und atmete heftig ein und aus. Ihr Kopf war kahlrasiert und eine Platzwunde zog sich von der Stirn zum Hinterkopf. Ihr Körper war in ein langes OP-Kleid gehüllt und ihre blauen Lippen bewegten sich, als führe sie stumme Selbstgespräche.
»Paska! Paska! Paska!«, jaulte Mika und wäre am liebsten sofort fortgerannt, wenn Kimo ihn nicht am Kragen gepackt und ihm eindringlich in die Augen gesehen hätte.
»Mika! Beruhige dich! Setz den Notruf ab, sofort!«
»Ich ...«
»Sofort, Mann!«
Während Mika mit zitternden Händen sein Smartphone aus der Tasche kramte und die Notrufnummer wählte, ging Kimo vorsichtig einen Schritt näher und zuckte zurück, als sich die Augen des blassen Mannes ruckartig auf ihn hefteten. Beinahe wäre er rücklings in den Schnee gefallen, als er über seine eigenen Füße stolperte, doch er fing sich im letzten Augenblick.
Hastig leuchtete er wieder zu dem Fremden, aus Angst, der könnte sich plötzlich auf ihn stürzen, doch die Augen des Blassen waren aufs Neue in den Himmel gerichtet. Hinter ihm rief Mika hastig etwas in sein Telefon, doch Kimo hörte gar nicht zu. Eine plötzliche Angst machte sich in ihm breit und er stupste seinen Freund an, als der aufgelegt hatte.
»Hast du ihnen die Kilometerangabe des Begrenzungspfahls durchgegeben?«
»Ja«, meinte Mika heiser und nickte, ohne den Blick von dem Fremden abzuwenden. »Die sind in spätestens zehn Minuten hier. Wieso?«
»Lass uns abhauen!«
»Was? Der erfriert hier doch! Ich dachte ...«
»Ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Wir sollten schleunigst verschwinden.«
»Keine Einwände, Mann«, stimmte Mika ihm schließlich zu, und, ohne sich noch einmal umzudrehen, rannten sie zu ihrem Toyota zurück, der wie eine Insel aus Licht inmitten eines Meeres aus Dunkelheit Sicherheit versprach.
3. Helsinki, 11.01.2020
Die dritte Lampe von rechts flackerte in einer abweichenden Frequenz und wirkte irgendwie heller als die anderen. Missmutig verharrte Bill auf dem Gang und starrte sie an, als würde sein Blick wie auf Schienen zu ihr hingeführt. Diese Abweichung von der Norm, dieser dezente Hinweis auf fehlende Zuverlässigkeit ärgerte ihn.
Er liebte die Nachtdienste in der Klinik, die Ruhe, die wenigen Menschen und die stillen, langen Gänge, die im warmen Licht der Deckenlampen geradezu heimelig wirkten – abgesehen von einzelnem Stöhnen leidender Patienten. In dem Maße wie die Tage laut und chaotisch waren, waren die Nächte in der Klinik ruhig und geordnet. Genau deshalb musste man den Nachtdienst einfach lieben – er war perfekt.
Doch nun störte diese eine kleine Lampe den Eindruck der Perfektion. Mit einem leichten Zucken in den Mundwinkeln wandte sich Bill vom Anblick der Störung ab und setzte seinen Weg über den Flur zwischen den beiden Stationen fort. In Gedanken ging er seine To-do-Liste durch: Zimmer 10, Frau Hiltji, Zustand nach Kraniotomie und Tumorresektion – Antibiose und Laborwerte prüfen; Zimmer 5, Herr Johnson, Drainage prüfen, und zum Schluss im Stationszimmer vorbeischauen und klären, ob alles okay ist ... Wer hatte heute Nachtdienst in der Pflege? Anschließend wollte er sich noch einmal mit seinen Forschungsdaten befassen und die neue Studie aus China lesen. Angeblich hatten die Chinesen im Tierexperiment einem Affen ein vollkommen neuartiges Brain-Computer-Interface (BCI) implantiert. Sie behaupteten nicht nur, dass sie extrem hochauflösend die Impulse des gesamten Motorcortex erfassen könnten, nein, sie beteuerten sogar, dass es ihnen gelungen sei, direkte visuelle Impulse über Elektroden im Sehnerv übermitteln zu können. Kurz gesagt versicherten sie also, dass sie nicht nur den Bereich des Gehirns auslesen konnten, der für alle willkürlichen Bewegungen zuständig ist, sondern darüber hinaus auch noch visuelle Wahrnehmung erzeugen konnten. Sollte das stimmen, wäre das ein riesiger Fortschritt und er könnte die Erkenntnisse der Chinesen in seinen eigenen Entwurf eines BCIs einfließen lassen. Steve und er hätten einen erfolgreichen, nächsten Entwicklungsschritt auch dringend nötig. Zwar war Bill noch nicht so verzweifelt wie Steve, doch auch er machte sich Sorgen, dass ihr Start-up scheitern könnte, wenn sie nicht bald einen ersten Prototypen für eine lauffähige Mensch-Maschine-Schnittstelle vorweisen konnten. Die Tür von Station sechs glitt hinter ihm mit einem satten Schmatzen ins Schloss und sperrte den Flur mit seiner defekten Lampe aus.
***
Das schrille Läuten seines Telefons riss ihn aus seinen Gedanken und zum wohl hundertsten Mal ärgerte er sich über die Sparmaßnahmen der Klinik, die ihn zwangen, mit einem Telefon zu arbeiten, bei dem man noch nicht einmal den elenden Klingelton gegen einen vernünftigen tauschen konnte. In welchem Jahrhundert lebten sie überhaupt?
»Portit, Neurochirurgie«, meldete er sich.
»Hallo, hier ist die Zentrale, wir haben einen angekündigten Notfall aus Ilomantsi, zirka dreißigjähriger Mann, bewusstlos, mit Hinweisen auf ein Schädel-Hirn-Trauma. Er kommt mit dem Helikopter. Erwartete Ankunft in zirka zwei Stunden, die Daten werden gerade in das KIS übertragen.«
»Verstanden«, sagte Bill und legte auf. Wieso schicken die mitten im Nachtdienst einen Bewusstlosen in die Neurochirurgie?
Zielstrebig eilte Bill auf das Stationszimmer zu, öffnete die Tür und schritt direkt auf den Rechner zu.
»Nabend, Tilda« sagte er über die Schulter gewandt und setzte sich direkt an den Computer, ohne auf eine Antwort zu warten.
»Guten Abend, Bill«, hörte er aus der hinteren rechten Ecke die weiche Stimme der Krankenschwester. »Wie geht es dir heute? Hast du schon nach Frau Hiltji geschaut? Ich habe ihr direkt um acht noch einmal Blut abgenommen und die Laborwerte sollten vorliegen.«
»Hmm, mache ich noch«, raunte Bill abwesend zur Antwort. »Ich muss kurz einen angekündigten Notfall prüfen und schauen, ob ich das OP-Team aktiviere, dann kümmere ich mich darum«.
Auf dem Monitor vor ihm erwachte endlich das KIS zum Leben und forderte ihn zur Eingabe der Patientendaten auf. Bill klickte sich durch die Menüs des Krankenhausinformationssystems, bis er den Notfall gefunden hatte. Kurz überflog er den Arztbrief aus der Notaufnahme in Ilomantsi - alles sah nach einer Bewusstlosigkeit aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas nach Einwirkung stumpfer Gewalt aus. Der Patient war offensichtlich halbwegs kreislaufstabil, allerdings hatte die erste neurologische Untersuchung einen positiven Babinski-Reflex beidseits ergeben, welcher jedoch in einer weiteren Untersuchung nicht mehr aufgetreten sei.
Ungewöhnlich, aber kein Grund für eine Verlegung zu uns, dachte Bill und suchte weiter nach einer Erklärung, warum man den Patienten mitten in der Nacht über fünfhundert Kilometer zu ihnen transportierte. Einige Zeilen später wurde es spannend und Bill las flüsternd mit, während sich in seinem Kopf ein Bild zusammensetzte:
... in der äußeren Inspektion des Craniums imponiert, bei fehlender Kopfbehaarung, eine Platzwunde von zirka 10 cm Durchmesser, ohne tastbare Instabilitäten der Schädeldecke und, soweit ersichtlich, ohne Eröffnung der Schädelhöhle. Hinter dem rechten Ohr befindet sich ein 6 cm durchmessender und zirka 2 cm hoher, runder, metallisch wirkender Fremdkörper, der fest mit dem Schädel verbunden zu sein scheint. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Cochlea-Implantat (CI), jedoch finden sich weder Herstellerbezeichnungen noch entspricht es in der Form irgendwelchen bekannten Produkten. Die durchgeführte Bildgebung (CT) ergab keine Hinweise auf weitere Bestandteile eines CIs, jedoch stellten sich multiple, dezente Raumforderungen in sämtlichen Bereichen des Gehirns dar ...
Okay, dachte Bill und spürte erstes Interesse aufsteigen: Hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen oder war es ein Unfall gewesen? Worauf, um Himmelswillen, könnten die vielfachen Raumforderungen hinweisen, und was hat es mit dem unbekannten Implantat auf sich? Weiter vorne stand etwas geschrieben, dass man den Mann angeblich in der Wildnis nahe der russischen Grenze gefunden hatte ... Ob das Implantat irgendeine geheime russische Technik darstellte und der Mann vielleicht ein geflohener Geheimagent war? ... Er zeigte sich selbst einen Vogel. Bill, jetzt übertreib es nicht, du bildest dir doch sonst was auf deine überragende Intelligenz ein, und nun kommst du mit solchen James-Bond-Fantasien um die Ecke ...
In seiner Neugierde vollends gefangen, überflog Bill die weiteren Zeilen mit dem üblichen Blabla und konzentrierte sich auf die Befunde der Bildgebung. Offensichtlich war sich der Radiologe bezüglich der Interpretation der Schnittbilder vollkommen unsicher und attestierte lediglich, dass es keine Hinweise auf knöcherne Defekte gebe, und die höchst dezenten Raumforderungen keiner ihm bekannten Erkrankung entsprechen würden und er nicht ausschließen könne, dass es sich um Fremdkörper handle. Er empfehle die erneute Bildgebung mittels höher auflösender CT und gegebenenfalls die Durchführung einer MRT, falls das unbekannte Implantat eine solche zulassen würde.
Seltsam, was es damit wohl auf sich hatte?
In der abschließenden Zusammenfassung fand sich ein weiterer spannender Hinweis: Die im Verlauf aufgetretene Dekortikationsstarre und Cushing-Triade bildeten sich nach Diuretikagabe (Mannitol Inf Loe 15% und Furosemid 100mg i.v.) und Sedierung mittels Diazepam (10mg i.v.) umgehend zurück. Keine Hinweise auf eine Stauungspapille.
Bill strich sich mit dem Zeigefinger über das Kinn, wie er es immer tat, wenn er in Gedanken versunken war. Warum zeigt Patient X Zeichen eines erhöhten Hirndrucks? Warum verschwanden die Zeichen wieder? Und was hat es mit diesem Fremdkörper hinter seinem Ohr auf sich?
Erst als es in der Leitung klingelte, realisierte Bill, dass er zum Telefon gegriffen und die Nummer der Radiologie gewählt hatte.
»Finholm, Radiologie«, meldete sich eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.
»Portit hier, aus der Neurochirurgie. Wir haben einen angekündigten Notfall aus Ilomantsi, Fallnummer 2001B97 im KIS, ich brauche für ihn das komplette Programm mit CT und möchte ihn auch ins MRT schicken. Bitte lesen Sie die Vorbefunde und bereiten Sie alles vor.«
»Sie wissen aber schon, wie spät es ist und wie lange das dauert? Außerdem warum eine MRT? Sie wollen doch nicht notfallmäßig eine Tumorresektion mitten in der Nacht vornehmen, oder?«
Selbst Bill entging der leicht genervte Unterton in ihrer Stimme nicht, obwohl er nach Meinung seiner wenigen Freunde kaum ein Gespür für so etwas hatte.
»Es ist zweiundzwanzig Uhr sechsunddreißig, und nein, ich gehe nicht davon aus, dass eine notfallmäßige Tumorresektion erfolgen muss. Bitte lesen Sie die Vorbefunde und bitte bereiten Sie alles vor.« Bill legte einfach auf, um eine weitere Auseinandersetzung gar nicht erst entstehen zu lassen. Nun würde es sich endlich einmal auszahlen, dass die Neurochirurgen die einzigen in der Klinik waren, die einen Facharzt Nachtdienst machen ließen, während sich überall sonst die Assistenzärzte die Nächte um die Ohren schlagen mussten. Nicht, dass er die Hierarchiekarte ausspielen wollte, aber wenn er etwas noch mehr hasste als Konflikte, dann waren es Zweifel an seiner fachlichen Kompetenz. Das OP Team würde er lediglich in Bereitschaft versetzen, damit es gegebenenfalls schnell gehen konnte. Nachdem die entsprechende Nachricht im KIS abgesetzt war, wandte er sich den Bildgebungsdaten zu und studierte sie erneut.
Er war zwar kein Radiologe, doch die Interpretation von kranialen CT Bildern bereitete ihm keine Schwierigkeiten. Am Ende musste er jedoch feststellen, dass die Auflösung der Bilddaten wirklich keine weiteren Aussagen ermöglichte und insbesondere die Weichteilgewebe nicht differenziert genug dargestellt werden konnten. Das kleine Krankenhaus in Ilomantsi war offensichtlich mit einem sehr alten Computertomographen ausgestattet. Gut, dass seine Forschungsgruppe über die letzten Fördergeldanträge genug Drittmittel hatte anwerben können, um ein neues neun Komma vier Tesla MRT-System zu finanzieren, das seit wenigen Wochen zur Verfügung stand. Damit würde sicherlich einiges mehr ans Tageslicht kommen.
»Hey, Bill«, hörte er Tilda direkt neben sich sagen. »Bist du fertig mit deinem Notfall? Frau Hiltji wartet und Herr Johnson klagt über stärker werdende Kopfschmerzen. Kannst du dich bitte darum kümmern?«
»Mache ich.«
Zügig, aber mit der notwendigen Sorgfalt, kontrollierte er die neuen Laborwerte von Frau Hiltji, die offensichtlich nicht an einer postoperativen Infektion sterben würde, sondern eher, weil sie ihre Insulintherapie nicht im Griff hatte. Nachdem eine kurze Untersuchung von Herrn Johnson keine relevanten neurologischen Auffälligkeiten ergab und seine Herz-Kreislaufparameter stabil waren, trug Bill schnell noch Ibuprofen zur Kopfschmerzbehandlung in die Patientenakte ein.
»Alles erledigt, Tilda. Falls es Herrn Johnson nicht zeitnah besser gehen sollte oder sich sein Zustand verschlechtert, ruf mich nochmal an. Ich bin in der Notaufnahme und warte auf den angekündigten Patienten.«
Tilda nickte und winkte ihm zum Abschied zu, während sie ihren Kaffee trank.
***
Mit einem lauten Zischen öffneten sich die Schiebetüren zum Landepad der Notaufnahme und plötzlich drang der ungefilterte Lärm des Hubschraubers an Bills Ohren. Zusammen mit zwei Krankenpflegern und einer Transportliege lief er nach draußen und stemmte sich mit geducktem Oberkörper gegen den Wind der Rotoren.
Aus der offenen Seitentür des Helikopters stieg der Notarzt und wartete auf sie. Während die Krankenpfleger den blassen Patienten samt seiner Infusionen auf ihre Liege hoben, brüllte ihm der Notarzt seine Übergabe entgegen: »Zirka dreißigjähriger Patient, komatös, Vitalparameter zwischendurch schwankend, aktuell aber stabil, Sauerstoffsättigung bei achtundneunzig Prozent, Herzfrequenz stark schwankend, zumeist etwas tachykard, Blutdruck hundertvierzig zu neunzig. Ich habe ihm außer der Infusion und dem Sauerstoff nichts gegeben, da er sich immer wieder selbst stabilisiert hat, und ich keine Ahnung habe, was da los ist. Viel Spaß damit, er ist nun Ihr Patient.«
Bill nickte lediglich, streckte den Daumen hoch und entfernte sich vom Hubschrauber, der kurze Zeit darauf abhob und in der wolkenverhangenen Nacht über Helsinki verschwand. In Gedanken schon bei der Diagnostik, half er den Pflegern beim Schieben der Liege, bis sie in die Wärme der Notaufnahme zurückgekehrt waren.
Der Patient wirkte auf Bill irgendwie fremdartig. Ob es die fehlenden Haare oder der blasse Hautton waren? Oder hatte es mit diesem leeren Gesichtsausdruck zu tun?
Manche Menschen wirkten im Koma wie versteinert und andere wach, nur mit geschlossenen Augen. Doch dieser Mann war irgendwie anders. Was er wohl ganz alleine in der Wildnis nahe der russischen Grenzen zu tun gehabt hatte?
Während Fred, der Internist der Notaufnahme, sein Routineprogramm abspulte, um mögliche internistische Ursachen abzuklären, führte Bill eine kurze neurologische Untersuchung durch und stieß am Ende auf den beschriebenen Fremdkörper hinter dem rechten Ohr.
Wie ein Cochlea-Implantat soll das aussehen? Auf keinen Fall, eher wie eine übergroße Knopfbatterie mit Chromverkleidung ...
Seine Finger tasteten vorsichtig über die glatte Oberfläche, die sich deutlich wärmer anfühlte, als er erwartet hatte. Er spürte einen feinen Rand zwischen dem Objekt und der Haut des Patienten und konnte bei genauerem Hinsehen erkennen, dass das Objekt offensichtlich in einer Art Verankerung steckte, welche anscheinend fest mit dem Schläfenknochen verbunden war. Leicht zog er daran, doch nichts geschah.
Als er etwas stärker zog und damit den Kopf des Patienten bewegte, blickte der Internist zu ihm herüber und zog eine Augenbraue hoch. Auch drehen oder drücken erbrachten keine Resultate, sodass Bill es letztendlich aufgab.
»Okay Fred, spricht etwas dagegen, dass ich den Patienten zu den Radiologen verfrachte? Ich wüsste gerne, was es mit der Platzwunde an seinem Kopf und vor allem mit diesem Ding hier auf sich hat.« Er deutete auf das seltsame Objekt unter seinen Fingern.
»Aus meiner Sicht nicht wirklich, Bill. Ich warte auf die Laborwerte und melde mich bei dir, aber aktuell scheint zumindest sein Kreislauf stabil zu sein.«
***
In der Radiologie wartete bereits eine junge Frau in blauer OP-Kleidung auf ihn. Mit ihren langen blonden Haaren, den strahlend blauen Augen und der offensichtlich durch viel Sport geformten Figur wäre sie genau Bills Typ gewesen. Hätte sie nicht beide Arme vor der Brust verschränkt und ihn mit regloser Miene angefinstert, hätte er sich vielleicht sogar getraut, sie anzusprechen. Er hätte gar nicht auf ihr Namensschild sehen müssen, um zu wissen, dass sie jene Dr. Finholm war, mit der er telefoniert hatte. Offensichtlich trug sie ihm ihr letztes Gespräch noch nach, was er nicht verstehen konnte, da er zweimal bitte gesagt hatte.
Bill setzte ein, wie er hoffte, ermunterndes Lächeln auf und wies mit einer Hand auf den im Bett liegenden Patienten. »Hey, hier ist der Patient aus Ilomantsi mit dem unklaren radiologischen Befund.«
Sie wandte den Blick von ihm ab und dem Patienten zu. »Ich habe mir die Befunde angesehen und, auch wenn ich nicht verstehe, warum es nicht bis morgen warten kann, habe ich alles vorbereitet. Ich hoffe, Ihnen ist klar, welches Risiko wir eingehen, wenn wir dem Patienten Kontrastmittel verabreichen, ohne irgendetwas über mögliche Allergien oder dergleichen von ihm zu wissen?«
»Mir ist durchaus ...«
»Und was ist das hier?« Sie hatte sich dichter zu dem Patienten begeben und wies auf das Implantat an seinem Kopf. »Wenn da auch nur ein winziger Bruchteil magnetischer Substanzen verarbeitet ist, kann er nicht in unser MRT! In so einem schwachen Magnetfeld wie dem des alten Teils in Ilomantsi, mag das ja noch gut gehen, aber mir sind keine Implantate bekannt, die über drei Tesla hinaus zertifiziert sind – geschweige denn für unser neues neun Komma vier Tesla MRT. Ich will dieses Risiko nicht eingehen. Wir müssen zuerst herausfinden, wer er ist, oder zumindest was dieses Ding da genau ist!« Ihr Blick war fordernd auf Bill gerichtet, der jedoch nicht daran dachte, so schnell aufzugeben.
»Haben Sie den Bericht nicht gelesen? Wir wissen nicht, wer er ist! Weder die Polizei in Ilomantsi konnte etwas über ihn herausfinden noch unsere Recherche in der Versichertendatenbank. Da er von irgendwelchen Campern in der Wildnis nahe der russischen Grenze gefunden wurde und keinerlei Papiere bei sich hatte, können wir noch nicht einmal davon ausgehen, dass er Finne ist. Warten, bis eine erweiterte Suche der Behörden etwas erbracht hat, können wir aber auch nicht, denn bis dahin wird er wahrscheinlich nicht überleben!«
»Okay, dann können wir gerade nicht herausfinden, wer er ist, doch das ändert nichts daran, dass ich recht habe – es ist zu riskant, ihn in unser MRT zu schicken!« Ihr Gesicht nahm eine Härte an, die selbst Bill nicht übersehen konnte und die ihm deutlich machte, dass er einen Kompromiss in die Wege leiten musste, wenn er hier nicht Stunden vergeuden wollte.
»Na schön, dann machen wir zunächst das CT, schauen uns an, ob wir mehr über dieses Implantat herausfinden können und entscheiden dann weiter.« Er wollte noch ein CT machen können Sie doch, oder? hinzufügen, sparte sich dann aber jede weitere Bemerkung, als sie nickte, und begann das Bett in Richtung CT 1 zu schieben. »Na kommen Sie schon, Sie können mir ruhig beim Schieben helfen.«
***
Gerade als der Patient auf dem Tisch des CTs lag, sich die Tür geschlossen hatte, und Bill zusammen mit der Radiologin am Rechner hinter der Strahlenschutzscheibe stand, begann sich der mobile Monitor am Bett des Patienten mit einem schrillen Warnton zu melden und blinkte Rot. Bill und Dr. Finholm liefen in den CT-Raum und ein schneller Blick auf die Anzeige offenbarte eindeutiges Kammerflimmern.
»Scheiße«, brach es aus der Radiologin, die auf einen Schlag ihre Gesichtsfarbe verloren hatte und irritiert zu Bill sah. »Er war doch bis eben noch vollkommen stabil! Ich habe ihm doch gar kein ...«
»Hören Sie auf und verständigen Sie das Reanimationsteam!«, fiel ihr Bill ins Wort und beförderte den Patienten so vorsichtig wie möglich auf den Boden, um mit der Reanimation zu beginnen.
***
»Aufhören, es hat keinen Sinn mehr!« Bill sackte auf dem nächstgelegenen Stuhl zusammen und stützte sich keuchend auf die Ellenbogen. Sein Blick wanderte zu dem verstorbenen unbekannten Patienten. Nach dreißig Minuten Reanimation musste jemand den Mut aufbringen, ihn für tot zu erklären und die Maßnahmen einzustellen. Die meisten Beteiligten wirkten erschöpft und frustriert, wie sie im Raum standen und offenbar nichts mit sich anzufangen wussten. Doch niemand kritisierte seine Entscheidung. Alle wussten, dass man den Kampf gegen den Tod nicht immer gewinnen konnte und dass nach einer halben Stunde erfolgloser Reanimation bei Asystolie nicht mehr mit einer Rettung des Patienten zu rechnen war.
Einige Zeit später waren das gesamte Reanimationsteam und mit ihm das gut koordinierte Chaos verschwunden, sodass nur noch Bill und die Radiologin zurückgeblieben waren. Sie teilten den Raum mit einer drückenden Stille und einem Geruch nach Stress und Blut.
Dr. Finholm hielt noch immer die Tasse in den Händen, die er ihr gebracht hatte und starrte auf den zugedeckten Toten. Mittlerweile war der Kaffee mit Sicherheit kalt geworden, doch das schien sie gar nicht zu bemerken.
»Ihr erster Toter?«, fragte Bill, den die Stille langsam irritierte.
»Nein, aber der erste Patient, der mir während meiner Untersuchung wegstirbt«, antwortete sie mit einem hohlen Widerhall in der Stimme.
»Kommen Sie, Sie müssen wieder in Gang kommen und etwas tun, damit Sie nicht so viel grübeln.«
»Was denn tun?«
»Naja, er ist zwar tot und damit können wir die Kontrastmittelgabe vergessen, aber das Geheimnis seines Implantats können wir noch immer lüften.«
»Portit, er ist tot«, warf sie ihm mit aufgerissenen Augen und ungläubigem Gesichtsausdruck entgegen.
»Ja, ich weiß, aber wollen Sie nicht auch wissen, warum? Und sehen Sie es mal positiv – wegen der Strahlung braucht er sich keine Gedanken mehr zu machen!«
»Sie sind selbst für einen Chirurgen ziemlich pietätlos, wissen Sie das?« Plötzlich stand sie auf und schob das Bett mit dem Toten in Richtung CT. »Kommen Sie Portit, bevor ich es mir anders überlege.«
***
Letztendlich erwies sich Dr. Finholm als neugieriger als Bill gedacht hätte. Er hatte ihr vorgeschlagen, doch Kontrastmittel zu injizieren und dann noch einige Thoraxkompressionen durchzuführen, um es ins Gehirn zu transportieren, doch diesen Vorschlag hatte sie als vollkommen inakzeptabel abgelehnt. Nachdem die hochauflösenden CT-Bilder jedoch ein höchst filigranes Netzwerk aus minimalen Raumforderungen offenbart hatten, sah sie endlich die Notwendigkeit eines MRTs ein.
Ein kurzer Check mittels Magneten ergab keine Hinweise auf Magnetismus bei dem Implantat und auch ein vorsichtiges Annähern an das MRT zeigte keine Reaktion. Letztendlich überzeugten all diese Versuche sie, dass keine Gefahr bestand.
Was sich schließlich im neun Komma vier Tesla MRT zeigte, war eine derartige Überraschung, dass beide zunächst stumm vor dem Monitor saßen und schwiegen.
4. Die Falle
Montana, 12. März 2031
»Hast du die Tür abgeschlossen?«
»Ja, Papa.«
»Hast du deinen Schlüssel in die Tasche gesteckt?«
»Ja«, antwortete seine Tochter geduldig und drehte sich auf der Fußmatte zu der massiven Holztür in ihrem Rücken, bevor sie ihm mit großen Augen zunickte. »Ja.«
»Gut. Wie viele Schritte bis zum Draht?«, fragte er.
»Papa, jeden Morgen?«
Als er sie ansah, fielen ihre kleinen Lippen leicht hinab und sie seufzte ergeben.
»Einunddreißig.«
»Und?«, hakte er unnachgiebig nach.
»Einunddreißig von meinen Schritten und zweiundzwanzig von deinen«, zählte sie auf und deutete mit ihrer kleinen Hand nach vorne. Sie zitterte leicht in der morgendlichen Kälte und die kleinen blonden Härchen auf ihrer Hand waren aufgestellt. Als sie zu ihm gesehen und festgestellt hatte, dass er nickte, wanderte ihr ausgestreckter Arm nach rechts. »Vierundvierzig und neunundzwanzig nach rechts.«
»Gut.«
Ihre Hand beschrieb einen Halbkreis und zeigte an ihm vorbei in die entgegengesetzte Richtung. »Dreißig und einundzwanzig nach links.«
»Wir gehen heute nach vorne und überprüfen die Kaninchenfallen«, erklärte er und überprüfte noch einmal den Sitz seines Rucksacks, was sie ihm nach einem kurzen Seitenblick gleichtat. Schließlich nahm er sein Jagdgewehr und hängte sich den Riemen über die Schulter. Die gefüllte Colaflasche, die mit Isolierband auf dem verlängerten Lauf aus gekerbtem Aluminium klemmte, war bereits rissig und verblichen wie das Relikt einer vergangenen Epoche. Ihr Anblick erinnerte ihn an eine Zeit, als der weiße Schriftzug auf rotem Hintergrund noch überall zu sehen gewesen war. Hier draußen in der Wildnis wirkte er eher wie eine im wahrsten Sinne des Wortes verblasste Erinnerung.
»Okay, Papa«, erwiderte June ruhig und sah zum Waldrand nach vorne, der sich wie ein Halbkreis aus dichtgedrängten Fichten und Birken um die Lichtung scharte, auf der sich ihre Blockhütte befand. Nicht zum ersten Mal fühlte er sich belagert.
»Was denkst du über das Wetter?«, fragte er June mehr als Aufforderung denn als echte Frage.
Seine Tochter rückte ihre Mütze zurecht, aus der dickes blondes Haar auf ihre schmalen Schultern quoll und machte zwei präzis gemessene Schritte vorwärts. Als er es ihr nachmachte und neben ihr stand, drehte sie sich um und sie sahen über das Schindeldach ihres Hauses die Bergwand hoch, die sich dahinter in den Himmel streckte. An der Spitze des grün bewachsenen und von weißem Puderschnee bedeckten Hanges wirbelten graue Wolkenfetzen um die Spitze und versperrten die Sicht auf den rauen Fels, der sonst eine Art Krone bildete und wie ein Gesicht aussah.
»Die Wolken bewegen sich sehr schnell, folglich ist es weiter draußen windig«, erklärte June mit einem Finger an den Lippen und warf ihm einen vorsichtigen Seitenblick zu. Als er stumm nickte, fuhr sie etwas selbstsicherer fort. »Das Thermometer hat drei Grad angezeigt, demnach kann es sein, dass es regnet oder schneit. Die Wolkendecke sieht von unten aber glatt aus, also wird es wahrscheinlich nicht regnen oder schneien. Nicht bald.«
»Gut. Was bedeutet das für uns?«
»Wir bleiben vorsichtig und gehen nicht zu weit fort. Wir behalten den Himmel im Auge, und wenn es regnet oder schneit, gehen wir zurück.«
»Warum tun wir das?«, hakte er nach.
»Damit wir nicht krank werden.«
»Richtig.« Er fasste sie an der Schulter, weil er sie sanft drücken wollte, um sie zu loben, hielt aber inne und drehte sie stattdessen Richtung Waldrand und deutete auf den von Reisig übersäten Grasboden vor ihren Füßen. »Was denkst du über den Boden?«
June hockte sich hin und ihre Bewegungen sahen noch immer ein wenig ungelenk aus. Er wünschte sich, dass sie schnell groß werden würde, stark und selbstständig, damit er sich nicht so viele Sorgen machen musste. Sie zog ihre selbstgestrickten Fäustlinge aus und berührte das nasse Gras, in dem sich die Fußabdrücke von vielen Jahren, da sie immer dieselben benutzt hatten, im Matsch abzeichneten.
»Er ist nass, aber der Matsch ist noch recht hart vom letzten Frost«, befand sie. »An einigen Stellen wird er schon aufgeweicht sein, im Wald, wo es wärmer ist, weil der Wind da nicht so stark ist.«
»Was heißt das für uns?«
»Wir müssen vorsichtig sein und auf unsere Fußspuren achten.«
Als er sie weiterhin fragend ansah, fügte sie schnell hinzu: »Wir hinterlassen niemals Spuren.«
»Gut. Gehen wir.« Er stapfte voran, nutzte die alten Fußspuren, um seine verbliebenen einundzwanzig Schritte präzise auszuführen. June tat es ihm auf seiner rechten Seite nach und sah konzentriert nach unten.
»Papa?«
»Ja?«
»Müssen wir das wirklich jeden Morgen machen?«, fragte sie und ihre Stimme klang kleinlaut, obwohl er den Eindruck hatte, dass sich ein leicht rebellischer Unterton eingeschlichen hatte. Er wartete, bis sich ihre Worte wie sanfter Morgennebel aufgelöst hatten.
Es tut mir leid, dass du so ein schreckliches, strenges Leben führen musst, Kleines, dachte er und zwang sich, sein Gesicht nicht weich werden zu lassen, wobei ihm sein dichter Vollbart half. Laut sagte er: »Weil wir sterben, wenn wir einen Fehler machen. Du weißt es.«
»Warum wollen die Anderen uns töten, Papa?«
»Weil wir hier leben.«
»Sehen die Anderen aus wie wir?«
»Wir reden später. Still jetzt«, sagte er, als er seinen neunundzwanzigsten Schritt ab der Haustür beendet hatte und nach dem silbrigen Glänzen zu seinen Füßen suchte. Als er es gefunden hatte, stieg er mit einer präzisen Bewegung über den Stolperdraht und wartete, bis June es ihm nachgemacht hatte.
Als sie hinter dem beinahe unsichtbaren Draht standen, nahmen sie sich wie jeden Morgen die Zeit, um aufmerksam und in absoluter Stille in den Wald zu sehen und zu lauschen. Als Erstes fiel ihm wie immer der vielstimmige Vogelgesang auf, der sich wie ein dicht gewebtes Tuch aus Lärm über sie senkte und ihn nervös machte. Er hatte jedes Mal das Gefühl, dass sich unter dem Deckmantel dieses Klangteppichs selbst ein Panzer an ihn anschleichen konnte. Aber am Ende kam es darauf an, wie gut er und June Geräusche filtern und einordnen konnten – dafür war dieses Innehalten essenziell, auch wenn June meist ungeduldig aus den Augenwinkeln zu ihm sah. Er tat, als würde er es nicht bemerken, um ihr wenigstens kleine Momente einer normalen kindlichen Reaktion zu ermöglichen, aber es sorgte ihn. Sie musste lernen und besser werden. Immer besser werden, so wie er hatte lernen müssen.
Er blickte auf seine Armbanduhr und reckte nach exakt fünf Minuten einen Daumen in ihre Richtung. Sie erwiderte die Geste gehorsam und sie machten sich auf den Weg, den leicht abfallenden Hang hinab zu den Kaninchenfallen am Fluss.
Die Fichten wirkten noch immer angeschlagen von den Schneemassen des Winters, der sich erst im Verlauf der letzten Wochen zurückgezogen hatte. Die Äste hingen schlaff herab und die Nadeln waren von einem gräulichen Grün, das eher an Krankheit als an Leben erinnerte. Die vielen Birken boten einen noch depressiveren Anblick: Ihre Rinde hatte sich größtenteils abgeschält und schimmerte in schmutzigem Weiß, das ihn an alte Aufnahmen von der Tschernobylkatastrophe und die kontaminierten Wälder rings um den Reaktor erinnerte. Die feuchten, kahlen Äste taten ihr Übriges, um diesen Eindruck zu verstärken. Selbst der nasse, von totem Laub bedeckte Boden schien ihnen entgegenwerfen zu wollen, wie allein und bedroht sie hier lebten.
Als sie eine halbe Stunde bergab gegangen waren und peinlichst darauf geachtet hatten, keine Spuren zu hinterlassen, erreichten sie den Fluss. Er schlängelte sich durch das lange Tal, das wie eine Wanne zwischen den schneebedeckten Bergen des Glacier National Parks lag. Da beide Ufer an dieser Stelle von kleinen Auen umgeben waren, die von dichtem Gras und Gestrüpp überwuchert wurden, konnte man von hier über die Baumwipfel bis zum Apikuni Mountain sehen, hinter dem sich das ehemalige Reservat des Blackfeet Stammes befand. Die schroffen Hänge und die von Wind und Wetter umtosten Gipfel der Giganten um sie waren von einer so atemberaubenden Schönheit, dass es ihn jedes Mal betrübte, dass er vor einer solch romantischen Kulisse einen dermaßen unbarmherzigen Kampf ums Überleben führen musste – vor allem für seine Tochter, die gerade über ein kleines Stück Gras zum Ufer des kleinen Flusses lief, dessen Stromschnellen laut plätscherten und dann innehielt. Sie sah prüfend stromaufwärts und winkte ihm zu. Daraufhin atmete er tief durch und bewegte sich gegen die Strömung, bis er etwa hundert Meter weiter an einer anderen freien Stelle stand und das weiß schäumende Wasser nach Kadavern absuchte. Als er nichts erkennen konnte, gab er ihr einen Wink und machte sich auf den Weg zurück zu ihr. Wie immer, wenn er sich weiter von ihr entfernt hatte als einige Schritte, ging sein Puls dabei ein wenig schneller.
Zurück bei ihr hatte sie bereits ihre beiden großen Feldflaschen gefüllt und sich um den Gürtel gebunden. An ihrer Hüfte sahen die Flaschen geradezu riesig aus, und es versetzte ihm abermals einen Stich, ansehen zu müssen, wie sie sich mit dem zusätzlichen Gewicht abmühte. Aber sie musste stärker werden und über ihre Grenzen hinausgehen, so oft es eben möglich war.
»Gehen wir jetzt die Kaninchen holen?«, fragte sie und lächelte scheinbar zufrieden, als er nickte.
Natürlich verstand er sofort, dass sie sich ganz und gar nicht darauf freute. Er ließ es ihr bisher immer durchgehen, dass sie immer wieder die Augen schloss, wenn er die gefangenen Kaninchen tötete und an einen Ast band, damit sie sie zurücktragen konnte. Es war seine Art, sie darauf vorzubereiten, für sich selbst sorgen zu können.
Sie verließen den Flusslauf und gingen stromabwärts, zurückgezogen im Schutz des Waldrands, sodass sie gerade noch durch die vorderen Baumreihen lugen konnten. Sie wanderten schweigend in Richtung der kleinen offenen Ebene im westlichen Teil des Tals, wo sich besonders viele Kaninchenpfade befanden. Es handelte sich um eine tiefgrüne Fläche aus Rasen, vereinzelten Büschen, Sträuchern und etwas verloren wirkenden Bäumen. Graue Findlinge ragten kahl und glatt inmitten der Vegetation auf und boten mit ihren moosbewachsenen Hälsen eine reichhaltige Nahrungs- und Wasserquelle für die Kaninchen und Hasen, die hier so reichlich vorkamen.
Bevor sie durch die letzten Bäume traten, hielten sie an und suchten die Ebene nach unnatürlichen Bewegungen ab.
»Nichts«, sagte er irgendwann.
»Nichts«, wiederholte auch June und schließlich gingen sie vorsichtig auf das weiche Gras hinaus, das unter ihren Wanderstiefeln bei jedem Schritt leicht schmatzte. Nach etwa zehn Metern stießen sie auf kleine schwarze Kotbälle. Er zeigte darauf und June kräuselte die Stirn.
»Sieht aus wie vom Fuchs«, stellte sie fest und für einen kurzen Moment huschte ein Ausdruck der Erleichterung über ihr glattes Gesicht. Ihre rosigen Wangen hoben sich ein wenig, als der Anflug eines Lächelns ihren Mund breiter werden ließ. Er bedachte sie mit einem strengen Blick und der Ausdruck war so schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war.
»Das ist nicht gut, weil er die Kaninchen verscheucht oder aus den Fallen gestohlen haben könnte«, erklärte sie wie mechanisch und er nickte.
»Hoffen wir, dass wir Glück haben. Du willst sicher nicht hungrig ins Bett gehen, oder?«
»Aber wir haben doch noch ganz viele Bohnen und Zimtcracker!«
»Die heben wir auf, falls mal schlechtere Zeiten anbrechen.«
»Ja, Papa.« June ließ die Schultern hängen und folgte ihm den kleinen Kaninchenpfad entlang, als er sich wieder in Bewegung setzte.
Nach einigen Minuten fanden sie die erste Falle, die jedoch leer war. Die Schlaufe des langen Schnürsenkels war unberührt geblieben, also ließ er die Konstruktion nach einer kurzen Überprüfung unangetastet. An einer Stelle, an der sich zwei Kaninchenpfade kreuzten, musste er kurz überlegen und bog dann nach links ab, wo er schon von weitem sehen konnte, dass an dem Ast eines der alleinstehenden Bäumchen etwas Massiges baumelte. Automatisch beschleunigte er seine Schritte und fand tatsächlich ein dickes Kaninchen, das an einer langen Schnur hing, die an einem der oberen Äste befestigt war. Auf dem Boden lagen einige Stöckchen und die Reste von aufgebissenen Nussschalen. Als er das Kaninchen packen wollte, begann es zu zucken und zu strampeln. Offenbar war sein Genick beim Sprung der Falle nicht gebrochen.
»Ich hole es runter«, sagte er, als er Junes entsetzten Gesichtsausdruck sah und deutete nach unten. »Du baust die Falle wieder auf und erklärst mir dabei die einzelnen Schritte.«
Seine Tochter nickte schnell, dankbar, den Blick von dem strampelnden Fellknäuel abwenden zu können und hockte sich auf den Boden, wo sie kurz warme Luft in ihre Hände blies und sich an die Falle machte.
»Das angespitzte V-Stück stecke ich wieder in den Boden und klopfe es mit einem Ast fest«, erklärte sie, während sie das gebogene Aststück im Boden befestigte und das freiliegende, ebenfalls angespitzte Holz von der Dicke eines Flaschenhalses etwas mehr als handbreit daneben hielt. Mit der freien Hand nahm sie ein dünnes, gerades Ästchen und hielt es prüfend zwischen V-Stück und Holz. »Der Abstand zwischen beiden entspricht der Länge des Köderholzes.«
June klopfte auf das längliche Holz in dem feuchten Boden. Er befreite das schwächer werdende Kaninchen aus der Schlaufe und packte es fest im Genick. Das dünne Seil reichte er seiner Tochter hinab, die es mit flinken Fingern entgegennahm, das schmale Holz, das sich über der Schlaufe befand, in dem V-Stück einsetzte und mit dem länglichen Hölzchen gegen den gegenüberliegenden Pflock verkeilte. Die sich selbst zuziehende Schlaufe zog sie größer und legte sie über dem Hölzchen, das als Trittauslöser diente, ab. Der Ast diente nun als Sprungfeder. Als Letztes griff sie in ihre Tasche und legte vier Nüsse unter das Auslösestöckchen. Dann sah sie zufrieden zu ihm auf und lächelte zufrieden, als er nach prüfendem Blick nickte.
»Heute bist du dran«, sagte er und hielt ihr das schwach strampelnde Kaninchen entgegen, dessen Kopf reglos in seinem festen Griff verharrte.
Zuerst schob sich Junes Unterlippe nach vorn, dann weiteten sich ihre Augen, und ein Ausdruck von Panik machte sich in ihnen breit. Angst und Entsetzen flammten auf und schlugen ihm so heftig entgegen, dass er am liebsten geschrien hätte. Er wollte das Kaninchen fortwerfen und sich zu ihr hinabbeugen, um sie in den Arm zu nehmen, und ihr versichern, dass sie niemals etwas so Schreckliches würde tun müssen, wie dieses niedliche Kleintier zu töten, doch mit all seiner Willenskraft zwang er sich, eine harte Miene beizubehalten.
Es ist ihr Bestes, redete er sich wie ein Mantra immer wieder ein und hielt ihrem herzzerreißenden Blick stand. Sie muss es lernen, um zu überleben, wenn mir etwas zustoßen sollte. Sie muss so hart werden wie die Natur in diesem Tal und so unerschrocken wie ich es mit einem Kind nie sein kann.
»Nein, Papa, ich will nicht!«, weinte sie schließlich und dicke Tränen kullerten über ihre fülligen Wangen. Jede einzelne traf ihn wie ein Pfeil ins Herz.
»Du musst.« Er reckte das Kaninchen noch ein wenig vor und packte erst ihre linke, dann ihre rechte Hand und legte sie um den Hals des Tiers. »Fest zugreifen. So.«
June hielt den Hals zitternd umklammert und das Kaninchen so weit von sich wie möglich.