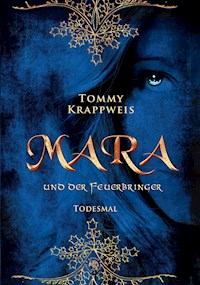9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Jeden Sommer brachen wir mit dem VW-Bus auf von München, Neuperlach in Richtung Süden, ins Jugoskorsikalawienland oder irgendwo anders hin, wo es düstere Felsen, düsteres Meer und düstere Ortschaften mit düsteren Menschen gab. Was es dort nicht gab, war so etwas wie ein Klo oder eine Dusche. Denn meine Eltern waren nicht einfach nur Camper. Nein, sie waren überzeugte Wildcamper. Riesenspinnen auf dem Rücksitz, Schlangen in der Trinkwasserzisterne, gigantische Müllberge und sinkende Schlauchboote – es war alles dabei, was Camping in den 70ern so außergewöhnlich machte. Zumindest wenn man mit meinen Eltern unterwegs war.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Tommy Krappweis
Das Vorzelt zur Hölle
Wie ich die Familienurlaube meiner Kindheit überlebte
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Jeden Sommer brachen wir mit dem VW-Bus auf von München-Neuperlach in Richtung Süden, ins Jugoskorsikalawienland oder irgendwo anders hin, wo es düstere Felsen, düsteres Meer und düstere Ortschaften mit düsteren Menschen gab. Was es dort nicht gab, war so etwas wie ein Klo oder eine Dusche. Denn meine Eltern waren nicht einfach nur Camper. Nein, sie waren überzeugte Wildcamper. Riesenspinnen auf dem Rücksitz, Schlangen in der Trinkwasserzisterne, gigantische Müllberge und sinkende Schlauchboote – es war alles dabei, was Camping in den 70ern so außergewöhnlich machte. Zumindest wenn man noch ein Kind und mit meinen Eltern unterwegs war.«
Besser als jeder Super-8-Film: Comedian Tommy Krappweis lädt ein zu einer skurrilen Zeitreise in die 70er Jahre.
Inhaltsübersicht
Prolog
Liegt es an mir?
Packwahn
Der Weg ist das Ziel
Der perfekte Platz
Die Spinne
Endlich ein uriger Platz
Das Vorzelt zur Hölle
Teppich, Teheppich ühüber ahalles …
Kann Wasser urig sein?
Das Kapitel, welches Sie [...]
Zwischenruf
Drei Kammern sollst du haben ...
Albern kentern leichtgemacht
Angriff der drei Kammern
Zum Thema Bootfahren hatte [...]
Felsen, Wulst und Wellen
Zu viel Sand ist auch nicht gut
Liegt es an mir?
Mein erstes Mal
Eine Pumpe für vier Halunken
Gas, ah Schmarrn!
Überwinde die Scham, sei frei
Der Campingplatz im Tunnel
Alleine zu zweit
Ausflüge
Camping ohne Eltern
Augen zu und durch
Tag der Erkenntnis
Tottis Tag
Bildteil
Bonusmaterial
Das zweite Mal
Prolog
Ich stehe im Studio Berlin-Adlershof am Set und blicke in ein deprimiertes Gesicht. Es gehört der niederschmetterndsten Backware seit Erfindung der Kornschrotung: Bernd das Brot. Meine Aufgabe ist es, die Regie zu führen, also das Drehbuch mit den gegebenen Umständen aus Personal, Budget und Zeit so gut wie möglich umzusetzen. Da ich gleichzeitig auch der Produzent bin, gibt es niemanden, der mich ermahnt, außer mir selbst.
Bernd das Brot wurde 1999 von meinem Kollegen Norman Cöster und mir erfunden. Bernd hat es uns nie gedankt.
Gerade drehen wir eine Szene, in der Bernd das Brot versucht, ein Campingzelt aufzubauen. Von den viel zu kurzen Armen mal abgesehen, läuft alles so ab, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Die Heringe lassen sich nicht in den Steinboden hämmern und verbiegen, die Gleiter an den Schnüren rutschen immer durch, der Zug erschlafft, der Reißverschluss klemmt …
Bernd schaut in die Kamera und sagt sein obligatorisches: »Mist.« Recht hat er.
Von Beginn der Produktion im Jahr 1999 an haben Norman Cöster, Erik Haffner und ich unsere Kindheitserinnerungen, Traumata und Hassbilder durch die Handpuppen Bernd das Brot, Chili das Schaf und Briegel den Busch gefiltert. Dadurch konnten wir unseren Dämonen einen Namen geben.
Norm hat die Namen von seinen Lehrern als Erzbösewichte eingebaut, Erik seine Jugend in der Pfalz unter anderem durch Briegels Auszeichnung als »Miss Pfalzwein 2004« verarbeitet, und ich … tja, ich drehe jetzt eine Camping-Folge, und Bernd muss leiden. So wie ich gelitten habe.
Meine Gedanken sind erfüllt von der Vorfreude auf das Gesicht, das mein Vater machen wird, wenn er jeden einzelnen Gag erkennt als das, was er ist: Rache. Meine persönliche Rache für unzählige schreckliche, nervtötende, nasskalte, brütend heiße, unbequeme, sicherheitstechnisch mehr als grenzwertige, weil oftmals lebensgefährliche Campingurlaube direkt in der Hölle und zurück.
Ha! So, Bernd, und jetzt klappt das rachitische Zelt über dir zusammen. Doppelmist, haha!
Natürlich muss ich mich zurückhalten, denn schließlich drehe ich gerade eine Familiensendung. Und so manches Abenteuer aus meiner Erinnerung würde trotz Handpuppen ein wenig übertrieben wirken. Also kapriziere ich mich in dieser Folge eher auf die allseits bekannten Klischees:
Jetzt macht Bernd sich auf zum kilometerweiten Gewaltmarsch Richtung sanitäre Anlagen. Dort wird er auf übergewichtige Stiernacken treffen, die ihn am Waschbecken zwischen ihren mächtigen Leibern einklemmen. Die Dusche wird vom obligatorischen Dauerduscher okkupiert sein, von dem nur ab und zu die eingeschäumten Hände zu sehen sind, wenn sie aus einem prall gefüllten Beutel mit Fünfzig-Cent-Stücken eine weitere Münze in den entsprechenden Schlitz schieben. Und die Toilette wird so sehr von Spinnweben überzogen sein, dass man die Schüssel nur auf den zweiten Blick als solche identifiziert. Das liegt daran, dass bis auf Bernd alle ihre eigene Camping-Toilette dabeihaben und nicht auf diesen, nennen wir es: Service zurückgreifen müssen. Und das war noch längst nicht alles! Ein wohliger Schauer durchfährt mich. Satisfaktion. Ahhh …
Als Autor bin ich es gewohnt, dass die Figuren in meiner Vorstellung den Text sprechen und ich ihn nur schnell genug tippen muss. Aber diesmal hatte es eine ganz neue Qualität. Selten floss mir ein Drehbuch so aus den Fingern wie Bernds Campingurlaub. Hier nahm Bernd wirklich fast eins zu eins meine Rolle ein, wunderte sich über die Dinge, über die ich mich damals gewundert hatte, und schimpfte weithin hörbar über all das, wofür ich damals keine Worte fand. Und Bernds Lamento wird genauso wenig von seinen Freunden Chili und Briegel gehört, wie mein Protest ehemals von meinen Eltern wahrgenommen wurde.
Der Grund hierfür ist ganz einfach: Meine Eltern waren und sind Campingfans.
Dies ist die Geschichte eines Jungen, der heute nur noch in Hotels übernachtet. Hotels, in denen kein Mülleimerchen auf dem Frühstückstisch steht.
Liegt es an mir?
Ich habe eine dreijährige Tochter namens Finja Maria Krappweis. Einerseits hoffe ich, dass sie mich verstehen wird, wenn sie irgendwann dieses Büchlein liest. Andererseits hoffe ich noch viel mehr, dass sie nicht zu einer solchen Verweigerungsmaschine heranwächst, wie ich eine bin.
Inzwischen weiß ich, dass es kaum möglich ist, mit mir Gesellschaftsspiele zu spielen oder länger als vielleicht zwei Stunden gesellig beisammen zu sein. Bald formt sich die Vorstellung in meinem Kopf, wie schön es doch wäre, jetzt auf der Couch ein Buch zu lesen. Oder irgendwas anderes zu tun, was man vorrangig alleine macht. Insofern weiß ich auch, dass es sicher nicht leicht war, mit einer Spaßbremse wie mir in den Urlaub zu fahren. Andererseits weiß ich aber auch, dass ich meiner Tochter zuhören werde, sie wahrnehmen möchte! Und ich argwöhne, dass es den Vorstellungshorizont meiner Eltern schlichtweg überstieg, dass ein kleiner Junge keinen Spaß beim Camping haben könne. Und darum wurde mein Gejammer ignoriert.
»Der Bua wird scho seng, wia schee dass des dann is«, lautete das gängige Argument meiner Eltern. Bezeichnenderweise in meinem Beisein geäußert.
Das macht es aber auch nicht wahrer. Ich erinnere mich an einen Skiausflug, bei dem ich es durch anhaltenden, mehrstündigen Protest während der Anreise schließlich schaffte, nicht mit auf den Berg zu müssen. Ich durfte stattdessen im Bus auf dem Parkplatz bleiben. Das liest sich sicher seltsam, aber ich empfand es tatsächlich als ein »dürfen« und somit durchgehend positiv! Ich durfte im Auto bleiben, ich durfte den ganzen Tag in Ruhe lesen, zeichnen oder dösen und dabei Hörspielkassetten hören! Urlaub! Schön.
Währenddessen kämpften sich meine Eltern den wolkenverhangenen Berg rauf und runter, denn mein Vater liebte es, wenn das Wetter im Skigebiet eher ungastlich war. Der Grund: »Dann san die Pistn leer, und ma fahrt einfach an den Lift hi und muas ned wartn!« Was soll man dazu sagen außer: Warum in Gottes Namen sind die Pisten wohl leer?! Warum wohl?!
Gerne hätte ich diese Buchstaben eurythmisch tanzen, im Takt der Silben auf und ab hopsen oder es in kindlicher Raserei immer und immer wieder brüllen können, während ich den Kopf gegen die Wand schlage. Es hätte nicht einmal etwas geholfen, meinem Vater die Worte auf die Netzhaut zu tätowieren (in Spiegelschrift natürlich). Selbst wenn die Frage nach diesem chirurgischen Eingriff für den Rest seines Lebens leicht wässrig vor ihm in der Luft geschwebt wäre, sobald er die Augen aufschlägt; er hätte darauf keine Antwort gehabt. Die Frage nach dem »Warum« macht in der Welt meines Vaters nämlich schlichtweg keinen Sinn, denn mein Vater denkt:
»Es macht Spaß, weil es mir Spaß macht, also macht es Spaß. Wer dazu keine Lust hat, der hat es eben noch nicht probiert. Denn hätte er es probiert, wüsste er ja, dass es Spaß macht, und würde es ebenso wollen. Also probiert er es jetzt, und dann macht es ihm auch Spaß.«
Aufgrund dieser höchst bestechenden Logik wurde ich also die Jahre über immer wieder genötigt, Dinge auszuprobieren, bis sie mir dann endlich Spaß machten. Gar nicht überraschenderweise funktionierte das jedoch nie. Das war aber natürlich kein Grund, den therapeutischen Ansatz zu überdenken. Nein, der einzige Grund, den mein Vater sich vorstellen konnte, war, dass ich vielleicht nicht die richtige Ausrüstung hatte.
Als begeisterter und höchst erfolgreicher Radrennfahrer wusste er, dass man auf einem schlechten Rad weder Spaß noch Erfolg haben konnte. Also wurde meiner Unwilligkeit generell begegnet mit einer stoischen Form technischer Aufrüstung.
Ich kann gar nicht zählen, wie oft er mich auf neue, noch unbequemere, schmalsattelige Rennräder setzte, meine Füße in ein neues Modell Skischuhe zwängte, mir andere Skier darunterschnallte oder mir hinterrücks Tauchermaske und Schnorchel ins Gesicht wobbelte, um mich danach auf hoher See aus dem Schlauchboot zu schubsen.
Nun gut, mag man sich vielleicht fragen, wo ist das Problem, etwas geschenkt zu bekommen? Sieht man mal von der Tatsache ab, dass ich als Beschenkter jedes Mal genötigt wurde, mich der Benutzung des Geschenkes immer und immer wieder zu verweigern. Es störte mich keineswegs, dass sich unser kleiner Keller unaufhörlich mit ungenutztem Sportgerät in gestaffelten Kindergrößen füllte. Das eigentliche Problem lag ganz woanders: Dieser Kram blockierte alle wichtigen Geschenkfeste!
Ich wünschte mir die ganze Kindheit hindurch eigentlich immer die gleichen drei Dinge: Lego, Marionetten und Super-8-Filmrollen. Geburtstage, Ostern und Weihnachten waren aber verstopft mit Skiern, Rädern und Trikots mit draufgesticktem »Tommi«, weil es in der Näherei kein »Y« gab!
Vielleicht erklärt sich nun meine Verweigerungshaltung ein wenig. Mal abgesehen von der angeborenen Charaktereigenschaft des Einzelgängertums musste ich an allen Fronten kämpfen, um irgendwie durchzudringen. Bei meinen Eltern hätte es nun mal nicht funktioniert, beim Tischgespräch gelegentlich den einen oder anderen Missstand aufzuzeigen und dann gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. Mein Vater hätte das innerhalb weniger Sekunden abgebügelt mit: »Ach Schmarrn, des probier ma jetz morgn einfach amal, und dann weast du scho sehn, wia schee dass des is!«
Nein, hier half nur die totale, völlige Verweigerung immer und überall, um letztlich allen so sehr damit auf den Wecker zu fallen, dass sie mich irgendwann in Ruhe lassen würden. Ja, das war ein harter Weg, aber ich war wild entschlossen, ihn zu beschreiten. Doch es sollten noch viele Jahre vergehen, bis ich endlich Herr meiner Freizeit wurde.
Bis dahin verbrachte ich sie campierend.
Packwahn
Meine früheste Kindheitserinnerung ist grün. Schuld daran ist ein grüner VW-Bus mit geteilter Scheibe und doppelter Klapptüre an der Seite. Man würde es heute wohl »Hippiebus« nennen und irgendwie cool finden.
Damals in den Siebzigern war das genauso normal wie Hosen mit Schlag von der Größe eines Tennisschlägers.
Mein Vater Werner Krappweis hatte die Inneneinrichtung des Busses selbst gebaut. Überhaupt hat mein Vater vieles selbst gebaut, die Ewigkeit hierbei immer fest im Blick.
So steht bis heute die wuchtige Garderobe aus Zehner-Balken im Eingangsbereich der Wohnung, und auch die Dachschräge aus gebeizten Nut-und-Feder-Brettern ziert immer noch das Wohnzimmer. Bis heute wartet mein Vater bei jedem neuen Besucher mit breitem Grinsen auf die Frage nach der bautechnischen Motivation einer Dachschräge im vierten Stock eines achtstöckigen Hochhauses in München-Neuperlach. Die Antwort lautet: Stauraum. Mein Vater liebt kaum etwas so sehr wie Stauraum. Aber davon später mehr.
Die Einrichtung des Hippiebusses hielt also länger als das Auto drumrum: Irgendwann fuhr der grüne Bus nämlich nur noch dreiundsiebzig Stundenkilometer, weil er zu ebenso viel Prozent aus eingeschweißten Eisenplatten bestand, die den Abstand zwischen den Rosträndern irgendwie überbrücken sollten. Als es schließlich keine Stellen mehr gab, an denen man etwas anschweißen konnte, war es dann doch Zeit für ein neueres Modell, das zum Zeitpunkt des Gebrauchtkaufs allerdings auch schon zu den betagteren Versionen zählte.
Da mein Vater als Automechanikermeister bei der Post arbeitete, entschloss er sich zu der Farbe Gelb – vermutlich weil er preisgünstigen Zugang zu entsprechenden Spraydosen hatte und schon voraussah, dass demnächst die erste von hundert Metallplatten farblich angeglichen werden musste. Die Inneneinrichtung jedoch wurde in weiten Teilen aus dem Hippiebus übernommen. Kein Wunder, hatte sie doch nicht nur unzählige Reisen an den Rand der zivilisierten Welt überstanden, sondern auch Wassereinbrüche, Aufschläge mit körperlichem Vollkontakt und die ein oder andere Gasexplosion.
Doch zurück zu dem grünen Ur-Bus und meiner ersten Kindheitserinnerung: Ich sehe alles aus der Perspektive eines mutmaßlichen Kindersitzes. Neben mir sitzt meine Oma Maria Krappweis zusammen mit anderen alten Damen und Herren ihres Wanderkreises dicht gedrängt auf der selbstgezimmerten Eckbank. Gerade steigt ein weiterer alter Herr – vermutlich mein Opa Hänsel – durch die Klappen, und man schickt sich allgemein an, noch mehr zusammenzurücken.
Mein Opa jedoch winkt störrisch ab, krallt sich stattdessen am Griff des Kühlschranks fest und sagt, dass er stehen wird. Sein Sohn – also mein Vater – versucht, ihn zu überzeugen, sich doch besser zu setzen, aber er dringt ebenso wenig durch wie die anderen Stimmen im Auto. Also fährt mein Vater schließlich los, und das erstaunlich ruckartig. Ich will ihm hier keine Absicht unterstellen, tue es aber doch.
Sofort klappt die Tür des Kühlschranks auf, und Opa Hänsel verliert den Griff. Nein, das stimmt nicht. Er behält den Griff, nur die Türe verliert ihn. Dafür plumpst Opa Hänsel an mir vorbei auf irgendeine ältere Dame, die so erschrocken aufquietscht, wie das nur ältere Damen können. Danach Aufruhr, und die Erinnerung verblasst.
Ich weiß, dass das eine seltsame Kindheitserinnerung ist, aber diese Szene ist unauslöschlich in mein Hirn graviert. Sie illustriert zudem mehrere Dinge, die mich entscheidend prägen sollten:
der Starrsinn Erwachsener im Allgemeinen und meiner Familie im Besonderen
die rustikale Art und Weise, mit der man sich untereinander beweist, wer recht hat
die Unzuverlässigkeit von Campingmöbeln, egal ob selbstgebaut oder direkt vom Fachbetrieb
das grundsätzlich unzureichende Platzangebot
Das Platzproblem begleitete uns überallhin. Wie oben schon erwähnt, nahm es in der Wohnung seinen Anfang. Dort drückte es sich in Form von künstlichen Dachschrägen aus oder durch einen seltsam erdrückend wirkenden Kasten über der Wohnungstür, der gefüllt war mit Schuhwerk quer durch alle Jahreszeiten.
Doch besonders kam das Platzproblem im Vorfeld der Campingreisen zum Ausdruck. Obwohl, ich muss mich korrigieren, irgendwie ist es gar kein echtes Platzproblem. Es ist eher eine Art Obsession über das Thema. Mein Vater pflegte schon mehrere Tage vor der Abreise mit dem Packen zu beginnen. Er schiebt das bis heute auf meine Mutter, die ja immer so unglaublich viel hätte mitnehmen wollen. Ich argwöhne jedoch, dass er an der Flut von Kram nicht unschuldig war, wollte er doch auf jedwede Eventualität vorbereitet sein und zudem nichts zu Hause lassen, was potenziell geeignet war, um im Urlaub für »Spaß« zu sorgen.
Außerdem glaube ich, dass mein Vater wirklich Freude hat am Einräumen. Bis heute ertappe ich ihn dabei, wie er Stifte auf einem Tisch parallel zur Schreibunterlage ausrichtet und mit einem wahrhaft systemischen Wahn die Spülmaschine be- und entlädt. Wobei mein Vater nicht zwanghaft wirkt, ganz im Gegenteil. Auf Menschen, die ihn kennenlernen, macht er sogar einen lockeren, humorvollen und absolut pferdediebstahlgeeigneten Eindruck. Das trifft im Großen und Ganzen auch zu – außer es geht um Einräumen, Umräumen, Werkzeug oder Vorräte. Da entwickelt mein Vater eine Pedanterie, die ihresgleichen sucht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der größere innere Befriedigung dabei empfindet, jede – aber auch wirklich jede – freie Stelle mit irgendetwas Nützlichem zugepfropft zu haben, bis tatsächlich kein Platz mehr frei ist – außer dem, an dem die Familie installiert werden muss. Hätte mein Vater sich jemals für den Game Boy interessiert, wäre er süchtig nach Tetris.
Diese Pack-Obsession führte dazu, dass wir in späteren Urlauben ein kleines Segelboot auf einem Anhänger mit uns führten. Jedoch nicht in erster Linie, um es zu wassern, sondern um es bis unter die straff gespannte Persenning vollzupacken mit Konserven, Kartoffelpüree-Flocken, Gaskartuschen, Batterien, Dosenmilch und diversen anderen Dingen mit Aufblas-, Ausklapp- oder Faltfunktion. Ansonsten war das Boot nur noch dazu da, dass wir es einen Tag vor der Heimreise schuldbewusst zu Wasser ließen, um damit zweimal zu kreuzen und einmal zu kentern und es anschließend doppelt so lange zu säubern, wie der Segeltörn gedauert hatte.
Anschließend wurde es wieder vollgepackt bis zum Rand, und ich frage mich bis heute, warum sich die Menge der Vorräte auf der Heimreise nicht signifikant von der Menge der Vorräte bei der Abreise unterschied. Ich weiß genau, dass wir laufend gegessen haben, denn ich musste ja auch laufend abspülen. Aber was immer ich da unter dem eiskalten Wasser mit dem grindigen Schwamm von dem Plastikgeschirr kratzte – es kann nicht aus den Konserven stammen, die wir im Boot hierher ans Ende der Welt gekarrt hatten. Denn die wurden nach dem Urlaub vollzählig wieder in die kleine Vorratskammer neben der Küche sortiert.
Insgesamt beschleicht mich heute in der Rückschau die Ahnung, dass dieser gesamte Campingwahnsinn wenig mit Urlaub zu tun hatte, sondern vielmehr mit Zwanghaftigkeit und Ritualen. Das trifft auf jeden Fall nicht nur auf das Packen und die Vorbereitungen vor der Abreise zu, sondern auch auf die ewig langen und beschwerlichen Wege in das sogenannte Urlaubsland. Oder was mein Vater für ein solches hielt …
Der Weg ist das Ziel
Der grüne VW-Bus hatte oben eine Luft/Licht-Luke. Um auch mit vollgepacktem Gepäckträger in den Genuss von beidem zu kommen, hatte mein Vater eine statische Meisterleistung ersägt. Er hatte genau an der Stelle, wo sich die Dachluke befand, die entsprechenden Streben des Dachgepäckständers gekappt. Somit konnte man das Gepäck wunderbar um dieses Loch herum drapieren, und wenn die Sonne hoch genug stand, fiel tatsächlich etwas Licht ins Innere des Busses.
Dafür fehlten dem Gepäckträger allerdings ein paar Querverbindungen, die der Designer des guten Stücks vermutlich nicht ausschließlich aus Jux und Dollerei dort installiert hatte. Aber tatsächlich taten Spanngurt und Wachsschnur jahrelang einen statisch ebenso einwandfreien Dienst.
So konnte mein Vater die dringend benötigten Gasflaschen für Kühlschrank und Herd auf dem Dach festzurren und musste sie nicht im Inneren des Busses lagern. Es war und ist zwar verboten, Gasflaschen auf einem Dachgepäckträger zu transportieren, weil die Sonne schon mal dafür sorgt, dass so eine Gasflasche dem Auto zu viel Drive gibt. Dieses Problem löste mein Vater jedoch elegant mit einer Plastikplane. Mit »Problem« meine ich allerdings nicht die pozentielle Lebensgefahr für Insassen und nähere Umgebung. Nein, damit ist gemeint, dass nun niemand mehr die Gasflaschen sehen konnte und wir mit ein bisschen Glück und vorausgesetzter Faulheit der Beamten ungestört über die Grenze kommen würden.
Aber da das Auto mit seinem handgezimmerten Innenausbau, den Metallplatten im Boden und den selbstverlegten Gasleitungen ohnehin keinem Sicherheitsstandard der Welt – außer dem meines Vaters – standhielt, waren Glück und Beamtenklischee sowieso unabdingbar. Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, bei der Passkontrolle auszurufen: »Aber Papi, das ist doch gar nicht erlaubt mit den Gasflaschen auf dem Dach!«
Ich habe es dann aber doch gelassen, weil mir ein griechischer Campingplatz immerhin noch bequemer erschien als ein griechischer Knast. Heute bin ich mir da allerdings nicht mehr so sicher …
Wie auch immer, nach drei Tagen waren Boot, Bus und Gepäckträger vollgepackt, und meine Mutter und ich traten die vorerst letzte Reise im heimischen Aufzug nach unten an. Wenn bisher noch nicht so arg viel von meiner Mutter die Rede war, dann ist das nicht wertend gemeint. Meine Mutter Karin Krappweis war damals noch nicht die omnipräsente Das-machen-wir-jetzt-so-und-das-machen-wir-jetzt-so-Maschine, die sie heute ist.
Wenn man so will, hatte sie ihr Coming-out als vollkommen eigenständige Persönlichkeit erst, nachdem sie und mein Vater sich scheiden ließen, als ich zwölf und mein Bruder Nico sechs Jahre alt war. Meine Eltern hatten früh geheiratet, und meine Mutter brauchte ein paar Jahre, bis sie sich über die Lautstärke meines Vaters hinweg ebenfalls vollumfänglich hörbar machen konnte.
Die Geschichten in diesem Buch fallen aber eher in die Zeit, als meine Mutter noch das meiste glaubte, was mein Vater erzählte, und im Großen und Ganzen darauf vertraute, dass er das Richtige zum Wohl aller Familienmitglieder tun würde. Und wenn mein Vater sagte, es herrsche keine Gefahr, dann herrschte keine Gefahr-ich-lach-mich-kaputt.
Vorsichtig ausgedrückt, zeichneten sich die Anreisen immer durch ein Höchstmaß an Unbequemlichkeit aus. Die schier endlose Fahrtdauer plus die wenig ergonomischen Sitze mal das zuckelige Reisetempo von irgendwas um die 80 Stundenkilometer ergaben eine Gesamtgrenzerfahrung, die mir heute noch das Gefühl hilfloser Agonie vermittelt.
Ich war auf dem Weg an einen Ort, den ich schon hasste, bevor wir angekommen waren, und hatte keine Möglichkeit, das irgendwie zu vermeiden. Das erste Mal alleine zurückbleiben durfte ich erst im Alter von vierzehn, und bis dahin war es noch lange hin. Also bestand die einzige Chance, das Ganze zu überstehen, darin, mich von Moment zu Moment mit der Situation zu arrangieren. Ich musste also mitfahren, na gut – aber keiner, nichts und niemand würde mich dazu bringen, Spaß zu haben!
Zuerst hörte ich meine Pumuckl-Kassetten noch über die Lautsprecher des Autoradios. Damals noch mit Alfred Pongratz als Meister Eder, denn Gustl Bayrhammer kam erst viel später. Doch Alfred hin, Gustl her, meinen Eltern ging vielmehr der Hans Clarin auf die Nerven. Nicht persönlich natürlich, sondern als Stimme vom Pumuckl.
Nachdem Kinder im Allgemeinen eine große Freude an der Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung haben, war schnell klar, dass ich dringend einen eigenen Kassettenrekorder benötigte. Also bekam ich eines dieser rechteckigen Henkelgeräte mit einem Monolautsprecher oben und einem Kassettenfach darunter, mit großen mechanischen Tasten, von denen eine rot war und die Funktion hatte, über das eingebaute Mikrofon aufzunehmen – vorausgesetzt, man hatte genug Kraft, um die REC- und die PLAY-Taste gleichzeitig runterzudrücken.
Mit diesem Gerät lümmelte ich mich also hinten auf der Eckbank im Hippiebus und hörte die gleichen vier Pumuckl-Kassetten rauf und runter. Ich weiß, dass mein Vater nach stundenlanger Fahrt Richtung Italien noch einmal entnervt umdrehte, weil wir meinen Kassettenrekorder zu Hause vergessen hatten. Das Gejammer war ihm dann wohl noch mehr auf die Nerven gegangen als das ewige »Pumuckl versteckt und niemand was meckt!«
Zu Hause hatte ich damals übrigens auch eine Schallplatte, und zwar das »Lied der Schlümpfe« von Vadder Abraham. Leider handelte es sich dabei um eine Single, und Singles waren nun mal immer so schnell vorbei, dass man das Legobauen laufend unterbrechen musste, um den Tonarm wieder geräuschvoll an den Anfang der Platte zu schmettern. Darum ging ich ziemlich rasch dazu über, die Single in dem langsameren Tempo für Langspielplatten abzuspielen. Das hatte den Vorteil, dass das Lied deutlich länger dauerte und ich somit auch nicht mehr so oft aufstehen musste. Der Nachteil war jedoch unüberhörbar: »Dööör Flööötooonnnschlumpfff föööngggdd onnnnn …«
Vielleicht war das der Grund, warum ich kurz darauf meine erste Langspielplatte geschenkt bekam, aber jetzt zurück zum Campingurlaub.
Da ich ziemlich früh mit dem Lesen begonnen hatte und das neben Legobauen und Marionettenspielen schnell zu meiner dritteinzigen Hauptbeschäftigung wurde, wich der Stapel Hörspielkassetten bald einem stehenden Klafter Bücher aus der städtischen Leihbibliothek. Man durfte vierzehn Stück auf einmal ausleihen, und genau so viele nahm ich auch in die Urlaube mit, fest entschlossen, wirklich gar nichts zu tun, außer mein kleines Zelt aufzubauen und die endlosen Tage dort drin mit meinen Büchern zu verbringen.
Leider war es jedes Mal das Gleiche: Wir zuckelten tausend Millionen Stunden mit dem Bus über die Autobahnen ins Urlaubsland und dort nochmals tausend Millionen Stunden über irgendwelche Autoputs auf der Suche nach dem urigsten Campingplatz. Kaum waren wir endlich irgendwo angelangt, hatte ich meine Bücher auch schon ausgelesen – und das in einem brüllend heißen Bus, der damals natürlich nicht über eine Klimaanlage verfügte, sondern nur über zwei Klappfenster, die man entgegen der Fahrtrichtung schräg stellen konnte.
Somit hatte ich die Wahl zwischen Brüten und Lärm. Das größere der beiden Klappfenster bot leider auch entsprechend mehr Windwiderstand und blieb demzufolge nur offen, wenn man sich dagegenstemmte. Also verbrachte ich viele Stunden liegend auf der Eckbank, die Füße gegen das Fenster gedrückt, um nicht zu ersticken. Mit der einen Hand presste ich meinen Kassettenrekorder ans linke Ohr beziehungsweise hielt das Buch hoch und drückte das Ohr gegen die Lehne der Eckbank. Mit der anderen Hand hielt ich mir das rechte Ohr zu. Wenn mein Körper dann irgendwann schmerzhaft verkrampfte und ich den Druck auf das Fenster nicht mehr aufrechterhalten konnte, schloss es sich ganz von selbst mit einem lauten Knall. Dann herrschte vergleichsweise Ruhe, dafür wurde es aber innerhalb weniger Sekunden unerträglich heiß.
Meinen Eltern ging es vorne sicher nicht anders, aber die schien das nicht zu stören! Die Hitze, der Wind und all die anderen Unannehmlichkeiten waren wohl Teil dieser »Freiheit«, die sie da empfanden, und somit ganz ausdrücklich willkommen. Es kam eben einfach darauf an, wie man die Dinge empfand.
Aber ich war leider nicht in der Lage, mich selbst zu hypnotisieren, um meinen Frust in Freude umzuwandeln. Okay, ich wollte es auch gar nicht. Ich wollte nur eines, und zwar nach Hause. Da das aber in weiter Ferne lag, sowohl zeitlich als auch räumlich – Tendenz steigend – blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder gegen das Fenster zu stemmen, sobald die Schmerzen in den Gliedern und am Ohr nachgelassen hatten.
Der perfekte Platz
Der perfekte Platz für einen Campingurlaub musste für meinen Vater vor allem eines sein: urig.
Urig ist ein dehnbarer Begriff und bedeutet irgendwas zwischen »wuchtig, romantisch, einsam, archaisch, zerklüftet, düster, wellenumtost« und »bar aller Anzeichen von Zivilisation«. Letzteres schließt auch sanitäre Anlagen mit ein.
Ja, mein Vater war und ist Wildcamper mit Leidenschaft. Ein tatsächlicher Campingplatz wurde nur angesteuert, wenn sich dort sonst nichts fand. Und man bedenke, wie die Suche vonstattenging in den Zeiten vor Internet und Google Maps. Um einen Ort als campingwert oder -unwert zu befinden, musste man diesen erst einmal aufsuchen und sich live mit eigenen Augen umsehen. Heutzutage suchmaschint man einfach nach versteckten Orten und Camping-Geheimtipps im entsprechenden Urlaubsland (ob dieser Geheimtipp dann wirklich so geheim ist, wenn er im Netz ergoogelbar ist, sei dahingestellt). Die versteckten Orte, die mein Vater suchte, zeichneten sich in jedem Fall dadurch aus, dass man sie nicht so leicht fand. Aber wir hatten ja die ganzen Ferien lang Zeit, und so konnte die Suche nach dem perfekten Standplatz schon einmal ein paar Tage in Anspruch nehmen.
Man konnte schließlich einfach so irgendwo haltmachen, dort einfach so übernachten und sich am nächsten Tag einfach so entscheiden, einfach so weiterzufahren! Hurra, diese Freiheit!
Frei waren aber eigentlich nur meine Eltern, ich war gefangen in ihrem Wahn, alles toll zu finden, was ihr Sohn scheiße fand.
So wurde es also irgendwann dunkel, und wir holperten auf den nächsten Campingplatz oder blieben einfach stehen, wo wir waren.
Bis heute reagiert mein Vater auf nächtliche Geräusche recht vehement. Er steht kerzengerade im Bett und macht mit der rechten Hand eine blitzschnelle Bewegung. Das mag vielleicht daran liegen, dass er zu viele Nächte auf irgendwelchen Parkbuchten im Niemandsland verbracht hat, wo das Einzige, was zwischen dem Verlust seiner Familie und aller mitgeführten Güter stand, er selbst und ein Finnmesser war.
Für Nichtcamper: Ein Finnmesser ist kein Gerät, um Skandinavier orten und weiträumig umgehen zu können, obwohl das auf Campingplätzen manchmal sogar Sinn gemacht hätte, wenn man nachts gerne durchschläft.
Nein, ein Finnmesser ist ein dünnes und so dermaßen scharfes Messer, dass man damit einen Baum von seinem Schatten trennen könnte. Ich sage »könnte«, denn da, wo wir campierten, war meistens kein Baum und somit leider auch kein Schatten, aber dazu später mehr.
Mein Vater demonstrierte die Schärfe dieser Waffe gerne dadurch, dass er ganz leicht mit der Klinge über seinen Daumennagel glitt, worauf sich dann eine hauchdünne Schicht des Nagels über die Schnittfläche kräuselte. Außerdem zerschnitt das Messer beim Wegstecken immer wieder die dafür passende Lederscheide aus dickem Schweinsleder. Hilfe.
Mit diesem Messer in der Hand wachte mein Vater auf der businternen Bettstatt über uns, bereit, jedem Straßenräuber die Finger zu filettieren – oder welches Körperteil auch immer dieser zuerst wagte in den Bus zu schieben. Zum Glück für die weltweite Diebesgilde kam es nie dazu.
Das konnte aber auch daran liegen, dass unser Bus nicht gerade so aussah, als würde jemand damit einen sündhaft teuren Fotoapparat oder jede Menge Deutschmark durch die Fremde zuckeln. Ganz im Gegenteil. Wir wirkten vermutlich eher wie eine kleine Hippiekommune auf dem Weg in den Ashram. Und falls irgendein Dieb doch einen Blick ins Innere wagte, sah er dort einen Mann mit wildem Bart, der ein Messer umklammert hielt und ihn mit einem halboffenen Auge auffordernd anstarrte. Mein Vater ist der einzige Mensch, den ich kenne, der so schlafen kann. Der Anblick ist höchst verstörend, aber offensichtlich recht wirkungsvoll.
Nachdem meine Mutter und ich lange genug nach Moskitos gehauen hatten, war es auch schon wieder Zeit, weiterzufahren. Wobei ich noch erwähnen sollte, dass mein Vater generell sehr ungern Pausen einlegte. Ihm war es immer wichtig, bei der Rückkehr sagen zu können: »Und dann binni de achzgdausnd Kilomedda in drei Dog owegrittn!«, oder so was in der Art. Und am Ende dieser achzgdausnd Kilomedda war dann immer »a ddrauumhafter Platz«, und an dem blieben wir die ganzen Ferien über, weil »wos Scheenas gibt’s ja gar ned«. Ansichtssache, würde ich da sagen, aber was hilft’s.
Wenn ich bisher wenig spezifisch bin, was die jeweiligen Urlaubsländer angeht, dann liegt das daran, dass das für mich anfangs alles das Gleiche war, nämlich »nicht zu Hause«. Ich komme aber später noch auf die einzelnen Länder und ihre Klischees zu sprechen – wär ja noch schöner. Auf jeden Fall fand mein Vater in jedem dieser Länder seinen »ddrauuumhaften Platz«.
Er hatte tatsächlich ein untrügliches Gespür dafür, an welcher Steilküste sich demnächst eine düstere Bucht öffnen würde oder wann man plötzlich scharf rechts in einen kleinen Wirtschaftsweg einbiegen sollte, um die kleine Felsnase zu erreichen, die nicht bei Flut vom Meer verschluckt wurde.
Ich erinnere mich da an einen dieser Momente; ich glaube, es war auf der Insel Korsika. Eine kleine Straße führte ziemlich scharf rechts von der Landstraße direkt hinunter ans Meer. Das konnte man auch ohne Navi gut erkennen, denn die Straße machte keine typischen Serpentinen, sondern verlief ebenso steil wie schnurstracks direkt nach unten, und man konnte am Ende tatsächlich das Wasser glitzern sehen. Mein Vater war sofort begeistert, und noch bevor meine Mutter »Aber …« rufen und mit zitternder Hand auf die unzähligen gähnenden Schlaglöcher deuten konnte, lenkte er unseren Bus bereits auf die ungeteerte Straße und griff beherzt zur Handbremse.
Die Fahrt nach unten war keine solche, denn ich glaube, die Räder haben sich kein einziges Mal gedreht. Mein Vater muss bis ganz nach unten durchgängig gebremst haben, denn man hörte es deutlich, und man sah es auch in Form von bläulichem Rauch, der bald unseren ganzen Bus eingehüllt hatte. Mir drängt sich heute eine Szene aus »Jim Knopf« auf, in der die Lokomotive Emma als Drache verkleidet wird und dann Feuer und Rauch speit. So ähnlich könnten wir für den ein oder anderen flüchtenden Korsen ausgesehen haben, vorausgesetzt, er hat sich auf der Flucht vor uns noch einmal umgedreht.
Mangels Anschnallpflicht wurde ich hinten im Bus so extrem durch die Gegend geschleudert, dass ich mich irgendwann nur noch panisch an dem Stahlrohr des beweglichen Tisches festklammerte, um nicht bei jedem Schlagloch hochgeworfen zu werden und gegen den kantigen Kühlschrank zu prallen. Meine Eltern hatten während dieser Abfahrt keine Sekunde Zeit, den Blick nach hinten zu wenden.
Mein Vater war zu sehr damit beschäftigt, nicht völlig die Kontrolle über den Wagen zu verlieren und gleichzeitig so auszusehen, als wäre das alles ein großer Spaß. Meine Mutter war zu sehr damit beschäftigt, panisch zu schreien – nur unterbrochen von den seltsamen Kieksern, die sie jedes Mal ausstieß, wenn sie wieder hart auf den Sitz oder mit dem Kopf gegen die Decke prallte.
Als wir irgendwann tatsächlich lebend unten angekommen waren, fand man mich zugedeckt von allem, was mein Vater so sorgsam hinter den vielen Klappen verstaut hatte. Hinzu kamen diverse Taschen, die Kissen von der Eckbank mitsamt der hölzernen Versteifung, so dies und das aus dem Kühlschrank und natürlich die unvermeidliche 1,5-Liter-Flasche Curry-Ketchup. Ich hasse den Geruch bis heute.
Meine Mutter öffnete die Doppeltüre des Busses, und es ergoss sich der ganze Kram mitsamt dem Sohn in den grobkörnigen Sand. Mein Vater lachte, meine Mutter weinte, und ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwelche Geräusche von mir gab.
Ich weiß nur noch, dass uns eine Gruppe Menschen stumm anstarrte und irgendwer fragend auf die Straße zeigte, die wir gerade heruntergeschlittert waren. Mein Vater nickte stolz. Das Gegenüber machte eine Geste, die man vielleicht am besten mit »Wischiwaschi« bezeichnet, und dann gingen sie alle brummelnd weg. Später erfuhren wir, dass es sich bei dieser Straße mitnichten um die offizielle Zufahrt zu diesem Campingplatz handelte, sondern um einen ausgetrockneten Bachlauf. Das erklärte vieles.
Die Spinne
Vielleicht haben Sie schon mal von dieser urbanen Legende gehört. Es ist immer irgendwer, der irgendwen kennt, dem das passiert sein soll: Dieser Irgendwer bekommt eine eingetopfte Yucca-Palme geschenkt, und als er sie gießt, hört er ein seltsames quietschendes Geräusch, das sich dann als eine riesige Spinne entpuppt, die wohl kein Wasser mag. Wahlweise gibt es diese Wandersage auch mit einer toten Giftspinne, die irgendwo gefunden wird, oder mit den unvermeidlichen kleinen Spinnen, die schlüpfen und in der Wohnung rumwuseln. Wir erlebten eine weitere Version. Direkt, ohne Umwege über wen, der irgendwen kennt, und ohne Palme, aber dafür mit Auto.
Es war, soweit ich weiß, auf dem Weg nach Egal-es-ist-überall-heiß-und-scheiße-Land. Nach einer ewigen Gewaltfahrt, auf der mein Vater mal wieder beweisen wollte, dass Schlaf generell überschätzt wird, bestand meine Mutter irgendwann doch auf einer Pause.
»Hier?!«, fragte mein Vater ungläubig.
»Ja, hier und jetzt.«