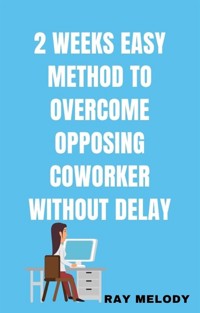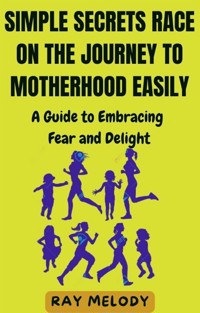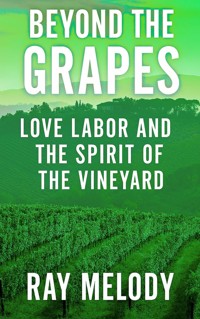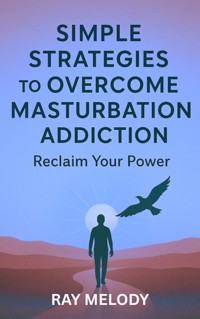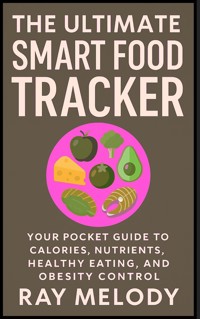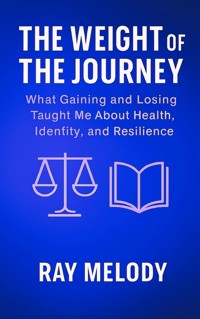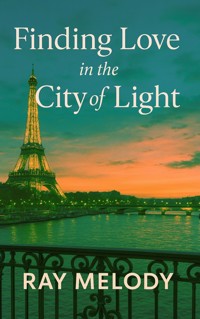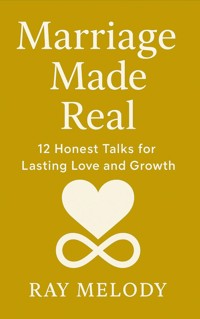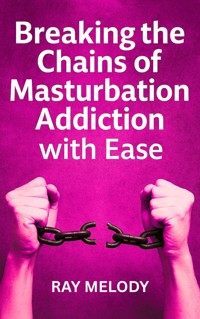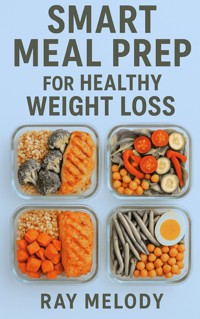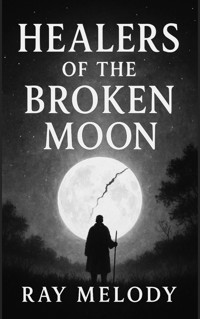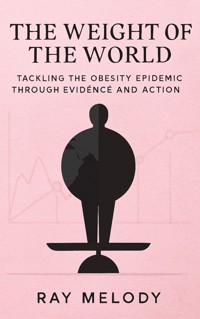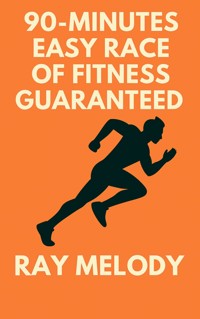Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Jentas EhfHörbuch-Herausgeber: Skinnbok
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Australien-Saga
- Sprache: Deutsch
Overcome Issues That Bothers You Easily Under 2 Weeks Or Less is a practical and empowering guide designed for anyone who feels overwhelmed by personal struggles and emotional challenges. This book offers a simple, structured approach to breaking free from the habits, fears, and mental blocks that keep you stuck. Within its pages, you will discover straightforward techniques that help you understand the root of your problems, regain emotional clarity, and take decisive steps toward a better life.
Whether you are dealing with stress, lack of confidence, relationship worries, procrastination, or a sense of being mentally drained, this guide shows you how to regain control in just a short period of time. Through easy exercises, proven psychological methods, and daily action steps, you will learn how to shift your mindset, replace unhealthy patterns, and build the inner strength needed to move forward.
This book is written to give you quick results without overwhelming you with theory. By following the strategies consistently, you can transform your thinking, boost your emotional well-being, and experience noticeable changes in less than two weeks. Your breakthrough begins here.
Ray Melody.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das weite Land
Das weite Land – Australien-Saga 6
© Vivian Stuart (William Stuart Long) 1984
© Deutsch: Jentas ehf 2022
Serie: Australien-Saga
Titel: Das weite Land
Teil: 6
Originaltitel: The Colonists
Übersetzung : Jentas ehf
ISBN: 978-9979-64-316-6
–––
Für
BILL MANN
in Dankbarkeit
ERSTER TEIL
Der Enterbte
1
»Sie sind da, Papa«, verkündete Emily Willoughby nervös. »Robert und James. Sie warten draußen.«
Konteradmiral Sir Francis Willoughby schaute von dem Buch auf, in dem er gerade las, und blickte seine Tochter mißbilligend an. »Habe ich nicht gebeten, daß du anklopfst, bevor du in mein Arbeitszimmer kommst?« fragte er streng.
Da Emily wie immer Angst vor seinen heftigen Wutausbrüchen hatte, entschuldigte sie sich. Sie wußte, daß es keinen Sinn hatte, ihm zu sagen, daß sie geklopft hatte. Niemals würde er zugeben, daß er immer schwerhöriger wurde. Seine Mißbilligung galt nicht ihr, sondern ihren Brüdern. Obwohl sie den genauen Grund dafür nicht kannte, nahm sie an, daß Roberts Verhalten wieder einmal an der Verstimmtheit ihres Vaters schuld war.
Seit seines Kriegsgerichtsprozesses vor zwei Jahren und seiner Entlassung aus der Königlichen Marine hatte Robert seinem Vater so viel Ärger bereitet, daß er seit einiger Zeit Hausverbot hatte. Sein Name durfte in Anwesenheit des Admirals nicht genannt werden. Darum war Emily um so erstaunter gewesen, als sie — erst gestern — erfahren hatte, daß der Vater ihn und seinen armen kleinen Bruder Jamie ins Haus bestellt hatte. Allerdings war es ihr schleierhaft, was Jamie getan haben könnte, um so plötzlich nach Hause gerufen zu werden.
Sie seufzte. Ihr jüngerer Bruder war erst dreizehn Jahre alt, aber schon ein Offiziersanwärter im College der Königlichen Marine in Portsmouth. Die ausgezeichneten Beurteilungen, die er bisher bekommen hatte, waren eine große Freude für ihren Vater, und sie wunderte sich sehr darüber, warum er ihm mitten im Semester die lange Reise von Plymouth nach Hause zugemutet hatte.
»Soll ich sie hereinholen, Papa?« fragte Emily angespannt. Sie würde natürlich aus dem Zimmer geschickt werden, sobald ihre Brüder da wären. Was immer ihr Vater ihnen auch zu sagen hatte, es war sicher nicht für ihre Ohren bestimmt. Als weibliches Wesen war sie von klein auf daran gewöhnt, von männlichen Angelegenheiten ausgeschlossen zu werden, ganz besonders, wenn es um berufliche Dinge ging.
Seit dem Tod ihrer Mutter vor acht Jahren hatte sie ihrem Vater das Haus geführt und die Erziehung ihrer beiden jüngeren Schwestern überwacht. Ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten hatten sich ausschließlich auf Haushaltsdinge beschränkt und waren weitgehend als selbstverständlich hingenommen worden. Sie war kein einziges Mal von ihrem Vater ins Vertrauen gezogen worden oder hatte ihn jemals nur annähernd so stark interessiert wie seine Söhne ... bis — und das war leider eine Tatsache — der arme Robert in Ungnade gefallen war.
»Soll ich«, fing Emily an, da ihr Vater in nachdenkliches Schweigen gefallen war, »soll ich den Jungs und dir Kaffee servieren, Papa? Oder eine Flasche von deinem Madeira? Sie haben noch keine Zeit gehabt zu frühstücken, und Jamie ist die ganze Nacht durchgereist. Er...«
»Nein!« unterbrach sie der Admiral. »Ich wünsche nicht, daß du uns irgend etwas bringst.« Er warf das Buch, in dem er gelesen hatte, so heftig auf den Tisch, daß es über die polierte Oberfläche rutschte und vor ihren Füßen landete. Als sie das Buch aufhob, erkannte Emily, daß es sich um ein juristisches Werk handelte.
Ihr Vater zog seine weißen Augenbrauen zusammen und deutete ungeduldig auf die Tür. »Hol deine Brüder herein. Und ... ich wünsche, daß auch du anwesend bist, wenn ich mit ihnen spreche, da die Angelegenheit auch dich angeht, wenn auch nur indirekt. Bitte bereite dich auf etwas sehr Unangenehmes vor — ich sage das nur, damit du keinen zu großen Schrecken bekommst.«
Emily zögerte einen Augenblick. Ihr Herz schlug wie rasend, und sie verließ eilig den Raum.
Ihre Brüder warteten in dem freundlichen sonnigen Zimmer. Es war das Boudoir ihrer Mutter gewesen und diente ihnen jetzt als Frühstückszimmer. Der hochgewachsene Robert, der in seiner Zivilkleidung wie ein Fremder wirkte, hatte die Weigerung ihres Vaters, ihnen etwas zum Trinken anzubieten, vorhergesehen. Denn es stand eine Flasche Brandy auf dem Tisch, und Robert hielt ein halbleeres Glas in der Hand.
Jamie sah angespannt aus, hatte es aber offensichtlich vorgezogen, nichts zu trinken, obwohl Hawkins, der ehemalige Steuermann des Admirals, der jetzt im Haus als Butler und Kutscher diente, auch ihm ein Glas hingestellt hatte.
Als Robert seine Schwester ins Zimmer kommen hörte, drehte er sich schnell um und leerte sein Glas auf einen Zug. Dann fragte er aggressiv: »Was will der alte Mann denn bloß, Emmy? Warum mußten wir in einer so gottverdammten Eile hier erscheinen?«
Emily schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Ahnung, Rob. Papa hat mir nichts gesagt. Nur, daß ich dabeisein soll, wenn er mit euch spricht. Er hat gesagt, es gehe mich auch etwas an.«
Robert fluchte leise. »Nein«, widersprach er. »Verdammt noch mal — nein! Ich will nicht, daß du dabei bist, wenn er mir Vorhaltungen über meinen Lebenswandel macht, der sich natürlich nicht mit seinen völlig veralteten Vorstellungen verträgt. Ich bitte dich darum, Emmy, daß du bei dem Gespräch nicht dabei bist, wenn ich dir auch nur ein bißchen etwas bedeute.«
Emily wurde rot. »Du weißt genau, wieviel du mir bedeutest, Rob. Aber ich kann Papa deshalb doch nicht den Gehorsam verweigern. Er hat anscheinend uns dreien etwas mitzuteilen.«
Er sah sie verwundert an. Seine Krawatte war fleckig, das Hemd schlecht gebügelt und seine Jacke abgetragen. Wo immer er jetzt auch wohnte, es war ganz offensichtlich, daß niemand sich um seine Kleider kümmerte und ... von einem plötzlichen Verdacht gepeinigt, fragte Emily angespannt: »Rob, arbeitest du noch bei der Bank in der Exeter Street?«
Robert lachte kurz auf. »Ach, großer Gott, nein — der alte Geldsack hat schon vor zwei Monaten auf meine Dienste verzichtet. Und verdammt noch mal — es hat mir keinen Augenblick lang leid getan! Ich bin bei der Arbeit vor Langeweile fast gestorben und hätte es sowieso nicht mehr viel länger dort ausgehalten. Aber ganz abgesehen davon, ist er ein hartgesottenes altes Schwein und hat Papa über alles, was ich tat — oder nicht tat — genauestens Bericht erstattet.«
Jamie wollte etwas sagen, überlegte es sich dann aber anders. Er wurde rot im Gesicht.
Wie sie es oft getan hatte, als er noch ein Kind war, legte ihm Emily schützend den Arm um die Schultern, aber er wich ihr aus und stotterte: »Wir sollten Papa nicht länger warten lassen, Rob.«
»Das sollten wir wirklich nicht«, stimmte Robert mit gespielter Unterwürfigkeit zu. »Man darf den hoch verehrten Admiral niemals warten lassen. Das kriegst du doch in deiner Schule beigebracht, oder?«
Jamie wurde noch röter und flüsterte Emily zu: »Er ist betrunken, Emmy. Er...«
Robert starrte ihn an. »Jetzt aber los, kleiner Bruder. Streich dem alten Mann um den Bart und erzähl ihm, was für Ehrungen und Vergünstigungen einen jungen Offiziersanwärter erwarten, der nie eine freche Antwort gibt! Ich komme nach, wenn ich noch ein Glas Brandy getrunken hab.«
Als er sein Glas nachfüllte, sah Emmy, daß seine Hand stark zitterte, und ihr wurde angst und bang. Ihr Vater lehnte exzessives Trinken ab, aber als hätte Robert es darauf angelegt, seinen Vater zu reizen, machte er sich nicht einmal die Mühe, sein Laster auch nur irgendwie zu verbergen. Mehr als einmal war er schwer betrunken zu Hause angekommen, genau wie heute morgen ... Sie nahm ihm das Glas ab, stellte es außerhalb seiner Reichweite und zog ihn zur Tür. »Jetzt komm schon, wir sollten Papa wirklich nicht zu lange warten lassen. Jamie hat ganz recht, es macht ihn nur ärgerlich. Versuch dich doch zusammenzunehmen, Rob.«
Er lächelte mühsam und folgte ihr durch den langen Flur. Emily dachte traurig, was für ein großes Unglück es doch war, daß er Vater immer noch mit aller Macht bekämpfte. Das war schon so gewesen, als er noch ein Kind war und ihre Mutter noch lebte...
»Wie steht’s mit deiner Romanze mit Dr. Simon Yates, Emmy?« fragte er unvermittelt und lächelte so hämisch, daß seine Schwester rot wurde. »Oder vielleicht wäre es besser, sich erst gar nicht danach zu erkundigen? Hat Papa dir den Umgang mit ihm jetzt ganz verboten?«
Jamie klopfte an die Tür des Arbeitszimmers, und Emily blieb keine Zeit mehr, Roberts zynische Frage zu beantworten. Sie dachte verbittert, daß Robert die Wahrheit ja sicher wußte ... Der gutaussehende junge Arzt hatte schon seit Monaten Hausverbot. Sie konnten sich nur noch selten und heimlich treffen, abgesehen von jenen zufälligen Begegnungen, die in der Öffentlichkeit stattfanden.
Einen schlecht erzogenen Glücksjäger — so hatte der Admiral Simon Yates genannt und ... Robert flüsterte ihr boshaft zu: »Papa wird dir überhaupt keinen Verehrer zugestehen, solang er dich als Haushälterin gebrauchen kann.«
Obwohl Emily innerlich vor Wut kochte, legte sie einen Finger auf die Lippen und wünschte sich, daß Robert sie und ihren jüngeren Bruder nicht so häufig gegen ihren Vater aufzuwiegeln suchte ... Denn es stimmte einfach nicht. Papa war gar nicht so ein Ungeheuer. Obwohl er ihr nie viel Zuneigung bewiesen hatte, zeigte er sich doch immer recht großzügig. Sie bekam alles von ihm, was sie für sich und den Haushalt benötigte, er stellte nie viele Fragen, und sie lebten wirklich gut. Murton Chase war ein großes, solide gebautes Herrenhaus, es war bequem eingerichtet, und...
»Emily ... James —« Der Admiral deutete auf zwei Stühle an der Wand gegenüber. »Setzt euch und hört schweigend zu, was ich eurem Bruder zu sagen habe. Robert —«, mit herrischer Geste bedeutete er Robert, sich vor seinen Schreibtisch zu stellen. Ganz als wäre er ein Krimineller, der schon gerichtet und verurteilt war, dachte Emily voller Mitleid.
Und es sah ganz so aus, als ob er das für ihren Vater auch wirklich war. Sie lauschte der Litanei seiner Vergehen, angefangen vom Kriegsgerichtsprozeß wegen seines grob fahrlässigen Verhaltens und seines Ungehorsams, der schließlich zum Verlust seines Schiffes geführt hatte, bis hin zu seiner Entlassung bei der Bank in London, zu der es offenbar aus ähnlichen Gründen gekommen war.
Mit kalten Worten erinnerte der Vater seinen Sohn daran, daß er seinen ehemaligen Kapitän öffentlich beleidigt und entgegen den landesüblichen Sitten einen dienstälteren Offizier zum Duell herausgefordert hatte.
»Du hast Schande über meine Familie gebracht«, klagte der Admiral seinen Sohn an. »Vier Generationen von Willoughbys haben in den Diensten des Königs gestanden. Du hattest das Vorbild vieler tapferer Männer vor Augen, von denen kein einziger seinen Dienst quittiert hat, es sei denn, er starb oder er ging in allen Ehren in Pension. Ich habe dich Robert Horatio getauft, im festen Glauben daran, daß du einem von Englands größten Admiralen zur Ehre gereichen würdest ... aber du hast mich dazu gebracht, daß ich meine Namensgebung bitter bereuen mußte.«
Robert versuchte sich zu verteidigen, wurde aber sofort unterbrochen. »Es gibt keine Entschuldigung! Ich kann deine verdrehten Erklärungen nicht mehr hören. Gott weiß, daß ich alles versucht habe, um dir zu helfen, aber jetzt ist es ein für allemal genug!«
»Captain Nevilles Anschuldigungen gegen mich waren bösartig und völlig unbegründet, Vater. Ich schwöre dir, daß er die ganze Sache nur aufgebracht hat, um seine eigene Inkompetenz zu bemänteln!« Roberts Stimme zitterte vor verhaltener Wut, aber er wurde wieder mit kalter Stimme gebeten, den Mund zu halten.
»Du hast Schulden gemacht, und ich habe sie beglichen«, sagte sein Vater haßerfüllt. »Ich habe meinen Einfluß geltend zu machen gewußt und habe dir eine Anstellung verschafft, aber du hast alle meine Versuche, dir zu helfen, in den Wind geschlagen. Und jetzt — jetzt wurde ich von einem gewissen George Batton — offenbar deinem Anwalt — davon informiert, daß du wegen eines höchst unangenehmen Deliktes angezeigt worden bist. Wegen eines kriminellen Deliktes, Robert! Verdammt noch mal, willst du das etwa bestreiten? Bestreitest du etwa, daß du dich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur durch eine Kaution auf freiem Fuß befindest?«
Emily sah, wie Robert totenblaß wurde. Er war vollkommen überrascht und wußte nichts zu erwidern. Emily überlegte verzweifelt, ob er es für möglich gehalten hatte, daß ihr Vater nichts von dem bevorstehenden Prozeß erfahren würde.
»Ich habe die Kaution für dich bezahlt«, sagte der Admiral kurz.
»Ich habe dich nicht darum gebeten«, gab Robert kühl zurück.
»Nein — aber Mr. Barton. Du hattest ihn gebeten, die Kaution für dich vorzustrecken, aber er hatte seine Zweifel, ob er sein Geld jemals wiedersehen würde. Er gab mir deutlich zu verstehen, daß du bis zu deinem Prozeß hinter Gittern verschwinden würdest, wenn ich die Kaution für dich nicht bezahlen würde. Und wenn die Anklage gegen dich zu Recht besteht, dann hast du mindestens mit sieben Jahren Haft zu rechnen — und wahrscheinlich sogar mit Verbannung nach Neusüdwales! Vielleicht sogar mit lebenslänglicher Verbannung, wenn ich Barton Glauben schenken soll ... Und seinem Brief nach klang es recht glaubwürdig.«
Emily fühlte, wie sich Jamie neben ihr versteifte. Genau wie sie schien auch ihr jüngster Bruder den Tränen nahe. Seit frühester Kindheit war Robert sein großer Held gewesen, dem seine ungeteilte Bewunderung gegolten hatte. Aber diese Enthüllung schockierte ihn zutiefst.
»Du wirst beschuldigt, eine junge Frau mißbraucht und ihren guten Ruf beschmutzt zu haben, die Tochter eines Wirtshausbesitzers in Plymouth ... Und sowohl du als auch ich kennen den Vater des armen, unglücklichen Mädchens sehr gut ... Es ist Daniel Raven, der unter meinem Kommando auf der Monarch gedient hat. Und versuch nicht, mir Sand in die Augen zu streuen, indem du behauptest, du hättest nicht gewußt, wer Raven ist. Oder, daß du dir nicht hättest vorstellen können, welchen Skandal es gäbe, wenn dieser Fall vor Gericht verhandelt wird. Mein guter Name würde dadurch in den Schmutz gezogen werden, denn ich kann es nicht verhindern, daß du meinen Namen trägst!«
»Bitte, hör mir zu«, bat Robert inständig. »Ich gebe dir mein Wort, daß ich —«
»Dein Wort!« schrie der Admiral in höchster Wut. »Welchen Wert hat denn dein Wort? Es reicht mir jetzt, und ich habe eine Entscheidung gefällt. Deshalb habe ich dich und James kommen lassen, da meine Entscheidung seine Zukunft ebenso bestimmt wie deine.«
Er versuchte, seinen Zorn zu zügeln und sprach scheinbar ruhig weiter: »Robert, du wirst dich auf meinen Wunsch hin außerhalb des Zugriffs der Rechtsbarkeit begeben. In den nächsten zwei Tagen läuft ein Sträflingstransporter, die Mary Ann, nach Port Jackson in Neusüdwales aus. Du mußt sofort an Bord gehen, hast du mich verstanden? Ich habe deine Schiffsreise gebucht, und du wirst unter dem Namen Roberts reisen. In Port Jackson wird dir die Summe von zweitausend Pfund ausgehändigt — das wird reichen, damit du dich als Farmer in der Kolonie niederlassen kannst.«
Robert schrie leise auf, aber der Admiral ignorierte diese Unterbrechung. Eiskalt fuhr er fort: »Ich habe Erkundigungen eingeholt. Der Kolonialminister Lord Bathurst sucht Freie Siedler mit etwas Kapital und behandelt sie bevorzugt, weil es ihm wichtig ist, den Wollhandel und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen in der Kolonie anzukurbeln. Ich werde dafür sorgen, daß du ein paar Einführungsschreiben in die Hände bekommst, die dir den Start in Neusüdwales erleichtern werden.«
Als sein Vater nicht weitersprach, schaute ihn Robert verzweifelt an. »Aber ich eigne mich doch überhaupt nicht zu einem Farmer! Ich habe keinerlei Ahnung von Landwirtschaft, und es interessiert mich auch nicht. Ich...«
»Für was interessierst du dich denn eigentlich?« donnerte der Admiral. »Wäre es dir lieber, in Ketten nach Neusüdwales zu reisen? Wie ein verurteilter Sträfling?« Ohne Roberts Antwort abzuwarten, schrie er voller Wut: »Du musst wissen, daß ich nichts dagegen hätte, daß einzig der rufschädigende Skandal um deinen Prozeß mich dazu bringt, dir noch einmal unter die Arme zu greifen! Allein deshalb gebe ich dir noch einmal die Chance, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber es ist die letzte Chance, da kannst du Gift drauf nehmen.«
Er deutete auf ein zusammengerolltes Dokument auf seinem Schreibtisch. »Das ist mein Letzter Wille. Ich teile dir hiermit mit, daß ich dich enterbt und deinen Bruder James zu meinem Erben ernannt habe. Abgesehen von dem, was meine Töchter bekommen, wird James bei meinem Tod alles erben, was ich besitze, abgesehen von meinem Adelstitel, den laut Gesetz du als mein erstgeborener Sohn bekommen wirst ... obwohl ich hoffe, daß du niemals darauf Anspruch erheben wirst. Und du bekommst die zweitausend Pfund, von denen ich gesprochen habe, nur unter der Bedingung, daß du dieses Land sofort verläßt. Und falls es dir lieber ist, mein Angebot auszuschlagen, breche ich sofort jeglichen Kontakt zu dir ab, werde dich ohne einen Pfennig aus meinem Haus jagen und in Gottes Namen die Schande auf mich nehmen, die der Prozeß mir bringen wird.« Er machte eine Pause und schaute Robert haßerfüllt an. »Nun? Akzeptierst du meine Bedingungen?«.
Robert richtete sich auf. Er war leichenblaß, schaffte es aber irgendwie, seinem Vater mit ruhiger Stimme zu antworten.
»Ich habe keine Alternative. Ich kann nur >ja< sagen ... aber ich bin alles andere als begeistert. Das letzte, was ich will, ist, mein Heimatland England zu verlassen.«
Jamie schaltete sich ein. Er versuchte, sich sein nacktes Entsetzen nicht anmerken zu lassen und sagte: »Rob, ich will dein Erbe gar nicht haben. Glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon, was Papa sich ausgedacht hat.«
»Freu dich doch, kleiner Bruder«, rief Robert ihm nach, als der Junge sich auf Geheiß des Vaters mit seiner Schwester aus dem Zimmer entfernte. »Freu dich doch, daß du plötzlich so gut dastehst. Du hast es doch viel besser als ich!«
Emily wischte sich die Tränen ab und schloß die Tür hinter sich. Dieses Mal wich Jamie nicht aus, als sie ihm den Arm um die Schultern legte. Als sie durch den Flur gingen, sagte er unglücklich: »Die Postkutsche geht schon in einer halben Stunde, und sie ist immer pünktlich. Wenn ich sie nicht verpassen will, muß ich gleich gehen. Das wird sowieso das Beste sein. Rob will mich bestimmt nicht sehen, oder? Nicht jetzt, nachdem ... das kann ich gut verstehen. Und ich will Papa auch nicht so schnell wiedersehen.«
Emily schaute vom Fenster aus zu, wie er zehn Minuten später das Haus verließ. Ein Gefühl der Verzweiflung überkam sie, und es verstärkte sich noch, als Robert endlich mit blassem, haßverzerrtem Gesicht aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters kam.
»Unser hochgeschätzter Vater hat angeordnet, daß ich nie wieder die Türschwelle seines Hauses beschmutze, Emmy«, sagte er mit gepreßter Stimme. »Und ich darf mich nicht einmal von unseren kleinen Schwestern verabschieden. Sobald Hawkins mit der Kutsche zurückkommt, soll er mich zum Hafen fahren und dort warten, um unserem Vater auch bestätigen zu können, daß ich an Bord dieser verdammten Mary Ann gegangen bin. Ich habe mir erlaubt zu bemerken, daß er dafür ein Fernglas braucht, falls das Schiff draußen in der Bucht vor Anker liegt, und Papa bezichtigte mich wieder der Unverschämtheit.«
»Ach, Rob!« brachte Emily heraus. »Lieber Rob, es tut mir so leid. Aber du —«
»Aber ich hab auch nichts Besseres verdient, meinst du?« beendete er ihren angefangenen Satz.
»Das wollte ich nicht sagen.«
Sein Gesichtsausdruck entspannte sich. »Ich wußte doch, daß du so etwas niemals sagen würdest. Du bist ein echter Schatz, Emmy — ich kann mir keine bessere Schwester als dich vorstellen, und ich werde dich sehr vermissen. Großer Gott, was für ein Leben erwartet mich! Das Leben in einer Strafkolonie am Ende der Welt, wo der Abschaum aus unseren Gefängnissen lebt! Und ich soll ein dreckiger Farmer am Arsch der Welt werden!«
»Die Geschichte hätte schlimmer für dich ausgehen können«, sagte Emily gedankenlos. »Nämlich wenn du die Reise als ein...« Sie unterbrach sich, wurde rot, und wie eben beendete Robert ihren Satz.
»... als ein verurteilter Sträfling in Ketten machen müßtest — das stimmt, das wäre wirklich sehr viel schlimmer. Ich muß jetzt lernen, Gott für jede Kleinigkeit dankbar zu sein, oder? Und ich muß sogar unserem Vater für seine Großzügigkeit dankbar sein.« Er zog ein gefaltetes Blatt Papier aus seiner Hosentasche und reichte es Emily. »Das ist ein Brief an einen Agenten in Kapstadt, der mir beim Kauf von Vieh behilflich sein soll. Anscheinend wird das so gemacht. Rinder und Schafe sind dort billiger zu haben als in der Kolonie. Man kann viel Geld sparen, vorausgesetzt, daß diese verdammten Viecher die Überfahrt nach Port Jackson überleben.«
Robert ging ins Frühstückszimmer. Der Brandy und die Gläser standen noch dort, und er schenkte sich nach und trank das Glas auf einen Zug leer.
»Liebe Emmy, ich habe ihm gesagt, daß ich ja gar keine Alternative habe. Ich werde also ans Ende der Welt fah ren ... aber ich muß ja nicht mein Leben lang dort bleiben, oder? Spätestens nach seinem Tode kreuze ich bestimmt hier wieder auf.«
»Ach, Rob, darum werde ich jeden Tag beten!« Emily schaute ihren Bruder an, sah ihn aber nur verschwommen, da sie nicht zu weinen aufhören konnte. Sie wollte ihn genauer nach der Anklage befragen, zögerte aber, weil sie fürchtete, ihn wieder zu verletzen. Papa hatte von einem ehren werten jungen Mädchen gesprochen und angedeutet, daß Robert Gewalt angewendet hätte, und das bedeutete nichts anderes, als daß er...
Als ob sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hätte, sagte Robert: »Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, Emmy.«
Das häßliche Wort hing wie ein dunkler Schatten zwischen ihnen, und Emily hielt die Luft an.
»Ach, Rob, du hast doch bestimmt nicht —«
»Es war ein mieser Dreh«, sagte Robert mit großer Bitterkeit. »Daniel Raven, der Vater des jungen Mädchens, ist ein ausgemachter Spitzbube. Im Lauf der Jahre hat er genug Geld zusammengekratzt, um eine Hafenspelunke zu kaufen. Wenn ich in der Stadt war, kehrte ich dort ein. Es ist zwar nicht gerade die Sorte Lokal, die von Offizieren besucht wird, aber ich ... ich kannte Dan Raven ja von früher gut. Ich hatte wirklich Respekt vor ihm. Er behandelte mich gut, und ich vertraute ihm völlig.«
»Erzähl weiter«, bat Emily leise.
Robert zuckte mit den Achseln. »Na gut, wenn du diese gräßliche Geschichte wirklich hören willst. Aber —« Er unterbrach sich und hielt ihr die leere Karaffe entgegen. »Kannst du mir noch ein bißchen Brandy holen, kleine Schwester? Ich brauch jetzt wirklich was und ... beim Spre chen wird man durstig, das weißt du doch.«
»Entschuldige«, meinte Emily bedauernd, »aber Hawkins hält allen Alkohol unter Verschluß, und jetzt ist er nicht da. Ich kann dir etwas Bier aus der Küche holen und vielleicht auch etwas zu essen. Ich glaube, du könntest etwas gebrauchen.«
»Und Papa? Ich möchte auf keinen Fall, daß er das sieht.« Robert sprach wieder mit großer Bitterkeit. »Er könnte es als Mißbrauch seiner Gastfreundschaft auslegen.«
»Papa kommt nie in dieses Zimmer«, antwortete Emily. »Erinnerst du dich nicht mehr daran, es war doch früher Mamas Boudoir.«
Sie lief in die Küche und kam bald mit einem beladenen Tablett zurück.
»Es war noch etwas Apfelwein da, den trinkst du doch so gern. Die Köchin hat alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen fürs Mittagessen, aber sie gab mir doch etwas kaltes Fleisch, Käse, saure Gurken und frisches Brot ... Wird dir das reichen, Rob? Ach, und hier ist auch noch ein Stück Apfelkuchen.«
»Das ist mehr als genug«, versicherte er ihr. Er setzte sich und fing sofort zu essen an. »Der alte Geldsack in der Bank hat seine armen Angestellten nie so gut gefüttert«, erzählte er. »Du kannst mir wirklich glauben, daß ich froh war, als ich rausgeschmissen wurde.
»Das glaube ich dir«, meinte Emily. Sie wartete schweigend, bis er zufrieden seufzend seinen Teller wegschob, und dann fragte sie neugierig: »Rob, wie ist sie denn, das junge Mädchen, das dich so bös reingelegt hat?«
»Rebecca Raven — Becky?« Robert seufzte laut. »Ach, sie ist hübsch genug, aber noch ein Kind, sie ist gerade sechzehn geworden. Sie kann kaum lesen und schreiben, hat eine ungeheuer schlampige Mutter und ist in einer Horde von Brüdern und Schwestern aufgewachsen ... Sie ist genau so, wie man das in so einer Familie erwarten würde. Ich bin ziemlich tief gesunken, nachdem meine Karriere in der Marine beendet war, aber ... ich hätte sie niemals heiraten kön nen, Emmy.«
»Du hättest sie nicht heiraten können?« wiederholte Emmy überrascht. »Aber ich dachte —« Sie starrte ihn verständnislos an.
»Dan Raven haßt Papa aus tiefstem Herzensgrund«, sagte Robert ernst. »Ich habe nie herausgefunden, was eigentlich zwischen den beiden vorgefallen ist. Jedenfalls war es ihm sehr recht, als ich in seiner Spelunke auftauchte, und ich war zu naiv, um zu merken, was für ein Spiel er spielte. Er trieb mich diesem Mädchen in die Arme. Verdammt noch mal, ich bin auch nur ein Mensch, und Becky verliebte sich in mich, es sah jedenfalls ganz so aus! Aber ich schwöre dir, daß ich sie nicht vergewaltigt habe. Aber ihr Vater behauptet das auch heute noch steif und fest, und nun versteh ich auch warum. Auf diese Weise konnte er unserem Vater eins auswischen. Vor Gericht haben sie natürlich ihm geglaubt, und nicht mir. Er bot mir an, die Klage zurückzuziehen, wenn ich seine Tochter heiraten würde ... Auch das hätte Papa ganz und gar nicht gepaßt. Und ich, ich konnte mich nicht dazu entschließen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, eine so ungebildete Person zur Frau zu haben. Und«, fügte er unglücklich hinzu, »ich fürchtete auch, daß Papa mich dann enterben würde.«
»Hast du denn geglaubt, daß Papa nichts von dem bevorstehenden Prozeß hören würde?« fragte Emily.
»Ja, das hielt ich für möglich«, gab Robert zu. »Und wenn dieser gemeine Hund von Rechtsanwalt sich nicht direkt an Papa gewandt hätte, dann hätte es auch gut ausgehen können. Aber er vermutete wohl, daß ich mich vor dem Prozeß dünnmachen wollte, und wandte sich deshalb an Papa ... und zwar, ohne mich davon zu informieren.«
»Rob«, flüsterte Emily bewegt, »es tut mir wirklich leid. Wenn du noch irgendwas brauchen kannst —«
»Ich brauche Geld«, sagte Robert und vermied es, seine Schwester anzusehen. »Leider muß ich noch ziemlich viel für mein Zimmer zahlen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein paar Pfund geben könntest, Emily.«
Emily besaß selbst nur ein paar Pfund — fünf oder sechs vielleicht, die sie sich erspart hatte, aber ... sie ging zu ihrem Schreibtisch. In einer Schublade lag das Haushaltsgeld, von dem sie noch nicht viel verbraucht hatte. Wenn sie sparsam einkaufte und ein paar Händler erst nächsten Monat bezahlte, konnte sie ihrem Bruder die Hälfte davon geben, ohne daß ihr Vater es jemals bemerken würde. Ohne weiter groß darüber nachzudenken, nahm sie fünf Pfund in Goldmünzen aus dem Schreibtischfach, in dem sie ihr eigenes Geld verwahrte, und zusätzlich zehn Pfund aus dem Lederbeutel, in dem das Haushaltsgeld lag.
»Es ist zwar nicht viel, Rob, aber...« Sie unterbrach sich, als eine Kutsche vor dem Haus anhielt. Hawkins war zurückgekommen, und sie mußte ihm den Befehl ihres Vaters ausrichten. »Ich — ich muß Hawkins sagen, daß er dich jetzt gleich in die Stadt fahren soll. Ich sag ihm, daß er warten soll, bis du ... bis du fertig bist.«
Aber Robert sprang auf und sagte: »Wir wollen dieses Trauerspiel hier nicht unnötig verlängern, meine liebe Emily.« Er steckte die Goldmünzen ein, lächelte und reichte ihr die Hand. »Herzlichen Dank! Und sag Charlotte und der kleinen Biddy auf Wiedersehen von mir, vergiß es nicht!«
Emily nickte und wischte sich die Tränen ab. Robert beugte sich zu ihr hinunter und küßte sie auf die Wange. »Ich find es gar nicht so verkehrt, wenn du diesen Dr. Yates heiratest, auch wenn Papa dagegen ist! Yates spricht doch immer davon, daß er ein Missionar werden möchte und die Maoris in Neuseeland mit zeitgenössischer Medizin und dem Christentum beglücken will, oder? Dann wären wir irgendwie Nachbarn, obwohl wir nicht gerade Tür an Tür wohnen würden ... Überleg’s dir gut! Und jetzt auf Wiedersehen, Emmy, Gott schütze dich!«
»Dich auch, liebster Rob.« Im Augenblick der Trennung wurde Emily ihr großer Verlust bewußt, und sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich bete darum, daß du eine gute Überfahrt hast und daß du — daß du es schaffst, in Sydney eine neue Existenz aufzubauen und neue Freunde zu finden.«
»Das werde ich ganz bestimmt«, antwortete Robert mit bitterem Sarkasmus. »Verdammt noch mal, es ist eine Strafkolonie, oder? Dort fühl ich mich bestimmt ganz zu Hause!«
Er drückte seine Schwester an sich, verließ das Haus, bestieg die Kutsche und setzte sich neben Hawkins auf den Kutschbock.
»Ich nehme an, daß Sie wissen, wo es hingeht?«
»Aye, Sir, das weiß ich«, antwortete Hawkins hölzern. »Zum Hafen, wo die Mary Ann in der Bucht vor Anker liegt. Und ich soll dem gnädigen Herrn berichten, daß Sie an Bord gegangen sind, Sir.« Er peitschte in die Luft, und die Kutsche setzte sich in Bewegung. Zu Emilys Kummer blickte sich Robert kein einziges Mal um.
»Der Vogel ist ausgeflogen, Martha«, kündigte Daniel Raven mit einer Zufriedenheit an, die er nicht einmal zu verbergen suchte. Er schenkte sich ein Glas Bier ein und trank es aus, bevor er weitersprach. »Du hast zwar immer gesagt, daß es rausgeschmissenes Geld ist, ihn beobachten zu lassen — aber jetzt hat sich’s gelohnt, Frau! Er kam vor weni ger als ’ner Stunde mit diesem Hawkins in der Kutsche zurück, packte seinen Kram zusammen, zahlte und fuhr weg. Und Charlie nix wie hinterher. Er hat gesehen, daß Robert sich in einem Boot zum Sträflingstransporter Mary Ann hinrudern ließ, mit all seinem Gepäck. Hab ich dir nicht auch gesagt, daß dieser gottverdammte Admiral Willoughby irgend so was plant, um sich die Schande zu ersparen? Ich wußte, daß ich recht hatte!«
Seine Frau schaute ihn mit ihren kohlschwarzen Augen fragend an. »Meinste«, fragte sie und schob eine graue Locke zurück, die ihr beim Abwischen der Wirtshaustheke ins Gesicht gefallen war, »meinste wirklich, daß der junge Mr. Willoughby abhauen will?«
»Das hat er schon immer vorgehabt«, antwortete ihr Raven voller Überzeugung. »Der Admiral hätte es niemals so weit kommen lassen, daß sein Sohn vor Gericht erscheint. Aber Botany Bay — dahin fährt die Mary Ann — ich schwöre dir, daß ich nicht erwartet hab, daß er seinen Sohn dahin schicken würde. Ich kam erst drauf, als ich ihn gestern im Hafen sah. Is natürlich ’n idealer Ort für den feinen jungen Herrn, nur hätt er in Ketten dorthin fahren solln, statt als respektabler Passagier.«
Martha Raven zog die Stirn kraus. Sie war von Anfang an nicht mit der Art einverstanden gewesen, mit der sich ihr Mann an Admiral Willoughby rächen wollte ... Martha seufzte unglücklich. Sie und ihr Mann hatten sich deswegen oft gestritten, und seit herausgekommen war, daß die arme Becky schwanger war, hatte sich die Kluft zwischen ihnen noch vertieft.
»Dan, jetzt laß es doch endlich gut sein! Läßt du den jungen Willoughby nach Botany Bay fahren?« Dann fügte sie bittend hinzu: »Du willst ihn doch jetzt nicht mehr einlochen lassen, oder? Dazu ist es doch bestimmt zu spät.«
Ihr Mann schüttete ein zweites Glas Bier in einem Zug hinunter. »Es is für gar nix zu spät, nein — die Mary Ann befindet sich immer noch in britischen Gewässern. Aber ich hab was Besseres vor.« Er beugte sich vor, griff nach ihrem Arm und zwang sie, zu ihm hochzuschaun. »Martha, ich bringe Becky auf das Schiff. Der alte Pfarrer Crickley kommt auch mit, und —«
»Pfarrer Crickley!« rief Martha entsetzt aus. »Dieser versoffene alte Mann? Ach Dan, du kannst doch nicht — er ist doch seit Jahren keinen Augenblick lang mehr nüchtern!«
»Aber er is immer noch ’n Pfarrer, oder? Er kann immer noch Leute verheiraten.« Dan Raven packte seine Frau noch fester am Arm. »Robert Willoughby wird meine Tochter heiraten und sie als seine Frau mit nach Botany Bay nehmen. Er hat ihr ’n Kind verpaßt, oder nich? Deshalb muß er sie heiraten. Wenn er das nicht macht, dann hetz ich ihm die Justiz auf den Hals! Aber ich glaub, daß er diesmal mitspielt.«
»Und Becky?« fragte Martha bitter. »Was sagt sie dazu? Oder haste ihr nich alles gesagt?«
Raven lächelte breit. »Sie is im siebten Himmel, das dumme Mädchen. Ich sagte ihr, daß Willoughby nach ihr geschickt hat. Sie packt ihre Sachen zusammen und is bereit, bis ans Ende der Welt zu fahren, nur wenn sie bei ihm sein kann.«
Martha fühlte einen Stich im Herz. Sie hatte nie ein gutes Verhältnis zu Becky gehabt, aber nie war es so schwierig gewesen wie in den letzten Monaten, als der Liebeskummer die ganze Familie halb verrückt gemacht hatte, doch ... das Mädchen war schließlich ihre Tochter, ihr eigenes Fleisch und Blut.
Unter dem mißbilligenden Blick ihres Mannes suchte Martha alle Münzen zusammen, die sie finden konnte. Es waren nicht viele, alles in allem nur fünf Pfund, aber wenigstens würde sie Becky nicht ganz ohne Geld in die Welt hinausschicken.
Martha fand ihre Tochter, ganz wie Dan gesagt hatte, strahlend und glücklich in ihrem Zimmer vor. Sie hatte ihre wenigen Kleider zu einem Bündel zusammengepackt und ihr bestes Sonntagskleid angezogen, das aber schon etwas eng saß und ihre beginnende Schwangerschaft deutlich erkennen ließ.
»Hat Papa dir’s gesagt?« fragte sie aufgeregt. »Hat er dir gesagt, daß Rob Willoughby mit ’nem Schiff nach Botany Bay fährt und mich mitnehmen will? Ach Mama, is das nich herrlich? Hat alles nich gestimmt, daß er mich nich heiraten will! Und der alte Pfarrer Crickley kommt mit uns, damit er Robert und mich noch vor Abfahrt des Schiffes trauen kann!«
Martha biß sich auf die Lippen und schaffte es, durch ihre Tränen zu lächeln. »Wie herrlich! Aber du mußt trotzdem gut auf dich aufpassen, meine liebe Becky«, bat sie ihre Tochter inständig. »Zieh dich immer warm an, wenn du an Deck gehst — hoffentlich hast du dein Umhängetuch eingepackt! Und du brauchst Kleidung für das Baby — ich schau schnell, was ich finden kann. Du mußt...« Ihr Mann rief ungeduldig nach ihr und unterbrach damit die guten Ratschläge, die Martha ihrer Tochter mit auf den Weg geben wollte.
Becky küßte ihre Mutter und riß sich los. »Ich muß gehen, Mama«, rief sie aus. »Papa sagt, daß das Schiff bald lossegelt. Auf Wiedersehen, Mama, und vielen Dank für das Geld. Ich kann’s gut brauchen — vielleicht kann ich damit Babykleidung kaufen.«
Martha konnte ihrer Tochter nur noch ihr eigenes Umhängetuch um die Schultern legen, und dann war sie schon eg, rannte die hölzerne Treppe hinunter, als ob der Teufel hinter ihr her wäre.
In der Schänke wartete Dan Raven bereits und hielt Pfarrer Crickley am Arm fest. Als Becky angerannt kam, nahm ihr der Vater das Kleiderbündel ab und schickte Charlie los, um ein Boot zu mieten, das sie zur Mary Ann ruderte. Als er das letzte Mal zu dem Schiff hingeschaut hatte, hatte es eine halbe Meile entfernt vor Anker gelegen, und er hatte durch sein Fernglas gesehen, daß sich weibliche Sträflinge unter Bewachung auf Deck die Beine vertreten hatten ... Das hatte er als ein Zeichen dafür gewertet, daß das Schiff noch nicht sofort lossegeln würde. Aber es wehte ein starker Nordostwind — deshalb hielt er es für möglich, daß der Kapitän noch heute lossegeln wollte, statt bis morgen früh zu warten.
Er drängte ungeduldig zur Eile. Becky war das nur recht. Sie redete unaufhörlich und löcherte ihn mit Fragen über Botany Bay, die er weder beantworten wollte noch konnte.
Dan zog die Stirn kraus: »Red nich soviel, mein Mädchen«, bat er seine Tochter streng. Er schob sich das schwere Kleiderbündel von der einen Schulter auf die andere und drängte den kurzatmigen, dicken Pfarrer zur Eile.
Das Boot wartete schon am Kai, und der abgerissene, mit allen Wassern gewaschene Charlie, der hin und wieder als Laufbursche für Dan arbeitete, grinste seinen Dienstherrn erwartungsvoll an. Dan griff in die Tasche, zog ein paar Schillinge heraus und gab sie dem Jungen, der sich grinsend bedankte und Becky und Pfarrer Crickley ins Boot half.
»Ich helf beim Rudern«, bot Dan an. »Wir haben’s eilig.«
Der Schiffer schaute ihn verärgert an, glaubte, daß er um seinen vollen Lohn betrogen werden sollte und schüttelte den Kopf.
»Ich bring Sie schon dahin, wo Sie hinwollen, Mr. Raven« murrte er. »Zur Mary Ann, stimmt’s?«
Er legte sich kraftvoll in die Riemen, und das kleine Boot schoß über die dunkle Wasserfläche des Hafenbeckens. Als sie aber in die Bucht hinauskamen, hatte das Boot gegen Wind und Wellen anzukämpfen, und der Mann an den Rudern war bald erschöpft und sagte: »Jetzt können Sie ’n Ru der übernehmen, Mr. Raven!«
Es war Becky, die als erste merkte, daß etwas nicht stimmte. Sie schrie entsetzt: »Papa! Ach Papa, schau mal — die Mary Ann setzt Segel! Papa, das Schiff fährt ja schon — es fährt ohne mich los!«
Dan drehte sich fluchend um. Er sah auf einen Blick, daß das Schiff schon den Anker gelichtet hatte. Die riesigen Segel blähten sich langsam auf, und das Schiff fuhr los.
Obwohl er wußte, daß es überhaupt keinen Sinn hatte, formte Dan seine Hände zu einem Trichter und schrie...
»Großer Gott!« rief der Fährmann entsetzt. »Passen Sie auf, Miss! Sonst fallen Sie ins Wasser!«
Jetzt sah Dan, daß Becky aufgestanden war und schwan kend mit ausgebreiteten Armen auf dem Bootsrand stand.
»Papa, Robert Willoughby hat nie nach mir schicken lassen, oder?« rief sie mit großer Bitterkeit. »Er wollt mich auch nie heiraten — du hast mich angelogen! Es ist alles nich wahr — nichts von alldem, was du mir erzählt hast, is wahr!« Alles Glück war aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie war totenblaß geworden und schaute ihn anklagend mit ihren dunklen, großen Augen an, aus denen die Tränen rannen. Plötzlich wußte Dan, was seine Tochter vorhatte und kroch angstvoll auf sie zu. Er versuchte sie an den Händen festzuhalten. Aber Becky wich ihm aus.
»Versuch nich mich zu retten, Papa«, warnte sie mit schriller Stimme. »Ich will sterben, ich ... ich hab nix mehr, für das sich das Leben lohnt.«
Sie ließ sich in das kalte, graue Wasser fallen, und das Boot schwankte gefährlich, als Dan verzweifelt versuchte, ihr Kleid zu fassen.
»Das Boot kentert!« rief der Fährmann aus. »Um Gottes willen, Mister, gehn Sie ans Ruder zurück und helfen Sie mir, das Boot beizudrehn!«
Dan gehorchte ihm, und sein Magen drehte sich fast um. Wie die meisten britischen Seeleute hatte er nie schwimmen gelernt, und obwohl er außer sich vor Entsetzen war, wußte er, daß vielleicht die einzige Chance, Becky zu retten, darin bestand, erst einmal im Boot zu bleiben. Pfarrer Crickley entdeckte das junge Mädchen als erster.
»Da drüben ist sie!« rief er aus. Mit einem Mut, den man dem alten Mann niemals zugetraut hätte, sprang er ins Wasser, erreichte nach ein paar Zügen das reglos unter der Wasseroberfläche treibende junge Mädchen, schnappte nach Luft und brachte es irgendwie fertig, mit ihr zum Boot zurückzukommen. Der Fährmann drehte bei, und Dan zog die beiden mit aller Kraft zurück ins Boot.
Becky lag mit offenen, blicklosen Augen da und starrte ins Leere. Dan versuchte es verzweifelt mit Wiederbelebungsversuchen, wußte aber in seinem Herzen, daß es zu spät war.
Der alte Pfarrer Crickley zitterte vor Kälte am ganzen Körper, hatte blaugefrorene Lippen und sagte: »Das arme junge Mädchen ist tot, Mr. Raven. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein!«
Dan Raven ließ sich auf die Ruderbank fallen. Die Galle stieg ihm hoch, als er sah, wie sich die Mary Ann mit majestätisch geblähten Segeln langsam entfernte.
In ohnmächtiger Wut erhob er die Faust und verfluchte das Schiff.
»Es wäre gescheiter zu beten, Mr. Raven«, sagte Pfarrer Crickley traurig. »Rebecca ist schon bei ihrem himmlischen Vater, und niemand kann sie ins Leben zurückrufen.«
Das stimmt, dachte Dan Raven, als er in Beckys stilles, schneeweißes Gesicht blickte. Seine Tochter war tot, aber der Mann, der sie verführt hatte — ihr Mörder — sollte dafür zahlen. Wenn es einen Gott gäbe, zu dem er beten önnte, und wenn dieser Gott ein gerechter Gott war, dann dürfte Rob Willoughby nicht ungestraft davonkommen.
Er wollte seine arme kleine Becky rächen. Gottes Mühlen mahlen langsam, erinnerte er sich, aber trefflich fein. Er schloß die Augen und wütete unter den gütigen Blicken des Pfarrers unhörbar und blasphemisch: »Gott sei ihrer Seele gnädig, aber er soll dafür sorgen, daß er im Höllenfeuer schmort!«
An Bord der Mary Ann lag Robert angezogen in seiner Kabine auf der Kojse. Während das Schiff den Anker gelichtet hatte, war er nicht an Bord gegangen, weil er überhaupt keine Lust gehabt hatte, den Hafen von Plymouth noch einmal zu sehen.
Bis vor kurzem hatte er in Begleitung von zwei jungen Männern — die sich genau wie er nach Neusüdwales eingeschifft hatten, um dort ihr Glück zu machen — in der Kombüse tief ins Glas geschaut. Der ältere seiner zwei neuen Bekannten, Henry Daniels, hatte ihm mit sichtlichem Vergnügen erzählt, daß er sich auf der Flucht vor seinen Gläubigern befände und hatte ihm gesagt, daß ihm großzügige Trinkgelder diese lange Reise sehr erleichtern würden.
Emilys Goldmünzen waren dafür gerade recht gewesen. Robert lächelte in sich hinein. Der Steward hatte ihm eine schöne Menge erstklassigen Alkohols günstig verkauft, und bevor er auf Wache ging, hatte der Kapitänsmaat versprochen, eine junge Sträflingsfrau herüberzuschicken, und hatte dreckig grinsend hinzugefügt: »Die jungen Herren sind ja bestimmt daran interessiert, daß eine anständige Frau ihnen ihre Kleidung wäscht und die Kabine säubert.«
Als er gefragt wurde, wie die Frau aussehen sollte, die er sich wünschte, hatte er scherzend geantwortet: »Es soll ganz einfach eine Jungfrau sein, wenn Sie eine finden können«, und der Kapitänsmaat hatte sich halb totgelacht über diesen ausgefallenen Wunsch. Er hatte ... Es klopfte leise an die Kabinentür, und Robert richtete sich in der Koje halb auf. »Herein, immer hereinspaziert«, antwortete er mit lallender Stimme.
Ein schmächtiges, verängstigtes Mädchen stand im Türrahmen — sie war höchstens fünfzehn oder sechzehn Jahre alt, hatte blaue Augen und wunderbare rotbraune Haare. Es hätte Becky Raven oder eine Zwillingsschwester von ihr sein können. Robert starrte sie an und fürchtete einen Augenblick lang, daß es doch Becky sei, daß sie ihn irgendwie gefunden hätte.
Das Mädchen machte einen unbeholfenen Knicks. Sie flüsterte nervös: »Ich heiße Alice, Sir — Alice Fairweather. Der Offiziersmaat versprach mir, daß Sie mich beschützen würden, Sir. Er sagte, daß Sie jemand suchten, der sich um Ihre Wäsche kümmert und der Ihnen die Kabine sauber und ordentlich hält. Ich —« Sie schnappte in ihrer Aufregung nach Luft. »Er sagte mir, daß es mir hier bei Ihnen besser gehen würde als im Laderaum bei den anderen Sträflingsfrauen. Viele von denen sind nämlich ... nun, man kann sagen, ganz schön abgebrüht, und sie reden, als ob ... ach, ich weiß auch nicht. Sie haben mir schreckliche Sachen nachgerufen, als mich der Maat mitgenommen hat. Sie nannten mich eine ... eine Hure, Sir. Aber das bin ich nicht, das müssen Sie mir um Gottes willen glauben.«
Robert lallte: »Bist du wirklich keine Hure? Na gut. Aber du bist eine Sträflingsfrau, stimmt’s? Du wirst doch nach Neusüdwales in die Verbannung geschickt, oder?«
Er griff nach ihr, riß sie in seine Arme und hörte nicht auf ihre flehentlichen Bitten, sie doch loszulassen. Dann nahm er sie brutal und ohne jede Leidenschaft.
2
Die Schaluppe Elizabeth Henrietta, die sich im Auftrag der Regierung auf der Überfahrt von Port Jackson nach Norfolk befand, wurde von einer haushohen Welle überrollt. Als die weiße Gischt an Deck wieder abgeflossen war, rieb sich der Kapitän Justin Broome das Salzwasser aus den Augen. Jetzt konnte er den dunklen Streifen am Horizont schon ohne Fernglas ausmachen, das Ziel ihrer Reise. Norfolk war, das wußte er von seinen früheren Besuchen her, wirklich keine große Insel. Captain Cook hatte sie 1774 entdeckt, und im Februar 1788 wurde sie vom ehemaligen Gouverneur King, damals noch ein junger Lieutenant, besiedelt. Sie war knapp sieben Meilen lang und vier Meilen breit, aber die Landschaft war überwältigend schön, und auf dem fruchtbaren Boden wuchsen wunderbare, stattliche Kiefern, die sich sehr gut für den Schiffsbau eigneten.
Unter Kings segensreicher Regierung hatte sich die Landwirtschaft auf Norfolk bestens entwickelt. Für die schweren Rodungsarbeiten, und später für die landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Arbeiten, gab es genügend Sträflinge. Nachdem King sein Amt als Gouverneur von Norfolk niedergelegt hatte, war die Insel aber zum Gefängnis für die allerschlimmsten Verbrecher Neusüdwales’ geworden und war im Lauf der Zeit zur Hölle auf Erden geworden.
Im Februar 1814 — also vor zehn Jahren — war Norfolk auf Befehl des britischen Kolonialministeriums aufgegeben worden. Die Sträflinge und die wenigen Freien Siedler wurden nach Tasmanien evakuiert. Für die Sträflinge hatte sich dabei kaum etwas geändert, sie hatten den Umzug mit mürrischer Gleichgültigkeit hingenommen. Aber den Freien Siedlern hatte der Abschied von der fruchtbaren Insel fast das Herz gebrochen. Sie war zu ihrer Heimat geworden, und es machte ihnen nichts aus, daß sie Hunderte von Seemeilen entfernt völlig abgelegen im Weltmeer lag.
Jetzt aber hatte das Kolonialministerium seine Politik wieder geändert und Sir Thomas Brisbane, dem gegenwärtigen Gouverneur von Neusüdwales, den Auftrag erteilt, Norfolk wie ehedem als Verbrecherinsel für die schlimmsten Bösewichte der Kolonie bewohnbar zu machen. Die Kapitalverbrecher — nach Neusüdwales verbannte Sträflinge, die für in der Kolonie verübte Vergehen zum Tode verurteilt worden waren, chronische Diebe und Flüchtlinge, die den Freien Siedlern das Leben schwermachten und gegen jede Form von Ordnung rebellierten, sollten zusammen mit Aufsehern und Gefängniswärtern die Insel bewohnen, die sich durch ihre abgeschiedene Lage als ideale Strafinsel erwies.
Sein eigener Auftrag lautete, dachte Justin gequält, dem Gouverneur einen genauen Bericht darüber abzustatten, welche Baulichkeiten noch bewohnbar oder zumindest zu reparieren seien. Und eine Liste anzufertigen, welche Baumaterialien und wie viele Arbeitskräfte erforderlich wären, um die Insel wieder so herzurichten, daß sie ihre ehemalige Rolle erfüllen könnte. Die Aufgabe verlockte Justin nicht gerade, aber ... Er hatte zwei fähige Männer als Passagiere bei sich, James Meehan, einen bei der Regierung angestellten Landvermesser und seinen eigenen Schwager George De Lancey, die ihm beide ihre Hilfe zugesagt hatten. George, der noch nie eine Sträflingsinsel mit eigenen Augen gesehen hatte, war hauptsächlich aus Interesse mitgekommen. Er glaubte erst in zweiter Linie daran, daß seine Hilfe oder sein Rat Justin sehr viel helfen könnten. Als stellvertretender Militärstaatsanwalt und Friedensrichter in Sydney mußte er oft Sträflinge für Straftaten verurteilen, die sie in der Verbannung in Neusüdwales begangen hatten. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit hatte er darauf bestanden, daß es seine Pflicht sei, sich über die Konditionen zu informieren, unter denen die Verurteilten leben würden.
Justin verspürte Hunger und fand George De Lancey am Tisch vor einem Teller Haferbrei und kaltem, geräuchertem Hammelfleisch sitzen — und er sah auf einen Blick, daß es seinem Schwager nicht besonders schmeckte.
»Eine Schiffschaukel ist nichts gegen deine Elizabeth Henrietta, Justin«, sagte er und verzog sein glattes, gutaussehendes Gesicht.
»Ich hatte gedacht, daß ich vollkommen immun gegen das mal de mer sei, aber jetzt —« Er schob seinen Teller weg. »Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Der arme Meehan kann schon gar nichts mehr essen, er liegt in seiner Koje.«
Justin setzte sich seinem Schwager gegenüber an den Tisch und freute sich über das Essen, das ihm der Steward gleich darauf servierte. »Es weht auch ein ziemlich starker Wind«, verteidigte er sein Schiff. »Ich hab dir ja schon vor Antritt der Reise erzählt, daß die Elizabeth sehr stark schlingert — das hat sie schon immer getan, das muß an einem Konstruktionsfehler liegen. Aber man gewöhnt sich daran.«
»Das verhüte Gott!« antwortete George mit dem Rest Ironie, den er in seinem Zustand aufbringen konnte. »Verdammt noch mal, ich bin eine Landratte und kein Seemann, und ich kann es kaum erwarten, meinen Fuß wieder auf festes Land zu setzen. Wann kommen wir deiner Meinung nach in Norfolk an?«
Justin lachte. »Ach, es dauert nur noch ein paar Stunden. Und wenn wir Glück haben, können wir auch gleich ein paar verwilderte Schweine schießen und unseren mageren Speiseplan durch etwas Frischfleisch aufbessern.«
Während er aß, wurde ihm wieder einmal bewußt, wie gut er De Lancey leiden konnte und wie glücklich seine Schwester Rachel sein konnte, daß sie mit ihm verheiratet war. Als erfolgreicher Jurist hatte George — obwohl er in Amerika geboren war — schon eine respektable Karriere in der britischen Armee hinter sich, er hatte in der berühmten Schlacht von Waterloo mitgekämpft, bei der Napoleon endgültig besiegt worden war.
George gähnte und sagte: »Ich bitte dich, mich zu entschuldigen. Ich fühle mich wirklich nicht gut — wahrscheinlich, weil ich jetzt schon so lange nicht mehr zur See gefahren bin. Ich werde es James Meehan nachmachen und mich langlegen. Bitte sag mir Bescheid, wenn es Zeit ist, an Land zu gehen!«
Aber er kam in Begleitung des Landvermessers James Meehan an Deck, als die Elizabeth zwischen den beiden felsigen Inseln namens Phillip und Nepean hindurchfuhr und an der südlichen Seite von Sydney Bay vor Anker ging. Die Bucht war dem Wind stark ausgesetzt, aber es gab keinen besseren Ankerplatz in der Nähe der ehemaligen Sträflingssiedlung Kingston, über die er einen Bericht erstellen sollte.
Als das Ruderboot am Landungssteg anlegte, sah Justin, daß der mit Steinen gepflasterte Platz trotz zehnjähriger Vernachlässigung noch einigermaßen in Ordnung war. Sie stiegen eine glitschige Treppe hinauf, und Meehan ging mit seinem Assistenten gleich in Richtung des ehemaligen Gefängnisses, um die Gemäuer auf ihre Stabilität zu untersuchen.
Justin hatte sich das Jagdgewehr umgehängt, schaute George fragend an und meinte: »Sollen wir uns erst einmal einen allgemeinen Überblick verschaffen und gleichzeitig für etwas Frischfleisch sorgen?«
George nickte zustimmend, und die beiden Männer gingen langsam hinter Meehan her. Überall zwischen den verfallenen Hütten und Häusern sprangen verwilderte Schweine und Ziegen herum und flüchteten sich in die Büsche.
Die Felder um die kleinen Farmen herum waren längst im Unkraut erstickt, aber Justin sah mit großer Freude, daß die Fruchtbäume noch reich blühten. In dem großen Obstgarten, der von den verschiedenen Gouverneuren der Insel sorgsam gepflegt worden war, wuchsen gesunde Weinstöcke und Obstbäume, die im Herbst eine reiche Ernte versprachen. Aber das schöne zweistöckige Steinhaus, das Colonel Foveaux und später seinen Nachfolgern als Regierungsgebäude gedient hatte, war fast völlig zusammengefallen.
Justin schoß ein großes, verwildertes Schwein, und sie schleppten es zum Ruderboot, bevor sie zum ehemaligen Gefängnis gingen. Meehan war immer noch dort und maß die Ruine aus. Er tupfte sich das erhitzte Gesicht mit einem Taschentuch ab und sagte: »Es muß praktisch von Grund auf neu gebaut werden, fürchte ich. Die Wände, die noch stehen, sind nicht viel stabiler als Kulissen. Die feuchte Salzluft hat ihnen böse mitgespielt. Wenn ich der Gouverneur wäre, würde ich diese Insel der Natur überlassen ... oder den Franzosen!«
»Es ist überall ziemlich dasselbe«, erzählte ihm George. Er beschrieb ihm, was er und Justin gesehen hatten, und der grauhaarige Landvermesser zuckte die Achseln.
»Aber die verwilderten Tiere gedeihen hier gut«, meinte er. »Mein Assistent und ich mußten eine ganze Ziegenherde und eine Muttersau mit ihren Ferkeln aus den Gebäuden jagen, bevor wir mit unserer Arbeit beginnen konnten!« Er schaute Justin fragend an. »Ich weiß nicht mehr, wieviel Uhr es ist, aber hab ich noch etwas Zeit, Captain Broome? Ich nehme an, daß Sie noch bei Tageslicht durch das Riff zurück zum Schiff fahren wollen.«
»Da haben Sie völlig recht, Mr. Meehan. Aber es ist noch mindestens zwei Stunden hell, also lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir schauen uns noch etwas um, ja?« Justin deutete auf den ehemaligen Gefängnishof und ging darauf zu. »Das willst du doch hauptsächlich sehen, oder? Damit du dir eine Vorstellung von den Bedingungen machen kannst, unter denen die Männer zu leben haben, die als Kapitalverbrecher hierher verbannt werden.«
George beschleunigte seinen Schritt und ging neben seinem Schwager her. »Ja, genau deshalb bin ich hierhergekommen.«
»Obwohl nur noch Ruinen übriggeblieben sind, kann man sich doch ganz gut vorstellen, wie sich das Leben hier abgespielt hat. Es wird auch interessant für dich sein, den Friedhof zu sehen. Der mit allen Machtbefugnissen ausgestattete Gouverneur bestimmt eigentlich darüber, wie es den Schwerverbrechern hier geht. Vom Klima und der Fruchtbarkeit her gesehen, könnte diese Insel ein kleines Paradies sein, und es ist meiner Meinung nach völlig überflüssig, daß die Sträflinge ihre Arbeit in Ketten verrichten — an Flucht ist hier sowieso nicht zu denken.«
Als sie zum einsam gelegenen Friedhof kamen, rief George: »Großer Gott, Justin, das sind ja Hunderte von Gräbern hier! Wie lang hat die Strafkolonie eigentlich existiert? Fünfundzwanzig Jahre lang?«
»Ja, ungefähr«, antwortete Justin. »Unter Gouverneur Bligh wurde —« Er unterbrach sich und fluchte leise. Ein merkwürdiger kleiner Mann sprang über die Gräber, schaute interessiert zu ihnen herüber und schien darauf vorbereitet zu sein, jederzeit die Flucht zu ergreifen. Justin fühlte, wie ihm sein Schwager beruhigend die Hand auf den Arm legte. Der Mann kam näher, ein kleiner, gedrungener Kerl mit wirrem Haar und einem üppigen weißen Vollbart. Seine Kleidung bestand mehr aus Löchern als aus Stoff, und er hielt eine rostige Axt schützend vor sich.
»Seid ihr von dem Schiff da draußen?« fragte er und blieb ein paar Schritte entfernt stehen. »Seid ihr Briten?«
»Ja«, bestätigte Justin. »Und wir führen nichts Böses im Schild.«
»Is das ’n Schiff von der Königlichen Marine? Und sind Sie ’n Königlicher Marineoffizier?«
»Es ist genauso, wie Sie sagen. Ich bin der Kapitän der Elizabeth