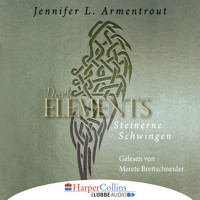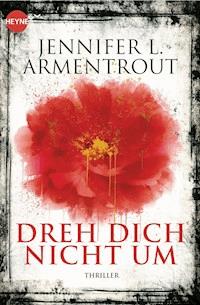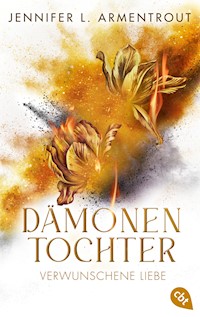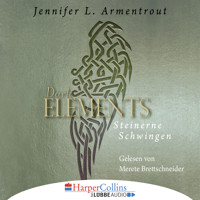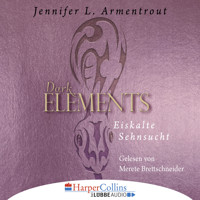8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ihr Herz droht zu zerbersten – vor Angst und heißer Leidenschaft …Vor zehn Jahren entkam Sasha nur knapp einem Serienkiller, der mehrere Frauen auf bestialische Weise hingerichtet und als Bräute drapiert hat. Schwer traumatisiert verließ sie ihre Heimat und brach alle Kontakte ab. Doch nun kehrt sie zurück. Als Sasha ihren attraktiven Exfreund Cole, mittlerweile FBI-Agent, wiedersieht, verspürt sie sofort heißes Herzklopfen. Und Cole hat auf sie gewartet. Aber bevor die beiden ihre Sehnsucht stillen können, wird eine tote Frau geborgen. Genau dort, wo der Serienkiller vor zehn Jahren seine Leichen deponierte. Ist Sashas Leben erneut in Gefahr?»Eine wilde, spannende Achterbahnfahrt voller Gänsehautmomente und Romantik!« RT Book Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deAus dem Amerikanischen von Vanessa LamatschISBN 978-3-492-97847-7© by Jennifer L. Armentrout 2017Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Till Death«, William Morrow, New York 2017© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2017Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCoverabbildung: FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Für meine Leser
Prolog
Es gab Regeln. Regeln, die nicht gebrochen werden durften. Aber dieses eine Mal war es geschehen. Und verdammt, es würde wieder passieren. Es spielte keine Rolle, dass die Situation bis jetzt unter Kontrolle gewesen war. Es spielte keine Rolle, dass die Regeln bislang befolgt worden waren und befolgt werden mussten. Jetzt war alles anders.
Denn sie war zurückgekommen.
Und sie würde wieder alles ruinieren.
Der zusammengekauerte, jämmerliche Schatten in der Ecke begann zu wimmern. Die Frau war wach. Endlich. Es machte bei Weitem nicht so viel Spaß, wenn sie während meiner Bemühungen bewusstlos waren. Planung erforderte Geduld, und Geduld war eine Tugend, über die man erst nach Jahren des Wartens verfügte.
Blutige, dreckige Seile umschlossen die Knöchel und Handgelenke der Frau. Als sie langsam den Kopf hob und ihre Lider flatternd öffnete, drang ein überraschter Schrei aus ihrer Kehle, und in diesem Schrei lag blankes Entsetzen. Man sah es an ihren weit aufgerissenen, glasigen Augen.
Sie wusste es. O ja, sie wusste, dass sie diesen Raum nicht wieder verlassen würde. Sie wusste, dass der Sonnenschein von heute Morgen, als sie zur Arbeit aufgebrochen war, der letzte ihres Lebens sein würde. Sie wusste, dass sie zum letzten Mal frische Luft geatmet hatte.
Schwaches, künstliches Licht war alles, was ihr jetzt noch blieb. Der dumpfe, erdige Geruch ihres Gefängnisses würde sie bis zum letzten Atemzug begleiten, würde sich in ihren Poren einnisten und in ihre Haare einziehen.
Das hier war ihr letzter Aufenthaltsort.
Die Frau ließ den Kopf gegen die feuchte Ziegelmauer sinken. Der ängstliche Ausdruck in ihren Augen ging in etwas Flehendes über. So war es immer. Und es war so verdammt vorhersehbar. So sinnlos. Denn hier gab es keine Hoffnung mehr. Sobald die Frauen einmal hier waren, gab es keine Rettung mehr.
Schritte erklangen über ihrem Kopf. Eine Sekunde später war entferntes Lachen zu hören. Die Frau starrte an die Decke. Sie versuchte, um Hilfe zu rufen, zu schreien, brachte aber nur ein jämmerliches Wimmern zustande.
Ihre Stimme erstarb, als dämmriges Licht auf einer scharfen Klinge glänzte.
Sie schüttelte den Kopf mit Nachdruck, sodass die schlaffen blonden Strähnen um ihr Gesicht flogen. Tränen füllten ihre braunen Augen.
»Es ist nicht deine Schuld.«
Ihre Brust hob und senkte sich in angestrengten Atemzügen.
»Wenn sie nicht zurückgekommen wäre, wäre dir das vielleicht erspart geblieben. Es ist ihre Schuld.« Es folgte ein kurzer Moment der Stille, in dem der Blick der Frau das Messer musterte. »Sie hat sich mit mir angelegt und ich werde mich auf die unangenehmste Weise an ihr rächen.«
Diesmal würde es enden, wie es immer enden sollte. Sie würde sterben, aber zuerst würde sie dafür bezahlen.
Für alles.
Kapitel 1
Mein Herz begann zu rasen, als ich in den Rückspiegel blickte. Meine braunen Augen waren weit aufgerissen. Ich wirkte vollkommen verängstigt … und das war ich auch.
Ich atmete tief durch, schnappte mir die Handtasche und öffnete die Tür des Honda, um auszusteigen. Als ich sie wieder zudrückte, glitt kalte Luft unter meinen dünnen Pulli. Ich atmete tief durch. Um mich herum roch es nach frisch gemähtem Gras.
Ich trat einen Schritt auf die Pension zu, in der ich aufgewachsen war, die ich jedoch seit Jahren nicht mehr besucht hatte. Sie sah noch immer aus wie in meiner Erinnerung. Die leeren Schaukelstühle auf der vorderen Veranda wiegten sich leicht im Wind. Doch die buschigen Farne, die im Frühling und im Sommer vor dem Vorbau gewachsen waren, waren verschwunden. Die Schindeln an der Wand leuchteten in frisch gestrichenem Weiß. Waldgrüne Fensterläden und …
Mein Mund wurde trocken. Eine Gänsehaut glitt über meine Arme und sorgte dafür, dass sich die dünnen blonden Haare in meinem Nacken aufstellten. Ein schreckliches, surreales Gefühl ergriff von mir Besitz und mein Atem stockte.
Das Gefühl glitt wie eine schlüpfrige und etwas zu grobe Liebkosung über meine Wirbelsäule nach unten. Mein Nacken brannte, wie er es immer getan hatte, wenn er hinter mir saß …
Ich wirbelte herum und ließ meinen Blick über den Vorgarten wandern. Hohe Hecken umrahmten das Grundstück. Es lag ein gutes Stück von der Queen Street entfernt – der Hauptstraße der Stadt –, doch ich konnte die Autos hören. Niemand war in der Nähe. Ich drehte mich einmal im Kreis. Kein Mensch hielt sich auf der Veranda oder im Hof auf, auch wenn vielleicht jemand am Fenster der Pension stand. Aber hier draußen war ich allein, egal, wie sehr mein Puls raste oder mich meine Instinkte warnten.
Ich konzentrierte mich erneut auf die grüne Hecke. Sie war so dicht, dass sich leicht jemand dahinter verstecken konnte, um mich zu beobachten und darauf zu warten, dass …
»Hör auf.« Ich ballte die Hand zur Faust. »Du leidest unter Paranoia und benimmst dich dämlich. Hör einfach auf. Niemand beobachtet dich.«
Doch mein Herzschlag beruhigte sich nicht. Stattdessen breitete sich ein Zittern über meinen Körper aus. Ich reagierte, ohne nachzudenken.
Und verfiel in Panik.
Die Angst versenkte ihre eisigen Klauen tief in meinen Eingeweiden. Ich rannte von meinem Auto in die Pension. Alles sauste verschwommen an mir vorbei, als ich durch den Eingangsbereich hastete, die Haupttreppe erreichte und einfach weiterlief, bis in den obersten Stock.
Dort, in dem stillen, schmalen Flur vor den Wohnungen über der Pension, ließ ich meine Tasche fallen. Ich war außer Atem und mir war schlecht, als ich mich keuchend vorbeugte und meine Hände auf die Knie stützte.
Ich war gerannt, als würde ich von den Dämonen der Hölle gejagt.
So hatte ich mich auch gefühlt.
Das hier war ein Fehler.
»Nein«, flüsterte ich in Richtung Decke. Ich setzte mich, lehnte mich gegen die Wand und rieb mir das Gesicht. »Das ist kein Fehler.«
Ich ließ die Arme sinken und zwang mich, die Augen zu öffnen. Natürlich reagierte ich heftig darauf, nach Hause zurückzukehren. Kein Wunder, nach allem, was geschehen war.
Als ich von hier verschwunden war, hatte ich geschworen, niemals wieder einen Fuß in die Stadt zu setzen.
Doch sag niemals nie.
Ich konnte kaum glauben, dass ich tatsächlich hier war; dass ich getan hatte, was ich niemals hatte tun wollen.
Als Kind war ich davon überzeugt gewesen, dass es in unserer Pension spukte. Wie sollte es anders sein? Das Herrenhaus im georgianischen Stil mit dem angrenzenden Kutschenhaus war älter als die Zeit. Früher hatte es einmal zur Underground Railroad gehört. Gerüchten zufolge war es nach der Schlacht am Antietam mit verletzten und sterbenden Soldaten gefüllt gewesen.
Nachts knarrten die Bodendielen auf unheimliche Art. In gewissen Räumen gab es kalte Stellen, die sich einfach nicht erwärmen ließen. Besonders die alte, schlecht beleuchtete Dienstbotentreppe, die vom ersten Stock in die Küche führte, hatte mir als Kind unglaubliche Angst eingejagt. Dort huschten ständig Schatten über die tapezierten Wände. Wenn es wirklich Geister gab, dann sollte diese Pension, die Scharlachrote Dirne, voll davon sein. Und selbst mit neunundzwanzig, als erwachsene Frau, war ich immer noch davon überzeugt, dass es hier von Gespenstern nur so wimmelte.
Doch inzwischen ging es um eine andere Art von Gespenst.
Was in diesen schmalen Fluren im oberen Stockwerk sein Unwesen trieb, auf Zehenspitzen über die geschliffenen Dielen schlich und sich in den dämmrigen Treppenhäusern verbarg, war die Sasha Keeton von vor zehn Jahren, bevor … bevor der Bräutigam in die Stadt gekommen war, in der sonst nie etwas geschah.
Bis er alles zerstört hatte.
Seufzend stand ich auf und sah den Flur entlang.
Vielleicht wäre ich nicht so ausgetickt, wenn ich nicht bei der Abfahrt von der Interstate die Nachricht im Radio gehört hätte, dass eine Frau aus Frederick verschwunden war. Ich hatte nur ihren Nachnamen mitbekommen: Banks. Sie arbeitete als Krankenschwester im Memorial Hospital. Ihr Ehemann hatte sie zuletzt am Morgen gesehen, als sie zur Arbeit aufgebrochen war.
Mein Atem stockte und ein kalter Schauder lief über meinen Rücken. Frederick lag nicht weit von Berkeley County entfernt. An Tagen ohne viel Verkehr dauerte die Fahrt nur ungefähr eine Dreiviertelstunde. Meine Fingerspitzen waren eiskalt, als ich meine Hände langsam öffnete und wieder zu Fäusten ballte.
Eine vermisste Person war schrecklich, traurig und unendlich tragisch, aber mehrere vermisste Personen waren eine grauenhafte, große Sache und bildeten ein Muster.
Ich fluchte leise und unterdrückte den Gedanken. Die vermisste Frau hatte nichts mit mir zu tun. Offensichtlich. Gott wusste, dass ich nur zu gut verstand, wie traumatisch das Verschwinden einer Person sein konnte, und ich hoffte wirklich, dass sie gesund und munter gefunden wurde …
Das hatte nichts mit mir zu tun.
Oder mit dem, was vor zehn Jahren geschehen war.
Der frische Januarwind zerrte urplötzlich am Dach des Hauses und erschreckte mich. Das Herz hämmerte gegen meine Rippen. Ich war so schreckhaft wie eine Maus in einem Raum voller hungriger Katzen. Das hier war …
Mein Handy klingelte und entriss mir den Gedanken. Ich beugte mich vor und wühlte in meiner großen Beuteltasche herum, bis meine Finger die glatte Oberfläche fanden und das Handy herauszogen. Dann zuckten meine Mundwinkel kurz, als ich erkannte, wer der Anrufer war.
»Sasha«, sagte Mom, kaum dass ich abgehoben hatte. Ihr Lachen zauberte ein breites Lächeln auf mein Gesicht. »Wo in aller Welt bist du? Ich habe dein Auto vor der Tür gesehen, kann dich aber nirgends finden.«
Ich verzog das Gesicht zu einer Grimasse, auch wenn sie es nicht sehen konnte. »Ich bin oben. Ich bin aus dem Auto gestiegen und wollte reinkommen, aber ich …«
Ich wollte die Worte nicht aussprechen, wollte nicht zugeben, wie verunsichert ich war.
»Soll ich hochkommen?«, fragte Mom sofort.
Ich presste die Augen zu. »Nein. Jetzt geht es mir gut.«
Es folgte ein kurzer Moment der Stille. »Sasha, Liebes, ich …« Moms Stimme verklang, und ich fragte mich, was sie hatte sagen wollen. »Ich bin froh, dass du endlich wieder zu Hause bist.«
Zu Hause.
Die meisten Neunundzwanzigjährigen würden es als Versagen betrachten, nach Hause zurückzukehren – aber für mich bedeutete es genau das Gegenteil. Nach Hause zu kommen war ein Erfolg, eine Leistung, die viel Kraft erfordert hatte. Ich öffnete die Augen wieder und unterdrückte ein Seufzen. »Ich komme gleich runter.«
»Das hoffe ich.« Sie lachte wieder, doch es klang zittrig. »Ich bin in der Küche.«
»Okay.« Ich umklammerte das Handy fester. »Ich bin in ein paar Minuten da.«
»In Ordnung, Liebes.« Mom legte auf und ich ließ das Handy wieder in meine Tasche fallen.
Für einen Moment stand ich wie angewurzelt da, dann nickte ich einmal. Es wurde Zeit.
Es wurde wirklich Zeit.
Der Anblick haute mich fast um.
Die Pension sah überhaupt nicht mehr so aus wie in meiner Erinnerung. Ich wanderte durch den Eingangsbereich, vollkommen vor den Kopf gestoßen von den Veränderungen der letzten zehn Jahre.
Mit der Tasche in der Hand schritt ich langsam durch das Erdgeschoss. Die Vasen mit künstlichen Orchideen waren neu. Die alten Stühle neben dem Empfangstresen waren verschwunden. Zwei ehemals große Zimmer waren zu einem riesigen Raum verbunden worden. Sanfte graue Farbe hatte die Blumentapeten ersetzt. Die traditionellen Stühle mit den Samtpolstern waren gegen grün-weiße Lehnsessel ausgetauscht worden, die sich um die Couchtische in der Nähe des Tresens verteilten. Die Ziegelmauer um den Kamin war freigelegt und weiß gestrichen worden.
Eine weitere Überraschung erwartete mich, als ich den Speisesaal der Pension betrat. Verschwunden war der große und wenig einladende Tisch, der alle Gäste dazu gezwungen hatte, zusammen zu essen. Stattdessen standen fünf runde Tische mit weißen Tischtüchern im großen Raum. Auch hier war, wie im Eingangsbereich, der Kamin freigelegt und gestrichen worden und die Flammen flackerten hinter einer Glasplatte. Eine Getränkestation war gegenüber aufgebaut worden.
Die Scharlachrote Dirne war endlich im 21. Jahrhundert angekommen.
Hatte Mom die Renovierung mir gegenüber irgendwann einmal erwähnt? Wir hatten oft telefoniert und Mom hatte mich in den letzten Jahren regelmäßig in Atlanta besucht. Sie musste davon gesprochen haben. Wahrscheinlich hatte sie es tatsächlich getan, doch ich neigte dazu, auf Durchzug zu schalten, wenn es um die Stadt ging – und anscheinend hatte ich einiges ausgeblendet.
Die Erkenntnis war wichtig, weil ich jetzt wusste, dass ich mich zu sehr von den Geschehnissen abgeschottet hatte.
Ein Kloß bildete sich in meiner Kehle und Tränen brannten in meinen Augen. »O Gott«, murmelte ich, blinzelte schnell und fuhr mir mit dem Handrücken über die Augen. »Okay. Reiß dich zusammen.«
Ich zählte bis zehn, räusperte mich und nickte einmal. Ich war bereit, meine Mom zu sehen. Ich konnte das schaffen, ohne zu heulen wie ein Kleinkind.
Sobald ich mir sicher war, dass ich keinen totalen Zusammenbruch erleiden würde, setzte ich mich wieder in Bewegung. Der Duft von gebratenem Fleisch führte mich in den hinteren Teil des Hauses. Die Schiebetür mit der Aufschrift Nur FÜR Personal war geschlossen. Als ich die Hand danach ausstreckte, wurde ich zurück in die Vergangenheit katapultiert. Plötzlich sah ich mich, wie ich am ersten Tag des Kindergartens durch diese Tür gestürmt war und mich in die Arme meines Vaters geworfen hatte, ein gemaltes Bild in der Hand. Ich erinnerte mich, wie ich mit zum ersten Mal gebrochenem Herzen durch diese Tür geschlurft war, weil Kenny Roberts mich auf dem Spielplatz mit dem Gesicht voran in den Matsch geschubst hatte. Ich sah mich selbst mit fünfzehn, in dem Wissen, dass mein Vater nie wieder auf mich warten würde.
Und ich sah mich, wie ich den Jungen, den ich im Einführungskurs Wirtschaft getroffen hatte, durch genau diese Tür führte, um ihm meine Mom vorzustellen. Mein Herz machte einen Sprung und riss mich damit aus den Erinnerungen.
»Himmel«, stöhnte ich und vertrieb den Gedanken in meinem Hirn, bevor das Bild dieser fahlblauen Wolfsaugen vor meinem Geist aufsteigen konnte. Denn wenn das geschah, würde ich die nächsten zwölftausend Jahre an ihn denken, und das konnte ich im Moment wirklich nicht brauchen. »Ich bin so kaputt.«
Ich schüttelte den Kopf, dann schob ich die Tür auf. Der Kloß in meinem Hals kehrte mit aller Macht zurück, als ich Mom hinter der Arbeitsplatte aus poliertem Stahl entdeckte, genau an der Stelle, wo Dad immer gestanden hatte, bis ein heftiger unangekündigter morgendlicher Herzinfarkt ihn dahingerafft hatte.
Ich vergaß die Angst, die ich die ganze lange Fahrt über empfunden hatte, vergaß, was ich im Radio gehört hatte, und fühlte mich, als wäre ich wieder fünf Jahre alt.
»Mom«, krächzte ich und ließ die Tasche auf den Boden fallen.
Anne Keeton trat hinter der Arbeitsfläche hervor. In meiner Eile, sie zu erreichen, stolperte ich. Es war ein Jahr her, dass ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Letzte Weihnachten war Mom nach Atlanta gekommen, weil sie gewusst hatte, dass ich immer noch nicht bereit war, sie hier zu besuchen. Seitdem waren gerade mal zwölf Monate vergangen, aber meine Mutter hatte sich genauso sehr verändert wie die Pension.
Ihr schulterlanges Haar wirkte inzwischen eher silbern als blond. Tiefe Falten hatten sich in die Haut um ihre braunen Augen gegraben, dünnere Linien umrahmten ihren Mund. Mom war immer kurvig gebaut gewesen – und ich hatte Hüfte, Brüste, Bauch und, okay, auch die Schenkel von ihr geerbt –, aber sie hatte mindestens zehn Kilo abgenommen.
Sorge stieg in mir auf, als sie die Arme um mich schloss. Hatte ich das letztes Jahr nicht bemerkt? War ich zu lange weg gewesen? In zehn Jahren konnte man eine Menge verpassen, wenn man eine Person nur hin und wieder sah.
»Liebes«, sagte Mom mit belegter Stimme, »ich bin ja so glücklich, dich zu sehen. So glücklich, dass du hier bist.«
»Ich auch«, flüsterte ich und meinte es so.
Nach Hause zu kommen war das Letzte, was ich mir gewünscht hatte. Aber als ich Mom fest umarmte und das vanillige Aroma ihres Parfüms einatmete, wusste ich, dass es richtig gewesen war. Auch weil sich die Sorge um sie weiter in mir ausbreitete.
Mom war erst fünfundfünfzig, aber in Bezug auf die Sterblichkeit spielte das Alter keine Rolle. Ich wusste das besser als jeder andere. Mein Dad war jung gestorben. Und vor zehn Jahren, mit gerade mal neunzehn, hatte ich … hatte ich fast meinen letzten Atemzug getan, nachdem mir alles andere genommen worden war.
Kapitel 2
Der schmiedeeiserne Bistrotisch vor dem großen Fenster mit Blick auf Veranda und Garten stand schon mein ganzes Leben lang in der Küche. Ich ließ meine Hand über die Platte gleiten, um die winzigen vertrauten Kratzer zu erfühlen. An diesem Tisch hatte ich als Kind gemalt und später, als Teenager, meine Hausaufgaben gemacht.
Die Tür zur alten Küche, die jetzt als Pausen- und Lagerraum diente, befand sich am anderen Ende des Raums, ebenfalls mit einem Nur FÜR Personal-Schild gekennzeichnet. Diese Tür, wie alles andere in der modernen Küche, war weiß gestrichen.
Mom trug zwei Tassen Kaffee an den Tisch und setzte sich mir gegenüber. Jetzt roch der Raum wie eine Espressobar und ich dachte nicht mehr an meine Panik von vorhin.
»Danke«, sagte ich, als ich die Finger um die warme Tasse legte. Ein Grinsen verzog meine Lippen. Winzige grüne Weihnachtsbäume prangten auf dem Porzellan. Obwohl Weihnachten seit zwei Wochen vorüber war und die Dekoration längst abgenommen worden war, würden diese Weihnachtstassen das ganze Jahr über in Gebrauch bleiben.
Ich sah mich stirnrunzelnd in der Küche um und fragte: »Wo ist James?« James Jordan arbeitete seit gut fünfzehn Jahren als Küchenchef in der Pension. »Ich rieche doch einen Braten.«
»Was du riechst, sind zwei Braten.« Mom nippte an ihrem Kaffee. »Und es gibt ein paar Veränderungen bei uns. Die Gäste müssen bis ein Uhr mitteilen, ob sie bei uns essen wollen, dann kochen wir angepasst an die Bestellungen. Das verringert die Arbeit und wir verschwenden nicht so viel Essen.« Sie hielt kurz inne. »James kommt nur noch dreimal die Woche. Dienstag, Donnerstag und Samstag.« Sie stellte ihre Tasse ab. »Das Geschäft läuft nach wie vor nicht schlecht, aber dank den vielen neuen Hotels in der Umgebung muss ich mehr darauf achten, wofür wir unser Geld ausgeben. Erinnerst du dich, dass ich dir von Angela Reidy erzählt habe?«
Als ich nickte, fuhr sie fort.
»Sie erledigt Mittwoch bis Sonntag vormittags und nachmittags den Großteil der Arbeit. Daphne ist immer noch bei uns, aber sie wird nicht jünger, also arbeitet sie nur noch in Teilzeit. So hat sie mehr Zeit für ihre Enkel. Angela ist toll, aber ein wenig flatterhaft und oft vergesslich. Sie sperrt sich ständig aus dem Haus aus, das sie gemietet hat – so oft, dass ein Ersatzschlüssel bei uns im Hinterzimmer lagert.«
Ich ließ Moms Worte auf mich wirken, als ich den süßen Kaffee trank, der genau so schmeckte, wie ich ihn liebte. Letztendlich sagte mir meine Mutter gerade, dass sie den größten Teil der Arbeit selbst machte. Das erklärte die tiefen Runzeln um ihre Augen, die Fältchen um ihren Mund und die silberne Färbung ihres blonden Haares. Eine Pension mit so wenigen Angestellten zu führen hätte von jedem seinen Tribut gefordert. Und ich wusste, dass die letzten zehn Jahre noch aus ganz anderen Gründen nicht ganz leicht für sie gewesen waren.
Es waren dieselben Gründe, warum die Zeit für mich nicht leicht gewesen war.
Manchmal gelang es mir zu vergessen, was mich von zu Hause fortgetrieben hatte. Das passierte nur sehr selten, doch wenn es geschah, dann empfand ich einen unendlich wunderbaren Frieden. Es war, als wäre alles wie vorher. Als könnte ich vorgeben, eine ganz normale Frau zu sein, mit einer Karriere, die ich durchaus mochte, und einer gewöhnlichen, vielleicht sogar langweiligen Vergangenheit. Es war nicht so, als hätte ich nicht mit dem abgeschlossen, was … mir und meiner Familie zugestoßen war. Das hatte ich sechs Jahren intensiver Therapie zu verdanken. Aber wann immer ich einfach vergaß, hieß ich diese Momente willkommen – und war dankbar.
»Du hast alles allein gemacht, Mom.« Ich stellte meine Tasse auf den Tisch und schlug die Beine übereinander. »Und das ist eine Menge.«
»Es ist … zu bewältigen.« Mom lächelte, doch das Lächeln erreichte ihre whiskeyfarbenen Augen nicht. »Aber jetzt bist du ja wieder da. Jetzt muss ich nicht mehr alles alleine machen.«
Ich nickte und ließ den Blick auf die Tasse sinken. »Ich hätte früher …«
»Sag das nicht.« Mom streckte den Arm aus und legte ihre Hand auf meine. »Du hattest einen sehr guten Job …«
»Mein Job bestand im Wesentlichen darin, den Babysitter für meinen Boss zu spielen, damit er seine dritte Frau nicht betrügt.« Ich hielt grinsend inne. »Offensichtlich war ich nicht besonders gut darin, da Nummer drei es wohl nicht mehr lange machen wird.«
Kopfschüttelnd hob Mom ihre Tasse. »Liebes, du warst die Chefassistentin für einen Mann, der eine milliardenschwere Beraterfirma führt. Du hattest mehr Verantwortung als nur dafür zu sorgen, dass sein Hosenlatz geschlossen bleibt.«
Ich kicherte.
Das Einzige, was meinen Chef mehr antrieb als der Gedanke ans Geschäft, war der Wunsch, mit so vielen Frauen wie möglich zu schlafen. Doch Mom hatte recht. Fünf Jahre lang hatten lange Nächte im Büro, abendliche Geschäftsessen und ständig wechselnde Arbeitszeiten mit Langstreckenflügen von einer Küste zur anderen mein Leben bestimmt. Diese Arbeit hatte Vor- und Nachteile gehabt, und ich hatte mir die Entscheidung, meinen Job zu kündigen, nicht leicht gemacht. Doch das gute Gehalt hatte mir erlaubt, ein wenig zur Seite zu legen, um mir den Übergang zu einer … langsameren Lebensart ein wenig zu erleichtern.
»Du hattest ein Leben in Atlanta«, fuhr sie fort.
Ich zog eine Augenbraue hoch. Meine Zeit war mehr oder minder Mr Bergs Zeit gewesen.
»Und es ist bestimmt nicht leicht, hierher zurückzukehren.«
Ich erstarrte. Sie wollte das nicht ansprechen, oder?
Sie drückte meine Hand. Sie würde es ansprechen.
»Es kann nicht leicht sein, in diese Stadt und zu all den Erinnerungen zurückzukehren. Das weiß ich, Liebes. Ich weiß es.« Sie lächelte wieder, doch unsicher. »Ich bin mir durchaus bewusst, was für eine große Sache das für dich ist. Was du bewältigen musstest, um diese Entscheidung zu treffen. Und auch, dass du das für mich machst. Rede nicht klein, was du gerade tust.«
O Gott, ich würde wieder anfangen zu heulen. Ja, ich tat das für sie, aber ich … ich tat es auch für mich.
Ich zog meine Hand zurück und nahm eilig einen tiefen Schluck von meinem Kaffee, bevor ich den Kopf auf den Tisch sinken ließ, wie ich es in der Vergangenheit viel zu oft getan hatte. Tränen liefen mir über die Wangen.
Mom lehnte sich zurück. »Also«, meinte sie mit einem Räuspern, »mehrere von deinen Kisten sind am Mittwoch gekommen und James hat sie für dich nach oben geräumt. Ich nehme an, du hast noch Kisten im Auto?«
»Ja«, murmelte ich, als sie aufstand und ihre Tasse zur großen Spüle trug. »Aber die kann ich selbst hochbringen. Es sind nur Klamotten. Und da ich unzählige Stunden im Auto saß, wird mir die Bewegung guttun.«
»Wahrscheinlich änderst du deine Meinung, wenn dir wieder einfällt, wie viele Stufen die Treppe hat.« Mom wusch ihre Tasse aus. »Wir haben im Moment nur drei Zimmer vermietet. Zwei der Gäste checken am Sonntag aus und ein frisch verheiratetes Paar am Donnerstag.«
Ich trank den letzten Schluck Kaffee. »Gibt es Reservierungen für die nächste Zeit?«
Mom wischte sich ihre Hände an einem Handtuch ab und ratterte die Buchungen der nächsten Woche herunter. Ich fand es beeindruckend, dass sie das alles im Kopf hatte.
»Gibt es etwas, womit ich dir jetzt im Moment helfen kann?«, fragte ich, sobald sie verstummte.
Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben zwei Reservierungen fürs Abendessen. Zwei Tische, fünf Personen. Die Roastbeefs brauchen noch eine Weile. Die Kartoffeln sind bereits gekocht und geschnitten. Falls du mir dabei helfen willst, das Abendessen zu servieren, bleiben dir noch zwei Stunden Zeit.«
»Klingt gut.« Ich wollte aufstehen, doch da erregte eine Bewegung im Augenwinkel meine Aufmerksamkeit.
Ich wandte mich dem Fenster zu und meinte einen Schatten rechts von der Veranda zu erkennen. Die Äste des kleinen Apfelbaumes schwankten. Mit zusammengekniffenen Augen lehnte ich mich vor. Irgendetwas bewegte sich hinter dem Rankgitter – ein Schatten, der dunkler war als der Rest und sich eng an die Hecke schmiegte. Ich wartete darauf, dass jemand heraustrat. Als das nicht geschah, ließ ich den Blick durch den Garten schweifen. Da ich nichts entdecken konnte, konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf die Veranda. Die Liegestühle waren leer, doch ich hätte schwören können, dass ich dort draußen gerade jemanden gesehen hatte.
»Was ist da, Liebes?«
Da ich keine Ahnung hatte, schüttelte ich den Kopf und wandte mich wieder zu Mom um. »Ich glaube, einer der Gäste.«
»Seltsam.« Sie lief an den hängenden Töpfen vorbei zum Ofen. »Keiner der Gäste ist gerade im Haus. Ich glaube, sie sind alle ausgeflogen.«
Ich drehte mich wieder zum Fenster um, als Mom nach einem Topflappen griff.
Draußen bewegte sich nichts. Wahrscheinlich war da gar niemand gewesen. Ich war einfach nervös. Und paranoid. Wie vorhin, als ich in die Pension und bis nach ganz oben gerannt war. Nach Hause zu kommen trieb mich an meine Belastungsgrenze, und ich sagte mir wieder einmal, dass mir das niemand übel nehmen konnte.
Ich biss mir auf die Unterlippe und dachte an die Nachricht, die ich im Radio gehört hatte. Mein Magen verkrampfte sich, als ich die Hände ineinander verschränkte.
»Ich habe etwas im Radio gehört … Über eine vermisste Frau in Frederick.«
Mom hielt auf halbem Weg zum Ofen inne. Unsere Blicke trafen sich. Als sie nicht antwortete, entstand in meinem Magen ein Gefühl, als wären hundert winzige Schlangen darin geschlüpft.
»Wieso hast du nichts gesagt?«, fragte ich sie.
Sie wandte sich dem Ofen zu. »Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich weiß, dass du dich bemühen wirst, es nicht zu tun, aber ich wollte dich einfach nicht beunruhigen.« Sie schüttelte leicht den Kopf. »Und ich wollte nicht, dass du deine Meinung änderst und vielleicht nicht mehr nach Hause kommen willst.«
Ich schnappte hörbar nach Luft. Hielt sie mich für so zerbrechlich, dass ich wegen einer vermissten Frau in einer benachbarten Stadt meine Meinung änderte? Direkt nach den Geschehnissen von damals wäre ich vielleicht so empfindlich gewesen. Ich wäre daran zerbrochen. Aber diese Zeit war vorbei.
»Was mit dieser Frau passiert ist, ist schrecklich, aber du weißt, was man sagt. Bei den meisten verschwundenen Personen ist jemand verantwortlich, den der Vermisste kennt«, sagte sie. »Vielleicht war es der Ehemann.«
Nur dass ich die Person, die mich entführt hatte, nicht gekannt hatte. Es war ein Fremder gewesen. Jemand, den ich nicht hatte kommen sehen, bis es zu spät war.
Stunden später, nachdem ich dabei geholfen hatte, dem süßen älteren Paar mit dem Zimmer im zweiten Stock und der dreiköpfigen Familie aus Kentucky, die hier Verwandte besuchte, das Essen zu servieren, stand ich in meinem neuen Apartment.
Gott, es war so ein seltsames Gefühl, zurück zu sein.
Vertraut, aber irgendwie auch anders.
Das Abendessen war gut gelaufen. Doch es kam mir trotzdem seltsam vor, etwas zu tun, was mir bereits in meiner Kindheit in Fleisch und Blut übergegangen war, obwohl ich es seit Jahren nicht gemacht hatte. Auf bizarre Weise erinnerte es mich an meinen Job als Chefassistentin. Genau wie bei Mr Berg musste ich versuchen, vorherzusehen, welche Dinge gebraucht werden würden. Zum Beispiel, wann die Gäste noch etwas zu trinken wollten oder die Teller abgeräumt werden konnten.
Nun ja. Und das Aufräumen stank immer noch zum Himmel, genau wie in meiner Erinnerung. Doch ich hatte nicht nachgedacht, als ich die Tische abgedeckt und die Teller abgespült hatte, bevor ich sie in die Spülmaschine räumte, während Mom ihre letzte Runde durch die Pension drehte. Mein Gehirn war wundervoll leer gewesen … bis zu dem Moment, als ich nach oben gegangen war.
Das Dachgeschoss war zu zweieinhalb Wohnungen ausgebaut worden. Dad war gestorben, bevor er die Renovierung der dritten Wohnung abgeschlossen hatte, seitdem wartete sie unberührt hinter verriegelten Türen, zwischen den zwei fertigen Wohnungen. Ich war mir nicht sicher, ob das dritte Apartment je ausgebaut werden würde – und falls ja, wofür wir es nutzen würden. Es war ja nicht so, als würde ich bald mehr Platz brauchen.
Oder jemals.
Geistesabwesend wanderte meine rechte Hand zu meiner linken, um den Ring an meinem Finger zu drehen. Selbst nachdem ich die Stadt verlassen und sechs Jahre in Therapie verbracht hatte, ging ich nicht davon aus, dass es mir jemals möglich sein würde, ein Hochzeitskleid anzuziehen oder jemandem zu erlauben, mir einen Ring auf den Finger zu schieben.
Meine Therapeutin hatte behauptet, das würde sich noch ändern, doch das bezweifelte ich stark. Ich hatte es nicht mal geschafft, zur dritten Hochzeit meines ehemaligen Chefs zu gehen. Schon bei der Vorstellung krampfte sich mein Magen.
Als mir klar wurde, was ich gerade tat, ließ ich die Hand sinken und konzentrierte mich wieder auf die Wohnung. Sie sah nicht ganz aus wie in meiner Erinnerung. Ich vermutete, dass Mom sie hatte renovieren lassen. Vielleicht wirkten die Räume auch einfach nur größer und neuer, da das ganze Zeug meiner Großmutter verschwunden war. Das Apartment roch nicht muffig oder alt, sondern nach Gewürzkuchen, und es war beengt – aber auf gemütliche Weise.
Das Wohnzimmer ging in eine Küche über, die lediglich mit einem Kühlschrank, einer Mikrowelle und einer Spüle ausgestattet war. Ich musste nur noch Barhocker für die Kücheninsel besorgen. Meine Couch, eine wunderbar weiche Schönheit, war bereits geliefert worden, zusammen mit allem anderen, was ich besaß. Die hellgrauen Decken – perfekt, um sich darin einzukuscheln – lagen bereits über der Sofalehne.
Das Schlafzimmer war groß genug. Es gab nur einen kleinen Schrank, aber das Bad, das vom engen Flur zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer abging, war mit einer Badewanne mit Löwenfüßen ausgestattet, die jeden Platzmangel ausglich.
Den Rest des Abends verbrachte ich damit, meine Wohnung einzurichten, was mehr oder minder bedeutete, den Fernseher anzuschließen und die ganzen Klamotten auszupacken – Klamotten, von denen ich mir inzwischen wünschte, ich hätte sie einfach der Wohlfahrt gespendet, weil bald schon meine Oberarme von dem ganzen Zusammenlegen und In-den-Schrank-räumen schmerzten.
Als ich schließlich ins Badezimmer ging, um mir das Gesicht zu waschen, war es nach Mitternacht. Den Blick unverwandt auf das weiße Porzellan des Beckens gerichtet, rieb ich mir das Waschgel auf die Wangen, bevor ich mich vorbeugte, um mir warmes Wasser ins Gesicht zu spritzen.
Ich tastete blind nach dem Handtuch, das ich vorhin gesehen hatte, und freute mich, als meine Finger gleich den weichen Stoff fanden. Ich trocknete mir das Gesicht ab, dann richtete ich mich auf, ließ das Handtuch sinken und öffnete die Augen.
Und fand mich meinem eigenen Spiegelbild gegenüber.
Ich machte vor Schreck einen Schritt zurück, sodass ich gegen die Badezimmertür stieß. »Verdammt«, murmelte ich genervt. Ich wollte nach der Zahnbürste greifen, doch dann atmete ich tief durch und tat etwas, was ich seit langer Zeit nicht mehr getan hatte.
Ich sah mich an.
Ich sah mich wirklich an.
Denn es war Ewigkeiten her, seitdem ich das getan hatte. Ich war so versiert darin, den Blick in den Spiegel zu vermeiden, dass ich inzwischen fähig war, mich ohne Spiegel zu schminken. Und das galt sogar für den Eyeliner. Auf dem Oberlid.
Doch nun sah ich hin. Meine braunen Augen waren nicht so dunkel, wie die von Dad gewesen waren. Sie waren wärmer und heller, wie Moms. Mein blondes Haar war schon den ganzen Tag über zu einem unordentlichen Dutt gebunden, doch wenn ich es öffnete, fiel es mir bis auf die Mitte des Rückens. Ohne mein ausdrucksstarkes Kinn hätte man mein Gesicht als herzförmig beschreiben können.
Ich umklammerte den Rand des Waschbeckens und lehnte mich vor, um mich noch eingehender im Spiegel zu betrachten.
Irgendwann im ersten Studienjahr war ich in meine Nase und meinen Mund hineingewachsen. Zumindest hatte ich es so empfunden – denn bis dahin waren meine Nase riesig und meine Lippen zu plump gewesen. Und auch wenn es nicht so klingen mochte: Es war keine attraktive Kombination gewesen. Den Mund hatte ich von meiner Großmutter geerbt. Das Kinn von Dad. Den Körper und die Augen von Mom.
Im ersten Studienjahr hatte ich erkannt, dass ich nicht länger durchschnittlich aussah, sondern hübsch war – eben das typische blonde Mädchen von nebenan. Im Moment fand ich, dass ich wie die Art von Frau wirkte, die ihren Nachbarn selbst gebackenen Apfelkuchen vorbeibrachte, während sie gerade mit dem dritten Kind schwanger war.
Meine Mundwinkel zuckten. Das Lächeln war schwach und traurig und ein wenig leer. Ich erkannte dunkle Ringe unter meinen Augen – und in den Tiefen einen wachsamen Ausdruck, der mich nie zu verlassen schien, egal, wie viele Jahre vergangen waren oder wie gut ich alles verarbeitet hatte.
Wenn ich in der Zeit hätte zurückreisen können, hätte ich der neunzehnjährigen Sasha gesagt, dass sie richtig auf den Putz hauen solle. Dass sie zu den Verbindungspartys gehen solle, auf die sie eingeladen worden war. Dass sie lange aufbleiben und noch länger schlafen solle. Mehr Selbstbewusstsein zeigen. Sich selbst anerkennen, wenn sie in den Spiegel sah.
Den großen Schritt in eine Beziehung mit dem Jungen wagen, den sie im Wirtschaftsgrundkurs getroffen hatte.
Von allen Erfahrungen, die ich nicht gemacht hatte, bevor … bevor der Bräutigam mich gefunden hatte … bereute ich das wahrscheinlich am meisten – weil er mir mein erstes Mal genommen und in etwas Grausames, Widerliches verwandelt hatte.
Ich presste die Lippen aufeinander und senkte den Blick. Pinkfarbene Zehennägel ragten unter dem zerfransten Saum meiner Jeans heraus. Ich stemmte die Hände in meine vollen Hüften und ließ sie ein kleines Stück nach oben wandern, wo meine Taille war.
Wie sah ich nackt aus? Ich hatte wirklich keine Ahnung.
Selbst wenn ich in den letzten Jahren mit Männern intim gewesen war, hatte ich mich selbst nie nackt im Spiegel angesehen. Als ich jetzt so darüber nachdachte, wurde mir klar, dass ich mich tatsächlich nie ganz ausgezogen hatte beim Sex.
Dafür gab es gute Gründe.
Zwei, um genau zu sein.
Da mir unangenehm war, welche Richtung meine Gedanken eingeschlagen hatten und ich nicht in diesem schwarzen Loch versinken wollte, beendete ich meine Selbsterkundung. Ich putzte mir die Zähne, schaltete das Licht aus und verließ das Bad.
Bevor ich ins Bett kroch, tapste ich noch einmal durch Wohnzimmer und Küche. Die Fliesen waren kühl unter meinen nackten Füßen. Ich entdeckte den Wohnungsschlüssel, den mir Mom auf die Arbeitsfläche gelegt hatte, und nahm mir vor, ihn bald an meinem Schlüsselring zu befestigen.
Neben der Kücheninsel befand sich ein bodentiefes Fenster mit Türklinke. Jede Wohnung besaß eine Terrassentür nach draußen, die auf die schmale Veranda führte, von der eine Treppe nach unten in den Garten ging.
Ich hielt vor der Tür an und überzeugte mich davon, dass sie verschlossen war. Obwohl ich mich dabei total neurotisch fühlte, drückte ich die Klinke herunter, um auf Nummer sicher zu gehen. Zu. Definitiv. Beruhigt ging ich ins Bett, zog mir die warme Decke bis zum Kinn und … starrte an die dunkle Decke. Erschöpft von der langen Fahrt, meinem inneren Aufruhr und dem endlosen Schrankeinräumen, gelang es mir trotzdem nicht, die Augen zu schließen.
Es dauerte lange, bis ich einschlief. So war es seit … na ja, seitdem ich neunzehn Jahre alt war. Seitdem Schlaf zu einem Zustand geworden war, in dem ich nicht sah, was auf mich zukam, und in dem ich mich nicht schützen konnte. Sechs Tage lang war Schlaf etwas gewesen, was ich mit jeder Zelle meines Körpers bekämpft hatte – bevor ich schließlich versagt und es sofort bereut hatte.
Irgendwann nickte ich ein, und als es so weit war, passierte das, was immer passierte …
Er drückt seine Stirn gegen meine, und ich weiß, dass er nicht bereit ist, mich loszulassen – das ist er nie und das mag ich an ihm. Ich liebe es sogar.
»Du musst wieder reingehen«, erkläre ich und nehme meine Hände von seiner Brust. »Du musst noch eine Menge lernen.«
»Ja«, murmelt er, doch er geht nicht. Seine Lippen gleiten über meine Wange, um dann mit absoluter Zielsicherheit meine Lippen zu finden. Er küsst mich sanft, zieht den Kuss in die Länge, bis ich kurz davor bin, ihn zu bitten, seine Lerngruppe sausen zu lassen. Doch dann tritt er zurück und hebt meinen Rucksack hoch. Er schiebt ihn mir auf die Schulter und zieht ein paar verirrte Haarsträhnen unter dem Riemen heraus. »Rufst du mich später an?«
Später wäre sehr spät, doch ich stimme zu.
»Pass auf dich auf«, sagt er.
Ich lächele, weil er derjenige ist, der den gefährlichen Job macht, wenn er nicht gerade Kurse besucht.
»Du auch auf dich.«
Ich winke ihm einmal zu und wende mich ab – denn wenn ich es jetzt nicht tue, wird er es auch nicht tun, und dann stehen wir die ganze Nacht knutschend vor der Unibibliothek.
Ich habe die Rasenfläche halb überquert, als er mir hinterherruft: »Ruf mich an, Süße! Ich werde warten.«
Lächelnd winke ich ihm noch einmal zu und eile über das Grün, bevor ich den Weg hinter dem Institut erreiche, der zum Parkplatz führt. Es ist spät, die Sonne ist bereits untergegangen und dicke Wolken verbergen die Sterne. Der Parkplatz ist schlecht beleuchtet, weil drei der fünf hohen Lampen ausgefallen sind und das College offenbar noch nicht dazu gekommen ist, die Birnen auszutauschen. Es stehen nur wenige Autos auf dem Parkplatz.
Ich gehe eine kleine Treppe nach unten und entdecke mein Auto. Meine Schritte werden langsamer, als ich auf den gesprungenen Asphalt trete. Ein dunkler Lieferwagen steht neben der Fahrerseite meines VW. Vorhin war er noch nicht da. Ein kalter Schauder läuft mir über den Rücken.
Ich beiße mir auf die Lippe, als ich näher komme. Mit zusammengekniffenen Augen spähe ich ins Innere des Lieferwagens. Ich kann vorn niemanden entdecken. Eine schreckliche Vorstellung ergreift von mir Besitz. Was, wenn sich jemand im hinteren Teil versteckt? Sofort verdränge ich diesen Gedanken. Nach allem, was in letzter Zeit mit dem Bräutigam vor sich gegangen ist, bin ich etwas paranoid. Das ist einfach nur ein Lieferwagen. Aber alle sind nervös.
»Sei nicht bescheuert«, ermahne ich mich selbst, als ich zwischen den Lieferwagen und mein Auto trete. Ich halte neben der Wagentür an, ziehe den Rucksack nach vorn und öffne die Vordertasche, um darin nach meinem Schlüssel zu graben.
Und da höre ich es. Das leise Kratzen von Metall auf Metall – das Geräusch einer Tür, die hinter mir geöffnet wird. Plötzlich ist es, als würde alles in Zeitlupe stattfinden. Meine Finger berühren den Schlüssel, als ich mich zur Seite drehe. Ein seltsamer Geruch umhüllt mich. Ich öffne den Mund, um einzuatmen, doch ich habe meinen letzten Atemzug in Freiheit getan, ohne es zu wissen. Eine grobe Hand umschließt meinen Hals. Angst erfüllt mich, als ich nach hinten gezerrt werde. Ein weiterer Arm schlingt sich um meine Taille, hält meinen rechten Arm fest. Der seltsam bittere Geruch ist überall, dringt in meine Nase und meinen Hals. Ich öffne den Mund, um zu schreien, als sich mein Herz in der Brust verkrampft. Ich hebe die Beine an, um mich zu wehren, zu treten, wegzurennen, doch es ist zu spät.
Es ist zu spät.
»Kämpf nicht gegen mich«, flüstert er mir ins Ohr. »Streite dich niemals mit mir.«
Keuchend schoss ich im Bett nach oben, saugte in tiefen Atemzügen Luft in meine Lunge, während mein Blick durch den dunklen und mir immer noch unbekannten Raum hetzte. Mein Herz raste so heftig, dass mir leicht übel wurde. Für einen Moment erkannte ich nicht, wo ich mich befand. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, dass ich in meiner Wohnung war, zurück in Berkeley County, über der Scharlachroten Dirne.
»Nur ein Albtraum«, flüsterte ich und zwang mich, mich wieder hinzulegen. »Das ist alles.«
Albträume waren eine häufige Spätfolge von Traumata; zumindest hatte mir das meine Therapeutin erzählt. Wahrscheinlich würden mich die Bilder für den Rest meines Lebens plagen – weil mein Unterbewusstsein nach wie vor versuchte, die schrecklichen Geschehnisse zu verarbeiten. Ich hatte diese Träume mindestens dreimal die Woche, aber es war wirklich ewig her, seitdem ich im Schlaf diese Nacht gesehen hatte.
Auf keinen Fall konnte ich wieder einschlafen, das wusste ich, also starrte ich einfach an die Decke. Die Stunden vergingen, bis das Licht der aufgehenden Sonne durch das kleine Fenster gegenüber drang. Und endlich war der Albtraum nur noch das, was er war: ein schlechter Traum.
Ich bezweifelte, dass ich es vor Mom nach unten schaffen würde, als ich kurz duschte, mir die Haare so gut wie möglich trocknete und dann zu einem Knoten band. Ich schnappte mir einen lockeren schwarzen Pulli – da der Januar hier um einiges kälter war als in Atlanta – und kombinierte ihn mit einem Paar karierter Leggins, das meinen Schenkeln nicht unbedingt schmeichelte, aber unglaublich bequem war.
Ich schlug mir eine Hand vor den Mund, um ein heftiges Gähnen zu unterdrücken, lief wieder ins Bad und hielt abrupt an. Stirnrunzelnd sah ich mich um. »Mist«, murmelte ich, als mir klar wurde, dass ich mein Kosmetiktäschchen in der Tragetasche in meinem Auto vergessen hatte.
Verdammt.
Ich drehte mich um und wanderte zu der Bank am Fußende des Bettes. Darunter standen meine Flipflops. Ich schlüpfte hinein, obwohl ich wusste, dass Mom die Wahl meiner Schuhe missbilligen würde. Doch das war eine Gewohnheit, die ich einfach nicht loswurde – selbst wenn es schneite. Ich schnappte mir den Schlüsselring aus der Handtasche und griff nach dem Wohnungsschlüssel.
Ich nahm die Tür zur Veranda, statt die Wohnung durch die richtige Eingangstür zu verlassen und die Haupt- oder die Dienstbotentreppe hinunterzusteigen. Ich zog die Schultern hoch, als die kalte Morgenluft die noch feuchten Strähnen in meinem Nacken in Bewegung versetzte. Die Flipflops klatschten den gesamten Weg die Treppe nach unten – eine Treppe, auf der ich mir wahrscheinlich irgendwann während des Winters das Steißbein brechen würde. Während ich die untere Veranda entlanglief, befestigte ich meinen Wohnungsschlüssel am Ring.
Mein Atem dampfte in der Luft, als ich das Haus umrundet hatte und quer über den Rasen ging. Das nasse Gras pikste seitlich in meine Füße. Ich erreichte den gepflasterten Weg und hielt direkt auf mein Auto zu, das ich vor dem Kutschenhaus geparkt hatte – dankbar, dass keiner unserer Gäste Frühaufsteher war. In Gedanken bei der Frage, ob mir wohl noch genug Zeit bleiben würde, Make-up aufzulegen, bevor ich Mom beim Frühstück half, hielt ich vor dem Wagen an.
Dann fiel mir die Kinnlade nach unten. »O mein Gott.«
Ich blinzelte, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich sah. Doch meine Augen funktionierten einwandfrei. Mein Magen hob sich, als ich einen Schritt auf mein Auto zumachte. Glas knirschte unter meinen Sohlen.
Glas, das an mein Auto gehörte, nicht auf den Boden.
Jedes Fenster meines Autos war eingeschlagen worden.
Jedes einzelne.
Kapitel 3
»Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Wir hatten noch nie einen Einbruch oder etwas Ähnliches.« Wut huschte über das Gesicht meiner Mutter und brachte ihre Wangen zum Brennen. »Das ist einfach unglaublich.«
Wir standen neben meinem Auto. Ich hatte es ins Kutschenhaus fahren wollen, damit die Gäste nichts mitbekamen, aber Mom wollte den Wagen nicht bewegen, bevor die Polizei ihn gesehen hatte. Außerdem lag auf den Sitzen Glas verteilt – überall eigentlich –, und sie wollte den restlichen Tag nicht damit verbringen, mir Scherben aus dem Hintern zu ziehen.
Meine Mutter hatte beschlossen abzuwarten, bis die Polizei eintraf, doch ich wollte das Frühstück fertig machen, damit die Gäste sich nicht ärgerten und schlechte Bewertungen im Internet hinterließen. Die schlechten Bewertungen würde es wahrscheinlich trotzdem geben, denn das Paar mit dem rothaarigen Kleinkind hatte mein Auto bereits gesehen und machte sich jetzt Sorgen um sein eigenes. Nicht, dass ich ihnen das hätte übel nehmen können. Aber irgendwie kam es mir seltsam vor, dass nur mein Wagen demoliert worden war und keines der drei anderen, viel schickeren Autos.
Wie der Lexus, der dem Paar gehörte.
Denn ehrlich, wenn man schon einen Wagen aufbrechen wollte, warum in aller Welt sollte man sich für einen Honda Accord entscheiden statt für einen Lexus und einen Cadillac?
Die Verbrecher in Berkeley County mussten dringend ihre Prioritäten überdenken.
»Mom …« Ich schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich war mir sicher, dass wir nicht lange würden warten müssen, bis die Cops eintrafen. Die Polizeistation lag am Ende der Straße. Also wirklich am Ende dieser Straße. »Es tut mir leid. Die Gäste sollten das wirklich nicht sehen und sich Sorgen um ihre Autos machen …«
»Wieso in aller Welt entschuldigst du dich?« Stirnrunzelnd legte mir Mom eine Hand auf die Schulter. »Das ist nicht deine Schuld. Außer, du bist mitten in der Nacht aufgestanden und hast auf dein Auto eingeschlagen. Falls ja, müssen wir uns mal unterhalten.«
Diese Aussage brachte mich trotz allem zum Lächeln. »Ich war es nicht«, antwortete ich trocken. »Aber ich wünsche mir wirklich, ich hätte daran gedacht, den Wagen ins Kutschenhaus zu fahren.«
»Wieso hättest du das tun sollen?« Sie legte ihren Arm um meine Schulter. »Wir haben hier eigentlich keine Probleme mit Diebstählen und Vandalismus. In anderen Vierteln der Stadt gibt es das, sicher, aber so etwas ist hier noch nie passiert.«
Irgendwie passte es, dass ausgerechnet in meiner ersten Nacht zu Hause irgendein Idiot mein Auto zerdepperte.
Ich löste mich von meiner Mutter, dann strich ich mir eine Strähne hinters Ohr. Ein Teil von mir wollte sich einen der Steine am Rande des Weges schnappen und aus reinem Frust gegen mein Auto schmeißen. Ich war versichert, das schon, doch eigentlich hatte ich mich heute nicht mit so etwas beschäftigen wollen.
Und es war gut, dass ich nicht mit Steinen warf, denn in diesem Moment entdeckte ich den blau-weißen Streifenwagen in der Einfahrt. Hätte wahrscheinlich keinen guten Eindruck gemacht, vor einem Polizisten Steine gegen mein Auto zu werfen.
»Ich hoffe, der Beamte ist schnuckelig«, meinte Mom.
Ich wirbelte herum und starrte sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Was?«
Grinsend strich sie sich die Haare glatt. »Ich liebe Männer in Uniform.«
»Mom!« Ich riss die Augen auf.
»Und wenn ich mich richtig erinnere, hattest auch du eine Schwäche für die Jungs in Blau«, fuhr sie fort, als sie die Strickjacke vor dem Körper zusammenzog.
Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf. O mein Gott, hat Mom das wirklich gerade gesagt?
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und beäugte den Streifenwagen, der in diesem Moment hinter meinem Auto anhielt. »Also entwickelst du vielleicht auch eine Schwäche für Polizisten …«
Konnte ich einfach tot umfallen? Bitte?
»Hey, ich darf doch wohl hoffen, oder?«, fuhr sie fort. »Ich würde dich so gern glücklich verheiratet sehen, bevor ich die Radieschen von unten betrachte.«
Meine Wangen fingen an zu brennen, als ich Mom entgeistert anstarrte. War sie besoffen?
»Oh.« Sie klang enttäuscht, während sie den Cop musterte, der gerade aus dem Wagen stieg. »Er ist sehr attraktiv, aber ein bisschen jung. Na ja, ich nehme an, du könntest auch mit einem jüngeren Mann ausgehen. Das ist gerade hip, oder? Er …«
»Mom«, zischte ich, die Augen drohend zusammengekniffen.
Sie sah mich mit einem unschuldigen Gesichtsausdruck an. Ich atmete tief durch, drehte mich um und erblickte den Polizeibeamten. Und wieder fiel mir die Kinnlade nach unten.
Auch der Beamte wirkte für einen Moment überrascht, als er sich näherte. Seine Schritte wurden langsamer. Mein Herz verkrampfte sich. Dieser Polizist … Er ähnelte so sehr dem Jungen aus dem Wirtschaftskurs – dem Kerl, auf den meine Mom vor ein paar Sekunden noch angespielt hatte.
Er konnte es nicht sein, aber …
Die Ähnlichkeit war unheimlich.
Dasselbe hellbraune Haar, ausrasiert an den Seiten und oben etwas länger. Breite Schultern – türrahmensprengend, um genau zu sein. Ich wusste instinktiv, dass sich unter der dunkelblauen Uniform und der Schutzweste eine durchtrainierte Brust versteckte. Es war derselbe Körperbau, bis hin zu der schmalen Hüfte und den muskulösen Schenkeln.
Doch die Ähnlichkeit ging über das rein Körperliche hinaus. Diese Augen – o mein Gott –, diese fahlblauen Augen wirkten wie Geister aus der Vergangenheit und das kantige Kinn war nur ein wenig sanfter als früher.
Er ähnelte so sehr Cole Landis.
Mein Herz raste. Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück. Fast hätte ich es nicht geschafft – hätte ihn nicht ansehen können. Denn alles, was ich sah, war Cole.
Doch das war er nicht. Dieser Polizist war zu jung. Cole war zwei Jahre älter gewesen als ich, als wir uns gegen Ende meines ersten Collegejahres getroffen hatten. Er musste inzwischen zweiunddreißig sein – und dieser Kerl wirkte kaum älter als fünfundzwanzig.
Der Polizeibeamte warf einen Blick auf mein Auto, als er daran vorbeiging. »Mrs Keeton?«
»Das wäre wohl ich.« Mom trat vor und lächelte. »Ich war diejenige, die heute Morgen angerufen hat. Aber das Auto gehört meiner Tochter Sasha.«
Auf dem attraktiven Gesicht des Beamten erschien ein Ausdruck der Freude. »Sasha Keeton?«
Ich erstarrte, als der Groschen bei mir fiel. Jetzt verstand ich auch seine überraschte Miene. Obwohl dieser Beamte noch in der Highschool gewesen sein musste, als all das passiert war, wusste jeder, der damals in der Stadt gelebt hatte, wer ich war.
Denn ich war die Eine – die Einzige, die entkommen war.
Panik loderte in mir auf und drohte mich zu überwältigen. Galle stieg mir in die Kehle. Ich sah die Schlagzeilen vor mir. Die überlebende Braut. Die Frau, die den Bräutigam zu Fall gebracht hat.
Ein Gedanke geisterte durch meinen Kopf: Ich hätte nicht zurückkommen sollen.
Doch mein Verstand schaltete sich ein. Statt herumzuwirbeln und mich in meinem Zimmer zu verbarrikadieren, atmete ich tief durch, wie meine Therapeutin es so oft mit mir geübt hatte. Ich drängte die Panik zurück und schob das Kinn vor. Ich würde nicht fliehen. Ich hatte nichts zu verbergen. Nicht, nachdem ich zehn Jahre damit verbracht hatte, mich zu verstecken, und deswegen so viel Zeit mit meiner Mom verpasst hatte.
Ich konnte es schaffen.
Mit jeder Sekunde ließ die Panik ein wenig nach und meine zugeschnürte Kehle wurde freier, sodass ich wieder sprechen konnte.
»Ich nehme an, Sie wissen, wer ich bin. Also befinde ich mich im Nachteil, da ich nicht weiß, wer Sie sind.«
Der Beamte öffnete den Mund, dann schloss er ihn wieder. Ein Augenblick verging. »Ich bin Officer Derek Bradshaw«, sagte er schließlich und sah nach rechts. »Und ich wette, dass Sie das Ihrem Auto nicht selbst angetan haben.«
Ein Teil der Anspannung verließ meinen Körper, als ich den Kopf schüttelte. »Nein. Irgendwie mochte ich die Fenster in meinem Auto.«
»Verständlich.« Er drehte sich leicht, um einen Notizblock aus der hinteren Hosentasche zu ziehen.
Die Tür der Pension schwang auf. Mr Adams trat auf die Veranda, der Mann des älteren Ehepaares. »Mrs Keeton? Tut mir leid sie zu stören, aber der Fernseher in unserem Zimmer funktioniert nicht. Wir haben versucht, an der Rezeption anzurufen, aber niemand hat abgehoben.«
»Ich komme sofort!«, rief Mom, bevor sie sich wieder mir zuwandte. »Tut mir leid, aber darum muss ich mich kümmern.« Sie hielt inne, um Officer Bradshaw zuzuzwinkern. »Auch wenn das Kabel wahrscheinlich einfach nicht eingesteckt ist«, fügte sie leise hinzu.
Officer Bradshaw lachte leise und wieder spürte ich einen kurzen Moment der Vertrautheit. Er lachte wie Cole. Ein tiefes, sexy Geräusch.
»Das ist okay«, meinte er.
Ich hatte das Gefühl, Gott für diese Unterbrechung danken zu müssen. Ich winkte meiner Mom kurz hinterher, während sie davoneilte, dann konzentrierte ich mich wieder auf den Officer.
Er hatte sich vorgebeugt, um in den Wagen zu spähen. »Haben Sie bemerkt, dass etwas gestohlen wurde, Miss Keeton?« Er drehte den Kopf. »›Miss‹ ist doch richtig, oder?«
Ich nickte. »Nicht verheiratet.«
»Interessant«, murmelte er.
Meine Augenbrauen schossen nach oben. Interessant? Nichts an dieser Information war auch nur ansatzweise interessant. Ich trat näher an den Wagen heran.
»Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht nachgesehen. Ich habe ihn heute Morgen so vorgefunden – oh!« Mir fiel wieder ein, warum ich nach draußen gekommen war, und eilte um das Auto herum. »Ich habe gestern eine Tragetasche im Auto gelassen und wollte sie heute Morgen holen. Da ist mir aufgefallen, dass die Fenster eingeschlagen worden sind.« Ich beugte mich vor und schaute ins Auto. Überraschung durchfuhr mich. »Sie ist noch drin! Meine Tasche. Offen auf dem Rücksitz. Die kann man eigentlich nicht übersehen.«
»Nein, kann man eigentlich nicht. Selbst im Dunkeln würde dieses Pink auffallen«, kommentierte Officer Bradshaw trocken, als er über meine Schulter spähte.
Ich hatte schon die Hand nach dem Türgriff ausgestreckt, hielt dann aber inne. »Darf ich die Tür öffnen?«
Er nickte. »Ich werde ehrlich zu Ihnen sein. Bei einem solchen Bagatelldelikt werden wir wahrscheinlich keine Fingerabdrücke nehmen, außer, es wurde etwas Wertvolles aus dem Wagen gestohlen.«
Seine Ehrlichkeit beleidigte mich nicht. Es war nur ein Auto und niemand war verletzt worden. Ich öffnete die Tür, beugte mich in den Innenraum und ergriff die Tragegurte des Beutels. Glasscherben fielen klirrend vom Sitz, als ich die Tasche aus dem Auto zog.
Während Officer Bradshaw um das Auto herumwanderte und es von allen Seiten betrachtete, öffnete ich die Tragetasche. Ich hoffte inständig, dass niemand mein Make-up gestohlen hatte. Wenn ich in die Drogerie fahren musste, um mich neu einzudecken, würde ich den Laden mit mindestens zweihundert Dollar weniger im Geldbeutel verlassen.
Ich biss mir auf die Unterlippe, als ich in die Tasche sah. »Was zur …?«
»Ja?« Officer Bradshaw richtete sich auf und sah mich über das Dach des Autos hinweg an.
»Mein Computer ist noch da. Zusammen mit meinem Make-up. Ich habe beides im Auto gelassen.« Wie betäubt berührte ich den Laptop, um mich zu überzeugen, dass er wirklich real war. Dann ließ ich meine Fingerspitzen über das Kosmetiktäschchen gleiten.
Officer Bradshaw kam wieder zu mir. »War noch etwas anderes im Auto?«
Kopfschüttelnd starrte ich in die Tasche. »Ich hatte ganz vergessen, dass er da drin war«, murmelte ich, bevor ich die Tasche sinken ließ. »Wieso sollte jemand mein Auto aufbrechen, ohne den Laptop zu stehlen? Das Kosmetiktäschchen verstehe ich ja, aber den Laptop?«
»Das ist in der Tat ziemlich ungewöhnlich.« Officer Bradshaw kritzelte etwas in sein kleines Notizbuch, als ein Rauschen aus seinem Funkgerät erklang. »Dürfte ein Zeichen dafür sein, dass jemand das Auto nicht aufbrechen wollte, um etwas zu stehlen.«
Ich hob eine Hand und wedelte damit in Richtung des Autos. »Ähm …«
»Wenn es Schäden gibt, ohne dass etwas gestohlen wurde – besonders Dinge von Wert –, handelt es sich gewöhnlich um Vandalismus.« Seine fahlen blauen Augen suchten meine. »Sie sind erst gestern angekommen, richtig?«
Wieder hob sich mein Magen ein wenig. »Ja.«
»Und sie waren zehn Jahre lang weg?«
Meine Muskeln verkrampften sich. »Ja. Ungefähr.«
»Wusste jemand, dass Sie in die Stadt zurückkehren wollen?«, fragte er, ohne den Blick abzuwenden, während eine Frauenstimme aus dem Funkgerät an seiner Brust erklang. »Abgesehen von Ihrer Mutter natürlich.«
Ich runzelte die Stirn und schüttelte langsam den Kopf. »Ich … nur meine Freundin Miranda – ähm, Miranda Locke. Ich glaube nicht, dass sie jemandem davon erzählt hat.« Ich kaute auf der Unterlippe herum und drückte mir die Tragetasche gegen die Brust. »Meine Mom dürfte es den Angestellten gesagt haben.«
Mit einem Nicken notierte er meine Aussage in seinem Notizbuch, dann schloss er es und schob es in eine Brusttasche, gefolgt von seinem Stift. »Ist es möglich, dass jemand Ihr Auto beschädigen wollte?«
Mir blieb der Mund offen stehen. »Absichtlich?« Das klang dämlich. Natürlich meinte er absichtlich. »Ich meine, Sie wollen damit sagen, dass vielleicht jemand hierhergekommen ist und das meinetwegen getan hat?«