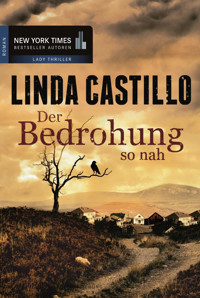9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Lügen, Korruption und tödliche Intrigen Der Anruf von Adam Lengacher, einem verwitweten amischen Familienvater, erreicht Kate Burkholder mitten in einem Schneesturm. Er habe eine halb erfrorene Frau auf seinem Grundstück gefunden, sie sei eine "Englische" und Kate solle sofort kommen. Kate erkennt die Frau sofort: Es ist Gina Colorosa, ihre Team-Partnerin von damals auf der Polizeiakademie in Columbus. Doch jetzt ist Gina auf der Flucht. Und das vor ihren eigenen Kollegen. Sie soll einen Kollegen ermordet haben. Doch Gina behauptet, diese Tat nicht begangen zu haben. Man wolle sie aus dem Weg räumen, weil sie kurz davor war, Unregelmäßigkeiten in ihrer Dienststelle aufzudecken. Je näher Kate der Wahrheit kommt, desto näher kommt den beiden Frauen auch der auf sie angesetzte Mörder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Linda Castillo
Dein ist die Lüge
Der neue Fall für Kate Burkholder
Thriller
Über dieses Buch
Lügen, Korruption und ein Netz falscher Anschuldigungen
Als Adam Lengacher, ein verwitweter amischer Familienvater, auf seiner Farm eine schwer verletzte Frau findet, bittet er Polizeichefin Kate Burkholder um Hilfe. Kate erkennt die Frau sofort: Sie heißt Gina Colorosa, vor 10 Jahren waren sie ein Team bei der Polizei in Columbus und beste Freundinnen. Doch jetzt ist Gina auf der Flucht. Ihre eigenen Kollegen wollen sie aus dem Weg räumen, weil sie ihnen auf die Schliche gekommen ist. Kate versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Doch je näher Kate der Wahrheit kommt, desto näher kommt den beiden Frauen auch der auf sie angesetzte Mörder.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-ONLINE-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986–1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies, Schwerpunkt Translations, ab. Die Übersetzerin lebt seit 1991 in Frankfurt am Main.
Inhalt
[Widmung]
[Anmerkung der Autorin]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Dank
Widmung
Mit jedem Buch lerne ich etwas Neues über die amische Kultur – über ihre Traditionen, ihre Religion, die Geschichte der Wiedertäufer – und die Herausforderungen, mit denen sie sich konfrontiert sieht. Und jedes Mal wächst meine Achtung und Bewunderung für sie. Dieses Buch widme ich all jenen Amischen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden, zu Mittag zu essen, oder die mich in ihr Haus eingeladen haben. Ich danke euch, dass ihr mir einen tieferen Einblick in euer Leben gewährt und mir so geholfen habt, eure Lebensweise besser zu verstehen.
Anmerkung der Autorin
Bei der Beschreibung der Strafverfolgungsbehörden in diesem Buch habe ich mir große literarische Freiheiten genommen. Deshalb möchte ich betonen, dass die Columbus Division of Police eine erstklassige Polizeibehörde mit großartigen Profis ist – jeder Einzelne macht einen sehr guten Job. Um die Geschichte schlüssig erzählen zu können, habe ich sie großzügig ausgeschmückt. Alle Darstellungen krimineller Handlungen von Polizisten sind fiktional, und alle Verfahrensfehler habe ich zu verantworten.
Prolog
Sie hatte gewusst, dass sie irgendwann kommen würden. Dass es mitten in der Nacht passieren würde, überfallartig und brutal. Sie wusste aber auch, dass sie trotz all des Trainings, trotz mentaler und körperlicher Vorbereitung, in dem Moment nicht darauf gefasst wäre.
Etwas hatte sie geweckt. Ein kaum hörbares Geräusch – das Klicken einer behutsam geschlossenen Autotür, das Knirschen von Schritten im Schnee oder das Kratzen von Schuhsohlen auf Steinstufen. Vielleicht war es auch eine Veränderung in der Luft, ähnlich der statischen Aufladung kurz vor einem Blitz.
Ihr Verstand begann zu arbeiten. Sie rollte sich aus dem Bett und hatte kaum die Füße auf den Boden gesetzt, als die Haustür donnernd aufflog. Mit einem Griff zum Nachttisch hatte sie die Sig Sauer P320 Nitron in der Hand, eine lebensrettende Kugel im Lauf und siebzehn im Magazin. Dutzende Füße trampelten übers Wohnzimmerparkett.
Stimmengewirr, dann: »Polizei! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Sofort!«
Mit zwei Schritten war sie an der Schlafzimmertür, schlug sie zu und schob den Riegel vor. Sie wirbelte herum, riss die Jacke vom Stuhl, fuhr mit einem Arm in den Ärmel und hob ihn schützend vor den Kopf, sprintete zum Fenster und hechtete kopfüber hindurch. Glas splitterte und Holz krachte, begleitet vom Schmerz rasiermesserscharfer Schnitte.
Sie knallte mit der Schulter auf den Boden, rang um Luft, überall war Schnee, im Gesicht, im Kragen, im Mund. Spuckend rappelte sie sich hoch und lief geduckt los, alle Sinne auf ihre Umgebung konzentriert. Sie steuerte auf die Hecke am Maschendrahtzaun zu, folgte DEM PLAN, den sie in den letzten Tagen Tausende Male durchgespielt hatte. Aus dem sternenlosen Himmel fiel Schnee. Beim Blick zurück sah sie parkende Autos an der Straße, ohne Licht. Das war typisch für unangekündigte Hausdurchsuchungen. Oder irrte sie sich vielleicht?
Sie hatte fast den Weg hinter ihrem Grundstück erreicht, als zehn Meter vor ihr aus dem Hof nebenan eine Gestalt auftauchte und mit klirrendem Equipment in ihre Richtung lief. »Halt! Polizei! Stehen bleiben!«
Sekundenschnell registrierte sie die Details: Mann, groß, schwarz gekleidet; Jacke mit POLIZEI-Aufdruck, Beretta Kaliber 9 mm im Anschlag.
»Hände hoch! Runter auf den Boden!« Seine Waffe war auf sie gerichtet, und er fuchtelte mit der linken Hand: »Runter! Auf den Boden! Sofort!«
Sie hob die Sig – und erkannte, dass es der Neuling war, ein junger, guter Kerl. Sie murmelte seinen Namen, spürte, dass die Entscheidung, die sie jetzt treffen würde, ihr schwer zu schaffen machte. »Tu’s nicht«, flüsterte sie.
Sein Mündungsfeuer blitzte auf. Die Kugel traf ihre Schulter, hart wie der Schlag eines Baseballschlägers, und sie wurde herumgewirbelt. Wie ein glühender Schürhaken wütete der Schmerz zwischen Schlüsselbein und Bizeps, und mit einem animalischen Stöhnen sank sie aufs Knie.
Steh auf. Steh auf. Steh auf.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er einen Schritt zurück trat und die Waffe sinken ließ. Jetzt stand er reglos da und sah sie einen Moment zu lange an. »Waffe fallen lassen! Runter auf den Boden. Herrgott nochmal, es ist vorbei!« Dann schrie er in sein Ansteckmikro.
Sie raffte sich auf, rannte das letzte Stück bis zur Hecke, und trotz des schlimmen Schmerzes im ganzen Körper schienen ihre Füße kaum den Boden zu berühren. Als sie den Drahtzaun übersprang, setzte donnernder Kugelhagel ein, und sie rechnete die ganze Zeit damit, dass eine Kugel sie im Rücken traf.
Dann erreichte sie den Weg. Keine Polizeilichter, alles war ruhig. Von Adrenalin getrieben, sprintete sie über den schmalen Streifen Asphalt, überwand den Zaun zum Nachbargrundstück und rannte zur Garagentür. Sie drehte am Knauf, stieß die Tür auf und stürzte hinein, schlug sie hinter sich zu. Schwer atmend lief sie zum Pick-up, riss die Tür auf und schob sich auf den Sitz, ignorierte die Schmerzen in der Schulter und die Befürchtung, dass sie schwer verwundet war – und auch die kleine Stimme, die flüsterte, dass DER PLAN scheitern würde.
Mit zitternder Hand zog sie den Schlüssel hervor, stieß ihn ins Zündschloss, ließ den Motor an, legte den Rückwärtsgang ein und trat aufs Gaspedal. Der Pick-up machte einen Satz nach hinten, gefolgt von einem explosionsartigen Schlag, als er mit Stoßstange und Ladefläche das Metalltor aus der Führung rammte, auf den Weg schleuderte und mit den Hinterrädern überrollte.
Sie riss das Lenkrad herum, rote Lichter tauchten im Rückspiegel auf, sie drehte sich nach hinten und feuerte sechs Kugeln durchs Rückfenster. Tausende feine Risse durchzogen das Glas, der Geruch von Schießpulver hing in der Luft, und in ihren Ohren klingelten die Schüsse. Sie rammte den Gang ein und trat aufs Gas, fuhr ohne Licht und schnell, zu schnell, fegte eine Mülltonne um und übersteuerte so stark, dass der Wagen heftig schlingerte und sie um ein Haar die Gewalt darüber verloren hätte. Doch sie brachte ihn gerade noch rechtzeitig unter Kontrolle und schaffte es im letzten Moment, abzubiegen. Auf der Straße jagte sie den Tacho auf einhundertdreißig km/h hoch, überfuhr das Halteschild an der Ecke und raste weiter.
Ein paar Sekunden lang war sie ein Tier auf der Flucht, panisch, gejagt von einer Bestie, die Blut gerochen hatte. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie hörte nichts weiter als ihren keuchenden Atem und die Panik, die durch ihre Adern rauschte. Das Wissen, dass es kein Zurück gab, ließ sie am ganzen Körper erzittern, ihr Verstand hatte ausgesetzt und war der Sorge gewichen, die Schwere ihrer Verletzung nicht einschätzen zu können. Denn sie wusste, es war noch nicht vorbei – der Albtraum, den sie seit Wochen hatte kommen sehen, nahm gerade erst seinen Lauf.
In der James Road rammte sie einen Bordstein, drosselte das Tempo auf etwas über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, zwang sich zur Ruhe und heftete den Blick weiter in den Rückspiegel. Keiner wusste von dem Pick-up. Sie musste bloß ruhig bleiben und schnellstens raus aus der Stadt. Als sie die Idee dazu gehabt hatte, schien ihr das ein guter Plan.
Als das Adrenalin sank, stieg der Schmerz. Ihre Schulter pochte im Rhythmus ihres Herzschlags, und sie warf einen Blick darauf: Das Blut hatte ihr Shirt durchtränkt, ihre Jacke – noch immer nur halb angezogen –, und tropfte unablässig neben ihrer Hüfte auf den Sitz. Das viele Blut machte ihr Angst, denn auch, wenn nichts gebrochen war – sie konnte den Arm noch bewegen –, könnte die Verletzung schwer und möglicherweise lebensbedrohlich sein, wenn sie kein Krankenhaus aufsuchte. Aber sie wusste, dass jedes Krankenhaus gesetzlich verpflichtet war, Schussverletzungen der Polizei zu melden. Im Moment blieb ihr keine andere Wahl als weiterzufahren.
Nach einem Blick in den Rückspiegel bog sie rechts ab in die Broad Street und fuhr weiter Richtung Osten, betete, dass ihr kein Polizeiauto begegnete. Selbst wenn sie ihr Kennzeichen nicht kannten und auch keine Beschreibung ihres Fahrzeugs hatten, würde es schwer werden, für die Schusslöcher im Rückfenster und das viele Blut eine plausible Erklärung zu liefern.
Als sie den Stadtrand von Columbus erreichte, schneite es heftig. Auch der Wind hatte zugenommen und fegte die Schneeflocken von der Seite her über die Straße. Es würde nicht lange dauern, bis der Schnee liegen blieb, und obwohl sie rutschige Straßen nicht mochte, und wegen der verletzten Schulter schon gar nicht, kämen sie ihr in diesem Fall vielleicht sogar zugute. Denn wenn sich die Highway-Patrol um Autounfälle kümmern musste, hatte sie weniger Zeit, sie zu suchen. Zudem würden deren Polizisten – im Gegensatz zu den anderen, die ebenfalls hinter ihr her waren – ihr keine Handschellen anlegen, sie nicht in ein Kornfeld zerren und ihr eine Kugel in den Kopf jagen. Sie brauchte Hilfe, doch wem konnte sie vertrauen?
Zweimal hatte sie ihr Handy genommen, um jemanden anzurufen, und zweimal hatte sie es zurück in die Konsole gelegt, weil ihr niemand einfiel. Die Erkenntnis, dass sie fünfunddreißig Jahre alt war und in ihrem ganzen Leben kaum enge Freundschaften gepflegt hatte und es niemanden gab, den sie um Hilfe bitten konnte, machte sie unendlich traurig.
Immerhin hatte, allen Widrigkeiten zum Trotz, DER PLAN funktioniert: Sie hatte es aus dem Haus und in ihr Auto geschafft. Aber wie absurd war es, sich kein Ziel zu überlegen? Hatte sie etwa geglaubt, gar nicht lange genug zu überleben, um eins zu brauchen?
Sie fuhr auf der Broad Street vorbei an Reynoldsburg und durch die Gegend um Pataskala, dann bog sie nach Norden auf eine weniger befahrene Landstraße ab. Als sie die Peripherie von Newark, Ohio, erreichte, schneite es so stark, dass die Sicht immer schlechter wurde. Auch ihr Arm blutete unvermindert weiter, und mit jeder Meile wuchs die widerliche Lache auf ihrem Sitz. Die Wunde pochte zwar nicht, und das Blut spritzte auch nicht heraus, so dass vermutlich keine Gefäße lebensgefährlich verletzt waren, doch wegen des Schmerzes und Schocks war ihr übel und schwindlig.
Als sie schließlich die Ohio State Route 16 in Richtung Osten erreichte, raste ihr Herz, sie fror in ihrer Jacke, und die Hände am Lenkrad waren nass und zitterten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, konnte sie jetzt kaum mehr als ein paar Meter weit sehen und kam zermürbend langsam voran. Drei Stunden waren seit der Flucht aus ihrem Haus verstrichen. Anfangs war sie gut vorangekommen und hatte über fünfzig Meilen Abstand zu ihren Verfolgern gewonnen. In der letzten Stunde hatten sich die Straßenverhältnisse allerdings dramatisch verschlechtert, wohl der Grund dafür, dass ihr nur noch zwei Autofahrer und ein einziger Schneepflug begegnet waren. Die Fahrbahn war nicht mehr zu sehen, und sie musste sich an Briefkästen, Zäunen, Bäumen und Telefonmasten orientieren, um nicht von der Straße abzukommen.
Schließlich passierte sie die Grenze zu Holmes County, und erst in dem Moment fiel ihr ihre alte Freundin ein. Viele Jahre waren vergangen, seit sie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten. Damals war etwas passiert, was ihre Beziehung sehr belastet – und wohl auch Narben hinterlassen – hatte. Aber wenn es auf der Welt überhaupt noch jemanden gab, dem sie vertrauen konnte, dann Kate …
Als bald darauf das Schneegestöber noch stärker wurde, konnte sie nicht mal mehr die Leitungsmasten sehen. Bis hierher schienen die Schneeräumfahrzeuge nicht gekommen zu sein, denn der Schnee lag bestimmt schon fünfzehn Zentimeter hoch, und es gab keine einzige Reifenspur. Sie sah so gut wie nichts, fuhr nur noch Schritttempo und versuchte mit zusammengekniffenen Augen, die Fahrbahn auszumachen. Wäre das alles nicht so schlimm gewesen, sie wäre angesichts der Ironie ihrer Situation in hysterisches Gelächter ausgebrochen. Und genau so würde man sie dann finden – blutverschmiert das Lenkrad umklammernd und hysterisch lachend wie eine Hyäne.
Ihr Pick-up hatte keinen Allradantrieb, aber die Reifen waren gut und den Anforderungen gewachsen. Der Tank war voll gewesen und noch immer halb voll. Das würde reichen, um da hinzukommen, wo sie hinwollte. Im Prinzip musste sie jetzt nur aufpassen, dass sie nicht von der Straße abkam oder stecken blieb.
Sie überquerte eine schmale Brücke und griff gerade nach unten, um die Scheibenheizung höher zu stellen, als wie aus dem Nichts ein Baum auftauchte, ein schwarzes Ungeheuer, das wie eine Erscheinung aus dem Schneegestöber auf sie zugerast kam. Sie riss das Steuer nach rechts, aber das war die falsche Richtung, und sie landete in einem Graben. Blech schepperte, die Frontschürze wurde eingedrückt, und die Kühlerhaube flog auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie hart in den Sicherheitsgurt geschleudert, wonach ihre Schulter noch mehr schmerzte, dann knallte der Airbag so fest gegen ihre Brust, dass sie wie betäubt war.
Fluchend drückte sie den Airbag zur Seite, zuckte zusammen, als sie dabei an ihre Schulter stieß. Der Pick-up hing mit der Schnauze im Graben, der Motor war ausgegangen, und die Scheinwerfer illuminierten den Dampf, der wie aus einem Geysir in die Luft schoss.
Sie riss sich, so gut es ging, zusammen, holte tief Luft und schob den Schalthebel auf Parken. Wenn sie es schaffte, den Wagen zurückzusetzen, konnte sie vielleicht die Kühlerhaube festbinden und weiterfahren. Sie drehte den Zündschlüssel um.
Nichts.
»Mach schon«, flüsterte sie. »Komm schon, mach.«
Sie wartete einen Moment und versuchte es wieder, trat diesmal aufs Gas, aber der Wagen weigerte sich anzuspringen.
Sie schloss die Augen und legte die Stirn aufs Lenkrad. »Schicksal, du bist ein mieser Dreckskerl.«
Die hochstehende Kühlerhaube wurde von einer Windbö erfasst und flatterte vor und zurück. Sie zog ihr Handy hervor und checkte den Akku: genug Saft, aber kein Netz …
Das Lachen, das aus ihrem Mund kam, klang in der Stille des Wageninneren wie der Schrei einer Verrückten.
Sie hatte zwei Optionen: Sie konnte den relativen Schutz ihres Autos verlassen und Hilfe suchen, vielleicht einen Farmer mit einem Traktor, der ihren Pick-up aus dem Graben zog. Oder sie blieb im Wagen sitzen, wartete ein paar Stunden bis zum Sonnenaufgang und hoffte, dass jemand vorbeikam –, wobei das dann womöglich der hiesige Sheriff war, der sehr wahrscheinlich eine Menge Fragen stellen würde, die sie keine Lust hatte zu beantworten.
Was ihr die Entscheidung erleichterte.
Sie öffnete den Sicherheitsgurt, stieß die Tür auf und trat in das Schneetreiben hinaus.
1. Kapitel
Der Pferdeschlitten war alt. Er stammte noch von seinen Großeltern, die ihn seinem Datt vermacht hatten, der ihn wiederum vor neun Jahren ihm zur Hochzeit geschenkt hatte. Seither wurde er so ziemlich für alles benutzt, zum Transport des Heus, der Milchkannen, der Eimer mit Ahornsirup und auch des kranken Kälbchens, das im Frühling vor zwei Jahren von seiner Mutter nicht angenommen worden war. Letzten Herbst waren die Kufen erneuert worden, was Adam eine Stange Geld gekostet hatte, und Weihnachten vor drei Jahren war eine Deichsel gebrochen, woraufhin er gleich beide ersetzen ließ. Zwar musste noch immer einiges in Ordnung gebracht werden – der Sitz zum Beispiel –, aber um mit den Kindern eine Spazierfahrt zu machen, reichte es allemal, besonders da das Wetter bald umschlagen würde.
Als Adam Lengacher im Stall Big Jimmy aus seiner Box führte, wollte er nicht daran denken, wie viel sich in den letzten beiden Jahren verändert hatte. Denn seit dem Tod seiner Frau, Leah, war nichts mehr wie zuvor. Ihr Leben hatte sich verändert, aber nicht zum Besseren. Es war, als ob das Herz des Hauses herausgerissen worden wäre und seine Bewohner jetzt alles täten, um diese leere Stelle mit etwas zu füllen, was eigentlich unmöglich war.
In den Tagen und Wochen danach waren er und die Kinder von ihren amischen Glaubensbrüdern umsorgt worden, in schweren Zeiten war das bei ihnen eine Selbstverständlichkeit. Noch heute brachten einige Frauen Töpfe mit Essen und im Sommer Gemüse aus ihren Gärten. Bischof Troyer nahm sich nach dem Gottesdienst immer ein paar Minuten extra Zeit für ihn, und einige der älteren Frauen hatten sogar schon versucht, ihn zu verkuppeln.
Bei diesem Gedanken schüttelte er den Kopf und lächelte. Das Leben ging weiter, dachte er, und so sollte es auch sein. Die Kinder kamen mit der neuen Situation zurecht, und Adam fand Trost in der Gewissheit, dass er, wenn die Zeit gekommen war, für immer und ewig mit Leah zusammen sein würde. Und doch fehlte sie ihm. Viel zu oft dachte er an sie, gab sich den Erinnerungen hin und wünschte, seine Kinder hätten noch ihre Mamm. Er sprach zwar nie darüber, aber es schmerzte ihn noch immer.
In der Stallgasse richtete er das alte Zugpferd vor dem Schlitten aus, hob die Deichsel an und führte das Tier rückwärts an den Pferdeschlitten heran. Er verschnallte gerade die Lederriemen, als sein Sohn Samuel in die Scheune gelaufen kam.
»Datt! Ich kann helfen.«
Ein Lächeln unterdrückend, richtete Adam sich auf, ging vorn um das Pferd herum und zog den Kehlriemen fest. Sein ältester Sohn war mit seinem quirligen Wesen und der Lust zu plaudern das Ebenbild seiner Mamm.
»Hast du deine Pancakes alle gegessen?«, fragte er.
»Ja.«
»Und alle Eier ins Haus gebracht?«
»Auch die braunen. Annie hat eins kaputt gemacht.«
Ein Wiehern aus dem Stall ließ sie wissen, dass ihr anderes Zugpferd, eine Stute namens Jenny, ihren Partner bereits vermisste.
»Du kriegst ihn bald wieder zurück, Jenny!«, rief Sammy in Richtung des Pferdes.
»Vo sinn die shveshtahs?«, fragte Adam. Wo sind deine Schwestern?
»Sie ziehen sich gerade den Mantel an. Lizzy sagt, ihr sind die Schuhe zu klein.«
Adam nickte. Was wusste er schon über Mädchen und ihre Schuhe? Rein gar nichts, und die Liste des Nichtwissens schien jeden Tag länger zu werden. »Dann führ du doch Big Jimmy aus der Scheune.«
Der Junge kreischte vor Freude, nahm den Lederriemen und sagte: »Kumma autseid, ald boo.« Komm, wir gehen raus, alter Junge.
Adam sah seinem Sohn und dem Pferd hinterher. Sammy war erst acht Jahre alt und versuchte bereits, ein Mann zu sein. Und das war auch das Einzige, wobei Adam helfen konnte, worin er gut war: seinen Sohn lehren, was es hieß, amisch zu sein, ein bescheidenes Leben im Dienste Gottes zu führen. Wohingegen ihm die Erziehung seiner beiden Töchter – Lizzie war fast sieben und Annie fünf Jahre alt – ein großes Rätsel war. Er hatte schlichtweg keine Ahnung, was er mit ihnen machen sollte.
Dabei gab es vieles, wofür er dankbar sein musste. Seine Kinder waren gesund und fröhlich und machten ihn glücklich. Die Arbeit auf der Farm sorgte für ausreichende Beschäftigung und gewährleistete ein respektables Leben. Genau wie Bischof Troyer in jener ersten schlimmen Woche gesagt hatte: Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, / Er hilft denen auf, die zerknirscht sind.
Adam hatte gerade das Scheunentor zugemacht, als seine Töchter mit wehender Kleidung den Gehweg entlanggelaufen kamen. Sie waren dick eingepackt mit Schal und Handschuhen, und schwarze Winterhauben wärmten ihre Köpfe. Heute Morgen konnten sie die Decke gut gebrauchen, die Leah gestrickt hatte, um sich warm zu halten.
»Samuel, hilft deinen Schwestern auf den Pferdeschlitten«, sagte Adam.
Während die Kinder aufstiegen, versuchte Adam, das Wetter einzuschätzen. Es hatte beinahe die ganze Nacht geschneit, und auch jetzt fielen die Flocken unvermindert weiter. Der Wind hatte eine Menge Tiefschnee an die Südseite der Scheune geweht, was kein Problem wäre, hätte der Wetterbericht nicht weitere heftige Schneefälle vorhergesagt. Zudem würde die Temperatur heute Nacht bis weit unter null fallen, und auch der Wind sollte zunehmen. Sein Nachbar, Mr Yoder, meinte sogar, ein Schneesturm sei im Anzug.
Als alle Kinder im Pferdeschlitten saßen – die Mädchen auf der hinteren Bank und Sammy neben ihm –, stieg Adam auf und nahm die Zügel in die Hand. »Kumma druff!«, sagte er zum Pferd. Los geht’s.
Big Jimmy war vielleicht ein wenig übergewichtig und hatte seine besten Jahre schon hinter sich, aber er liebte die Kälte und den Schnee und lebte heute Morgen so richtig auf. Mit erhobenem Kopf und Schwanz stapfte das Tier durch den Schnee, der ihm fast bis zu den Knien reichte, und nur wenige Minuten später glitt der Schlitten an der nördlichen Grundstücksgrenze am Zaun entlang.
»Guckt mal, wie Jimmy rennt«, rief Annie und zeigte aufs Pferd.
Der Anblick des alten Wallachs erwärmte Adam das Herz. »Ich glaube, er gibt an.«
»Er kriegt eine Extraportion Hafer, wenn wir nach Hause kommen«, verkündete Lizzie.
»Wenn Jimmy noch ein bisschen mehr Hafer kriegt, müssen wir ihn bald mit dem Schlitten ziehen«, erklärte Adam.
Seine lachenden Kinder, das klirrende Pferdegeschirr und die frische Luft im Gesicht taten ihm so gut, dass er spürte, wie das Gewicht auf seinen Schultern leichter wurde. Er lenkte den Schlitten nach Norden über die Felder, wo die Stoppeln des geschnittenen Getreides unter der bestimmt dreißig Zentimeter hohen Schneedecke fast ganz verschwanden. Die Bäume glitzerten weiß, und als sie am Wald vorbeikamen, wies er die Kinder auf den Zehnender am Feldrand hin. Er zeigte ihnen die Gänseschar, die sich auf dem seit langem zugefrorenen Stück des Teichs zusammendrängte. Die landschaftliche Schönheit Ohios schaffte es stets aufs Neue, seinen Lebensgeistern Auftrieb zu geben, aber heute Morgen, mit dem Lachen der Kinder im Ohr und dem sanft fallenden Schnee, ganz besonders.
Am nördlichen Ende des Grundstücks bog er rechts ab und fuhr nach Osten weiter Richtung Painters Creek. Es war zu kalt, um noch lange im Freien zu bleiben, auch wenn sie alle warm angezogen waren. Der Wind drang durch die Kleider, Gesicht und Finger brannten schon vor Kälte. Und da sie jetzt den Waldrand hinter sich gelassen hatten, bemerkte er auch die dunklen Wolken, die aus Nordwesten herüberzogen. Er beschloss, mit dem Schlitten zur Landstraße zu fahren und von dort Richtung Süden zurück nach Hause. Vielleicht würde er vor dem nachmittäglichen Füttern der Kühe und Schweine für alle eine heiße Schokolade zubereiten.
Adam war keine hundert Meter weitergefahren, als er vor ihnen im Straßengraben das Dach eines Autos durch die Schneeschicht schimmern sah. Ein motorisiertes Fahrzeug war in diesem Abschnitt der Nebenstraße ein ungewöhnlicher Anblick, denn in dieser Gegend gab es nur wenige Farmen, und fast alle Nachbarn waren Amische. Er zügelte das Pferd, und sie näherten sich langsam dem Wagen.
»Was ist das?«, hörte er Annie von der Rückbank rufen.
»Sieht aus wie ein englisches Auto«, sagte Sammy.
»Vielleicht sind sie im Schnee stecken geblieben«, meinte Lizzie.
»Brr.« Adam hielt den Schlitten an, sah sich um und lauschte. Doch außer Jimmys Schnaufen, dem Schrei einer Krähe aus dem Wald im Osten und dem Knacken von Ästen im Wind war alles still.
»Glaubst du, da ist noch jemand drin, Datt?«, fragte Sammy.
»Es gibt nur eine Möglichkeit, um das herauszufinden.« Adam band die Zügel fest, stieg vom Schlitten und machte sich auf zu dem Wagen.
»Ich will’s sana!« Ich will mitkommen. Sammy stand auf, um vom Schlitten zu klettern.
»Bleib bei deinen Schwestern«, befahl Adam seinem Sohn.
Aus drei Metern Entfernung sah er, dass der schneebedeckte Wagen, ein Pick-up, mit den Vorderrädern im Graben hing. Durch den Aufprall war die Kühlerhaube eingedrückt worden und aufgegangen. Bei dem vielen Schnee letzte Nacht hatte der Fahrer wohl nicht gut sehen können und war von der Straße abgekommen. Adam konnte nicht erkennen, ob jemand noch im Wagen saß, und stapfte durch den tiefen Schnee im Graben zur Fahrerseite herum, wo er überrascht feststellte, dass die Tür ein paar Zentimeter offen stand. Schnee war hineingeweht. Er beugte sich vor und warf einen Blick ins Innere.
Der Airbag war aufgegangen, und die Windschutzscheibe hatte einen Sprung, war noch intakt. Dann sah er das Blut, viel Blut. Zu viel, flüsterte eine kleine Stimme, und ihm wurde ganz mulmig zumute. Adam hatte zwar keine Ahnung von Autos, konnte sich aber nicht vorstellen, dass man durch so einen Aufprall so schlimm blutete. Was, um Himmels willen, war hier passiert?
Adam steckte den Kopf ein Stück weiter ins Wageninnere, konnte aber nichts Auffallendes entdecken. Er richtete sich auf und sah sich um, doch mögliche Spuren hatte der Schnee inzwischen zugedeckt. Wo war der Fahrer?
Er ging zur Rückseite des Pick-ups, und eine böse Ahnung überkam ihn beim Anblick mehrerer Einschusslöcher in der Heckscheibe, die durch ein Netz weißer Risse miteinander verbunden waren.
»Datt? Ist jemand da drin?«
Die Stimme seines Sohnes ließ ihn hochschrecken. Er drehte sich um und sah, dass der Junge doch hinter ihm hergekommen war und jetzt, bis zu den Hüften im Schnee steckend, den Hals reckte, um ins Auto zu sehen.
»Geh zurück zum Schlitten, Sammy.«
Aber der Junge hatte das Blut schon entdeckt. »Oh.« Er blickte besorgt. »Er ist verletzt, Datt, und braucht Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn suchen.«
Er hatte natürlich recht. Den Notleidenden zu helfen war für Amische die natürlichste Sache der Welt. Aber die Schusslöcher gaben Adam zu denken. Wie waren sie da reingekommen, und warum?
»Wir gehen zurück zum Schlitten«, sagte er seinem Sohn.
Seite an Seite kämpften sie sich durch den Graben, wobei Adam nach Spuren Ausschau hielt, jedoch keine entdeckte. Entweder war jemand vorbeigekommen und hatte den verletzten Fahrer mitgenommen, oder er hatte sich zu Fuß aufgemacht und Hilfe gefunden.
»Wer ist das, Datt?«, fragte Annie.
»Im Auto ist niemand«, antwortete er.
»Gehen wir ihn suchen?«, fragte Lizzie.
»Wir sehen uns ein wenig um«, sagte er.
Sammy senkte die Stimme, wohl um seine Schwestern nicht zu beunruhigen: »Glaubst du, er ist verletzt, Datt?«
»Fleicht«, antwortete er. Vielleicht.
Adam legte die Hand auf den Kopf seines Sohnes. So ein freundlicher Junge, so hilfsbereit und mitfühlend. Zwar hatten die Schusslöcher Adam alarmiert, und das viele Blut sowieso, aber wenn jemand verletzt war, musste man das Richtige tun und ihm helfen.
»Ich suche in der Umgebung«, sagte er seinen Kindern. »Ihr seht euch in der Nähe des Schlittens um. Ruft mich, wenn ihr auf etwas stoßt. Wenn wir niemanden finden, fahren wir zum Kühlhaus in der Ithaca Road und rufen die Polizei an.«
Das »Kühlhaus« war ein Wellblech-Gebäude mit einem Dutzend Gefriertruhen, die Amische für ihr Gemüse und Fleisch mieteten. Zudem gab es dort eine öffentliche Toilette, Pfosten, um die Pferde anzubinden, und einen Münzfernsprecher.
Adam hob seine jüngste Tochter vom Schlitten und blickte sich um. Der Zaun entlang der Straße aus krummen Pfosten und durchhängendem Stacheldraht war kaum mehr zu sehen unter dem Schnee. Auf der anderen Straßenseite führte ein dichter Wald bis hin zum Painters Creek.
»Seid vorsichtig, Kinder«, sagte er und ging in Richtung Zaun. »Bleibt zusammen und passt auf, dass ihr nicht in tiefe Schneewehen geratet, sonst muss ich euch auch noch ausgraben.«
Seine Worte entlockten den Kindern ein Kichern, dann machten sie sich auf zur Straße.
Adam durchquerte wieder den Graben und ging am Grenzzaun entlang. In etwa fünfzehn Metern Entfernung kam eine kleine Anhöhe mit jungen Bäumen und einer Stelle, an der im Spätsommer Brombeeren wuchsen. Er war erst sechs Meter gegangen, als er weiter vorn einen Stofffetzen am Stacheldrahtzaun sah, und ein Stück dahinter war der Schnee aufgewühlt. Zuerst dachte er, ein Hirsch oder Reh wäre angefahren worden, dorthin geflüchtet und verendet. Aber als er dann näher kam, sah er das schwarze Leder eines Stiefels und blauen Jeansstoff.
Er lief schneller, was im Tiefschnee mühsam war. »Hallo? Ist dort jemand? Sind Sie verletzt?«
Etwa drei Meter vor sich erkannte er die Umrisse einer Frau. Schwarze Lederjacke, schwarze Stiefel, Bluejeans.
Er lief hin und kniete sich neben die Frau. Sie lag auf der Seite, Kopf und Schulter an einen Zaunpfosten gelehnt und die Beine dicht an den Oberkörper gezogen, als versuche sie, sich warm zu halten. Schwarzbraunes Haar sah unter einer violetten Strickmütze hervor und bedeckte einen Großteil ihres Gesichts, ihre Kleider waren schneebedeckt. Als Adam ihre Haare zur Seite strich, stellte er entsetzt fest, dass sie steif gefroren und ihre Lippen bläulich angelaufen waren. Ihr Gesicht war leichenblass, um den Hals hatte sie einen Schal und nur an der rechten Hand einen Handschuh, die andere war voller Blut. Ihre Haut fühlte sich eiskalt an, und eine Schrecksekunde lang glaubte er, sie sei tot. Erfroren.
Von dem Gedanken aufgerüttelt, zog er einen Handschuh aus und legte die Fingerspitzen unter den Haaren auf ihren Hals. Warm, stellte er erleichtert fest. Sie lebte noch.
Er blickte sich um. Sein Haus war am nächsten gelegen. Die Farm der Yoders lag eine Meile weit weg, und es schneite jetzt so heftig, dass er nicht einmal das Dach ihrer Scheune sehen konnte. Und als Amische hatten sie auch kein Telefon. Der nächste Münzfernsprecher war im Kühlhaus, und das lag genau in der entgegengesetzten Richtung.
Er sah auf, entdecke Lizzie und Annie, die mit einem Stock im Schnee Tik Tak Toe spielten. Sammy checkte zwanzig Meter davon entfernt die Umgebung entlang des Zauns.
Die Frau stöhnte. Adam drehte sich wieder zu ihr um und sah, wie sie sich wand, den Kopf hob und mit weit aufgerissenen Augen auf seinen Hut starrte, das Gesicht eine Maske aus Irritation und Schmerz. »Verschwinden Sie«, brachte sie mühsam hervor.
Ihre Worte verschlugen ihm die Sprache. Er wollte doch nur helfen. War sie verwirrt? So etwas konnte passieren, wie damals seinem Cousin, der beim Jagen ins Eis eingebrochen war. Als sie dann zu Hause ankamen, konnte sein Cousin schon nicht mehr sprechen.
»Sie brauchen keine Angst zu haben.« Er hob die Hände, setzte sich zurück in die Hocke. »Ich will Ihnen helfen.«
»Gehen Sie.« Sie hob die linke Hand, als wollte sie ihn von sich fernhalten. »Das ist mein Ernst.«
»Sie hatten einen Unfall«, sagte er. »Sie bluten und brauchen einen Arzt.«
»Kein Arzt.« Sie versuchte, von ihm wegzurutschen und mehr Abstand zu gewinnen, kippte jedoch auf den Bauch und landete mit dem Gesicht im Schnee. Eiskristalle hafteten auf ihrer Haut, und an ihrer Wange klebte Blut. Sie hievte sich auf den Ellbogen, fuhr mit der rechten Hand unter ihre Jacke und zog eine Pistole hervor.
»Halten Sie Abstand«, zischte sie. »Keinen Schritt näher.«
Adam taumelte zurück. »Ich habe Kinder.«
Sie besah sich ihre linke Hand – die blaugefrorenen, blutbeschmierten Finger –, als wäre es nicht ihre eigene, und wischte sich damit übers Gesicht. »Wer sind Sie?«
»Adam … Lengacher.«
Sie schaute blinzelnd zu ihm hoch. »Wo bin ich?«
»In Painters Mill.«
Aus dem Augenwinkel checkte er den Standort der Kinder – sie waren nur zehn Meter entfernt, beim Zaun. Zu nah. Wenn die Frau narrisch – verrückt – war und anfing zu schießen, könnte er sie nicht beschützen.
Er rückte noch ein Stück weiter zurück, mit erhobenen Händen. »Ich gehe. Beruhigen Sie sich, wir verschwinden. Okay?«
»Es ist eine Lady.«
Ihm stockte das Herz. Das war die Stimme seines Sohnes. Er hatte ihn nicht kommen hören. Er fuhr herum und sah ihm fest in die Augen. »Gay zu da shlay, Samuel. Nau.« Geh zum Schlitten. Sofort.
Der Junge riss die Augen auf. Der Ton seines Vaters erschreckte ihn. »Was ist passiert?«
»Gay«, sagte er. »Nau.« Geh. Jetzt.
Verängstigt ging der Junge rückwärts davon. Adam wandte sich wieder der Frau zu, die Sammy anstarrte und ihre Pistole umklammerte wie einen Rettungsanker. Lieber Gott, wo war er da hineingeraten?
Noch bevor er darüber nachdenken konnte, sank der Arm der Frau herab, die Pistole entglitt ihrer Hand, ihr Körper verlor seine Spannung, und ihr Kopf fiel in den Schnee. Sie starrte ihn kurz an, dann schloss sie die Augen.
»Ich bin am Ende«, krächzte sie.
Adam musste verhindern, dass sie wieder nach der Waffe griff. Er rutschte näher und hob sie auf. Der Stahl lag kalt in seiner Hand, an der Mündung hing Eis. Es war kein Revolver. Mit Gewehren kannte er sich aus, hatte schon mit dreizehn angefangen zu jagen und einen .22er Vorderlader zu Hause. Aber hier ging es um etwas … anderes. Warum hatte die Frau eine Waffe? Um sich zu schützen? Konnte er ihr trauen? Oder war sie eine Kriminelle? Wenn er ihr half und sie in sein Haus brachte, würde er sich und seine Kinder gefährden?
Er drehte sich so, dass die Kinder die Waffe in seiner Hand nicht sehen konnten, und brauchte einen Moment, um herauszufinden, wie man das Magazin mit den Kugeln entfernte. Er steckte es in die Jackentasche, zog den Schlitten zurück, checkte die Patronenkammer, ließ die Patrone darin in den Schnee fallen und schob die Pistole in die andere Jackentasche.
»Jetzt bin ich Ihnen auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert, ja?«, flüsterte die Frau.
Adam erhob sich und warf einen Blick über die Schulter zu seinen Kindern. Alle drei saßen im Schlitten und sahen in seine Richtung, die Gesichter neugierig und sorgenvoll. Der Zauber, der sie alle auf der Schlittenfahrt umgeben hatte, war verschwunden, der Schnee war nicht länger magisch, sondern bedrohlich, und auch der Wind hatte zugenommen, fegte ihnen die Flocken nun entgegen. Selbst das Pferd hatte den Kopf gesenkt gegen den eisigen Wind.
Er sah hinab auf die Frau. Sie lag reglos da, mit geschlossenen Augen, als hätte sie aufgegeben. Schon bedeckte eine dünne Schneeschicht ihre Kleider und Haare. Wenn er sie hier liegen ließ, würde sie erfrieren – oder völlig zugeschneit sein, wenn der Sheriff und seine Leute nicht schnell genug kamen.
Sie bewegte sich, als hätte sie Schmerzen, und stieß ein Stöhnen aus, das aber auch ein Wort gewesen sein konnte. In einigem Abstand ging Adam wieder in die Hocke. »Soll ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Die Augen geschlossen und mit kaum geöffneten Lippen, stieß sie hervor: »Holen Sie Kate Burkholder. Ich bin Polizistin. Holen Sie sie.«
Adam wusste, wer Katie Burkholder war, kannte sie fast schon sein ganzes Leben lang. Woher kannte die Fremde sie? Doch jetzt war nicht der Moment, um das zu fragen. Sie war verletzt und schwach. Er sah zu seinen Kindern. »Macht auf der Rückbank Platz für sie«, rief er. »Wir nehmen sie mit nach Hause.«
»Ja!«, sagte Sammy.
Adam sah die Frau an. »Können Sie laufen?«
Sie bewegte sich und zuckte zusammen. »Ich weiß es nicht. Geben Sie mir eine Minute.«
Er hatte nicht das Gefühl, dass eine Minute half. Denn wenn sie nicht schnellstens ins Warme kam, würde sie sicher ohnmächtig werden und sterben.
»Ich helfe Ihnen.« Ohne sich auf eine Diskussion einzulassen, beugte er sich hinunter, schob seine Hände unter ihren Körper und hob sie hoch. Sie war klein, roch nach kalter Luft und dem süßlichen Duft einer Englischen.
»Sammy!«, sagte er. »Du nimmst die Zügel. Wir fahren nach Hause.«
Die Frau hing leblos in seinen Armen, ihr Kopf wackelte hin und her. Seine Sorge wuchs, als er das Blut an ihrer Jacke sah. Und während er mit ihr durch den tiefen Schnee stapfte, lief es warm über sein Handgelenk.
»Eine Englische«, sagte Sammy, als Adam den Schlitten erreichte.
»Ja«, antwortete er.
»Ist sie erfroren?«, fragte der Junge.
»Verletzt und von der Kälte geschwächt.«
»Wer ist sie?«, fragte Lizzie.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte er. »Hat sich wohl im Schneesturm verirrt. Wahrscheinlich macht sich schon jemand große Sorgen um sie, meinst du nicht?«
»Wahrscheinlich ihre Mamm«, sagte Lizzie. »Mamms machen sich immer Sorgen.«
»Annie, nimm die Decke, damit wir sie darin einhüllen können. Mach schnell.«
»Datt, sie blutet ja!«, rief Sammy erschrocken aus, die Zügel fest in den kleinen Händen.
»Sie hat sich bestimmt bei dem Autounfall verletzt«, sagte Adam. »Los jetzt. Ihr Mädchen setzt euch mit auf den Vordersitz, damit sie hinten genug Platz hat.«
Lizzie und Annie kletterten nach vorn. Adam stieg in den Schlitten, legte die Frau auf die Hinterbank und ignorierte das Blut, das auf den Ledersitz tropfte. Die Bank war zu kurz, um sie lang hinzulegen, und er beugte ihre Beine in den Knien.
»Gebt mir die Decke«, sagte er.
Annie warf sie ihm zu. »Sie sieht kalt aus.«
»Ich glaube, sie ist schon lange hier draußen«, erwiderte er. »Zu lange.«
»Muss sie sterben?«, fragte Lizzie.
Seit ihre Mutter gestorben war, kannten die Kinder den Tod und all seine düsteren Aspekte. Adam hatte sein Bestes getan, um ihre Fragen zu beantworten, und so wussten sie, dass der Tod ein Teil des Lebenszyklus war und die Menschen, die starben, in den Himmel kamen und bis in alle Ewigkeit bei Gott waren. Aber sie wussten auch, dass der Tod ihnen ihre Mamm genommen hatte und sie nie wieder zurückkommen würde.
»Das liegt jetzt in Gottes Hand.« Adam breitete die Decke über die Frau. »Wir werden ihr helfen, so gut wir können. Alles andere entscheidet Er.«
Er zog seine Jacke aus und legte sie ebenfalls auf die fremde Frau. Unter anderen Umständen hätte er die Zügel selbst genommen und eines der Kinder gebeten, bei ihr zu bleiben. Doch angesichts der Waffe und ihrer harschen Worte wollte er nicht, dass sie ihr zu nahe kamen.
Er kniete sich auf den Boden zwischen Vorder- und Rücksitz und legte seinem Sohn die Hand auf die Schulter.
»Fahr los«, sagte er.
2. Kapitel
Als Polizistin lernt man im Laufe der Zeit den Wert des Alltäglichen zu schätzen. In einer Stadt wie Painters Mill, Ohio, mit fünftausenddreihundert Seelen und einem Drittel davon Amische, gehört das Alltagsgeschehen zu den Dingen, auf die man sich so ziemlich verlassen kann. Außer natürlich, wenn Mutter Natur dreißig Zentimeter Neuschnee fallen lässt und alle glauben, trotzdem pünktlich an die Arbeit kommen zu müssen. Auch das gehört zum Leben einer Polizeichefin in einer Kleinstadt.
Ich stehe neben meinem Dienstwagen, einem Explorer, am Straßenrand der Township Road 18, etwa eine Meile entfernt von Painters Mill. Der Schnee fällt in dichten Flocken vom Himmel, der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von mindestens fünfzig km/h, und die Sichtweite ist auf wenige Meter geschrumpft. Wenn man dem Wetterbericht glauben darf, wird es erst noch schlimmer und soll dann besser werden.
Der alte Mercedes hat den Holzzaun durchbrochen, dabei alle vier Querstangen und zwei Pfosten umgemäht, tiefe Radfurchen im Graben hinterlassen und steht nun schief auf der Weide. Das Dutzend Black-Angus-Rinder von Levi Hochstetler findet den Wagen offensichtlich interessanter als den Heuhaufen neben der Scheune, denn es beäugt ihn neugierig aus nächster Nähe. Zwei weitere Tiere inspizieren bereits die Öffnung im Zaun.
»Ich war unterwegs zum Einkaufen und bin über den Hügel gekommen.« Der Fahrer, Joe Neely, Besitzer des demolierten Mercedes und von Mocha Joe’s, einem vornehmen kleinen Café in der Stadt, zeigt auf die Straße hinter mir. »Muss wohl auf Glatteis geraten sein, jedenfalls kam ich plötzlich ins Schleudern, und dann stand ich auf der Weide.«
Ich nicke, sage nichts, habe aber das Gefühl, dass er mir nur die halbe Wahrheit erzählt – und verschweigt, dass er es eilig hatte und für die Straßenverhältnisse zu schnell gefahren ist. Doch diese Theorie behalte ich für mich. Seit Eröffnung des Mocha Joe’s vor ein paar Jahren habe ich einige Male bei ihm vorbeigeschaut, denn ich lege Wert darauf, alle Kaufleute und Ladenbesitzer der Stadt zu kennen. Und er hat mir und meinen Officern – aber auch den Leuten vom Sheriffbüro – immer einen Kaffee spendiert. Er ist ein korrekter Mensch und hat Familie, ich bin zuversichtlich, dass er den Besitzer des Zauns entschädigen wird.
»Sind Sie verletzt, Mr Neely?«, frage ich. »Soll ich den Krankenwagen bestellen, damit man Sie im Krankenhaus durchcheckt?«
»Nein, um Himmels willen, Chief Burkholder. Mir ist nichts passiert. Nur …« Er blickt zu seinem Auto und seufzt. »Ich hänge an dem Wagen. Er ist zwar alt, aber es ist mein erster Mercedes. Hab die alte Schachtel an dem Tag gekauft, an dem ich das Café eröffnet hab, und war von Anfang an in sie verliebt.«
»Einen neuen Scheinwerfer brauchen Sie ganz sicher, und vielleicht auch einen Kotfügel. Soll ich einen Abschleppwagen anfordern?«
»Ja, das wäre nett, danke«, sagt er.
Ich beuge den Kopf vor, um in mein Ansteckmikro zu sprechen, und versuche, den Schnee zu ignorieren, der mir dabei in den Kragen fällt. »Brauche Abschleppwagen«, sage ich und nenne unseren Standort.
»Verstanden,« erwidert Lois Monroe. Lois arbeitet morgens in der Telefonzentrale des Reviers, lacht gern ausgelassen und ist so temperamentvoll wie ihr nicht zu bändigendes Haar. Obwohl sie als unsere »Revier-Mom« gilt, habe ich mehr als einmal erlebt, wie sie Leute, die ihr dumm gekommen sind, zurechtgestutzt hat. »›Ricky’s Abschleppdienst‹ kommt heute Morgen kaum noch mit der Arbeit hinterher, Chief. Er kriegt seit Stunden neue Anrufe und sagt, dass es eine Weile dauern wird.«
»Versuchen Sie es bei Jonny Ray.«
»Okay.«
Das hier ist der vierte Blechschaden, zu dem ich heute Morgen gerufen wurde, und es ist noch nicht einmal neun Uhr – ein sicheres Anzeichen dafür, dass der erste Tag der Woche seinem Ruf alle Ehre machen wird.
Ich stelle gerade Warnleuchten auf, als Reifen im Schnee knirschen. Ich drehe mich um und sehe, dass Rupert »Glock« Maddox’ Streifenwagen mit Blaulicht hinter meinem Explorer hält. Glock arbeitet gewöhnlich die Morgenschicht, ist ein ehemaliger Marine und mein erfahrenster Officer, und wie immer bin ich froh, ihn zu sehen.
»Brauchen Sie Hilfe, Chief?«
Ich platziere die letzte Leuchte und frage mich wieder einmal, wie er es schafft, immer dann zu kommen, wenn ich ihn brauche. »Wenn Sie hier auf den Abschleppwagen warten, sage ich Hochstetler Bescheid, dass er die Kühe im Stall einsperren muss, bis er den Zaun ausbessern kann.«
Glock nimmt eine weitere Warnleuchte aus seinem Wagen und stellt sie auf die Mittellinie. »Bei den glatten Straßen und der schlechten Sicht brauchen wir wirklich nicht noch Rinder, die frei herumlaufen.«
Ich steuere gerade auf den Explorer zu, als mein Handy an der Hüfte vibriert. REVIER steht auf dem Display, und ich nehme ab. »Heute Morgen halten Sie uns wirklich auf Trab, Lois.«
»Gerade hat Adam Lengacher angerufen, Chief. Er war mit seinen Kindern im Schlitten unterwegs und hat auf einem Feld eine verletzte Frau gefunden. Sie hatte in der Nacht einen Autounfall und den Wagen stehen gelassen, um Hilfe zu holen, und sich dann wohl verirrt.«
Mit zusammengekniffenen Augen wegen des Windes, der mir den Schnee heftig ins Gesicht bläst, erreiche ich den Explorer und reiße die Tür auf. »Wie schwer ist sie verletzt?«
»Er sagt, er kann’s nicht beurteilen.«
»Finden Sie heraus, ob noch Krankenwagen fahren. Falls ja, sollen sie die Frau ins Pomerene Hospital bringen. Wissen Sie, wo genau der Unfall passiert ist?«
»Township Road 36.«
»Rufen Sie das Sheriffbüro von Holmes County an, die sollen sich darum kümmern. Sagen Sie, wir sind überlastet und haben keine Kapazitäten mehr frei, okay?«
»Genau das hatte ich vor, Chief, aber Adam meinte, die Frau hätte nach Ihnen gefragt.«
Das überrascht mich. »Hat sie auch einen Namen?«
»Er hat nicht daran gedacht, sie danach zu fragen.«
Ich seufze, frage mich, wer sie wohl ist und warum sie nach mir gefragt hat. »Nun gut«, sage ich. »Also kein Sheriffbüro. Ich erledige das hier noch schnell und fahre dann hin.«
Ich überlege kurz, durch den Schnee zurück zu Glock zu gehen, doch stattdessen rufe ich ihn an. Er steht mit Joe am Straßenrand, sie unterhalten sich und sehen dabei zu dem beschädigten Mercedes.
»Ich muss raus zur Lengacher-Farm«, sage ich. »Können Sie Hochstetler Bescheid sagen, dass er die Rinder in den Stall bringen muss, bis der Zaun repariert ist?«
Mit dem Handy am Ohr, sieht er in meine Richtung und grinst. »Wird erledigt, Chief. Und fahren Sie vorsichtig.«
Ich kenne Adam Lengacher seit meinem achten Lebensjahr und war eine Zeitlang mit seiner Schwester befreundet. Ihr Datt hatte einen Schweinezuchtbetrieb, betätigte sich nebenher als Schlachter – wobei er für seine guten Würste nach deutscher Art bekannt war – und besaß eine Räucherkammer für Wildbret. Als Kinder hatten wir, während die Männer Tiere zerlegten und Pfeife rauchten, zu dritt mit den jungen Ferkeln rumgetollt oder im Kornfeld hinter ihrem Haus Verstecken gespielt. Diese unbeschwerten Tage endeten, als wir ins Teenageralter kamen und uns aus den Augen verloren. Adam heiratete und gründete eine Familie. Ich fiel bei meinen amischen Glaubensbrüdern in Ungnade, verließ schließlich die Gemeinschaft und tauschte das kleine Painters Mill gegen die Großstadtlichter von Columbus.
Seit meiner Rückkehr als Polizeichefin sind wir uns ein paarmal in der Stadt begegnet, haben uns zugewinkt, gelächelt oder ein Hallo zugerufen, mehr aber nicht. Mit ihm gesprochen habe ich zuletzt vor zwei Jahren auf der Beerdigung seiner Frau, um ihm mein Beileid auszusprechen.
Adam lebt mit seinen drei Kindern ein paar Meilen östlich von Painters Mill an einer wenig befahrenen Landstraße, die mehr aus Schotter als Asphalt besteht. Auf dem Weg dorthin komme ich an einem Schneepflug vorbei, weiß aber, dass die weiter entfernten Nebenstraßen nicht geräumt sein werden. Als ich dann die Landstraße 36 entlangkrieche, mein Wagen über jede wachsende Verwehung holpert und mein Außenspiegel von pudrigem Schnee überzogen ist, wird mir das ganze Ausmaß dieser Wetterlage so richtig bewusst. Zwar habe ich bis jetzt keine offizielle Meldung erhalten, dass die Rettungsfahrzeuge keine Einsätze mehr fahren, kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Krankenwagen das Risiko eingeht, in einer abgelegenen Gegend im Schnee stecken zu bleiben.
Die Straße ist praktisch nicht mehr zu sehen. Das liegt nur zum Teil an der schlechten Sicht, denn auch Fahrbahn und Seitenstreifen sind unter dem mittlerweile dreißig Zentimeter hohen Schnee kaum noch auszumachen. Zudem hat der Wind weiter zugenommen und treibt die Schneewehen in immer gefährlichere Höhen. Wenn es so weitergeht, werden die Ost-West-Straßen in wenigen Stunden nicht mehr passierbar sein. Sollte die verletzte Autofahrerin, die Adam gefunden hat, medizinisch versorgt werden müssen und noch transportfähig sein, wird mir nichts anderes übrig bleiben, als sie selbst ins Krankenhaus zu bringen.
Ich stelle den Explorer auf Allradantrieb um, biege in den Weg zur Lengacher-Farm ein und kann trotz der schlimmen Wetterbedingungen nicht umhin, den schönen Anblick des verschneiten alten Farmhauses und der fünfundzwanzig Meter hohen schneebedeckten Kiefern zu bestaunen. Der Weg, der auf beiden Seiten von weißen Weidezäunen gesäumt ist, führt einen kleinen Hügel hinauf und gibt die Sicht auf eine große rote Scheune frei, deren Tor offen steht. Ein paar Meter davor steht ein alter Pferdeschlitten, und ich sehe gerade noch, wie zwei amische Mädchen in Jacken und Winterhauben mit einem wohlgenährten Apfelschimmel in der Scheune verschwinden.
Ich parke so nahe am Haus wie möglich, stelle den Motor aus und ziehe mir die Kapuze über den Kopf. Wind und Schnee prügeln auf mich ein, als ich ums Haus herum zum Vordereingang stapfe und klopfe. Die Tür geht auf, und vor mir steht ein etwa acht Jahre alter Junge mit blondem Haar und Augen in der Farbe eines Blauhähers. Er trägt eine braune Jacke, einen flachkrempigen Hut und Strümpfe mit einem Loch, aus dem der große Zeh herauslugt.
»Hi.« Ich lächele und sehe an ihm vorbei ins Innere. »Ist dein Datt zu Hause?«
»Ja.« Der Junge legt den Kopf zur Seite. »Sind Sie die Polizei?«
»Ja. Aber du kannst Katie zu mir sagen.«
»Datt möchte, dass ich Sie mitbringe.« Er nimmt meine Hand. »Kommen Sie. Wir haben eine Frau gefunden. Eine autseidah.« Eine Außenstehende. »Sie ist verletzt und liegt auf dem Sofa in Mamms Nähzimmer.«
Seine kleine Hand fühlt sich kalt und schwielig an, als er mich durch die Tür in das schwach beleuchtete Wohnzimmer führt. Die warme Luft riecht angenehm nach Holzrauch und den Hausbewohnern, und mein Blick fällt auf ein verschlissenes Sofa voller Kissen mit Häkelbezügen, einen handgefertigten Couchtisch und einen Makramee-Wandteppich. In der Ecke zischt eine mit Propangas betriebene Bodenlampe.
»Ich bin acht, aber nächsten Monat werde ich neun«, erklärt mir der Junge, als wir durchs Wohnzimmer gehen. »Meine Schwestern bringen Jimmy gerade in den Stall zurück.«
»Jimmy ist bestimmt der imposante Ackergaul, den ich gerade gesehen habe«, sage ich.
»Er ist dick, aber er zieht immer noch gern den Pferdeschlitten«, lässt er mich wissen, als wir in einen schmalen Flur kommen. »Annie liebt ihn wegen seiner rosa Nase.«
Am Ende des Flurs bleiben wir vor einer offenen Tür stehen, die in ein etwa acht Quadratmeter kleines Zimmer mit nur einem Fenster führt. Entlang der Wand reihen sich ein Arbeitstisch und eine alte Singer-Nähmaschine, die aussieht, als wäre sie schon lange nicht mehr benutzt worden.
Adam Lengacher steht nahe der Tür und sieht mich an. Er ist groß und langgliedrig, hat blonde Haare und blaue Augen. Er trägt noch seine dicke Winterjacke, ebenso die Hose, die am Saum nass ist, und die Stiefel, die feuchte Spuren auf dem Boden hinterlassen haben.
»Hi, Adam«, sage ich.
»Katie.«
Erinnerungen blitzen in seinen Augen auf. Ein zaghaftes Lächeln um einen Mund, der nicht mehr zu wissen scheint, wie das geht. Auch nach all den Jahren erkenne ich noch den Jungen in ihm, der er einmal war. Der kaum ein Wort sagte. Den ich einmal so lange in einen Kornspeicher gesperrt hatte, bis er weinte …
»Man hat mir gemeldet, dass du eine verletzte Autofahrerin hergebracht hast«, sage ich.
»Hab sie auf unserer Fahrt mit dem Pferdeschlitten gefunden. Scheint einen Unfall gehabt zu haben. Ich glaube, sie ist verletzt. Sie hat stark geblutet.«
»Wir dachten schon, sie sei tot«, sagt der Junge, der die Augen seines Vaters geerbt hat, ein wenig zu enthusiastisch. »Aber Datt sagt, sie ist nur kalt.«
Adam sieht seinen Sohn an. »Hohla die shveshtahs. Fazayla eena zukumma inseid.« Geh zu deinen Schwestern. Sag ihnen, sie sollen ins Haus kommen.
Der Blick des Jungen haftet noch kurz auf mir, dann läuft er polternd los, so dass seine bestrumpften Füße im Flur hallen.
Als ich ins Zimmer treten will, stoppt mich Adam. »Sie katt en bix, Katie.« Sie hatte eine Waffe. »Sie gedroit mich mitt es.« Sie hat mich damit bedroht.
»Wo ist die?«, frage ich auf Pennsylvaniadeutsch.
Finster dreinblickend, greift er in seine Jackentasche und holt eine Sig Sauer P320 heraus, 9 Millimeter, Polymergriff.
»Wo ist das Magazin?«, frage ich.
Er greift in die andere Tasche und holt es heraus, ein typisches Magazin mit siebzehn Patronen. Ich nehme die Pistole, checke den Lauf, der leer ist, stecke sie in meine rechte Jackentasche und das Magazin in die linke.
»Hat sie irgendetwas gesagt?«, frage ich.
»Wenig.«
»Hat sie ihren Namen genannt?« Den würde ich dann durch LEADS laufen lassen, um zu sehen, ob sie ein Strafregister hat oder ob ein Haftbefehl gegen sie vorliegt.
Doch er schüttelt den Kopf. »Sie hat immer wieder das Bewusstsein verloren und war im Delirium, vermutlich von der Kälte.«
Ich überlege, was es mit der Waffe auf sich haben könnte und warum er die Frau trotzdem zu sich nach Hause mitgenommen hat. Ein anderer Polizist würde vermutlich sein Urteilsvermögen anzweifeln, schon weil er drei kleine Kinder dabei hat. Da ich aber selbst als Amische geboren und aufgewachsen bin, kann ich sein Handeln nachvollziehen: Bei so einem Wetter lässt man niemanden einfach liegen, auch keinen Außenstehenden, und erst recht nicht, wenn er verletzt ist.
Mein Blick wandert an Adam vorbei zu der Frau auf der Couch. Sie liegt unter einer verschlissenen Steppdecke, das Gesicht halb abgewandt, feuchtes Haar klebt an ihrer Wange. Selbst aus der kurzen Entfernung sehe ich, dass sie heftig zittert, ein gutes Zeichen, falls sie unterkühlt ist. Unter der Couch stehen nasse Lederstiefel, eine klitschnasse Jacke hängt tropfend über einem Stuhlrücken. Auf dem Holzboden neben der Couch ist Blut.
»Bleib hier«, sage ich zu Adam und gehe zu der Frau. »Ma’am? Ich bin Polizistin und muss Ihre –«
Die Frau dreht den Kopf, sieht mich an, und ich verstumme. Ich kenne sie, es ist Gina Colorosa, wir haben uns seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Früher sind wir Freundinnen gewesen, haben zusammen die Polizeiakademie besucht und gleichzeitig unseren Abschluss gemacht. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung und auch sonst eine Menge miteinander geteilt – all die Irrungen und Wirrungen junger Frauen, die ihren Platz in der Welt suchten. Wäre Gina nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich nie bei der Polizei angefangen.