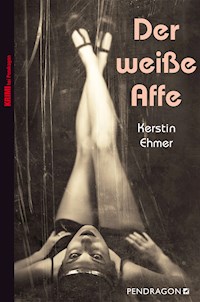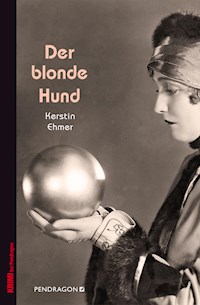
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: PendragonHörbuch-Herausgeber: PENDRAGON Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Spiro
- Sprache: Deutsch
Rasant und bildgewaltig: Der dritte Fall für Spiro! Berlin im November 1925: Eine Leiche wird aus einem Berliner Kanal gezogen. Das Mordopfer ist ein Journalist, der für den »Völkischen Beobachter« geschrieben hat. Während Spiro zweifelhafte Kontakte nutzt, um eine Spur zu finden, bewegt sich Nike in den spirituellen Kreisen von Berlin und nimmt an Séancen teil. Plötzlich taucht der Ausweis eines Jungen auf, der in Verbindung zum Toten stand. Aber der »blonde Hund«, wie er genannt wird, ist in München untergetaucht. In den Schwabinger Salons beginnen für Spiro nervenaufreibende Ermittlungen, die ihn durch ganz Deutschland führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Ehmer
Der blonde Hund
PENDRAGON
»Es passierte buchstäblich ohne sein Zutun,sogar ohne sein Wissen,wie die Launen und Exzesse eines Satrapenan den fernen Grenzen seiner selbst,die ihm in der Hauptstadt seines Wesensnur gerüchteweise zu Ohren kamen.«
Claus Cornelius Fischer, Commissaris van Leeuwenund das Mädchen mit der Silbermünze
Inhalt
1 Nacht vom 15. auf den 16. November 1925
Montag, 16. November 1925
2 Dienstag, 17. November 1925
3 Mittwoch, 18. November 1925
4 Donnerstag, 19. November 1925
5 Freitag, 20. November 1925
6 Samstag, 21. November 1925
7 Sonntag, 22. November 1925
8 Montag, 23. November 1925
9 Dienstag, 24. November 1925
10 Mittwoch, 25. November 1925
11 Donnerstag, 26. November 1925
12 Freitag, 27. November 1925
13 Samstag, 28. November 1925
14 Sonntag, 29. November 1925
15 Montag, 30. November 1925
16 Dienstag, 1. Dezember 1925
Danksagung
1
Nacht vom 15. auf den 16. November 1925
Saturn, der Unheilverkünder, steht bei Neumondim Zeichen Skorpion.
Im vergitterten Zwinger sieht er die zusammengerollten Leiber der Dobermänner auf dem Boden ruhen. Ein Schritt und ihre Ohren spitzen sich. Träge wenden sich die schmalen Köpfe. Einen Schritt weiter und im Dunkel leuchten ihre Augen. Sie sind jetzt wach. Ein weiterer Schritt und sie stehen, recken, strecken ihre Glieder. Noch ein Schritt und der Zwinger bebt unter dem ersten Sprung. Wut und Raserei, weiße Fänge in geifernden Schnauzen. Sie springen höher, als er groß ist. Immer wieder schnellt ein Hund über die verknäulten Körper seiner Artgenossen hinweg und kracht aufjaulend ans Gitter. Sind sie blöd?, fragt er sich. Wie kann man immer wieder gegen dasselbe Hindernis springen? Oder hoffen sie, dass sich der Käfig in Luft aufgelöst hat, während sie schliefen? Sie denken gar nichts, beschließt er. Sie sind einfach nur wütend, dass ich da bin. Ein Unbekannter, ein Fremder und sie riechen mit ihren feinen Nasen alles, was ich bin, und alles, was ich nicht bin.
»Prachtkerle sind das. Einer schöner als der andere. Edmunds ganzer Stolz. Echte Bestien.« Der alte Mann steht so dicht hinter ihm, dass seine schleppenden Sätze die aufgestellten Härchen in seinem Nacken streifen. Der Atem stinkt nach Alkohol und die Stimme schraubt sich zu einem Kreischen in die Höhe: »Bläu ihnen ein, wer der Herr ist und wer der Knecht! Du zitterst doch nicht etwa?« Er dreht sich zu dem Alten um. Seit ein paar Monaten ist er größer. Seine Schultern sind breit geworden, die Arme stark. Er sieht in das aufgeregt zuckende Gesicht des alten Mannes und schüttelt langsam den Kopf. Der Alte verzieht die Mundwinkel zu einem Lächeln. Das Zucken hört auf und seine Augen mustern ihn mit derselben Kälte, die ihn schon immer in die Knie gezwungen hat. Er sieht zu Boden.
»Jetzt zeig uns, ob du Mumm in den Knochen hast«, schnarrt die Stimme des Alten.
Er hält den Kopf gesenkt. Und wenn der Alte sagt: »Spring von der Brücke!«, mach ich das dann auch?, fragt er sich. Wahrscheinlich schon. Was sonst? Aber das hier ist keine Brücke. Nur ein Zwinger voller Viecher. Der Alte hat sich weggedreht und steigt die Stufen zur Terrasse hinauf. »Canis Domini. Hund des Herrn. Zeig mir, ob du noch mein Fackelträger bist!«, fordert er. Im gelben Licht hinter hohen Fenstern tuschelnde Köpfe, nah beieinander. Der Arm des Alten schwingt ausladend Richtung Hof. Hinter einem der Fenster sieht er eine Frau in hellem Kleid, ihre zusammengelegten Hände gegen die schmalen Lippen gepresst. Ihre Augen sind auf ihn gerichtet, weit und glänzend. Es ist also eine Vorführung, denkt er, schluckt seine Angst hinunter und dreht sich zurück zum Rasen der Dobermänner. Er holt Luft. Einen Schritt macht er, dann noch einen. Ihr Geifern überschlägt sich. Er greift eine Latte vom Boden und schiebt den Riegel des Zwingers zurück.
Montag, 16. November 1925
Ein Männerkörper treibt meist unfreiwillig im Wasser. Es sind überwiegend Frauen, die aus freien Stücken hineinspazieren und der Nachwelt eine einsame Anklage am Ufer stehen lassen wie eine Ruine ihrer unglücklichen Existenz. Frauen sind empfänglich für dieses melancholische Pathos, zumindest wenn sie dem oberen Bürgertum entstammen. Männer dagegen hatten meistens keine Wahl. Selten springen sie einfach von einer Brücke in den Fluss, höchstens von einem Achterdeck in den Quirl der Schiffsschraube. Weniger Pathos, mehr Dramatik. Warum das so ist, kann er nicht sagen, aber seine These bestätigt sich immer wieder. Wenn ein Mann im Wasser treibt, handelt es sich fast immer um Mord. Und mit dem hier wird es nicht anders sein.
Kommissar Ariel Spiro steht auf der Weidendammer Brücke und bläst in seine tauben Hände. Er hat den Mantelkragen hochgeschlagen und den Hut gegen den Wind heruntergedrückt, aber das nützt wenig. Über der Spree reißen eiskalte Böen den Morgennebel in Fetzen. Es wird ein harter Winter, da ist er sich sicher und beschließt, demnächst Handschuhe zu kaufen. Auf der Brücke sammeln sich Schaulustige und spähen hinab auf den Fluss. Mit dem Gesicht nach unten schaukelt der Körper eines kahlköpfigen Mannes in den Wellen vor dem Brückenpfeiler. Arme und Beine treiben ausgebreitet in der Strömung. Etwas sehr Leichtes liegt in diesem Dümpeln. Als würde er auf dem Wasser schweben. Wie lange wird er noch gestrampelt haben? Eine Minute höchstens, schätzt Spiro. Er hat morgens schon Eisschollen, dünn wie Fensterglas, auf der Spree treiben sehen. Angeblich wird es Ertrinkenden noch einmal warm, bevor es ganz vorbei ist. Kalt ist anschließend nur noch den anderen. Wenn man so will, hat der Tote sozusagen Glück im Unglück gehabt.
Von einem entladenen Apfelkahn aus angeln drei Schupos ungeschickt mit Haken nach ihm. »Der hat’s hinter sich«, murmelt Spiros älterer Kollege Bohlke, dessen Laune heute noch schlechter ist, als Kälte und Uhrzeit angemessen erscheinen lassen. Er hinkt auf die Gaffer zu und wedelt mit den Armen. »Weiter geht’s, Leute. Hier jibtet nichts zu sehn.«
Spiro mustert die Schaulustigen, die sich widerstrebend verziehen. Wo kommen die alle her? Es ist halb sieben, fast noch dunkel, aber auf der Friedrichstraße beinahe schon Gedränge. Fliegender Wechsel zwischen Nachtschwärmern und Frühschicht. Nichts als Neugier sieht er in den Gesichtern, nur wenige wirken betroffen. Die meisten scheinen in wohligem Grusel zu baden. Keiner wirkt verdächtig. Mit einer Geste ordert er die Sperrung des Gehsteigs an. Vier Schupos in blauen Uniformen setzen sich in Bewegung.
Unten im Fluss wird nach wie vor nach dem dümpelnden Körper gestochert. Jetzt haben sie ein Bein erwischt und hieven den schweren Körper über die Bordwand an Deck des leichten Kahns. Sie haben seine Tragkraft überschätzt. Gefährlich weit neigt er sich zum aufgeregten Wasser hinab. Der Schiffer am Steuer brüllt etwas und zwei Schupos hechten an die gegenüberliegende Bordwand, um gerade noch rechtzeitig auszugleichen. Sie haben ihn also endlich, denkt Spiro, in ein paar Minuten ist er an Land. Wieder sieht er sich um. Am Nordufer spaziert ein Anzugträger gemessenen Schritts Richtung Monbijou-Brücke. Spiro kneift die Augen zusammen, aber er ist zu weit weg, um Einzelheiten zu erkennen. Er ist sich allerdings sicher, dass derselbe Mann ein paar Minuten früher in die andere Richtung gelaufen ist. Langsam setzt er sich in Bewegung, aber nach einem schnellen Blick über seine Schulter biegt der Mann auf das Gelände der Frauenklinik ab und ist verschwunden. Spiro kehrt um, überquert die Brücke und läuft den Weidendamm entlang, bis ein paar Granitstufen hinunter zum Wasser führen. Schwankend legt dort der Apfelkahn an. Am Fuß der Treppe treten weitere Schupos und Bahrenträger frierend von einem Bein aufs andere. Die kleine Plattform ist voll und man steht sich hilfsbereit im Weg. Spiro bleibt oben und wartet, bis sie den Toten leise fluchend die Stufen hinauftragen. Er ist schwer, seine Kleidung vollgesogen mit eisiger Spree, die dem unteren Träger über Hände und Hose suppt. Unsanft setzen sie ihn vor Spiro ab, als wäre der Tote schuld an den nassen, schwankenden Umständen, die er ihnen bereitet.
»Er kann nichts dafür«, sagt Spiro und sie sehen ertappt zu Boden.
»Ob er was dafür kann oder nich, is überhaupt noch nich raus.«, nörgelt Bohlke. »Oder kannste mittlerweile hellsehen?« Spiro blickt nachdenklich zu dem herbeihinkenden Kollegen. Hinter ihm erkennt er die Gestalt eines großen, schmalen Mannes mit intelligenten Zügen und goldgerahmter Brille. Es ist tatsächlich Professor Fraenckel, der Leiter des gerichtsmedizinischen Instituts, persönlich. Selten treibt es ihn aus seinem Keller an die Tatorte. Er reibt sich die Hände, ob vor Kälte oder weil es ihn in den Fingern juckt, weiß Spiro nicht.
»Auf die Minute genau zum Empfang des neuen Kunden. Spiro, Sie dürfen mich loben.«
Überrascht und tatsächlich höchst erfreut reicht er ihm die Hand. »Professor Fraenckel. Sie selbst, hier draußen und das in aller Herrgottsfrühe?«
Fraenckel deutet eine Verbeugung an. »Meine Gnädigste ist zu Besuch bei der Frau Mama und so habe ich die einsame Nacht genutzt: Ein paar bemerkenswerte Funde gehörten als Anschauungsmaterial präpariert oder in Formalin, ein Vortrag war zu schreiben, ein paar Versuche. So geht die Nacht dahin, wenn man nicht aufpasst. Der Anruf aus der Burg hat mich quasi auf frischer Tat ertappt.«
Nach der launigen Begrüßung wendet er sich abrupt dem nassen Leichnam zu. Die beiden Kommissare sind für ihn abgemeldet und treten respektvoll zurück. Spiros Blick folgt dem von Fraenckel und bleibt an den Schuhen des Toten hängen. Helle Kalbslederstiefel mit Ledersohlen, teuer jedenfalls, und fast zu dünn für diese Jahreszeit. Überhaupt wirkt die gesamte Kleidung auf gediegene Art und Weise leicht exzentrisch. Ein Dreiteiler aus melierter Wolle, exzellent geschnitten und vor dem Bad in der Spree sicher fast weiß. Hornknöpfe, Krawatte, Manschetten. Kein Mantel. Ungewöhnlich das Ganze. Ein Engländer vielleicht? Die tragen Stoffe, denen man die Wolle noch ansieht, aus der sie gewebt sind. Die Reichshauptstadt, zumindest der männliche Teil, trägt am Abend Schwarz oder Mitternachtsblau in möglichst feinen Qualitäten. Woran erinnert ihn dieser Anzug, der grobe, aber teure Wollstoff, die geschnürten Stiefel? Er kommt nicht drauf.
Professor Fraenckel meldet sich aus der Hocke: »Wie schon fast befürchtet, sind die Taschen leer, keine Uhr, keine Ringe, keine Börse, kein Ausweis. Nur die Manschettenknöpfe haben sie vergessen. Musste vielleicht auch schnell gehen. Kennt man ja. Vielleicht hat er was in der Unterhose stecken, was uns weiterhilft, aber das bitte erst im Institut. Und schauen Sie mal hier. Er hat eins über den Schädel gekriegt. Da hat er noch gelebt und in die Stirn eingeblutet. So ohne Haupthaar ist das prächtig und sofort zu sehen. Sieht nicht tief aus, hat aber vielleicht doch gereicht. Da muss ich mit der Säge ran. Ob der Schlag tödlich war, kann ich so aus der Lamäng nicht sagen. Auf also! Zurück in die heiligen Hallen. Ist denn das Fahrzeug schon da?« Es ist. Fraenckel geht hinüber, um wortreich und gestikulierend den Transport in die Gerichtsmedizin zu regeln. »Wir telefonieren«, ruft er Spiro zu.
Der nickt und bittet die Träger mit einer Geste noch etwas zu warten. Ein Passant mit einem langen, traurigen Gesicht betrachtet im Vorbeigehen fassungslos den Körper des Mannes am Boden. Als würde er es ihm übelnehmen, denkt Spiro. Komischer Mensch. Langsam geht er neben dem Toten in die Knie. Er war nicht lang im Wasser. Gesicht und Körper sind noch nicht gedunsen. Trotzdem wirkt das Gesicht mit den tiefen Falten und den dichten, schwarzen Brauen seltsam erschlafft. Über den vollen Lippen des kleinen Mundes sträubt sich ein dunkler Schnauzer. Vorsichtig hebt er ein Lid des Toten an. Seine Augen sind dunkelbraun. Sicher war er in seiner Jugend schwarzhaarig, mindestens brünett. Jetzt ist sein eckiger Schädel kahl. Über der linken Stirnhälfte ist die Haut aufgeplatzt, ein Hämatom schimmert bläulich, in seiner Mitte weiß und ausgefranst die Wunde. Das Wasser hat das Blut ausgewaschen, soweit es kam. In seinem hellen Anzug muss er um diese Jahreszeit aufgefallen sein wie ein bunter Hund. Es wird nicht schwer sein, ihn zu identifizieren. Und er war nicht arm. Mit dem Vermögen steigt erfahrungsgemäß die Zahl derer, die ein Mordopfer vermissen. Wahrscheinlich sitzt bereits eine weinende Witwe oder ein besorgter Privatsekretär im Präsidium, wenn sie dort eintreffen.
Er steht auf und gibt seinen Toten zum Transport frei.
»Ich brauch ’nen Kaffee«, grimmt Bohlke und stapft Richtung Aschinger in der Friedrichstraße.
»Was dagegen, wenn ich mitkomme?«, will Spiro wissen.
»Und wenn ich was dagegen hätte, nur mal angenommen, dann würd’s mir auch nichts nützen.«
Spiro lässt ihn murren und schweigt, bis sie im überheizten Aschinger angekommen sind. »Kaffee, die Herren?«, fragt der Ober.
»Zweeje«, raunzt Bohlke, »und die gefälligst flott.«
Der Ober hebt lediglich eine Augenbraue, mehr nicht. Dafür lässt er sich beim Abwischen des Nebentisches Zeit, bevor er ihre Bestellung weitergibt.
»Bohlke, was ist los? Seit über einer Woche bist du mit der Zange nicht anzufassen. Wenn’s an mir liegt, dann wüsste ich gern Bescheid, was ich falsch mache und wenn nicht, lass deine schlechte Laune nicht an mir aus.«
Bohlke produziert in seiner Kehle ein verschlammtes Gurgeln. »Das passiert, wenn der Mensch seine Ruhe am Abend nicht hat, sondern immer raus muss, in die Stadt, zu den aufgetakelten Tanten und ihren Vorträgen.«
»Was für Vorträge?«, wundert sich Spiro. Der raubeinige Kollege ist bislang nicht durch einen gesteigerten Bildungshunger aufgefallen. Ganz im Gegenteil, er scheint Spiro in Methoden und Vorlieben eher ein Relikt der Kaiserzeit zu sein, ausgestattet mit an Starrsinn grenzendem Beharrungsvermögen. Aber vielleicht hat er sich geirrt.
»Ach, frag nicht. Ich weiß es doch auch nicht, worum es denen eigentlich geht. Schlimmer noch, je mehr ich höre, desto weniger kenn ich mich damit aus, wo es doch eigentlich umgekehrt sein sollte. Es geht um ätherische Leiber, um Seelen … Ich kann’s dir nicht sagen. Und ich will’s auch nicht, aber die Traudel will es hören und deshalb geh ick mit.«
»Deine Frau?«
Bohlke stöhnt und nickt. »Sie hat eine alte Schulfreundin getroffen, die ist auch Lehrerin in Schwaben, aber an einer neuen Art von Schule und diese neue Schule gefällt Traudel. Sie will es auch lernen und deshalb die Vorträge. Es ist aber nicht nur Schule, es geht auch um Tanz und Religion und Übersinnliches, da ist kein Anfang und kein Ende abzusehen. Wenn du mich fragst, ist das alles Schmuh. Und heute Abend ist schon wieder was. Irgendeine Tanzerei.«
Spiro versucht, ihn zu beruhigen: »Die Traudel weiß, was sie will. Gib ihr etwas Zeit.« Er hält viel von der Frau seines Kollegen. Zu Bohlkes letztem Geburtstag hat sie Nike und ihn in ihre drei Zimmer im Prenzlauer Berg eingeladen. Sie saßen in der guten Stube, Fenster weit offen und von Zeit zu Zeit das Krachen abstürzender Kastanien unten im Hof. Traudels prüfender Blick auf der jüdischen Frau und auf ihm selbst, dem jungen Kollegen ihres Ewalds, der von der Elbe kommt und nicht aus Berlin, zwei Fremde an ihrem Tisch. Eine knappe Stunde und ein paar selbst gemachte Schnäpse später war das Eis gebrochen. Irgendwann in der Nacht hat man Brüderschaft getrunken, allerdings mit Einschränkungen. Bohlke weigert sich, ihn Ariel zu nennen. Er sei nicht im Theater, sondern im Dienst. Wo kämen sie da hin? Seitdem sind sie also Spiro und Bohlke, aber per Du.
»Mal was ganz anderes.« Er beugt sich nah zu dem argwöhnisch zurückweichenden Bohlke. »Bewerben wir uns eigentlich beim Dicken für die neue Mordkommission? Stell dir vor: keine Raufereien mehr, bei denen ein Ganove dem anderen was aufs Dach gibt, keine geklauten Handtaschen, keine abhandengekommenen Sparstrümpfe, nur noch Delikte an Leib und Leben mit den allerneusten Methoden.« Die neue Abteilung reizt Spiro sehr. Bislang allerdings hat er wenig mit dem fülligen Polizeirat Ernst Gennat zu tun, der die Abteilung aus der Taufe hebt und die Auswahl dafür trifft. Vor zwei Wochen, bei der Vorstellung der künftigen Mordkomission im Plenum aller Kriminalkommissare, blieben die Augen des Dicken ein paar Sekunden lang an ihm hängen. Hin- und hergerissen zwischen Ehrgeiz und Skrupel sehnt er sich seitdem insgeheim nach einem spektakulären Fall, idealerweise einem Tötungsdelikt, dessen Aufklärung er als Bewerbungsschreiben einreichen kann. Die Kriminalpolizei hat in ihren Reihen etliche Adelige, die gezwungenermaßen vom Familiengut in den Brotberuf gewechselt sind. Bei Beförderungen scheinen sie noch immer den angeborenen Vortritt zu genießen. Ob er eine Chance hat? Er will es zumindest versuchen.
In der neuen Mordkommission sollen je ein alter und ein junger Kommissar zusammenarbeiten. Bohlke und er machen das bereits seit Monaten. Spiro hat lange überlegt, ob er mit oder ohne den bärbeißigen Kollegen weitermachen möchte. Er ist studierter Jurist. Bohlke hat lediglich die Volksschule abgeschlossen und sich in einer langjährigen Ochsentour vom einfachen Schupo bis zum Kriminalkommissar hochgearbeitet. Er neigt zum Jähzorn und manchmal rutscht ihm die Hand aus. Man muss ihm auf die Finger schauen. Aber er ist verlässlich, kennt die Stadt und ihre Pappenheimer und kann vor allem auch mal Fünfe gerade sein lassen. Sie kommen gut miteinander aus. Bohlke hält ihn mit seiner tiefen Verankerung im märkischen Sandboden davon ab, sich im Labyrinth der Möglichkeiten zu verirren, auf deren verschlungenen Wegen er mal die Dienstanweisungen vergisst, mal einfach die Übersicht verliert. Und näher betrachtet ist Bohlke gar nicht so preußisch wie seine Herkunft. Dafür hat der Weltkrieg gesorgt. Preußen hat ihn in den Krieg geschickt und dort hungern und frieren lassen. Er wurde schwer verwundet, zusammengenäht und gleich wieder zurück in den Schützengraben verfrachtet. Seitdem kann ihn der Kaiser mal, aber auch die neue Republik ist ihm nicht geheuer. Das Militär wird noch immer vom selben ost-elbischen Adel befehligt, der ums Verrecken nicht kapitulierte, selbst als es keinerlei Chance auf einen militärischen Sieg mehr gab. Verantwortung für die Tausenden Toten und Krüppel der letzten Kriegsmonate übernahm die oberste Heeresleitung nie. Und dieselben Militärs sollen nun die junge Republik beschützen. Er hat da seine Zweifel.
Der Ober bringt ihre Kaffees. Bohlke brummt ein Danke und verrührt auch Spiros Zuckerwürfel ohne zu fragen in seiner Tasse. Der trinkt ihn schwarz, das weiß er und zuhause hält ihn Traudel auf Diät. »Dich wird der Dicke vielleicht nehmen. Hast ja ordentlich vorgelegt, seit du hier bist. Aber mich? Alt, lahm, ein Splitter im Bauch, die Hackfresse. Wüsste nicht, warum er mich haben wollen sollte.«
»Weil du Erfahrung hast und wir gut zusammenarbeiten. Alle Fälle haben wir gemeinsam gelöst.« Spiros Stimme klingt optimistischer, als er es ist.
Bohlke hat es bemerkt und verzieht das Gesicht. Aber dann überrascht ihn Bohlke ein weiteres Mal an diesem Morgen: »Wir könnja mal zum Dicken hochgehen. Mit etwas Glück gibt’s zumindest Kuchen.«
Einen guten Kilometer spreeabwärts schwingt im Keller des Instituts für Sexualwissenschaften des Sanitätsrates Dr. Magnus Hirschfeld ganz unwissenschaftlich ein goldenes Pendel an seiner langen Kette, gehalten von den zarten Fingern Nike Fromms, Spiros eigenwilliger Geliebten. Sie ist die Tochter seines ersten Mordopfers in Berlin und noch während seine Ermittlung lief, hat sie ihn geküsst, wunderbar, aber eindeutig verboten. Durch sein Verhalten während der Ermittlungen fühlte sie sich von ihm hintergangen, hat ihn weggeschickt und einen neuen Gespielen gefunden. Dennoch ist ihr der Kommissar nicht aus dem Kopf gegangen und sie ihm erst recht nicht. Irgendwann hat sie eingesehen, dass er gar nicht anders gekonnt hat und ihm vergeben. Seit drei schwindelerregenden Monaten sehen sie sich regelmäßig. Es gab keine aufsehenerregenden Fälle für ihn, keine Prüfungen für sie, sondern gemeinsame Abendessen und Wochenendausflüge in die märkischen Herbstwälder mit dem Hund seines Mitbewohners. »Werden wir jetzt eins dieser faden Paare?«, hat sie ihren Bruder Ambros gefragt. »Nein, Fadheit ist bei euch ganz ausgeschlossen. Aber es ist vielleicht zur Abwechslung mal was Ernstes«, hat er geantwortet und sie damit nachhaltig erschreckt.
»Na, wer sagt’s denn? Da haben wir eine erstklassige seherische Begabung.« Nikes Freundin Dorchen klatscht ihr zufrieden die Pranke auf den Rücken.
Nike schüttelte sie ärgerlich ab. Konzentriert und fassungslos zugleich verfolgt sie, wie sich das Pendel auf Nachfrage in ordentlichen Kreisen von links nach rechts für Ja und von rechts nach links für Nein dreht. »Ist mein Kleid grün?« Ja. »Habe ich ein Pferd?« Ja. »Bin ich verheiratet?« Nein. »Bin ich ein bisschen verliebt?« Das Pendel verneint. Sie erschrickt.
»Falsche Frage«, schaltet sich Dorchen ein. »Ist sie schwerstens verliebt? Bis über beide Ohren sozusagen?« Das Pendel kreist wie eine außer Rand und Band geratene Uhr. Ein deutliches Ja. Dorchen triumphiert.
Nike wehrt sich: »Das glaube ich nicht. Wozu studiere ich überhaupt, wenn es irgendwo eine Quelle der Wahrheit gibt, die mit etwas Training die Diagnosen auch per Kreisbewegung anzeigen könnte?« Sie überlegt einen Moment. »Neue Frage: Ist Dorchen eine Frau?« Keine Antwort. Das Pendel hängt wie ein Segel in der Flaute. »Ist sie ein Mann?« Auch nichts.
Die Freundin zuckt die Achseln. »Das ist ja auch mit Ja oder Nee nicht zu sagen, was ich bin. Das Pendel hat schon wieder recht.« In Haube und Schürze versieht Dorchen ihren Dienst als Hausmädchen. Hausjunge wäre biologisch richtiger formuliert, aber so fühlt sie sich nicht. Vor drei Jahren ließ sie sich die männlichen Keimdrüsen entfernen, seitdem runden sich Brust und Hüften. Auch den Rest, der sie noch immer zum Mann macht, wäre sie gern los und hofft, dass entweder Hirschfeld selber oder Nike, wenn sie denn Studium und Praktikum als Medizinerin abgeschlossen hat, ihr zu einem Leben als vollwertige Frau verhilft. Pendeln fällt allerdings weder in den Aufgabenbereich der einen noch der anderen. Aber es ist Mittagspause und das Pendeln ihre Privatangelegenheit.
Schritte poltern auf den Stufen. »Nike! Bitte! Sofort nach oben! Wir haben einen Notfall.«
Sie springt auf und zieht im Gehen ihren Kittel über. Vor dem Ordinationszimmer zertretene Blutlachen, klebrige Spuren eines konfusen Hin-und-Her. Fräulein Rennhack scheucht wartende Patienten nach Hause. Um den Tisch stehen der Neurologe Dr. Abraham und zwei überforderte Sexualberater an der äußeren Grenze des für sie Erträglichen, ferner zwei todblasse Jungs mit zerlaufenem Augen-Make-up. Einer heult noch immer und zieht den Rotz hoch. Dr. Abraham ruft: »Wir brauchen Levy-Lenz. Wir brauchen einen Chirurgen.« Aber Dr. Levy-Lenz praktiziert heute in seiner Praxis am Rosenthaler Platz. »Nike, Gott sei Dank sind Sie da. Sie waren doch erst kürzlich in der Chirurgie, nicht wahr?« Sie nickt beklommen. Dr. Abraham sammelt sich. »Raus, alles, was nicht hergehört. Steriles Besteck, bitte. Nike, sind Sie so freundlich? Aber fix. Sonst läuft er uns aus.«
Sie wäscht sich die Hände gründlich, sterilisiert ein Tablett, Skalpelle und Nadeln, holt Faden, Kompressen, Verbände. Auf einer notdürftig hergerichteten Liege flattern die Lider ihres Patienten. Ein kaum 20-jähriger Junge mit kalkweißem Gesicht. Um seine Augen Reste von Kajal. Eine zähe Blutlache breitet sich unter seinem Becken aus. Sie schneiden ihn aus seinen Kleidern. Was sie zu sehen bekommen, verschlägt Nike den Atem. Aber sie erlaubt sich keine Schlussfolgerungen, versucht stattdessen mit klarem Kopf zu erkennen, was als Erstes und was als Letztes zu tun ist. Die Blutungen zuerst. Stillen, nähen, desinfizieren. Sein After ist aufgerissen, Darmschlingen hängen heraus, die Hoden fast schwarz, was ist mit ihnen? Sind sie verbrannt, zerdrückt? Brandwunden überall. Quetschungen, Schnitte. Dr. Abraham schwitzt neben ihr. »Chloroform. Wir müssen ihn betäuben, sonst springt er uns noch vom Tisch. Es ist alles aufgerissen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.«
Nike drückt eine Kompresse in die Wunde. »Hier, wir fangen hier an.«
»Er sollte in die Charité. Das ist nichts für uns.«
Sie überlegt einen Moment und schüttelt dann entschieden den Kopf. »Das schafft er nicht mehr.«
Dr. Abraham stöhnt. Sie zieht einen Faden auf.
Zwei Stunden später ist es vorbei. Das Institut hat keinen OP-Saal, nur ein Ordinationszimmer. Genauso gut hätten sie ihn auch in Hirschfelds Wohnzimmer operieren können. Der ist auf Vortragsreise und das ist vielleicht auch besser so. Sie ist todmüde und aufgeregt zugleich.
Der Junge ist wach geworden und wimmert vor Schmerzen. Sie schaut zu Dr. Abraham, der nickt und sie injiziert ihm Morphium. »Wer war das?«, fragt sie. »Wer hat dir das angetan?«
Der Junge flüstert: »Er ist manchmal etwas grob, mein Offizier. Aber diesmal hat er wirklich übertrieben.« Dann drehen sich seine Pupillen nach oben. Er schläft. Der spinnt, denkt sie verstört. Im Keller des Instituts wechselt sie ihr Kleid und lässt sich eine Droschke rufen. Dorchen will etwas sagen, aber sie winkt ab.
Spiro und Bohlke sind kurz davor aufzugeben. Seit Stunden laufen sie die Friedrichstraße auf und ab, halten Ausschau nach Taschendieben, die hier Jagd auf ahnungslose Berlinbesucher aus dem Aus- und Umland machen. Der Tote wurde beraubt. So was kommt vor und zwar häufig. Aber dass einem Beraubten auch noch der Schädel eingeschlagen und er anschließend in der Spree versenkt wird, passt nicht zum vorsichtigen Wesen der Diebe. Viel zu viel Aufsehen, schlecht fürs Geschäft. Sie wollen bei den Dieben Erkundigungen einziehen, aber der Leichenfund hat sich herumgesprochen.
»Keiner da«, sagt Bohlke. »Die machen blau.«
»Oder sie sind in ein anderes Revier ausgewichen. Wohin würdest du gehen, wenn du ein Dieb wärst und mit Polizeikontrollen rechnen müsstest?«
Bohlke sieht ihn entgeistert an. »Was weiß denn icke, wo die hin sind.«
Spiro überlegt. »Ich würde weggehen, aber nicht zu weit. Schließlich ist das alte Berlin mein Revier. Weiter im Osten sind die Leute arm. Da ist nicht viel zu holen. Unter den Linden ist zu viel Polizei und es ist auch zu übersichtlich. Aber am Potsdamer und am Leipziger Platz, da ist Gedränge, da sind Besucher mit gut gefüllten Börsen. Lass es uns da versuchen.«
Am Potsdamer Platz kulminieren Verkehrs- und Menschenmassen, am Potsdamer Platz muss jeder mal gewesen sein, getafelt und getanzt haben. Dort liegt das Café Josty und darin steuert Bohlke zielstrebig auf einen schmächtigen Mann an einem Fensterplatz zu, der die zarten Hände an einer dampfenden Tasse Boullion wärmt. Sein Haar ist blond, durchsetzt mit Grau und spärlich, die Farbe seines Gesichtes fahl, sein Anzug weder alt noch neu, nicht billig und nicht teuer. Keine besonderen Merkmale. Exakter Durchschnitt. Maximales Mittelmaß, denkt Spiro und ist wenig beeindruckt. Unter halbgesenkten Lidern wandern graue Augen, schauen nichts und niemanden an, bleiben nirgends hängen und haben doch alles gesehen. Als sich Bohlke seinem Tisch nähert, steht er auf und empfängt sie mit einer leichten Verbeugung. Sein Blick bleibt auf dem Boden kleben. »Der Kommissar Bohlke, habe die Ehre, und wen hat er dabei?« Seine Stimme ist leise, die Aussprache kultiviert.
Bohlkes ist es nicht: »Den Kollegen Spiro hat er dabei. Darf ick vorstellen, Karl Meyerholt, genannt der Graf. Wie er sich den Titel verdient hat? Keine Ahnung.«
»Das Gesicht ist mir gleich bekannt vorgekommen«, murmelt Meyerholt in Spiros Richtung. »Darf ich den Herren vielleicht einen Platz anbieten? Es plaudert sich im Sitzen doch weitaus angenehmer.«
»Wir wollen wissen, was du in den Taschen …«, dröhnt Bohlke, aber Spiro unterbricht: »Gern, sehr gern.« Er zieht sich einen Stuhl heran, Bohlke nimmt den gegenüber.
Der Graf versucht, die Bedienung zu ihnen zu lotsen. Erfolglos. Sie übersieht ihn. Er zuckt bedauernd die Achseln.
»Herr Meyerholt«, eröffnet Spiro, »wie laufen die Geschäfte?«
»Den Umständen entsprechend nicht schlecht. Selbstverständlich könnten sie auch besser sein, aber wir wollen bescheiden bleiben.«
Spiro überlegt einen Moment, dann entscheidet er sich für den direkten Weg: »Heute morgen schwamm ein Toter in der Spree, Höhe Weidendammer Brücke.«
Noch immer sieht ihn Meyerholt nicht an.
»Habe davon gehört. Sehr ärgerlich.«
»Wie kann so was passieren? Für Sie muss das«, er überlegt einen Moment, dann fährt er mit ironischem Lächeln fort, »geradezu geschäftsschädigend sein. Der Aufruhr, die Polizei. Wo bleibt da die Diskretion, die Ihr Gewerbe doch dringend benötigt?«
Jetzt ein erster grauer Blick, für den Bruchteil einer Sekunde nur. »Kommissar Spiro, Sie beweisen ein großes Einfühlungsvermögen. Leider ist das in Ihrem Berufstand nicht besonders weit verbreitet.« Er tupft sich die Lippen mit der Serviette und sieht aus dem Fenster. »Sie können mir glauben, dass wir alles andere als glücklich über die Vorkommnisse sind. Eine Leiche bedeutet immer einen Rückgang der Einnahmen. Niemand will so etwas. Und von uns war es auch niemand. Das ist zumindest das Ergebnis einer zugegebenermaßen etwas hastig durchgeführten Umfrage. Alle sind erschüttert und auch ein wenig besorgt.«
Spiro ist überrascht, wie schnell die Neuigkeiten noch vor den ersten Zeitungen die Runde machen. Wer von den Gaffern war der Dieb, der alle anderen gewarnt hat? Er überlegt, dann sagt er grinsend: »Der Anzugträger heute früh. Langes Gesicht, tieftraurige Augen? Das war Ihr Mann?«
Meyerholts Blick wandert über die Deckentäfelung. »Sie erwähnten es bereits. Von enormer Wichtigkeit ist für uns die Diskretion.«
Bohlke schnaubt. Spiro bleibt gelassen: »Sie bringen mich in die unangenehme Lage, Sie für einen sicherlich nur kurzen, aber doch unerfreulichen Aufenthalt in unser Untergeschoss bitten zu müssen. Ein paar Stunden, vielleicht noch die Nacht, solang wie Sie eben brauchen, um diesen idiotischen Reflex niederzuringen: keine Gespräche mit der Polizei. Ich tue es ungern, aber mir bleibt kaum eine andere Wahl.«
Meyerholt hüstelt, dann kommt nichts.
Spiro fährt fort: »Es geht nicht um Ihre Diebstähle, es geht um Mord. Denken Sie nach. Was nützt Ihnen, was nützt Ihnen nicht? Sagen Sie uns, was Sie wissen. Je eher Sie reden, desto schneller haben Sie wieder Ihre Ruhe.«
Meyerholt begutachtet seine Schuhe. Von dort wandern seine verhangenen Augen nach oben, kreuzen für einen sehr kurzen Augenblick Spiros. »Es wird Sie nicht freuen, Herr Kommissar.« Seine Stimme ist so leise, dass Spiro sich vorbeugen muss, um die Worte zu verstehen. »Über Ihren Toten wissen wir nichts. Nur, dass ihn keiner von uns beklaut hat. Und es gibt einen zweiten Toten oder Halbtoten. Selbe Nacht, gleiches Spreeufer, um die Ecke von Ihrer Leiche. Der ist allerdings verschwunden.«
Verblüfftes Schweigen bei den Kommissaren. Spiro kratzt sich unter dem Hutrand. »Tot oder halbtot? Geht das ein bisschen genauer? Mensch Meyerholt, reden Sie.«
Der Graf faltet seine Serviette zu einem Schiffchen. »Letzte Nacht also, Neumond. Ich bin gleich zuhause geblieben. Bei Neumond lohnt es sich nicht, nie. Der besagte melancholische Kollege hätte es besser genauso gemacht. Hat er aber nicht. Er ist also am Ende einer erfolglosen Nachtschicht angelangt. Neumond, ich sagte es bereits. Er ist auf dem Weg nach Hause. Es gibt eine Abkürzung, aber sie ist dunkel. Eine kleine, düstere Gasse nach Norden und mittendrin stolpert er über einen, der da liegt, einen jungen Mann. Halb hinüber, ohnmächtig, Wunden, Blut. Ein furchtbarer und natürlich höchst bedauernswerter Anblick, aber da, wo der ist, braucht er kein Geld, vielleicht nie wieder, denkt der Kollege und erleichtert ihn. Die Ausbeute der Nacht war bis dahin, wie bereits gesagt, gering. Ein bedauerlicher Fehltritt, geboren aus der Not. Zuhause drückt ihn aber das Gewissen. Der Schlaf macht einen großen Bogen um ihn. Er versucht es mit Baldriantee, aber der hilft auch nicht. Irgendwann zieht er sich wieder an und geht zurück. Der Körper ist weg, spurlos verschwunden. Er hat Streichhölzer dabei und leuchtet auf den Boden. Das Blut ist noch da, er hat sich das Ganze also nicht eingebildet. Gut, denkt er, eine Sorge weniger. Erleichtert spaziert er Richtung Spree und will sehn, ob er schon irgendwo einen Kaffee kriegt. Da sieht er die Schupos, wie sie mit einem Schiffer verhandeln und schließlich ein Boot nehmen und er sieht auch die Leiche im Wasser, die ihn verwirrt. Hätte es sich um den jungen Mann gehandelt, wäre da eine gewisse Schlüssigkeit zu erkennen. Jemand hat zu Ende gebracht, was er angefangen hatte. Aber dem ist nicht so. In der Spree schwimmt ein deutlich älterer Herr. Für seinen Geschmack sind das eindeutig zu viele Verbrechen auf einem Haufen. Er verabscheut Gewalt. Er wartet ein bisschen, spitzt die Ohren, dann reißt er mich aus dem Schlaf.«
Spiro und Bohlke sehen sich an. Die Geschichte ist zu abwegig, um erfunden zu sein. Solche Volten schlägt in der Regel nur das wahre Leben.
»Er sollte mit uns sprechen. Schnellstens«, sagt Spiro schließlich. »Und das ist keine höfliche Bitte.«
Meyerholt sieht betrübt auf die kalte Boullion. »Das wird er nicht. Der Junge hatte ein Zugbillett in der Tasche, nach Dresden. Das war der wertvollste Teil der moralisch zweifelhaften Beute meines Kollegen. Seine Papiere hat er, auf mein Anraten hin, verbrannt.«
»Er ist weg?«
Meyerholt schenkt dem fassungslosen Spiro einen seltenen Sekundenblick. »Ich habe Sie gewarnt, dass Ihnen nicht gefallen wird, was Sie hören.«
»Wie heißt Ihr Kollege? Und was will er in Dresden?«
»Er wird sich umsehen. Dresden, barockes Kleinod deutscher Stadtkultur. Zwinger, Grünes Gewölbe. Auch da ist der Besucherandrang stark. Vielleicht geht er auch wandern im Elbsandsteingebirge. Auf den Spuren der Deutschen Romantik. Ich bin mir sicher, dass ihm die sächsische Metropole in jeglicher Hinsicht etwas zu bieten hat. Berlin hingegen scheint ihm momentan kein guter Ort zu sein. Die Wogen sind aufgewühlt, die Diskretion nicht gewährleistet.«
»Wie heißt er?«, knurrt Spiro.
»Er nennt sich Traugott. Traugott Biederstedt. Hierbei könnte es sich allerdings um einen Künstlernamen handeln.«
Bohlke schnaubt verächtlich, Spiro grinst. »Ein vertrauenerweckender Name.«
Der Graf nickt. »Vorteilhaft in unserem Beruf. Vielleicht zu vorteilhaft, um wahr zu sein.«
Spiro schreibt eine Telefonnummer auf seinen Block und reißt die Seite heraus. »Rufen Sie mich an, wenn er auftaucht. Oder wenn Sie mehr in Erfahrung gebracht haben.« Meyerholts Blick ist ihnen durchs Fenster vorausgeeilt und in den dichten Trauben der Passanten verschwunden. »Wir werden sehen.«
»Ja, werden wir. Sagen wir übermorgen hier? Selbe Zeit, selbe Stelle?«
Der Graf kehrt gequält zu seiner Tasse zurück. »Es ist wohl nicht zu vermeiden.«
Spiro nickt. »Danke, Meyerholt.«
Draußen fegt ihnen der Wind halbgefrorenen Nieselregen ins Gesicht. Bohlke ist sauer: »Warum hängt der Graf nicht an meinem Handgelenk? Der läuft jetzt los und fingert dem nächsten Breslauer die Patte aus der Jacke. Protokoll, Aussage? Brauchen wir das alles nicht mehr? Schwenkow erklärt uns für geisteskrank, wenn er das hört.«
Spiro schüttelt den Kopf. »Wir brauchen den Grafen auf der Straße, nicht in der Zelle. Wir brauchen seine Augen und Ohren und er sollte uns vertrauen. Schwenkow muss von dem zweiten Opfer gar nichts wissen, zumindest jetzt noch nicht. Noch ist es gar nicht aufgetaucht. Noch ist es eine Geschichte, erzählt von einem Dieb.«
Bohlke wiegt zweifelnd den dicken Kopf.
Sie fahren zurück in die Burg und erstatten Oberkommissar Schwenkow Bericht.
»Noch nix«, sagt Bohlke und puhlt in seinem Ohr.
Schwenkows Blick wandert zu Spiro. Der hat nichts hinzuzufügen und schweigt. Schwenkow saugt hörbar die Luft ein. Er ist sich sicher, dass es doch etwas gibt. Sei’s drum, denkt er. Sie werden schon rechtzeitig mit der Sprache herausrücken. »Feierabend für heute.«
Aber er irrt sich. Als sich die Büros und Gänge des Präsidiums geleert haben, als es still geworden ist, der Pförtner eine Stulle auspackt und die Bereitschaft die Spielkarten, wird ein Hörer abgenommen, dreht sich die Wählscheibe, dreimal klingelt es am anderen Ende der Verbindung, dann wird abgenommen: »Ja?«
»Ich wollte sagen, dass es noch nichts gibt. Spiro und Bohlke haben den Fall. Diesen Spiro sollte man nicht unterschätzen. Noch tappen sie im Dunkeln, sie stochern. Aber das ist normal am ersten Tag.«
»Von wo rufen Sie an?«
»Von meinem Schreibtisch.«
»Sind Sie des Wahnsinns? Tun Sie das nie wieder. Wir melden uns bei Ihnen, nicht umgekehrt.«
Währenddessen schwitzt Spiro im Krächzen der Drei-Minuten-Klingel seines Boxstalls. Vor ein paar Monaten hat er mit dem Boxen angefangen und ist dabei geblieben. Es hat ihn verändert.
Zuhause in Wittenberge ist er sommers in die Elbe gegangen, hat seine Kräfte gegen die Strömung gesetzt, bis sie ihn besiegte und mitnahm, flussabwärts. Lange Spaziergänge in den Auen, weder Tennis noch Fußball. Geritten ist er auch nicht. Im Boxstall in der Lützowstraße schaltet er seinen Kopf ab und unterwirft sich ohne Wenn und Aber den knappen Anweisungen seines Trainers Harry Kupka. Er scheucht die Boxer, bis ihr Schweiß die Scheiben beschlägt. Es riecht nach Bier, ungewaschenen Achseln und Testosteron. Muskeln glänzen speckig, Seile knallen auf den Boden, Fäuste dreschen ins genarbte Leder der Sandsäcke. In der Mitte, erhöht und weiß umspannt, das Quadrat des Rings, die Arena. Dreimal in der Woche ist Spiro dabei. Warum, kann er nicht genau sagen, er merkt nur, dass es ihm guttut, das Prügeln, Wamsen und Dreschen, das Schwitzen, das Pochen des Pulses und die Schwere der Muskeln danach. Nike misst manchmal entzückt den wachsenden Umfang seiner Bizepse und legt Wickel mit essigsaurer Tonerde auf die blauen Flecken. »Das ist so romantisch: der blutende Held nach der Schlacht in den treusorgenden Armen der Geliebten.« Ihre Mutter, die von Spiro hochverehrte Pianistin Charlotte Fromm, hat nur kurz gelächelt und augenblicklich kam er sich vor wie ein Idiot. Nikes Bruder Ambros ist anderer Meinung. »Steht dir ausgezeichnet«, war sein Kommentar. Er hätte Spiro ebenfalls genommen. Gern und sogar ohne Boxtraining. Das Schicksal hat ihn seiner Schwester zugedacht. Aber andere Mütter haben auch schöne Söhne.
Im Ring gekämpft hat Spiro allerdings noch nicht. Kupka hat ihn gleich zu Anfang mit Sebes, einem kahlköpfigen Muskelpaket, zusammengespannt. Sie trainieren gemeinsam, halten sich die Sandsäcke, springen Seil um die Wette. Spiro lernt viel von ihm. Über Kraft und was sie anrichten kann. Sebes ist kein Mann großer Worte. »Tach«, lautet seine Begrüßung, »Man sieht sich«, sein Abschied, dazwischen eventuell ein »Geht’s los?«, wenn Spiro beim Bandagieren trödelt. Aber auch nur dann. Heute hat er überraschend auf »Schönen Tach auch, Spiro«, erweitert und seine bräunlichen Zahnreihen gebleckt. »Was ist denn los?«, hat der sich gleich besorgt erkundigt. Sebes hat ein paar Sekunden lang überlegt und ihm dann ein knappes Wort vor die Füße geworfen: »Sparring.«
»Ich?«, fragt Spiro erschrocken.
»Mit mir«, sagt Sebes und lächelt.
Zum ersten Mal klettert er hoch in den Ring, schiebt sich zwischen den Seilen hindurch auf den Gummiboden. »Tanz!«, brüllt Kupka und Spiro federt aus Fesseln und Knien. Gegen Sebes’ Kraft hat er keine Chance. Er muss versuchen auszuweichen, sonst geht er unter. Die Glocke krächzt. Drei Minuten muss er schaffen. Er tänzelt vor und zurück, duckt sich weg, reißt den Oberkörper zur Seite, biegt sich nach hinten. Sebes’ Schwinger preschen ins Nichts. Der beginnt zu schwitzen, Beinarbeit ist nicht seine Stärke. Spiro bewegt ihn in langsamen Runden. Ich führe, erkennt er. Nachgeben, ausweichen kann also auch Führung bedeuten. Aber er hat Sebes unterschätzt. Einen Sekundenbruchteil nur war er mit den Gedanken nicht im Ring. Zu lang. Ein rechter Haken knallt in seine Rippen. Ihm bleibt die Luft weg und er sinkt in die Knie. Sebes’ kahler Kopf schiebt sich erwartungsvoll in sein Blickfeld. »Geht’s?«
»Keine Luft«, keucht Spiro. Die Glocke schnarrt. Die nächsten Kämpfer entern den Ring.
»Ein guter Boxer muss vor allem einstecken können«, sagt Harry Kupka.
Gar nicht weit von Spiros Boxstall, lediglich eine diagonale Querung der Potsdamer Straße ist nötig, um ein gänzlich anderes Universum zu betreten, rutscht ein erschöpfter Bohlke auf einem harten Stuhl herum. Purpurn, gelb und orange flattert es vor seinen Augen. Aus einem Flügel perlt Beethoven. Ein Farbgewitter mit Böen aus Seide. »Wie schön«, flüstert Traudel und nimmt seine Hand.
Auf der Bühne des Kulturraums drehen sich acht Frauen um sich selbst, fließen zusammen und trennen sich wieder. Ihre schwerelosen Gewänder wehen ihnen nach, sie rinnen an den sanft schwingenden Armen hinab, scheinen für Momente in der Luft zu stehen, während die Tänzerinnen zurückweichen. Körper wölben flüchtige Abdrücke in die leuchtenden Seidenbahnen und lösen sich auf. Kreise bilden sich, werden zu Linien, werden getrennt, formen sich neu. Es ist ein Gleiten und Schweben, ein Wogen und Wallen. Auf und nieder flattern die Arme wie die Schwingen prächtiger Vögel. Es nützt ihnen nicht, sie bleiben am Boden. Die Erde hält sie fest.
»Wenigstens haltense heute die Klappe«, brummt Bohlke. Traudel gibt ihm einen Klaps auf die Hand. Es ist ihm egal. Seine Lider werden schwer und umspült von den Klängen einer Beethovensonate schläft er ein.
Während Spiro die Bandagen abwickelt und Bohlke die Paradiesvögel auf der Bühne durch ein geschnarchtes Grunzen aus dem Takt bringt, übergibt Nike ihren Mantel dem Dienstmädchen der Baronin von Aue. »Sie sind spät«, flüstert das Mädchen.
»Ja, und?«, fragt Nike und öffnet die Tür zum angrenzenden Salon.
»Kommen Sie in unseren Zirkel! Eine Geistanrufung ist kein Besuch im Zoo und das Reich der Toten duldet keine Zaungäste. Setzen Sie sich!« Die Lippen der Frau sind kaum mehr als zwei blassviolette Striche in einem welken Gesicht, aber ihre Stimme unerwartet befehlsgewohnt. Es folgt kein Lächeln. Fünf Augenpaare warten darauf, dass sich Nike zu ihnen gesellt, um mit gespreizten Fingern den Kreis ihrer Hände zu schließen. Nach der blutigen Operation am Nachmittag hätte sie mehr als einen Grund gehabt abzusagen. Aber getrieben von Neugierde und Überreiztheit hat sie das nicht getan und bereut es jetzt. Wie immer macht sie der Salon der Baronin von Aue ein wenig beklommen. Vor den Fenstern fließt dunkelgrüner Samt in fast unverschämt üppigen Bahnen aufs Parkett. Ein großes Dunkel wächst in seinen Falten und dunkel ist auch das Mobiliar. Schwarze Rosen, vor 400 Jahren aus Ebenholz geschnitzt, bewachen den Schlaf alten Silbers in einem Schrank, der einst den Saal einer Burg mit Fernblick über den Rhein zierte. Für den heutigen Salon der Baronin ist er überdimensioniert wie andere kostbare Stücke auch. Überall steht etwas herum und im Weg, jeder Gang ein Slalom. Polstersessel umstehen einen runden Kartentisch, auf dessen Platte eine verschwenderische Fortuna in Intarsien ihr Füllhorn ausschüttet. Nike nestelt an ihrem Kragen. Wie immer scheint ihr die Luft in diesem Raum verbraucht, schwer und dickflüssig geworden im Lauf der jahrhundertealten Familiengeschichte der von Aues, schwebend zwischen den Polen Macht, Vermögen und Pflicht.
Mit nur einem Sohn ist die Baronin erst spät im Leben niedergekommen. Früher, als er noch konnte, hat er Nike ein paar Mal zum Tanzen ausgeführt. Er besaß eines der ersten Automobile Berlins, eine Sensation. Vor Begeisterung schreiend hat sie sich in den Fahrtwind gehängt, besoffen von der Geschwindigkeit und dem Röhren des Motors. Die Baronin war bereits ein wenig beunruhigt über die Exkursionen der beiden, da begann Johannes zu husten, hörte gar nicht mehr auf und sie erkannte, dass die schöne Nike Fromm und ihre jüdische Abstammung das Geringste ihrer Probleme war. Ihr Sohn erkrankte und Besserung kam nicht in Sicht.
Erfreut hat sie deshalb Nike eingeladen, als sie sich zufällig auf der Straße begegneten, als könne die junge Frau das Leben zurück in ihren Sohn zwingen. Die letzten Monate hat er in Kliniken und Sanatorien verbracht. Ohne Erfolg. Er sitzt im Rollstuhl, ein Schemen seines früheren Selbst, aus dem man Luft und Leben abgelassen hat. Nike schluckt, als sie ihn sieht. Er flüstert mit angestrengtem Lächeln: »Nike, wie schön, dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme. Wie immer eine Augenweide. Bitte entschuldige, dass ich mich diesbezüglich so gar nicht revanchieren kann.«
Sie schweigt verwirrt. Er schließt die Augen und versinkt im Polster seines Stuhls. Seine gelbliche Hand liegt wartend auf den Intarsien. Vorschriftsmäßig schließt sie den Kreis.
Die magere, ältliche Frau, das Medium dieser Seance, kramt in ihrer Handtasche. Endlich hat sie gefunden, was sie suchte: einen Flakon, von dessen Inhalt sie sich einige Tropfen auf Schläfen und Stirn verreibt. Ein schwerer Duft schliert in den Raum, holzig und süß. Nike wundert sich. Nichts passt weniger zu dem schlichten Kostüm der Frau, auf dessen Stoff die Wolle in grauen Knötchen flockt. Der Hauch von Orient, den sie in ihrem Fläschchen spazieren trägt, passt auch nicht zu ihrem ungeschminkten, reizlosen Gesicht mit den kleinen grauen Augen, nicht zu ihrem mausfarbenen Haar, das sie in einem dünnen Knoten trägt. Sie entrollt eine Ledermatte. Darauf finden sich kreisförmig angeordnet die hübsch kalligrafierten Buchstaben des Alphabets, verbunden von einem Strahlenkranz. In seine Mitte setzt sie mit ungeschicktem Poltern ein umgedrehtes Silberschälchen. »Wir schließen den Kreis, wir schließen die Augen.« Ein tadelnder Blick trifft auf Nikes Neugier. Gehorsam schließt sie die Augen. Die Stimme des Mediums ist leise, teilnahmslos und brüchig: »Wir rufen dich, oh Herr, der du über das Dunkel wachst. Wir rufen dich, Herr, der du die Ewigkeit auf der anderen Seite bestimmst. Offenbare dich uns! Wir rufen dich, oh Herr, der du über das Dunkel wachst. Wir rufen dich, Herr, der du die Ewigkeit auf der anderen Seite bestimmst. Offenbare dich uns! Wir rufen dich …« Wieder und wieder dieselben Sätze, die zu einem Mantra zusammenwachsen. Nike möchte sich bewegen, möchte die Augen öffnen, einen Schluck Wasser trinken und sich an der Nase kratzen. Sie hätte nicht geglaubt, dass es so anstrengend sein kann, einfach nur zu sitzen. Aber sie beherrscht sich. Sie wollte eine Seance erleben, bitte, sie ist mittendrin. Aber wie lange wird das gehen? Unermüdlich leiert die Stimme: »Wir rufen dich, oh Herr, der du über das Dunkel wachst. Wir rufen dich, Herr, der du die Ewigkeit auf der anderen Seite bestimmst. Offenbare dich uns! …«
Nike riecht die Ausdünstungen der Körper im Kreis. An ihrer Seite der leise rasselnde Atem Johannes von Aues. Sie zwingt sich, die Augen geschlossen zu halten. Irgendwo in ihr entsteht ein neuer, ein sechster Sinn, wächst und wird deutlich. Kein Toter meldet sich, sondern Johannes von Aue, der schweigende Mann neben ihr. Der Tisch, der Raum treten zurück, und so klar als hätte er es ausgesprochen, kann sie die Geschichte seiner Erkrankung hören, die ihn umbringen und so das alte Geschlecht der von Aues auslöschen wird. Er ist der letzte seiner Art und hat sich gegen ein Leben entschieden, in dem alles vorherbestimmt war, ein Leben, das nur darauf wartete, dass er die richtige Schuhgröße erreichen würde, um ihm ein weiteres Paar längst ausgetretener Schuhe überzustreifen. Ausgetreten von edlen Füßen zwar, aber niemals waren sie neu und nur für ihn und immer folgten sie einem vorbestimmten Weg. Seine Krankheit ist eine Revolte. Still und defensiv ist sie doch ein Aufbegehren. Nike legt ihre Hand auf seine. Er zieht sie darunter hervor und schließt erneut den Kreis. Er will es so und nicht anders. Etwas in ihr gibt nach. Sie lässt sich vom heiser gewordenen Singsang des Mediums tragen, nimmt wahr, wie sich irgendwo in ihrem Inneren Dulden und Wollen auf zwei Waagschalen einpendeln. Das Sitzen wird leicht, die Zeit steht. Sie wartet auf nichts mehr, wird durchscheinend, ein Sandkorn im Innern einer weißen Düne. Und bevor sich auch dieses Sandkorn auflöst, hebt sich plötzlich der Tisch unter ihren Händen und fällt laut krachend zurück.
»Sie sind da«, keucht das Medium. Auf beiden Seiten wird das Band der Hände unterbrochen. »Wir danken dir, dass du gekommen bist. Einer der unseren wird bald bei dir sein. Er fürchtet sich. Willst du ihn hören?« Die Anwesenden legen ihre Zeigefinger auf den Boden der Schale in ihrer Mitte. Nike legt ihren als letzte obenauf und sofort beginnt die Schale zwischen den Buchstaben des Kreises umherzufahren. Heisere Stimmen buchstabieren: S-P-R-I-C-H. Das Medium nickt Johannes von Aue zu. »Frag, was du zu fragen hast. Er ist bereit. Aber fasse dich kurz.«
Er räuspert sich. »Wird es weh tun? Werde ich Schmerzen haben?« Die Schale fährt mit wilden Zacken durch den Kreis: H-I-E-R I-S-T D-A-S E-N-D-E A-L-L-E-R S-C-H-M-E-R-Z-E-N. Nike spürt, wie Johannes von Aue neben ihr zusammenzuckt. Seine Mutter schluckt mit feuchten Augen. Mumpitz, denkt sie, da stöhnt das Medium leise, fast ein wenig wollüstig und gebietet den Anwesenden die Finger wieder auf die Schale zu legen. I-S-T M-E-I-N-E T-O-C-H-T-E-R U-N-T-E-R E-U-C-H. Abrupt zieht Nike ihre Hand zurück. Sie ist erschrocken wie selten. In den kleinen Augen des Mediums steht eine fiebrige Erregung. Es ist erst ein knappes Dreivierteljahr her, da wurde ihr Vater, der Bankier Eduard Fromm, von einem geistesgestörten Jungen ermordet. Ein jäher Verlust, der viel Ungesagtes zwischen Vater und Tochter übrig ließ. Mit diesem scheinbaren Vorstoß aus dem Reich der Toten hat sie nicht gerechnet und er geht ihr entschieden zu weit. Sie wollte sich amüsiert gruseln, das war ihr Plan. Etwas Zerstreuung nach einem aufregenden Tag. Was sie auf gar keinen Fall wollte, war Johannes von Aues Siechtum auf zweifelhafte Art zu erleichtern und ebenso wenig ist es ihr ein Bedürfnis, die eigene Trauer vor Publikum auszubreiten. Sie ist verärgert, am meisten über sich selbst.
Der Bann ist gebrochen. Die Schale bleibt, wo sie ist, und schweigt. Die übrigen Teilnehmer bewegen die steifgewordenen Gelenke. Sie sind enttäuscht. Nike hat ihnen die Pointe verdorben. Sie schaut zu Johannes, doch der reagiert nicht und sie steht auf. Unsicher läuft sie ein paar Schritte. Ihre Knie sind weich und nachgiebig. Die Tür geht auf und ein Dienstmädchen bringt ein Tablett mit Wein und Wasser. Leise beginnen die Unterhaltungen.
»Der arme Junge.«
»Das ist meine elfte Seance. Ich mache kaum mehr etwas anderes …«
»Die Frau ist gut. Das muss man ihr lassen.«
Das Medium winkt Nike zu sich heran, aber die dreht den Kopf ganz bewusst in die andere Richtung und die kleine Frau huscht weiter. Die Baronin eilt ihr nach.
Nike lässt sich ihre Garderobe bringen. Das Hausmädchen hilft ihr hinein. In der Diele steht noch immer das Medium in einem abgetragenen Mantel und stülpt eine handgestrickte Mütze über. An ihrem Arm baumelt die große Handtasche, aus der die zusammengerollte Matte hervorsteht. Die Baronin steckt ein paar Banknoten hinein und umklammert dankbar ihr Handgelenk. Die Frau schüttelt sie mit einer ungehaltenen Bewegung ab. Ihr fahriger Blick streift Nike, abgewandt spricht sie weiter: »Ihr Vater wird Sie finden. Er hat gerufen, laut und deutlich. Die Toten kriegen ihren Willen, glauben Sie mir. Er kommt, er sucht Sie.«
»Tatsächlich?«, sagt Nike und sonst nichts. Noch bevor das Dienstmädchen zur Stelle ist, öffnet die Frau selbst die Tür und läuft hinaus. Die Gastgeberin seufzt. Nike zwingt sich zu einer zivilisierten Verabschiedung: »Ich möchte mich bedanken, liebe Baronin. Das war ein ganz außergewöhnlicher Abend. Den muss ich erst mal verarbeiten. Ich bin, gelinde gesagt, etwas verwirrt.«
Die Baronin schenkt ihr ein mildes Lächeln. »Sie müssen ihr vertrauen. Sie ist die Beste. Selbst wenn ihr Benehmen manchmal etwas zu wünschen übrig lässt. Die äußere Erscheinung leider auch. Aber darüber müssen wir in diesem Fall hinwegsehen. Was zählt ist allein die mediale Begabung. Die Stadt ist ja diesbezüglich voller Scharlatane. Was habe ich nicht schon für grauenhafte Vorstellungen von selbsternannten Medien über mich ergehen lassen. Tand und Talmi, falsche Bärte und ein fremdländischer Akzent unterlegt von feinstem Sächseln. Einmal hatten sie sogar künstlichen Nebel. Ein anderes Mal stand ein sprechender Geist meines Erachtens nach ganz zweifelsfrei hinter dem Vorhang. Ein gräßlicher Mummenschanz. Aber sie, dieses Fräulein Schwandke, auf das Fräulein besteht sie, sie ist ganz großartig. Sie hat die Gabe. Alle sind sich sicher. Diese Frau hat wirklich Kontakt nach …«, sie zögert, »nach drüben oder wie immer man das nennen will. Sie hat den Enkel einer guten Freundin beschworen. Nur fünf Jahre ist er alt geworden. Die Masern. Er hat das Fieber nicht verkraftet. Das war herzzerreißend. Auch den Baron hat sie für mich geholt und wird es wieder tun. Das ist ein großer Trost, wo ich doch bald schon ganz allein sein werde.« Sie schnäuzt sich in ein Tuch mit dem gestickten Wappen ihres gebeutelten Geschlechts. »Sie sollten über ihre Worte nachdenken. Ihr Vater sucht nach Ihnen. Seien Sie froh, dass er sich zu erkennen gibt. Meinen Mann, den Baron, hat Fräulein Schwandke erst in mehreren Anläufen überreden müssen. Das ist allerdings zu seinen Lebzeiten ganz genauso gewesen. Er neigte nicht zur Plauderei. Überlegen Sie es sich. Ich schicke Ihnen eine Einladung zur nächsten Seance.«
Nike zögert. »Ich weiß noch nicht, ob ich dabei sein möchte. Ich brauche etwas Zeit.« Sie küsst die Baronin zum Abschied auf beide Wangen. »Bestellen Sie Johannes meinen Gruß. Er schien ganz in sich versunken zu sein. Ich wollte ihn nicht stören. Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen noch einmal wieder, um ihn zu besuchen.«
»Nike, unser Haus steht Ihnen jederzeit offen. Das wissen Sie.« Fröstelnd weicht die Baronin von der Tür zurück ins warme Innere.
Nike läuft erleichtert die Stufen des Treppenhauses hinab. Draußen ist die Nacht klar, die Luft kalt und frisch.
2
Dienstag, 17. November 1925
Zunehmender Mond in Schütze:Weit- und Zuversicht.
Mit schweren Schritten und einer leichten Unsicherheit auf der Geraden nähert sich der Barkeeper Jake Heuer nach einer langen Schicht seiner Bleibe, der Pension Koch, die er gemeinsam mit Spiro und der Wirtin Margarete, von allen nur Gretchen genannt, bewohnt. Sein Foxterrier Erbse trottet verschlafen an der Leine, dann stemmt er alle Viere in den Boden, um sich ein letztes Mal hinzuhocken. Jake schlingert am anderen Ende der Leine, dann stoppt auch er und sieht sich um. Mit ein paar Gläsern Absinth haben sich Inspiration und Dichtung an seine Seite begeben, sie haben ihn links und rechts untergehakt und seinen Heimweg in ein Epos verwandelt. Die Straße Am Karlsbad liegt Grau in Grau, die Dämmerung ist noch zu schwach für Farben. Ein Mann schleppt sich nahe der Hausmauern übers Trottoir. ›Im Morgengrauen schon erschöpft wie Sisyphos‹, denkt Jake. ›Die lange Reihe armer Schweine reicht durch die Jahrtausende bis hierher, bis jetzt, bis in diese Sekunde.‹ Er kann sie grunzen hören. Durch leere Straßen reihen sich die Schweine, durch Moore und Äcker, über Berge und Täler bis an die Hänge eines steinigen Hügels in Ithaka. Er ist überwältigt. Dann wird sein Moment der Erkenntnis gestört. Mit klackernden Absätzen hastest eine Eifrige durch die verschwommene Weite der Straße. Jake verliert für einen kurzen Augenblick das Gleichgewicht. ›Unangenehm, diese mit dem Lineal gezogene Geradlinigkeit. Geradezu beängstigend.‹ Zu seiner Beruhigung schlurft gleich darauf ein Kind mit unbegrenzten Zeitreserven planlos durch den Rinnstein. Jake lächelt. Ein wartender Chauffeur, ein dunkler Berg hinter seinem Steuer, schlägt die Zeit tot. Ruhende Masse, in der ab und an eine Zigarette aufglüht. Absinth ist doch eine feine Sache, denkt Jake. Der bringt einen auf Ideen. Erbses Geschäft ist erledigt, sie setzen sich wieder in Bewegung. Er zieht den unwilligen Hund in die Mitte der Straße, weist mit kreisendem Arm auf die schlafenden Fenster und lacht. »Sie stützen sich«, erklärt er dem skeptischen Tier, »sonst würden sie fallen, die Bürgerhäuser. Sie stehen Schulter an Schulter in einer Reihe. Aber würde man sie fragen, wären sie lieber Villen, weitläufig und elegant, hingegossen in üppige Gärten, erreichbar nur über knirschende Wege aus weißem Kies. Der ganze Zierrat, die Simse, Statuen und Säulen, die angeklebten Ranken und Rosetten aus Gips können uns nicht täuschen. Auf vier Etagen liegt die Ambition der Großbürger übereinander wie die Schichten einer Torte. Sie würden so gerne repräsentieren, aber die plumpe Schwere der Sparsamkeit bleibt ihnen auf den Leib geschrieben.« Er lacht, Erbse sieht ihn an. Feuchte, dunkle Augen, unergründlich wie die einer Sphinx. »Glaub’s mir. Zwischen sich dulden sie an manchen Stellen noch die alten Gewerbe oder die Reste ehemaliger Landwirtschaft. Wo heute unsere Terasse ist haben mal Hühner gepickt. Kannst Du Dir das überhaupt vorstellen? Die Fabriken und die Bauernhäuser mit ihren Scheunen und Ställen sind noch ehrlich. Sie wollen gar nichts repräsentieren, sie sind Arbeitsstätten, nichts weiter. Sie wissen, dass es vollkommen ausreicht, einfach seinen Zweck zu erfüllen.« Erbse gähnt und schüttelt sich. »Banausin«, sagt Jake und setzt sich wieder in Bewegung. Der unerwartete Ansturm frühmorgendlicher Wahrheit jagt ihm einen Schauer über den Rücken. Beeindruckt vom eigenen Tiefsinn fädelt er endlich nach mehreren Anläufen den Schlüssel ins Torschloss.
Im weiten Hinterhof, an dessen Ende die Pension Koch liegt, steht ein braunes Pferd. Festgebunden an der Balustrade der Terrasse schnaubt es leise und heller Atem dampft aus seinen Nüstern. Erbse prescht vor und erwürgt sich fast an ihrem Halsband. Ihre vornehme Abstammung aus einer Zucht im Süden Englands verpflichtet sie zu furchtloser Jagd, aber auch zu besinnungsloser Raserei. Ihr heiseres Gebell überschlägt sich. Wer in Haus und Hof bisher noch nicht wach war, ist es jetzt. Jake blickt nachdenklich auf das Pferd, greift sich schließlich den bebenden Hund und hält ihm die Schnauze zu. Das Pferd steigt aufgeregt und reißt an seinem Strick. Aus der Tür schiebt sich Spiros zerzauster Kopf, an ihm vorbei drückt sich Nike.
»Guten Morgen, Schönste. Gehört dieses große Tier etwa dir? Erbse hätte vor Schreck fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich übrigens auch.«
»Morgen, Jake«, grüßt Nike und streift mit freundlicher Hand im Vorbeigehen seine Wange. Mit leiser, dunkler Stimme spricht sie zu dem Pferd, fängt seinen hochgerissenen Kopf mit festem Griff in die Mähne, zieht ihn zu sich, liebkost die geweiteten, weichen Nüstern, gurrt weiter, krault und streichelt, bis es sich beruhigt.
In der Küche hat Spiro den Kessel aufgesetzt und Kaffee gemahlen. Erbse lungert noch immer aufgebracht knurrend vor der Tür.
»Wolltet ihr nicht gestern vorbeigekommen sein? Gewartet habe ich die ganze, öde Nacht«, sagt Jake.
Spiro gießt auf. »Nike ist nicht aufgetaucht. Ich habe hier herumgesessen, dann war es spät und ich bin ins Bett. Gegen sechs hat sie an mein Fenster geklopft.«
Jake grinst. »Geringfügig verspätet.«
»Was will man machen?« In Spiros Morgenmantel gleitet Nike in die Küche.
Jake schnüffelt. »Woher kenne ich diesen Geruch? Ländlich-sittlich, ich erinnere mich vage.«
»Das ist das Pferd, das mir seinen Duft angeschmiert hat«, gesteht sie bereitwillig und zieht die bloßen Füße unter den Körper.
Spiro betrachtet diese Füße und denkt, dass er sie gern in seinen Händen wärmen würde, aber er murmelt nur: »Man gewöhnt sich dran«, und haucht ihr einen Kuss aufs Haar. Als sie im frühen Halbdunkel unter seine Decke schlüpfte, war es noch feucht vom Tau, Nase und Ohren kalt, nur ihre Lippen waren warm und weich. Er hat sie nicht gefragt, warum sie gestern nicht gekommen ist. In einer eigentümlichen Mischung aus Hast und Hingabe hat er sie geküsst und wäre es nach ihm gegangen, hätte dieser Kuss weitergehen können bis ans Ende aller Tage. Eine zugegebenermaßen lange Zeitspanne, die durch Erbses hysterisches Gebell abrupt und empfindlich verkürzt wurde. Trotzdem. Wie so oft in ihrer Gegenwart muss er sich zusammenreißen, damit er nicht besinnungslos, aber glücklich grinsend den Idioten gibt. Idioten mag sie nicht, das weiß er, und macht sich instinktiv bisweilen rar, stürzt sich in die Arbeit, geht boxen, will ihr Erfolge präsentieren wie ein Jagdhund seine apportierte Beute. Manchmal fragt er sich, ob sie dieselbe Strategie verfolgt. Auch sie ist ehrgeizig. In nächster Zeit schließt sie ihr Studium ab und sie ist gut, sehr gut sogar. Bald wird sie ihr letztes Examen schreiben und schon jetzt gibt es Offerten für die Anstellung danach. Ob er selbst dann noch immer eine Rolle in ihrem Leben spielt, eine größere, länger angelegte, daran verbietet er sich zu denken. Bloß keine Pläne, die sie verschrecken könnten. Jede Minute mit ihr ist kostbar, als könne sie sich in der nächsten auflösen, ein großes, aber flüchtiges Glück. Doch wenn er ehrlich ist, hätte er es gern etwas verbindlicher. Er möchte wissen, wohin diese Liebe geht, ob sie überhaupt irgendeine Richtung hat oder nur einer ihrer Launen folgt. Wenn er nachts neben ihr liegt und hört, wie ihr Atem leichter und gleichmäßiger wird, spürt, wie sich ihr warmer Körper an seiner Seite entspannt, drängen ihn Fragen, nagen und bohren. Aber er wagt nicht, sie auszusprechen.
Auf ihrem Stuhl kauernd, folgt sie ihm nun mit einem schwer zu deutenden Blick.
»Wo drückt der Schuh? Was ist los?«, fragt er.
»Ich sag’s, aber du musst versprechen, dass du mich nicht auslachst.«
Er hebt die Finger zum Schwur und sie nickt zufrieden.
»Gestern Abend war ich bei den von Aues. Baron Johannes von Aue, ein Jugendfreund, stirbt, er hat Tbc. Das ist natürlich unendlich traurig, aber darum geht es jetzt erst einmal gar nicht. Seine Mutter, die Baronin, hat ein Medium eingeladen, eine merkwürdige, kleine Frau, die angeblich Kontakt zum Totenreich aufnehmen kann, zu den Geistern der Verstorbenen, um genau zu sein. Johannes hat verständlicherweise Angst vor dem bevorstehenden Ende. Die Seance sollte ihm helfen und hat es vielleicht sogar getan. Aber aus dem Geisterreich meldete sich angeblich auch mein Vater, weil er mir etwas zu sagen hätte. Das zumindest versuchte dieses Medium mir weiszumachen. Natürlich glaube ich nicht an so einen Hokuspokus, aber eigenartig ist es schon.«
In Spiro meldet sich der Polizist. »Aber was genau dir der Geist deines Vaters sagen möchte, das erfährst du sicher erst, nachdem du ihren medialen Fähigkeiten mit 100 Reichsmark auf die Sprünge geholfen hast. Richtig? Scharlatanerie heißt vor Gericht übrigens Betrug und kann bis zu fünf Jahre hinter Gitter bedeuten. Soll ich mir die Dame mal vorknöpfen?«
»Untersteh dich, das ist einzig und allein meine Angelegenheit.« Sie zieht den Morgenmantel enger zusammen. »Ich war neugierig. Tout le monde rennt zu Seancen, pendelt, legt Karten und starrt in den Kaffeesatz. Ich wollte bloß mal gucken, was sie da so treiben. Man muss schließlich mitreden können.«
Spiro schnauft. »Es ist eine Pest. Kaum hat sich die Religion in die Kirchen zurückgezogen, wo sie meiner bescheidenen Meinung nach auch hingehört, kriecht der Aberglaube aus allen Löchern. Es ist, als wären alle gleichzeitig verrückt geworden.« Er hat sich ereifert.
Nike zieht ihn auf: »Acht Uhr früh und die Welt geht bereits unter? Mach mal halblang und lass ihnen den Spaß. Sie werden schon wieder zur Vernunft zurückfinden.«