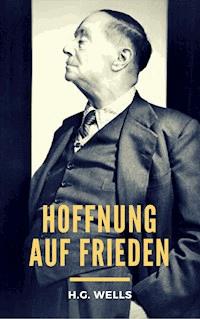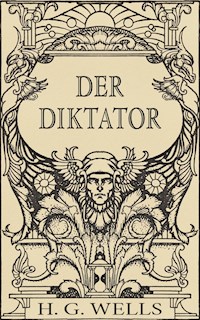
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einige Zeit hindurch war Mr. Parham dem Gedanken, einer spiritistischen Sitzung beizuwohnen, wozu Sir Bussy Woodcock ihn aufgefordert hatte, in stärkstem Maße abgeneigt. Mr. Parham wollte mit Spiritismus nichts zu schaffen haben. Gleichzeitig aber wollte er seine Beziehungen zu Sir Bussy Woodcock nicht lockern. Sir Bussy Woodcock war einer jener ungebildeten Plutokraten, deren Umgang Männer von überragender Intelligenz heutzutage pflegen müssen, wenn sie nur den geringsten Ehrgeiz in sich verspüren, beim Schauspiel des Lebens mehr zu sein als bloße Zuschauer. Reiche Abenteuer solcher Art sind unter den heutigen Bedingungen die notwendigen Vermittler zwischen edlem Denken und gemeiner Wirklichkeit. Die Notwendigkeit einer so schwierigen und dabei so entwürdigenden Vermittlung ist bedauerlich, doch scheint sie in dieser unerklärlichen Welt nun einmal zu bestehen. Der Denker und der Mann der Tat sind einander nötig – zumindest scheint der Denker ihres Zusammenwirkens zu bedürfen. Sowohl Plato wie auch Konfuzius oder Machiavelli mußten sich einen Fürsten suchen. Heutzutage, da Fürsten auf schwachen Beinen stehen, müssen Denker sich an reiche Leute halten. Es ist schwer, reiche Leute zu finden, die für geistige Bestrebungen etwas übrig haben, und hat man sie gefunden, so sind sie zumeist recht störrisch. An Sir Bussy zum Beispiel gab es so manches, was ein Mensch von hoher Geistigkeit kaum ertragen hätte, wenn ihm nicht die wunderbarste Selbstbeherrschung eigen gewesen wäre. Sir Bussy war ein kleiner Mann mit rotem, sommersprossigem Gesicht, einer hochgestülpten Nase, wie man sie heute so häufig findet, und einem Mund, der einer aufs Geratewohl ins Gesicht gesetzten Schmarre glich; er war untersetzt, was einen Menschen von hohem, schlankem Wuchs an und für sich schon unangenehm berühren muß, und er bewegte sich mit einer Lebhaftigkeit und Hast, die einem oft auf die Nerven fiel und jederzeit bewies, daß Sir Bussy gewisse, einem kultivierten Geiste unerläßliche …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. G. WellsDERDIKTATORoderMr.Parhamwirdallmächtig
ERSTES BUCHEine hoffnungsvolle Freundschaft
1Mr. Parham und Sir Bussy Woodcock
Einige Zeit hindurch war Mr. Parham dem Gedanken, einer spiritistischen Sitzung beizuwohnen, wozu Sir Bussy Woodcock ihn aufgefordert hatte, in stärkstem Maße abgeneigt.
Mr. Parham wollte mit Spiritismus nichts zu schaffen haben. Gleichzeitig aber wollte er seine Beziehungen zu Sir Bussy Woodcock nicht lockern.
Sir Bussy Woodcock war einer jener ungebildeten Plutokraten, deren Umgang Männer von überragender Intelligenz heutzutage pflegen müssen, wenn sie nur den geringsten Ehrgeiz in sich verspüren, beim Schauspiel des Lebens mehr zu sein als bloße Zuschauer. Reiche Abenteuer solcher Art sind unter den heutigen Bedingungen die notwendigen Vermittler zwischen edlem Denken und gemeiner Wirklichkeit. Die Notwendigkeit einer so schwierigen und dabei so entwürdigenden Vermittlung ist bedauerlich, doch scheint sie in dieser unerklärlichen Welt nun einmal zu bestehen. Der Denker und der Mann der Tat sind einander nötig – zumindest scheint der Denker ihres Zusammenwirkens zu bedürfen. Sowohl Plato wie auch Konfuzius oder Machiavelli mußten sich einen Fürsten suchen. Heutzutage, da Fürsten auf schwachen Beinen stehen, müssen Denker sich an reiche Leute halten.
Es ist schwer, reiche Leute zu finden, die für geistige Bestrebungen etwas übrig haben, und hat man sie gefunden, so sind sie zumeist recht störrisch. An Sir Bussy zum Beispiel gab es so manches, was ein Mensch von hoher Geistigkeit kaum ertragen hätte, wenn ihm nicht die wunderbarste Selbstbeherrschung eigen gewesen wäre. Sir Bussy war ein kleiner Mann mit rotem, sommersprossigem Gesicht, einer hochgestülpten Nase, wie man sie heute so häufig findet, und einem Mund, der einer aufs Geratewohl ins Gesicht gesetzten Schmarre glich; er war untersetzt, was einen Menschen von hohem, schlankem Wuchs an und für sich schon unangenehm berühren muß, und er bewegte sich mit einer Lebhaftigkeit und Hast, die einem oft auf die Nerven fiel und jederzeit bewies, daß Sir Bussy gewisse, einem kultivierten Geiste unerläßliche Hemmungen völlig fehlten. Sein ganzes Gehaben hatte etwas Gieriges. Wenn man mit ihm sprach, schwätzte er mitten in eine wohlangebrachte Pause hinein, und Mr. Parham, der es lange Zeit hindurch gewohnt gewesen war, zu stummen Studenten zu sprechen, hatte nichts so trefflich gelernt wie die wohlüberlegte Anbringung von Pausen inmitten der Rede. Ein gut Teil seiner Besonderheit ging verloren, wenn man Mr. Parham das bedeutsame Schweigen inmitten des Gesprächs unmöglich machte. Doch Sir Bussy besaß kein Verständnis für dies bedeutsame Schweigen. Wann immer man bedeutsam schwieg, pflegte er auf eine sozusagen verheerende Art und Weise den Mund zu einem hastigen »Was wollten Sie sagen?« aufzutun. Und sein Lieblingswort war »Nu!« Er sagte es unaufhörlich, in mannigfachstem Tonfall und schien sich damit niemals an irgend eine bestimmte Person zu wenden. Das Wort bedeutete nichts oder konnte, was weit ärgerlicher war, alles bedeuten.
Der Kerl war von niedriger Herkunft. Sein Vater war Hansomkutscher in London gewesen, seine Mutter Pflegerin in einer Lungenheilanstalt zu Hampstead – der Vorname »Bussy« ging auf einen interessanten jungen Mann unter ihren ehemaligen Patienten zurück; und der Sohn der beiden hatte, im Alter von vierzehn Jahren bereits von Ehrgeiz erfüllt, einen recht anstrengenden Fortbildungskurs mit der tagfüllenden Arbeit bei dem geschwätzigen Inhaber eines Annoncenbüros vertauscht, weil, wie er sagte, »dies andere Zeug keinerlei Zweck hatte«. Das »andere Zeug« war, muß man wissen, Wordsworth, die Reformation, Morphologie der Pflanzen und National-Ökonomie, dargestellt durch blasierte und ein wenig dunkel spöttische junge Herren von den Universitäten.
Tolerant, weitherzig und von dem Wunsche erfüllt, durchaus modern zu sein, war Mr. Parham stets bemüht, diese Tatsachen zu vergessen. Er vergaß sie niemals wirklich, doch so oft er mit Sir Bussy zusammen war, versuchte er, es zu tun. Sir Bussys Aufstieg von solchen Anfängen zu Reichtum und Macht war eine der zahllosen märchenhaften Geschichten aus dem modernen Geschäftsleben. Mr. Parham ließ es sich angelegen sein, so wenig wie möglich darüber zu wissen.
Der Mann war nun einmal da. In knapp einem Vierteljahrhundert, während welcher Zeit Mr. Parham sich hauptsächlich mit unvergänglichen Dingen beschäftigt und Prüfungsarbeiten darüber durchgesehen hatte, war Sir Bussy zum Beherrscher einer reichen Fülle vergänglicher, aber greifbarer Phänomene geworden; zu diesen zählte ein großes Annoncenunternehmen, ein wichtiger Teil des Kleinhandels mit Lebensmitteln, eine Gruppe von Hotels, Plantagen in den Tropen, Kinos und noch so manches andere, wovon Mr. Parham nicht eigentlich Kenntnis, wohl aber eine gefühlsmäßige Ahnung hatte. Über diese kurzlebigen Erscheinungen gebot Sir Bussy während jener Stunden seiner Tage, die er nicht dem geselligen Leben widmete; auch wurde er gelegentlich um ihretwillen inmitten einer Gesellschaft ans Telephon gerufen oder führte im Flüstertone Privatgespräche mit jungen Leuten, die plötzlich, man wußte nicht woher, auftauchten. Infolge dieser Tätigkeit, die Mr. Parham stets recht dunkel blieb, lebte Sir Bussy, umgeben von einer Schar gehorsamer und unterwürfiger Menschen, so behaglich und luxuriös, daß ein schwächerer oder gemeinerer Geist als der Mr. Parhams davon völlig überwältigt worden wäre. Erschien er nachts in einer Haustür, so tauchten wunderbarerweise sofort etliche Chauffeure aus der Dunkelheit auf und standen, die Hand grüßend an der Mütze, vor ihm; er sagte »Nu!« und machte damit auf die allerfeinsten Bedienten Eindruck. In einer lichtvolleren Welt hätte es anders sein können, in dieser aber galt Mr. Parham den Chauffeuren des Sir Bussy offenkundig als ein unnützes Menschenwesen, das mit sich herumzuschleppen Sir Bussy Vergnügen machte, und wenn auch die Dienerschaft in Buntincombe, im Carfex House, Marmion House sowie in The Hangar Mr. Parham als Gentleman behandelte, so tat sie das doch sichtlich mehr infolge ihrer guten Erziehung, als weil sie ihn für einen solchen hielt. Immer wieder empfand man Sir Bussy als Wunder. Er konnte einer Unzahl von Menschen Befehle erteilen, doch war es Mr. Parham durchaus klar, daß er im Grunde keineswegs wußte, was er von den Leuten wollte. Aber er erteilte ihnen jedenfalls Befehle. Es war nur natürlich, daß Mr. Parham dachte: »Wenn ich so viel Macht besäße wie er, würde ich Erstaunliches leisten.«
Zum Beispiel hätte Sir Bussy Geschichte machen können.
Mr. Parham hatte sich sein ganzes Leben hindurch mit Geschichte und Philosophie befaßt. Er hatte mehrere historische Studien geschrieben – hauptsächlich über Richelieu und dessen Zeit, wobei er tiefer in die Eigenart Richelieus eingedrungen war als irgend ein Historiker vor ihm; er hatte Sonder-Geschichtskurse abgehalten; er hatte der Welt einen Band Essays geschenkt; er war Chefredakteur der populären Zeitschrift »Philosophy of History« und schrieb kritische Abhandlungen über die Arbeiten bedeutender Gelehrter, Abhandlungen, die – mitunter zu seinem Leidwesen zusammengestrichen und verstümmelt – im Empire, dem Weekly Philosopher und der Georgian Review erschienen. Niemand vermochte einer neuen Idee, die Form anzunehmen versuchte, so schneidig und dabei liebenswürdig den Garaus zu machen wie Mr. Parham. Und da er die Geschichte und die Philosophie so sehr liebte, war es ihm eine Qual, fühlen zu müssen, wie schlecht die Verworrenheit unserer Zeit zu dem paßte, was als Geschichtswissenschaft oder als reine Philosophie bezeichnet wird. Der Weltkrieg war ein Stück Geschichte, das sah er ein, wenn auch ein sehr klumpiges, rohes und widerspenstiges, und die Konferenz von Versailles war ebenfalls Geschichte – Geschichte in noch weiter fortgeschrittener Entartung. Man konnte diese Konferenz immerhin noch als einen Wettstreit zwischen dieser und jener Macht hinstellen, konnte von einem Kampf um die »Vorherrschaft« sprechen und die »Staatskunst« dieses oder jenes Menschen oder auswärtigen Amtes mit subtiler Logik auslegen.
Von 1919 an jedoch wurde alles fortschreitend schlimmer. Personen und Ereignisse verloren in immer stärkerem Maße jegliche Bedeutung. Sinnlosigkeit, eine Verwirrung aller Werte machte sich im Fluß der Geschehnisse geltend. Da war zum Beispiel Mr. Lloyd George. Wie sollte man einen derartigen Mann behandeln? Nach einem Höhepunkt von der Art der Versailler Konferenz hat eine geschichtliche Persönlichkeit ihre Laufbahn zu beenden und die Historiker ans Werk schreiten zu lassen, wie es Woodrow Wilson ja auch wirklich getan hatte, und vor ihm Lincoln, Sulla, Cäsar oder Alexander. Geschichtliche Persönlichkeiten haben einen Höhepunkt zu erreichen und sich dann sozusagen abzurunden, unangenehme Tatsachen müssen Stück für Stück von ihnen abfallen, so daß man sie allmählich mit immer größerer Sicherheit historisch auffassen kann. Die Wirklichkeit der Geschichte bricht dann eben durch den ganz oberflächlichen äußeren Schein hindurch; die Logik der Ereignisse tritt zu Tage.
Wo aber waren nun die Machtfaktoren? Um was für Kräfte handelte es sich? Angesichts von Dingen, wie sie heute vor sich gehen, fühlte sich dieser geschulte Historiker wie ein gewandter Bildschnitzer, von dem man verlangt, daß er aus einer Flüssigkeit ein Bildwerk schneide. Wo war das Grundgerüst? – überhaupt irgend ein Grundgerüst? Ein Mann wie Sir Bussy hätte in einem großen Kampfe zwischen den neuen Reichen und der älteren Oligarchie eine Rolle spielen sollen; er hätte einem römischen Ritter gleichen sollen, der den Patriziern gegenübersteht. Mit ihm hätte gewissermaßen das Zeitalter der Wahlrechtsdemokratie zu einem endgültigen Abschluß kommen müssen. Er hätte eine neue Phase in der Geschichte Großbritanniens, hätte das neue Imperium verkörpern sollen. Tat er das aber? Vertrat er überhaupt irgend etwas? Zu Zeiten überkam Mr. Parham ein Gefühl, als würde er verrückt werden, wenn es ihm nicht gelingen sollte, Sir Bussy zu einem Vertreter von irgend etwas zu stempeln, irgend etwas formell und historisch Bestimmtem.
Die altehrwürdigen Entwicklungsprozesse der Geschichte mußten doch wohl immer noch weitergehen – ohne Zweifel gingen sie immer noch weiter. Was hätte sonst vor sich gehen sollen? Sicherheit und Vorherrschaft – in Europa, in Asien, im Finanzwesen – wurden mit würdevollem Ernst von Mr. Parham und ihm verwandten Seelen in den bedeutenderen Wochen- und Monatszeitschriften besprochen. Überall gab es immer noch Regierungen und auswärtige Ämter, und sie schlugen sich den Regeln entsprechend, anständig und ordnungsgemäß durch die Phasen eines Kampfes um Weltherrschaft hindurch. Jede irgendwie bedeutsame Verhandlung oder Abmachung zwischen den Mächten wurde nunmehr streng geheim gehalten. Die Spionage war niemals noch so ausgebreitet, gewissenhaft und angesehen gewesen, und das Doppelkreuz der christlichen Diplomatie herrschte von Washington bis Tokio. Großbritannien und Frankreich, Amerika, Deutschland und Moskau unterhielten Flotten und Heere, führten höchst würdevolle diplomatische Verhandlungen und trafen geheime Abmachungen miteinander sowie gegen einander, just als ob es das alberne Gerede von einem »Krieg, der den Krieg aus der Welt schaffen soll«, niemals gegeben hätte. Das bolschewistische Moskau hatte nach einer beunruhigenden Anfangsphase zu den besten Überlieferungen des auswärtigen Amtes der Zarenherrschaft zurückgefunden. Hätte Mr. Parham das Vorrecht eines freundschaftlichen Verkehrs mit Staatsmännern gleich Sir Austin Chamberlain und Mr. Winston Churchill oder Monsieur Poincaré genossen, wäre er von dem einen oder dem anderen zum Abendessen eingeladen worden, so würden sich nach beendigtem Mahle, bei zugezogenen Fenstervorhängen und indes Portwein und Zigarren sich, Schachfiguren vergleichbar, in nachdenklicher Unregelmäßigkeit über das schimmernde Mahagoni hin bewegten, Gespräche ergeben haben, die ihn warm und behaglich zu seinem unbedingten Glauben an die Geschichte zurückgeführt hätten, an die Geschichte, wie er sie gelernt hatte und lehrte.
Leider boten sich ihm jedoch derartige gesellschaftliche Möglichkeiten nicht – trotz seiner lebendig aufschlußreichen Bücher und seiner trefflichen, ja mitunter geradezu bedeutenden Artikel.
Da ihm ein beruhigender Umgang solcher Art fehlte, tauchte ein seltsamer Gedanke in seinem Geiste auf und gewann an Kraft, der Gedanke nämlich, daß rings um die gegenwärtigen Erscheinungen des historischen Geschehens etwas ganz Anderes und Neues im Gange sei und diese Erscheinungen, wenn auch nicht gerade bedrohe, so doch bedeutungslos mache. Es fiel ihm schwer zu sagen, was dieses Andere sein mochte. Es äußerte sich als eine riesengroße und stetig zunehmende Gleichgültigkeit. Es zeigte sich in der Tatsache, daß alle Welt so lebte, als ob die ernstesten Dinge des Daseins gar nicht mehr ernst zu nehmen wären.
Als ob es vielmehr andere ernste Dinge gäbe. Und während der letzten Jahre hatte jenes Etwas sich Mr. Parham insbesondere in Sir Bussy gezeigt. Eines Nachts stellte Mr. Parham sich eine sehr ernste Frage. Es war ihm späterhin zweifelhaft, ob er sich in tiefes Brüten verloren habe oder von einem Alpdrücken heimgesucht worden sei, ob er nachgedacht oder nur geträumt habe, er denke nach. Angenommen – in dieser Form kam ihm die Sache in den Sinn – angenommen, Staatsmänner, Diplomaten, Fürsten, Professoren der Nationalökonomie, Militär- und Marinesachverständige, mit einem Wort, alle gegenwärtigen Erben der Geschichte, führten eine verwickelte, schwierige und gefährliche Situation herbei, eine Situation, in der Noten und Gegennoten getauscht, Äußerungen getan und sogar Ultimata gestellt würden, so daß es schließlich ob irgend einer »Frage« zu einer Kriegserklärung käme. Und angenommen – oh Entsetzen! – angenommen, die Menschen im allgemeinen und Sir Bussy im besonderen würden sich das Ganze gelassen ansehen, würden »Nu« oder »Was wollt ihr eigentlich?« sagen und sich abwenden. Sich abwenden und zu ihrer gewohnten Beschäftigung zurückkehren, der Beschäftigung mit Dingen, die für die Geschichte belanglos sind? Was würden die Erben der Geschichte dann tun? Würden die Soldaten es wagen, mit der Pistole gegen Sir Bussy vorzugehen? Würden die Staatsmänner ihn beiseite schieben? Angenommen, er würde sich nicht beiseite schieben lassen, sondern in der ihm eigenen, sonderbaren hinterhältigen Art und Weise Widerstand leisten. Angenommen, er würde sagen: »Schluß mit alledem – und zwar sofort!« Und angenommen, die anderen würden entdecken, daß sie wirklich Schluß damit zu machen haben!
Was sollte dann aus unserem geschichtlichen Erbe werden? Wo bliebe das Reich, die Großmächte, unsere nationalen Überlieferungen und unsere Politik? Ein absonderlicher Gedanke, diese Vorstellung, daß die historische Tradition völlig zusammenbrechen sollte; so absonderlich, daß er Mr. Parham in wachem Zustand niemals in den Sinn gekommen wäre. Es gab in Mr. Parhams Geist tatsächlich nichts, worauf ein solcher Gedanke sich hätte stützen, keinerlei Begriffe, mit denen er sich hätte verknüpfen können; trotzdem faßte er Fuß und belästigte Mr. Parham wie eine alberne Melodie, die einem nicht aus dem Kopf will. »Sie werden nicht gehorchen – wenn die Zeit kommt, werden sie nicht gehorchen«; das war der Kehrreim. Was danach aus dem menschlichen Leben werden sollte, vermochte Mr. Parham sich nicht vorzustellen. Es konnte nichts anderes kommen als das Chaos!
Worin Sir Bussy, das fühlte er, doch noch weiterleben würde, verwandelt vielleicht, aber in unverminderter Kraft. Erschrecklich. Triumphierend.
Nunmehr war Mr. Parham völlig wach, darüber konnte kein Zweifel herrschen, und er lag wach, bis die Morgendämmerung kam.
Die Muse der Geschichte mochte vom Aufstieg großer Dynastien erzählen, von der Vorherrschaft dieser oder jener Macht, von den ersten Anfängen des Nationalismus in Mazedonien, von dem Verfall und dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, von den endlosen Kämpfen zwischen dem Islam und dem Christentum oder der lateinischen und der griechischen Kirche, von der wunderbaren Laufbahn Alexanders, Cäsars und Napoleons, sie mochte das Zauberbuch der großen Taten aufschlagen und so Sir Bussy aufzurütteln sich bemühen, damit er seine Rolle spiele, seine untergeordnete, aber dennoch bedeutsame Rolle in ihrem stetig fortschreitenden Drama: Sir Bussy lauschte ihrer Rede stets nur schlaftrunken, hielt allem Anscheine nach nicht viel davon, verlor sich, irgend einem seiner eigenen Gedankengänge folgend, in Regionen, die Mr. Parham unzugänglich blieben, und sagte schließlich »Nu!«
Nu!
Mr. Parham begann sich schwach und elend zu fühlen …
Und um die Schwierigkeiten seines Daseins zu vermehren, war da nun auch noch dieser verfluchte spiritistische Blödsinn, dieser verrückte Gedanke, einer Séance beizuwohnen und Medien ernst zu nehmen, Medien und die widerwärtigen, verrufenen und aufreizend rätselhaften Phänomene rings um sie.
Als es zu dämmern begann, dachte Mr. Parham ganz ernstlich daran, Sir Bussy aufzugeben. Aber er hatte mit diesem Gedanken schon mehrere Male gespielt und immer mit demselben Ergebnis. Schließlich wohnte er nicht nur einer, sondern sogar einer ganzen Reihe von spiritistischen Sitzungen bei, wie dieses Buch berichten wird.
2Wie Sir Bussy und Mr. Parham sich zusammenfanden
Als Mr. Parham Sir Bussy vor fünf Jahren oder mehr zum ersten Male sah, hatte es den Anschein gehabt, als sei in dem großen Finanzmann ein wirkliches Interesse an geistigen Dingen lebendig. Ein bescheidenes, aber ernstes Interesse.
Bei einem von Sebright Smith im Hotel Rialto veranstalteten Herren-Souper hatte Mr. Parham über Michelangelo und Botticelli gesprochen. Es war eine jener Veranstaltungen gewesen, die Mr. Parham als Sebrights wunderbare Geselligkeitskunststücke zu bezeichnen pflegte. Sebright Smith ging allezeit in größter Unbekümmertheit eine Fülle gesellschaftlicher Verpflichtungen ein, und wenn es ihrer so viele geworden waren, daß sie ihn zu bedrücken begannen, gab er ein riesenhaftes Diner oder Souper, um sich ihrer zu entledigen. Es war ihm gleichgültig, welche Leute bei ihm zusammentrafen, er verließ sich darauf, daß der Champagner die Zungen lösen werde. Und der liberal moderne und dabei doch so kultivierte Mr. Parham fand diese Feste entzückend vorurteilslos.
Niemand hört so gut zu wie Leute, die sich in einer Gesellschaft nicht ganz behaglich fühlen, und Mr. Parham, der zum Vielwisser geboren worden war, ließ seiner Zunge freien Lauf. Er sagte Dinge über Botticelli, mit denen ein gewinnsüchtigerer Mann vierzig oder fünfzig Pfund verdient haben würde, indem er sie zu einem kleinen Buche verarbeitet hätte. Sir Bussy lauschte mit einem Gesichtsausdruck, den Leute, die ihn nicht kannten, für boshaft hätten halten können. Jedoch mit Unrecht: Er hatte nämlich die Gewohnheit, den linken Mundwinkel herabzuziehen, wenn ihn etwas interessierte oder wenn er mit irgend einem Aktionsplan beschäftigt war.
Als mit den Zigarren Bewegung in die Gesellschaft kam und Negersänger ein Lied anzustimmen begannen, nahm Sir Bussy die Gelegenheit wahr, sich auf dem neben Mr. Parham freigewordenen Stuhle niederzulassen.
»Sie wissen in diesen Dingen Bescheid?« fragte er, der herzbewegenden Klänge des geistlichen Negerliedes nicht achtend.
Mr. Parham blickte ihm fragend ins Gesicht.
»Alte Meister, Kunst und so weiter.«
»Sie interessieren mich«, sagte Mr. Parham mit freundlich herablassendem Lächeln, denn noch waren ihm Name und Ansehen des Mannes, mit dem er sprach, unbekannt.
»Mich hätten sie vielleicht auch interessieren können – aber ich gab es auf, mich mit ihnen zu beschäftigen. Essen Sie manchmal in der City zu Mittag?«
»Nicht oft.«
»Nun, wenn der Weg Sie einmal dahin führt – nächste Woche zum Beispiel – rufen Sie mich doch im Marmion House an.«
Der Name sagte Mr. Parham nichts.
»Gerne«, erwiderte er höflich.
Sir Bussy schien im Begriff zu gehen. Er schwieg einen Augenblick. »Es mag allerlei hinter der Kunst stecken«, hob er darauf wieder an. »Kommen Sie doch bestimmt. Was Sie sagten, hat mich wirklich interessiert.« Er lächelte, wobei ein seltsamer Schimmer von Liebenswürdigkeit in seinem Gesicht aufleuchtete, um sofort wieder zu verschwinden, und verließ die Gesellschaft lebhaften Schrittes inmitten einer Pause, während welcher Sebright Smith und die Neger mit lauter Stimme besprachen, welches Lied als nächstes gesungen werden sollte.
Ein wenig später suchte Mr. Parham den Gastgeber. »Wer ist der untersetzte kleine Mann mit dem roten Gesicht und den borstigen Haaren, der ganz früh wegging?«
»Meinen Sie vielleicht, daß ich hier jedermann kenne?« sagte Sebright Smith.
»Aber er saß neben Ihnen!«
»Ach so, der! Das ist einer unserer Er- Eroberer«, erwiderte Sebright Smith, der betrunken war.
»Hat er einen Namen?«
»Keinen wird er haben! Sir Blas-dich-auf Bussy-Bussy Kauf-das-Weltall-zusammen Woodcock. Er gehört zu der Sorte Menschen, die alles aufkaufen. Läden, Häuser und Fabriken, Landgüter und Kneipen. Steinbrüche. Ganze Handelszweige. Er kauft die Dinge, die man nötig braucht, und spielt ein bißchen mit ihnen herum, bis man sie dann endlich kriegt. Sie können heute in London kein Stückchen Butter essen, das er nicht zuvor gekauft und wieder verkauft hätte. Eisenbahnen kauft er, Hotels, Kinos und Vorstädte, Männer und Frauen mit Seele und Leib. Passen Sie auf, daß er Sie nicht auch kaufe.«
»Ich bin keine Marktware.«
»Sondern nur unter der Hand zu haben, wie?« meinte Sebright Smith. Der erschrocken fragende Gesichtsausdruck Mr. Parhams belehrte ihn, daß er sich eine Taktlosigkeit hatte zuschulden kommen lassen, und er versuchte sie mit der Frage »Noch ein Glas Champagner?« wieder gutzumachen.
Mr. Parham erblickte einen alten Freund, der ihm zuwinkte, und ließ die Bemerkung seines Wirtes unbeantwortet. Er konnte auch keinerlei Sinn in ihr entdecken, überdies war der Mann offenkundig betrunken. Gegen den Freund hin gewendet, hob er die Hand senkrecht empor, als wolle er einen Wagen aufhalten, und bahnte sich einen Weg zu ihm hinüber.
Im Laufe der folgenden Tage zog Mr. Parham auf sehr diskrete Art Erkundigungen über Sir Bussy ein und beschloß daraufhin überaus nachdrücklich, die Einladung in das Marmion House anzunehmen. Wenn der Mann Unterweisung in Dingen der Kunst haben wollte, sollte er sie bekommen. Hatte nicht Lord Rosebery gesagt: »Wir müssen die Leute erziehen, die uns beherrschen?«
Es sollte ein freundschaftliches Tête-à-Tête werden. Mr. Parham gedachte, seinem Wirt das Tor zur goldenen Welt der Kunst zu öffnen und nebenbei einen langgehegten Traum zu erwähnen, den Sir Bussy mit leichter Mühe in herrliche Wirklichkeit verwandeln konnte.
Dieser Traum, der Mr. Parham während langer Jahre vergeblichen Hoffens zu einem grollenden Vasallen Sir Bussys machen sollte, war der Plan, ein vornehmes und angesehenes Wochenblatt herauszugeben, zweispaltig und mit zurückhaltenden Überschriften. Eine jener Zeitschriften sollte es sein, die zwar keineswegs übermäßig stark verbreitet sind, trotzdem aber die öffentliche Meinung beeinflussen und in der ganzen zivilisierten Welt das geschichtliche Geschehen der Gegenwart lenken. Was der Spectator, die Saturday Review, die Nation und der New Statesman waren und sind, sollte sie sein, und noch mehr. Mr. Parham und einige von ihm entdeckte und beeinflußte junge Leute sollten sie zum größten Teile schreiben. Das ganze Schauspiel des Lebens sollte sie kritisch betrachten, öffentliche Angelegenheiten, Gegenwartsprobleme, Wissenschaft, Kunst und Literatur. Sie sollte für alles Verständnis zeigen, stets gute Ratschläge bereit haben, jedoch niemals von der hohen Warte ihres geistigen Ranges herabsteigen. Bald sollte sie kühn sein, bald würdig streng, bald freimütig, bei keinem Anlaß aber laut oder gemein. Als Herausgeber einer Zeitung hat man etwas vom Wesen Gottes an sich; man ist Gott mit einem einzigen Hemmnis: dem Zeitungsinhaber nämlich. Wenn man jedoch tüchtig ist, kann man Gott mit einem wohlausgearbeiteten Kontrakt sein. Und ohne Gottes Verantwortlichkeit für die Mängel und Fehler des Weltalls, das man betrachtet. Man kann lächeln und Witze reißen, was ihm verboten ist. Denn er würde in den Verdacht kommen, daß er sich die Anlässe zu seinen Scherzen absichtlich geschaffen habe.
»Glossen der Woche« zu schreiben, ist vielleicht eine der reinsten Freuden, die das Leben einem klugen und kultivierten Menschen bieten kann. Man muntert Nationen auf oder weist sie zurecht. Man zeigt, wie Rußland geirrt und Deutschland die Anregung, die man vorvorige Woche gab, sich zunutze gemacht hat. Man analysiert die Beweggründe der Staatsmänner und warnt Bankiers, ja selbst die Großen der Geschäftswelt! Man richtet Richter. Für die oft so törichte Schar der Schreibenden hat man ein Wort des freundlichen Lobes oder der milden Verachtung. Die Künstler bedenkt man mit Komplimenten, manchmal mit boshaften. Lärmende kleine Korrespondenten blicken zu einem empor, schreiben aufgebrachte Protestbriefe und bedürfen von Zeit zu Zeit eines freundlichen Tadels. Heute läßt man einen bisher Unbekannten zu Ruhm gelangen, morgen stürzt man eine anerkannte Größe. Man kritisiert jedermann und bleibt selbst von aller Kritik verschont. Man spricht aus einer Wolke, glorreich, mächtig, der Menge entrückt. Nur wenige Menschen sind dieser großen Aufgabe würdig, doch wußte Mr. Parham seit langem, daß er zu dieser auserwählten Minderheit zählte. Nur schwer hatte er sein Geheimnis gewahrt, hatte auf seine Zeitung gewartet wie einst Jungfrauen hinter klösterlichen Mauern, des Liebsten harrten. Und hier war nun endlich Sir Bussy, Sir Bussy, der kaum den Finger zu rühren brauchte, um Mr. Parham zu der ersehnten Versetzung unter die Götter zu verhelfen.
Er brauchte nur »ja« zu sagen. Mr. Parham wußte genau, wohin er sich zu wenden und was er zu tun hatte. Es war die große Gelegenheit für Sir Bussy. Er konnte einen Gott ins Leben rufen. Er selbst besaß weder die nötige Bildung noch überhaupt die Fähigkeit, ein Gott zu sein, aber er konnte einen Gott schaffen.
Sir Bussy hatte alles mögliche aufgekauft, das aufregende Erlebnis jedoch, eine Zeitung sein eigen zu nennen, war ihm bisher fremd geblieben. Es war Zeit, daß er es kennen lernte. Es war Zeit, daß er Macht, Einfluß und Wissen frisch von der Quelle zu kosten bekam. Von seiner eigenen Quelle.
Von solchen Gedanken erfüllt, hatte sich Mr. Parham zu seinem ersten Mittagessen im Marmion House begeben.
Er entdeckte, daß in diesem Marmion House ein sehr reges Leben herrschte. Sir Bussy hatte das Gebäude errichten lassen. Achtunddreißig Handelsgesellschaften hatten ihre Büros darin, und in dem breiten Torweg des Victoria-Street-Einganges geriet Mr. Parham in eine Schar eilfertiger Büroangestellter und Stenographen, die zum Essen weggingen. Ein vollgepfropfter Fahrstuhl setzte in jedem Stockwerk eine Anzahl von Passagieren ab; schließlich fuhr Mr. Parham mit dem Liftjungen allein nach dem Obergeschoß hinauf.
Es sollte nicht das nette kleine Tête-à-Tête werden, das Mr. Parham seit seinem telephonischen Anruf am Morgen erwartet hatte. In einem großen Eßzimmer mit einem langen Tische fand er Sir Bussy, umgeben von einer recht beträchtlichen Anzahl von Leuten, die ihn beim ersten Anblick Schmarotzer der schlimmsten Sorte dünkten. Später sollte er erfahren, daß zumindest etliche unter ihnen ganz achtbare Menschen waren und in dieser oder jener der achtunddreißig Handelsgesellschaften arbeiteten, die Sir Bussy ins Leben gerufen hatte; der erste Eindruck aber war ein anderer. Es war dazu Sir Bussys Linker eine Stenographin mit ernster, wachsamer Miene, die Mr. Parham für ihre Stellung viel zu würdevoll im Gehaben, dabei viel zu hübsch und zu gut gekleidet schien; ferner waren da zwei junge Damen mit überaus familiären Manieren, die Sir Bussy »lieber Bussy« nannten und Mr. Parham anstarrten, als ob er ein Ausländer wäre. Bei näherer Bekanntschaft erfuhr Mr. Parham, daß diese beiden jungen Mädchen Sir Bussys angeheiratete Lieblingsnichten waren – er hatte keine eigenen Kinder –; im Augenblicke aber dachte Mr. Parham das Allerschlimmste von ihnen. Sie waren geschminkt. Dann war da ein unendlich dicker und fröhlicher Mann in einem hellen Anzug, der eine einschmeichelnde Stimme hatte und Mr. Parham ganz unvermittelt fragte, ob seiner Meinung nach nicht etwas mit Westernhanger geschehen sollte, worauf er sich in ein unverständliches Wortgeplänkel mit einer der beiden Nichten einließ, während Mr. Parham darüber nachdachte, wer oder was Westernhanger wohl sein mochte. Überdies war da ein nachdenklicher kleiner Mann mit außerordentlich hoher Stirn: Sir Titus Knowles aus der Harley-Street, wie Mr. Parham erfuhr. Während des Essens wurde kein ernstes Gespräch geführt, man tauschte nur belanglose Bemerkungen aus. Ein ruhiger Mann, der zwischen Mr. Parham und Sir Bussy saß, fragte Mr. Parham, ob er nicht die meisten Gebäude der City abscheulich finde.
»Denken Sie einmal an New York«, sagte er.
Mr. Parham überlegte. »New York ist anders.«
Der ruhige Mann meinte nach einer Pause des Nachdenkens, das sei wohl wahr, trotzdem aber …
Sir Bussy hatte Mr. Parham mit dem ihm eigenen, flüchtig in seinem Gesichte aufleuchtenden Schimmer von Liebenswürdigkeit begrüßt und ihm gesagt, er möge sich irgendwo hinsetzen. Und nach einem dunklen Geschäker quer über den Tisch hin mit einem der hübschen geschminkten Mädchen über die Frage, ob sie in London »echtes Tennis« spielen könne, war der Gastgeber in nachdenkliches Stillschweigen versunken. Einmal sagte er aus keinem ersichtlichen Grunde »Nu!«
Das Mittagessen hatte nichts von der ruhigen Gemessenheit, die eine Tischgesellschaft im West-End auszuzeichnen pflegt. Drei oder vier junge Männer in weißen Leinenjacken bedienten flink, aber ohne irgendwelche Würde. Es gab Nierenragout und Roast-Beef, Sellerie in reichlichen Mengen nach amerikanischer Art, und auf einem Buffet standen verschiedene Sorten kalten Fleisches, ferner Obsttörtchen und Wein in Flaschen. Mehrere Glaskrüge auf dem Tisch enthielten eine Art Bowle. Mr. Parham dachte, einem schlichten Gelehrten und Gentleman gezieme es, die Weine des Plutokraten zu verachten und gewöhnliches Bier aus einem Deckelkruge zu trinken. Als das Mahl vorüber war, verschwand mehr als die Hälfte der Teilnehmer, darunter auch die hübsche Sekretärin, deren Gesicht Mr. Parham zu interessieren begonnen hatte; die übrigen folgten Sir Bussy in einen großen, niedrigen Raum, wo Zigarren und Zigaretten, sowie Kaffee und Liköre herumgereicht wurden.
»Wir fahren mit Tremayne nach diesem Tennisplatz«, verkündeten die hübschen Mädchen wie aus einem Munde.
»Doch nicht Lord Tremayne!« dachte Mr. Parham und betrachtete den Mann von riesenhaftem Leibesumfang mit neuem Interesse. Lord Tremayne war nämlich im Christ’s College zu Cambridge gewesen.
»Wenn er nach dem Mittagessen, das er eben verzehrt hat, mit Keulen und harten Bällen Tennis spielt, wird ihn der Schlag treffen«, meinte Sir Bussy.
»Sie unterschätzen die Leistungsfähigkeit meines Verdauungsapparates«, sagte der umfangreiche Herr.
»Trinken Sie einen Kognak, Tremayne, und dann frisch ans Werk«, sagte Sir Bussy.
»Kognak!« rief Tremayne einem vorübergehenden Diener zu. »Einen Doppelkognak.«
»Bringen Sie Lord Tremayne einen alten Kognak«, befahl Sir Bussy.
Es war also wirklich Lord Tremayne! So dick geworden! Mr. Parham war bereits Tutor gewesen, als Lord Tremayne, damals ein reizender schlanker Jüngling, nach Cambridge gekommen war. Allzu lange hatte sein Aufenthalt in der Universitätsstadt nicht gedauert, doch war er in der kurzen Zeit sehr bewundert worden.
Die drei gingen ab, und Sir Bussy kam auf Mr. Parham zu.
»Haben Sie für heute nachmittag etwas vor?« fragte er.
Mr. Parham hatte nichts Unaufschiebbares zu erledigen.
»Dann wollen wir uns ein paar Bilder anschauen gehen«, sagte Sir Bussy. »Ich möchte das sehr gerne. Ist es Ihnen recht? Sie scheinen von Bildern etwas zu verstehen.«
»Es gibt so viele Bilder«, meinte Mr. Parham in belustigtem Ton und lächelnd.
»Ich meine, wir wollen in die National Gallery. Vielleicht auch in die Tate Gallery. Auch die Academy ist noch geöffnet. Überdies können wir zu dem einen oder dem anderen Kunsthändler gehen. Wir wollen uns so viel ansehen, wie uns nötig scheint. Ich möchte einen allgemeinen Überblick bekommen. Und Ihre Ansicht kennen lernen.«
Während sein Rolls-Royce in glatter rascher Fahrt westwärts rollte, legte Sir Bussy den Zweck des Ausflugs klarer dar. »Ich möchte einen Begriff von der ganzen Malerei bekommen«, sagte er. »Welchen Sinn hat sie? Und welchen Zweck? Wie sind die Menschen dazu gekommen? Und was bedeuten ihnen die Gemälde? All die Gemälde?«
Seine Mundwinkel waren herabgezogen, und er blickte seinem Gefährten mit einem sonderbaren Gemisch von Feindseligkeit und flehender Wißbegier ins Gesicht.
Mr. Parham bedauerte, daß er sich auf diese Unterredung nicht hatte vorbereiten können. Er zeigte Sir Bussy sein Profil.
»Was ist die Kunst?« sagte er, um Zeit zu gewinnen. »Eine große Frage.«
»Nicht die Kunst – nur die Malerei«, verbesserte Sir Bussy.
»Das ist eben die Kunst«, sagte Mr. Parham. »Die Kunst in ihrer ureigensten Wesensart. Ein unteilbares Ganzes.«
»Nu«, sagte Sir Bussy leise, und seine Miene wurde noch erwartungsvoller.
»Vielleicht ist die Malerei die Quintessenz der Kunst«, meinte Mr. Parham tastend. Er schüttelte die erhobene Hand, eine Bewegung, die ihm unter seinen Studenten den ungerechten und häßlichen Spitznamen »Langfinger« eingetragen hatte. In Wirklichkeit waren seine Hände sehr wohlgeformt. »Sie bemüht sich, uns alles Liebliche und Schöne rings um uns in konzentrierter Form vor Augen zu führen.«
»Das Schöne sollen wir wirklich suchen«, warf Sir Bussy ein.
»Und es festhalten. Ihm eine dauernde Form geben.«
Nach einer Pause des Nachdenkens hob Sir Bussy aufs neue zu sprechen an. Und zwar sprach er mit einer Miene, als ob er einen lange unterdrückten Gedanken in Worte zu kleiden versuche. »Wollen uns die Maler nicht am Ende etwas weismachen – uns übertölpeln? Ich dachte mir – neulich abends – während Sie sprachen … es kam mir nur so in den Sinn …«
Mr. Parham betrachtete seinen Gefährten von der Seite. »Nein«, sagte er langsam und nachdrücklich, »ich glaube nicht, daß sie uns etwas weismachen.« Der leise Beigeschmack von Ironie, den er dem letzten Worte gab, war an Sir Bussy verloren.
»Davon möchte ich mich eben überzeugen.«
Es war der seltsame Anfang eines seltsamen Nachmittages – eines Nachmittages mit einem Barbaren. Der aber unbestreitbar »einer unserer Eroberer war«, wie Sebright Smith gesagt hatte. Kein Barbar, den man einfach übersehen konnte. Er kämpfte für sein Barbarentum gleich einem Bullenbeißer. Mr. Parham war überrascht worden. Indes der Nachmittag fortschritt, wünschte er immer sehnlicher, daß er sich auf die so dringlich an ihn gestellte Frage hätte vorbereiten können. Dann hätte er bestimmte Bilder herausgreifen und einen wohlgeordneten Vortrag halten können. So aber mußte er aufs Geratewohl zu Werke gehen. Anstatt in regelrechtem Kampf für die Kunst und ihre erhabenen Wunder einzutreten, sah er sich in der Lage eines Heerführers, der zu den Waffen gerufen wird, während der Feind schon ins Lager gedrungen ist. Es war eine zerstückte Diskussion.
Sir Bussys Haltung war, soweit Mr. Parham aus seiner abgerissenen und ungebildeten Ausdrucksweise schließen konnte, die eines wißbegierigen Zweiflers. Der Mann war ungebildet – über alle Maßen ungebildet – doch fehlte es ihm nicht an natürlicher Klugheit. Die Ehrerbietung, die alle Menschen von Verstand und Geschmack den großen Meistern auf dem Gebiete der Malerei zollen, hatte offenbar tiefen Eindruck auf ihn gemacht, und er konnte nicht begreifen, warum man sie so überaus hoch pries. Er wollte eine Erklärung dafür. Es war offenkundig eine starke Wißbegier in ihm lebendig. Heute verlangte er, über Michelangelo und Tizian belehrt zu werden. Morgen mochte Beethoven oder Shakespeare an die Reihe kommen. Mit dem seit langem feststehenden Ansehen ließ er sich nicht abspeisen. Es gab für ihn kein unerschütterlich feststehendes Ansehen. Die Anerkennung, die Generationen jenen Formen der Größe gezollt hatten, mußte man völlig aus dem Spiele lassen.
Er schritt die Stufen zum Eingang der National Gallery so rasch und sicher empor, daß Mr. Parham der Gedanke kam, er müsse schon dagewesen sein. Und ohne zu zögern, begab er sich zu den Italienern.
»Also, hier haben wir Bilder«, sagte er, indem er raschen Schrittes von einem Saal zum andern weitereilte und erst im größten halt machte. »Sie sind recht nett und interessant. Die meisten wenigstens. Sehr viele haben strahlende Farben. Sie könnten vielleicht noch strahlender sein. Man merkt, welche Freude es den Kerlen bereitet haben muß, die Bilder zu machen. Das gebe ich alles gerne zu. Ich hätte nicht das Geringste dagegen, wenn etliche von den Dingern im Carfex House hingen. Ich hätte sogar Lust, selber so ein bißchen herumzupinseln. Wenn aber behauptet wird, daß noch etwas ganz anderes in diesen Bildern steckt, und wenn man so ehrfurchtsvoll von ihnen spricht, als ob die Maler Gott weiß was gewußt und es uns verkündet hätten, so verstehe ich das nicht. Nein, wahrhaftig, ich verstehe es nicht.«
»Hier aber zum Beispiel«, sagte Mr. Parham, »dieser Francesca – göttlich ist doch gewiß nicht zu viel gesagt für solche Süße und Zartheit.«
»Süße und Zartheit! Göttlich! Nehmen Sie einen Frühlingstag in England, nehmen Sie den Flaum auf der Brust eines Fasans oder einen Sonnenuntergang oder das Morgenlicht, das ein Glas mit Blumen auf dem Fensterbrett bescheint. Dinge dieser Art sind ganz gewiß unendlich viel süßer, zarter, göttlicher und so weiter als all dies – dies gepfefferte Machwerk hier.«
»Gepfeffert!« Einen Augenblick lang war Mr. Parham überwältigt.
»Es ist eine gepfefferte Schönheit«, sagte Sir Bussy herausfordernd. »Eine gepfefferte Lieblichkeit, wenn Sie wollen … Und recht viele unter den Dingern sind gar nicht so sehr schön und nicht einmal besonders gut, was das Gepfeffertsein anbelangt.«
Sir Bussy benutzte die Fassungslosigkeit Mr. Parhams, um ihm weiter zuzusetzen. »All diese Madonnen. Wollten die Kerle sie malen oder wurden sie dazu gezwungen? Wer hat je Geschmack an einer Frau gefunden, die so patzig auf einem Thron sitzt?«
»Gepfeffert!« Mr. Parham blieb bei der wesentlichen Frage. »Nein!«
Sir Bussy wurde plötzlich erwartungsvoll, ließ die Mundwinkel sinken und schob den Kopf seitwärts an Mr. Parham heran.
Mr. Parham schüttelte die erhobene Hand und fand das Wort, das er suchte. »Wunderbar Schönes ist da ausgewählt worden.«
Es gelang ihm noch besser. »Wunderbar Schönes ist auserlesen und festgehalten worden. Diese Menschen gingen auf der Welt umher und sahen – sahen mit all ihrer Kraft. Sahen aus einer außerordentlichen Begabung heraus. Sie waren zum Sehen geboren. Und sie versuchten – meiner Ansicht nach mit Erfolg – etwas von ihren stärksten Eindrücken festzuhalten. Uns wiederzugeben. Die Madonna war oft – war in der Regel – nichts weiter als ein Vorwand …«
Sir Bussys Mund wurde wieder normaler, und er wandte sich mit einem Ausdruck größeren Respekts aufs neue den Bildern zu. Er wollte sie von jenem Gesichtspunkt aus auf sich wirken lassen. Doch dauerte seine prüfende Betrachtung nicht lange.
»Dies da«, sagte er, indem er zu dem Gegenstand ihrer ersten Diskussion zurückkehrte.
»Francescas Taufe Christi«, hauchte Mr. Parham.
»Meiner Meinung nach ist da keine Auswahl getroffen: es ist vielmehr ein Vielerlei. Alles mögliche, was er eben gerne malen wollte. Der Hintergrund macht Spaß, aber nur, weil er einen an Dinge erinnert, die man schon gesehen hat. Nein, ich werde mich nicht anbetend davor niederknien. Und die meisten anderen …«
Er schien die gesamten Schätze der National Gallery zu meinen.
»… sind weiter nichts als Malerei.«
»Das muß ich bestreiten«, sagte Mr. Parham. »Das muß ich bestreiten.«
Er führte die feine Farbgebung Filippo Lippis ins Treffen, die Erhabenheit, Anmut und klassische Lieblichkeit Botticellis; er sprach von Reichtum des Ausdrucks, anatomischem Wissen und Virtuosität; schließlich gipfelte seine Rede in einem Hinweis auf die unendlich feierliche Schönheit der Madonna in der Felsengrotte von Leonardo. »Sehen Sie den geheimnisvollen, den heiteren und doch geheimnisvollen Ausdruck in dem beschatteten Gesichte jener Frau; die süße Weisheit in der selbstzufriedenen Miene des Engels«, sagte Mr. Parham. »Malerei! Es ist eine Enthüllung.«
»Nu«, sagte Sir Bussy, den Kopf zur Seite gelegt.
Gleich einem widerspenstigen Kinde ließ er sich von Bild zu Bild führen. »Ich sage ja nicht, daß die Sachen schlecht sind«, wiederholte er; »ich gebe zu, daß sie mich interessieren; aber ich sehe keinen Anlaß, sie so übermäßig zu loben. Man wird an alles mögliche erinnert, aber doch nur an Dinge, die man eben in sich hat. Alles in allem sind es gewiß kluge und tüchtige Arbeiten, doch soll mich der Kuckuck holen, wenn ich etwas Göttliches darin finden kann.«
Überdies machte er der Kultur ein sonderbar ungnädiges Zugeständnis. »Nach einer Weile«, meinte er, »gewöhnt man sich an das Zeug. So wie man sich im Kino allmählich an die Dunkelheit gewöhnt.«
Es wäre langweilig, wenn wir berichten wollten, wie jeder einzelne der Kunstschätze auf ihn wirkte, die unserem Geiste ein so teures Erbe sind. Raphael erklärte er als »verflixt fein«. Gegen El Greco lehnte er sich auf. »Diese byzantinische Feierlichkeit« – das Wort war Mr. Parham nachgesprochen – »erinnert mich an das langgezogene Gesicht, das man hat, wenn man sich in der Hinterseite eines Löffels beguckt.« Vor Tintorettos Ursprung der Milchstraße geriet er jedoch fast in Begeisterung. »Nu«, sagte er warm. »Das ja! Es ist nicht sehr anständig, aber es ist verflixt hübsch.«
Er kehrte um und besah das Bild noch einmal.
Vergebens versuchte Mr. Parham, ihn an der Venus mit dem Spiegel vorüberzulocken.
»Wer hat das gemacht?« fragte er, als ob er irgend einen Argwohn gegen Mr. Parham hege.
»Velasquez.«
»Also, welcher wesentliche Unterschied besteht zwischen dem da und einer guten großen Photographie einer nackten Frau, koloriert und so gestellt, daß der Anblick einen aufregt?«
Mr. Parham schämte sich ein wenig, daß er ein so primitives Problem an einem öffentlichen Ort und noch dazu hörbar erörtern mußte, doch Sir Bussy betrachtete ihn mit einem ihm eigenen Ausdruck der unbewußten Drohung, der eine Antwort erzwang.
»Die beiden Dinge sind nicht in einem Atem zu nennen. Eine Photographie ist materiell, beruht auf Tatsachen, ist persönlich, individuell. Hier handelt es sich um Schönheit, die entzückenden Linien eines schlanken menschlichen Körpers sind einfach nur das Thema einer vollendeten Komposition. Der Körper wird transzendental. Er ist sublimiert. Er ist frei von allen individuellen Mängeln und aller individuellen Roheit.«
»Unsinn! Die Frau da ist sehr individuell – individuell genug für jedermann.«
»Ich bin nicht dieser Meinung. Ich bin durchaus nicht dieser Meinung.«
»Nu! Ich habe ja an dem Bilde gar nichts auszusetzen, nur kann ich das Transzendentale und Sublimierte darin nicht sehen. Ich mag es gerne – ebenso wie ich den Tintoretto da drüben gerne mag. Aber eine schöne nackte Frau ist immer und überall schön, besonders wenn man in der nötigen Stimmung ist, und ich sehe nicht ein, warum ein armer kleiner Händler, der auf der Straße unzüchtige Bilder feilbietet, eingesteckt werden soll: er verkauft doch nur just das, was hier jedermann betrachten kann! Und nicht nur betrachten kann man’s, man kann sich im Vestibül auch Photographien davon kaufen. Ich habe nichts gegen die Kunst, ich kann es nur nicht leiden, wenn sie gar so groß tut. Es ist, als ob sie zum Diner im Buckingham Palace eingeladen worden wäre und sich nun nicht mehr mit ihren armen Verwandten sehen lassen wollte. Die aber ebenso viel Existenzberechtigung haben wie sie.«
Mr. Parham ging mit einem Gesichtsausdruck weiter, der andeuten sollte, daß die Diskussion auf üble Abwege geraten sei.
»Ob wir Zeit haben, auch noch in die Tate Gallery zu gehen?« erwog er. »Dort werden Sie die britische Schule finden und den wilden Nachwuchs, der sich noch nicht ganz durchgesetzt hat.« Er vermochte ein feines, kaum merkbares Hohnlächeln nicht zu unterdrücken. »Die Bilder dort sind neuer. Vielleicht werden sie Ihnen deshalb besser gefallen.«
Sie besuchten tatsächlich auch noch die Tate Gallery. Sir Bussy hatte dort zwar keine weiteren Einwände gegen die Kunst vorzubringen, konnte sich aber auch nicht mit ihr aussöhnen. Sein wesentlichstes Urteil ging dahin, daß Augustus John »Courage« habe. Als er und Mr. Parham das Gebäude verließen, schien er in Nachdenken versunken; dann äußerte er, was offenbar die nunmehr in seinem Innern ausgereifte Antwort auf die Frage war, die er sich für jenen Nachmittag gestellt hatte.
»Ich glaube nicht, daß die Malerei einen irgendwohin führt. Oder aus irgend etwas herausreißt. Sie bedeutet weder eine Entdeckung noch eine Befreiung. Die Leute reden so von ihr, als ob sie uns den Weg in eine bessere Welt zeigte. Sagen Sie ehrlich: tut sie das?«
»Sie hat das Leben ungezählter still beobachtender Menschen bereichert und verschönt.«
»Das kann das Cricketspiel auch«, meinte Sir Bussy.
Mr. Parham wußte auf eine solche Bemerkung keine Antwort zu geben. Einige kurze Augenblicke lang schien es ihm, als ob der Nachmittag durchaus verfehlt wäre. Er hatte sein Bestes getan, doch dieser Sir Bussy war verstockt und schwer zu beeinflussen; es war ihm, das fühlte er, nicht im geringsten gelungen, dem Mann die Idee der Kunst zu übermitteln. Stillschweigend standen sie im Licht des Abendrots nebeneinander und warteten, bis Sir Bussys Chauffeur merkte, daß sie aufgetaucht waren. Dieser Plutokrat, dachte Mr. Parham, wird mich nie verstehen, wird niemals begreifen, welches die Ziele der wahren Zivilisation sind, und niemals die Zeitschrift finanzieren, die ich brauche. Ich muß höflich und gelassen freundlich bleiben, wie es einem gebildeten Menschen geziemt, aber ich habe Zeit und Hoffnung an ihn verschwendet.
Im Wagen zeigte sich Sir Bussy jedoch ganz unerwartet dankbar, und Mr. Parham erkannte, daß sein Pessimismus verfrüht gewesen sei.
»Ich habe diesen Nachmittag sehr genossen«, sagte Sir Bussy. »Es waren schöne Stunden. Sie haben mein Interesse erweckt. Vieles von all dem, was Sie mir über die Kunst gesagt haben, werde ich mir gut merken. Und wir waren sehr fleißig. Ein Bild nach dem andern haben wir aufmerksam betrachtet. Ich glaube, ich habe Ihre Ansicht begriffen – ja, das glaube ich wirklich. Neulich abends sagte ich mir: ›Ich muß der Ansicht dieses Mannes auf den Grund kommen. Er ist erstaunlich.‹ Ich hoffe, daß ich noch oft das Vergnügen haben werde, mit Ihnen zusammen zu sein und Ihre Ansichten näher kennen zu lernen … Liegt Ihnen an hübschen Frauen?«
»Hm?« machte Mr. Parham.
»Liegt Ihnen an hübschen Frauen?«
»Der Mensch ist sterblich«, sagte Mr. Parham im Tone eines Beichtenden.
»Es würde mich außerordentlich freuen, wenn Sie an einer Abendgesellschaft teilnehmen wollten, die ich im Hotel Savoy gebe. Nächsten Donnerstag. Es wird die ganze Nacht hindurch gegessen, getrunken und getanzt. Alles, was es auf den Londoner Bühnen Hübsches gibt, wird da sein und sich im besten Lichte zeigen.«
»Ich bin kein Tänzer, müssen Sie wissen.«
»Ich auch nicht. Sie aber sollten Stunden nehmen. Sie haben die langen Beine, die ein guter Tänzer braucht. Doch können wir jedenfalls miteinander in einer gemütlichen Ecke sitzen, und Sie erzählen mir dann etwas über die Frauen. So wie Sie mich über die Kunst belehrt haben. Ich bin immer viel zu sehr beschäftigt gewesen, möchte aber seit jeher etwas über die Frauen wissen. Und so oft es Ihnen langweilig wird, können Sie sich eine Dame aussuchen und mit ihr in den Speisesaal gehen, um etwas zu essen oder zu trinken. Es sind immer ihrer genug da, die sich gern in den Speisesaal führen lassen. Auch wird mit Essen und Trinken nicht geknausert.«
3Mr. Parham unter den flott lebenden Reichen
Es war Mr. Parham nicht ganz klar, ob er seine Zeitung bekommen würde; doch merkte er, daß er Aussichten hatte, etwas wie ein Mentor des Sir Bussy zu werden. Was für eine Art von Mentor, ließ sich noch nicht voraussehen. Wenn man sich Sokrates als groß und gut gewachsen vorstellt, Alkibiades hingegen als klein und energisch, sich überdies jene unheilvolle Expedition nach Syrakus unter besseren Umständen inmitten einer machtvollen Konsolidierung Griechenlands wiederholt denkt – wenn man mit einem Wort den Vergleich so weit zurechtstutzt, daß gerade noch eine Spur von Ähnlichkeit bestehen bleibt, beginnt man zu erkennen, wie die Erwartungen Mr. Parhams beschaffen waren. Vielleicht sind übrigens Aristoteles und Alexander besser für unseren Zweck geeignet. Es ist einer der zahllosen Vorteile einer guten klassischen Bildung, daß man eine menschliche Beziehung niemals in ihrer ganz gewöhnlichen Einfachheit zu sehen braucht, noch sehen kann; sie wird stets durch den Vergleich mit Vergangenem bereichert. Man verliert allen Sinn für die Geschehnisse der Gegenwart; es ist einem, als ob sich die geschichtlichen Ereignisse mit denen man vollgepfropft wurde, immerfort wiederholten.
Bei der Abendgesellschaft im Hotel Savoy bekam Mr. Parham zum erstenmal einen Begriff von dem Aufwand in der Lebensführung Sir Bussys. Ein gewöhnlicherer Geist wäre von dem Eindruck überwältigt gewesen. Selbst Mr. Parham ertappte sich dabei, daß er insgeheim nachrechnete, was bloß dieser eine Abend seinen neuen Bekannten kosten mochte. Die Summe würde der Schätzung Mr. Parhams nach genügt haben, ein Wochenblatt allerersten Ranges für mindestens drei Jahre zu finanzieren.
Mr. Parham legte Wert darauf, sich für jeden gesellschaftlichen Anlaß richtig und gut zu kleiden. Er war ein Gegner der unter Gelehrten und intellektuell hochstehenden Menschen verbreiteten Meinung, daß man in großer Gesellschaft einen niedrigen Kragen und bei einer Tanzunterhaltung einen veralteten Smoking tragen könne. Seiner Ansicht nach mußte man vielmehr den Leuten zeigen, daß ein Philosoph durchaus imstande ist, gelegentlich als Mann von Welt aufzutreten. Seine schlanke Größe gestattete ihm eine elegant nachlässige Körperhaltung, die ein wenig an Lord Balfour gemahnte, und er wußte, daß er mit seinen feinen und blasierten Gesichtszügen im ganzen recht gut aussah. Sein für unser liederliches Zeitalter ein wenig altmodischer Klapphut hielt seine unruhigen langen Finger in Zaum, und seine schöne goldene Uhrkette war offensichtlich ein Familienerbstück.
Das ganze Hotel Savoy hatte sich Sir Bussy zur Verfügung gestellt. Das gesamte Personal des Hauses war an dem Abend seine Dienerschaft. In ihren Kniehosen aus grauem Plüsch und ihren gelben Westen sahen die Leute wie Bediente einer altadeligen Familie aus. In der Garderobe traf Mr. Parham Sir Titus Knowles mit der mächtigen Stirn, der sich eben eines außerordentlich kleinen steifen Hutes und eines riesigen Abendmantels entledigte.
»Hallo!« sagte Sir Titus. »Sie hier?«
Mr. Parham nahm den Ausruf weiter nicht übel. »Wie man sieht«, antwortete er.
»Ah!« sagte Sir Titus.
»Marke ist nicht nötig, Sir Titus«, sagte der Garderobier. »Wir kennen Sie ja.«
Sir Titus verschwand mit lächelndem Gesicht.
Mr. Parham jedoch erhielt eine Marke für seinen Überrock.
Er schob sich durch die Herren, die auf ihre Damen warteten, und befand sich alsbald inmitten einer blendenden Menge von lieblichen und außerordentlich teuer aussehenden Frauen mit schimmernden Armen, Schultern und Rücken, und einer sehr mannigfachen Schar von Männern. Das lebhafte Sprechen der Menschen ringsum klang so, als ob ein starker und dabei sehr ungleichmäßiger Wind durch Bäume mit Zinnblättern blase. Etwas wie ein Empfang ging vor sich. Plötzlich erschien Sir Bussy.
»Fein«, sagte er erfreut. »Wir müssen nachher gemütlich plaudern. Kennen Sie Pomander Poole? Sie brennt darauf, Sie kennen zu lernen.«
Er verschwand, und Mr. Parham hatte an dem Abend kein einziges Mal Gelegenheit, mehr mit ihm zu reden als ein paar flüchtig hingeworfene Sätze, obgleich er ihn von ferne her immer wieder erblickte, ein wenig verstimmt geschäftig oder erkünstelt fröhlich.
Miss Pomander Poole begann sehr ernst damit, daß sie Mr. Parham um seinen Namen fragte, den Sir Bussy aus Nachlässigkeit oder in augenblicklicher Vergeßlichkeit nicht genannt hatte. »Parham ist der Name des Mannes, den Sie so gerne kennen lernen möchten«, sagte Mr. Parham mit einem bestrickenden Lächeln, das alle seine ausgezeichneten Zähne sehen ließ, ausgenommen die Backenzähne selbstverständlich.
»Bussy erinnert heute abend mehr als je an einen Floh«, sagte Miss Pomander Poole. »Er ist wie eine verlorene Stecknadel oder ein winziges Sandkörnchen. Ich habe schon sechs Leute gesehen, die vergeblich hinter ihm her jagten.«
Sie war eine dunkelhaarige, hübsche Dame mit unruhigen Augen und mehr Körperfülle als heute modern ist. Ihre Stimme war tief und wohlklingend. Sie blickte über den länglichen Saal hin, in dem sie sich befanden. »Warum in aller Welt gibt er wohl diese Gesellschaften? Ich kann es nicht begreifen!« sagte sie, seufzte und schwieg dann, um zu zeigen, daß sie zur Anknüpfung eines Gesprächs nunmehr das Ihrige getan hatte.
Mr. Parham war einigermaßen unentschlossen. Er hatte den Namen Pomander Poole schon oft genug gehört, wußte aber im Augenblick durchaus nicht, ob im Zusammenhang mit Büchern, Zeitungsartikeln, Theaterstücken, Bildern, Skandalgeschichten und Gesellschaftstratsch oder mit der Welt der Varietékunst. Wie sollte er da den ungezwungenen, aufmunternden und dabei überlegenen Gesprächston finden, der einem Philosophen in weltmännischer Stimmung geziemt? Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zunächst auf Äußerungen zu beschränken, die einer Ausfragerei bedenklich nahe kamen.
»Ich kenne unseren Wirt erst seit ganz kurzer Zeit«, sagte er. Der Satz zielte offenkundig auf Erläuterungen ab.
»Er existiert gar nicht«, sagte sie.
Allem Anscheine nach gedachte seine Partnerin durch Geist zu glänzen, und da war nun Mr. Parham gewiß nicht der Mann, der seine Stichworte verfehlt. »Wir sind also einem Phantom begegnet«, meinte er.
Sie ging völlig achtlos über diese Antwort hinweg. »Er existiert nicht«, seufzte sie noch einmal. »Infolgedessen jagen nicht nur seine Nebenmenschen vergeblich hinter ihm her, auch er selber kann sich sozusagen niemals erwischen. Alle Tage dreht er sein Bettzeug um und um und sucht seine eigene Person. Aber es nützt ihm nichts.«
Die Dame besaß nicht nur Körperfülle, sondern auch einen üppigen Witz.
»Er erwirbt Reichtümer«, sagte Mr. Parham.
»Die Natur verabscheut ein Vakuum«, sagte sie mit der müden Lässigkeit eines Menschen, der ein längst bekanntes Frage- und Antwortspiel über sich ergehen läßt. Ihre unruhigen, forschenden dunklen Augen blickten in die Runde, als ob sie sich nach irgend jemandem umsähe, der sie von Mr. Parham befreien mochte.
»Heute abend ist das Vakuum von interessanten Menschen erfüllt.«
»Ich kenne die wenigsten.«
»Ich bin unweltlich genug, um ihre äußere Erscheinung interessant zu finden.«
»Und ich weltlich genug, um mich davon nicht blenden zu lassen.«
Aufs neue trat eine peinliche Pause des Stillschweigens ein. Mr. Parham wünschte, seine Gefährtin könnte hinweggezaubert und jemand Angenehmerer an ihre Stelle gesetzt werden. Doch sie rettete die Situation. »Es ist wohl noch zu früh, um zum Souper hinunter zu gehen«, sagte sie; »hinunter oder hinauf – ich weiß nicht, wo der Speisesaal ist. So eine Vakuum-Gesellschaft erzeugt ein außerordentliches Gefühl der Leere in mir.«
»Wir wollen es erforschen«, meinte Mr. Parham, setzte sein Lächeln wieder auf und nahm die Dame ins Schlepptau.
»Ich glaube, ich habe Sie in der Royal Institution einen Vortrag halten gehört«, erklärte sie.
»Ich bin noch nie dagewesen«, entgegnete Mr. Parham.
»Ich habe Sie aber da gesehen. Schon öfter. Und zwar gewöhnlich zwei oder drei Herren, die ganz so aussehen wie Sie. Sie sind ein Mann der Wissenschaft.«
»Hochschullehrer, meine Gnädigste. Historiker. Mit einigen Lieblingsthemen, die ich immer und immer wiederkäue – und einem tintigen Zeigefinger.«