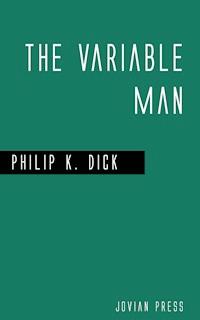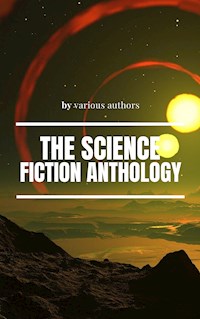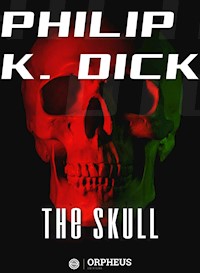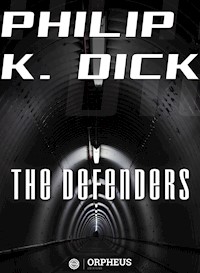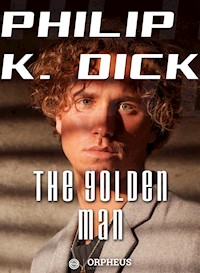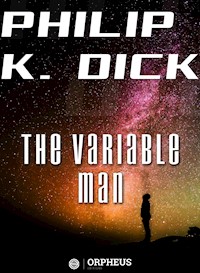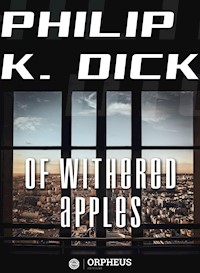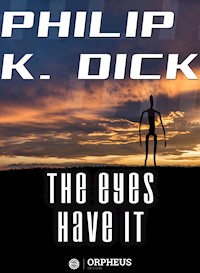9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Orange County eingeschleust wird. Bob Arctor – alias Fred – ist Junkie und Geheimagent der Drogenfahndung, und damit er nicht auffliegt, beginnt er, auch mit Substanz T zu experimentieren, bis er merkt, dass seine beiden Identitäten gegeneinander agieren ... Viele schätzen ›Der dunkle Schirm‹ (1977) als den stärksten Roman Philip K. Dicks. Autobiographische Details zeichnen ein nur allzu realistisches Bild der Drogenkultur Kaliforniens in den 70ern, die in die Zukunft projiziert wird. 2006 wurde das Buch von Richard Linklater mit Keanu Reeves und Winona Ryder verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Ähnliche
Philip K. Dick
Der dunkle Schirm
Roman
Aus dem Amerikanischen von Karl-Ulrich Burgdorf
FISCHER E-Books
Mit einem Nachwort von Christian Gasser
Inhalt
Eins
Da stand einmal ein Typ und versuchte den ganzen Tag lang verzweifelt, sich die Wanzen aus den Haaren zu schütteln. Sein Arzt erklärte ihm, er habe überhaupt keine Wanzen in den Haaren. Nachdem er acht Stunden lang geduscht hatte, wobei er Stunde um Stunde unter dem heißen Wasserstrahl stand und unter dem Gekrabbel der Wanzen litt, trat er aus der Duschkabine und trocknete sich ab – und er hatte immer noch Wanzen in seinem Haar; ja, sie hatten sich jetzt sogar über seinen ganzen Körper ausgebreitet. Einen Monat später hatte er bereits Wanzen in der Lunge.
Da es sonst nichts gab, was er hätte tun oder worüber er hätte nachdenken können, machte er sich daran, den Lebenszyklus der Wanzen zu erforschen und mit Hilfe der Encyclopedia Britannica genau zu bestimmen, um welche Gattung von Wanzen es sich eigentlich handelte. Jetzt waren sie schon überall in seinem Haus. Während er die umfangreiche Literatur über die zahlreichen Wanzenarten, die es auf der Welt gab, systematisch durcharbeitete, bemerkte er schließlich auch draußen im Freien Wanzen – und daraus schloss er, dass es sich wohl um Vertreter der Spezies Aphidina handeln müsse, also um Blattläuse. Nachdem er einmal zu dieser Erkenntnis gelangt war, ließ er sich davon nicht mehr abbringen, ganz gleich, was andere Leute ihm erzählen mochten – wie zum Beispiel: »Aber Jerry, Blattläuse beißen doch keine Menschen!«
Er aber wusste es besser, weil die endlosen Wanzenbisse ihm mittlerweile wahre Höllenqualen bereiteten. Im 24-Stunden-Supermarkt, der zu einer Ladenkette gehörte, die sich über fast ganz Kalifornien erstreckte, erstand er Sprühdosen, auf denen ›Razzia‹, ›Schwarzkreuz‹ und ›Hofwächter‹ stand. Erst sprühte er das Haus damit ein und dann sich selbst. ›Hofwächter‹-Spray schien am besten zu wirken.
Zugleich verfolgte er auch den theoretischen Aspekt des Problems weiter und entdeckte dabei drei Entwicklungsstadien im Lebenszyklus der Wanzen. Zunächst wurden sie von Menschen, die er fortan ›Wanzenträger‹ nannte, in sein Haus eingeschleppt, um ihn zu verseuchen. Diese Wanzenträger waren Personen, die sich ihrer Rolle bei der Verbreitung der Wanzen gar nicht bewusst waren. Während dieses Stadiums hatten die Wanzen noch keine Beißwerkzeuge oder Mandibeln (er entdeckte dieses Wort bei seinen wochenlangen Recherchen, während er sich immer tiefer in die Bücher vergrub – eine recht ungewöhnliche Beschäftigung für einen Typen, der in einem Bremsen- und Reifen-Schnelldienst arbeitete und dessen Aufgabe darin bestand, Bremstrommeln zu richten). Die Wanzenträger spürten daher nichts. Oft hockte Jerry im hintersten Winkel des Wohnzimmers und beobachtete die Wanzenträger, die den Raum betraten, meist Leute, die er schon länger kannte, aber auch einige neue Gesichter. Sie alle waren über und über mit Blattläusen dieses ersten Entwicklungsstadiums bedeckt. Manchmal lächelte Jerry dabei schief vor sich hin, weil er als Einziger wusste, dass die betreffende Person von den Wanzen benutzt wurde und das noch gar nicht geschnallt hatte.
»Warum grinst du eigentlich so, Jerry?«, fragten sie ihn dann bisweilen.
Er aber lächelte weiter und antwortete nicht.
Im nächsten Stadium wuchsen den Wanzen Flügel; nun, eigentlich waren es keine richtigen Flügel, sondern eher Auswüchse, die die Funktion von Flügeln erfüllten und es den Wanzen ermöglichten, auszuschwärmen – denn nur so konnten sie von einer Person zur anderen überwechseln und sich auf einem neuen Träger niederlassen, also in erster Linie auf Jerry. Wenn die Wanzen zu schwärmen begannen, war die Luft voll von ihnen; sie hingen wie lebende Wolken in seinem Wohnzimmer, ja in seinem ganzen Haus. Während dieses Stadiums versuchte er verzweifelt, sie nicht einzuatmen.
Am meisten tat Jerry sein Hund Max leid, denn er konnte sehen, wie die Wanzen auf ihm landeten und sich überall in seinem Fell niederließen; vielleicht gelangten sie auch in Max’ Lunge, so wie sie in Jerrys Lunge eingedrungen waren. Er spürte, dass der Hund ebenso stark litt wie er selbst. Daher überlegte er, ob er Max fortgeben sollte, um wenigstens ihm das Leben leichter zu machen. Aber schließlich entschied er sich doch dagegen, weil der Hund ja bereits infiziert worden war und ihn die Wanzen überallhin begleiten würden.
Manchmal nahm er den Hund mit unter die Dusche und versuchte, ihn von den Wanzen zu befreien. Doch er hatte bei Max auch nicht mehr Erfolg als bei sich selbst. Da er ein sehr mitfühlender Mensch war, schmerzte es ihn, mit ansehen zu müssen, wie der Hund litt – also setzte er die Versuche, ihm zu helfen, unermüdlich fort. In gewisser Weise waren die Qualen dieses hilflosen Tieres, das sich nicht einmal beklagen konnte, das Schlimmste an der ganzen Wanzenplage.
»Was, zum Teufel, machst du eigentlich den ganzen Tag lang mit dem gottverdammten Köter unter der Dusche?«, fragte ihn sein Kumpel Charles Freck einmal, der während einer dieser Duschprozeduren hereingekommen war.
»Ich muss die Aphidien von ihm runterkriegen«, erwiderte Jerry. Er schleppte Max aus der Duschkabine und rubbelte ihn ab. Dann sah Freck verwirrt zu, wie Jerry Babyöl und Talkumpuder in das Fell des Hundes einmassierte. Überall im Haus türmten sich Insektenspraydosen und Flaschen mit Talkum, Babyöl und Hautpflegemitteln, die meisten davon leer; mittlerweile verbrauchte Jerry Dutzende Flaschen pro Tag.
»Ich seh hier keine Aphidien«, sagte Freck. »Was ist eigentlich ’ne Aphidie?«
Jerry blickte ihn an. »Kann manchmal tödlich sein. Genau das ist ’ne Aphidie – tödlich. Die Biester sind in meinen Haaren und auf meiner Haut und in meiner Lunge, und die gottverdammten Schmerzen werden langsam unerträglich – ich werd wohl bald ins Krankenhaus müssen.«
»Wie kommt’s, dass ich sie nicht sehen kann?«
Jerry setzte den Hund ab, den er inzwischen in ein Badetuch eingewickelt hatte, und kniete sich auf dem Zottelteppich hin. »Pass auf, ich zeig dir mal eine«, sagte er. Der Teppich war dicht mit Blattläusen bedeckt; überall schnellten welche hoch, hüpften auf und nieder, wobei manche höher sprangen als ihre Artgenossen. Jerry hielt Ausschau nach einem besonders großen Exemplar – weil es eben anderen Leuten so schwerfiel, die Biester zu sehen. »Hol mir mal ’ne Flasche oder ’n Glas. Unterm Spülstein. Wir decken das Glas dann mit einem Tuch ab oder schrauben den Deckel drauf, und dann kann ich’s mitnehmen, wenn ich zum Arzt geh, und der kann sich das Vieh mal genau ansehen.«
Freck brachte ihm ein leeres Mayonnaiseglas, und Jerry setzte seine Suche fort – und schließlich entdeckte er eine Blattlaus, die mindestens drei Zentimeter lang war und bestimmt einen halben Meter hoch in die Luft sprang. Er fing sie geschickt mit seinen Händen, trug sie zum Glas, ließ sie vorsichtig hineinfallen und schraubte rasch den Deckel zu. Dann hielt er die Blattlaus triumphierend hoch. »Na, siehst du sie?«, rief er.
»Jaaaaaa«, sagte Freck. Seine Augen weiteten sich, während er den Inhalt des Glases musterte. »Was für ein Riesenvieh! Wow!«
»Hilf mir mal, noch mehr einzufangen, die ich dann dem Arzt zeigen kann.« Jerry hockte sich erneut auf den Teppich, das Glas neben sich.
»Klar«, erwiderte Freck und machte sich an die Arbeit.
Binnen einer Stunde hatten sie drei Gläser voller Wanzen. Obwohl Freck sich zum ersten Mal an einer Wanzenjagd beteiligt hatte, erwischte er einige der größten Exemplare.
Das war um die Mittagszeit, im Juni 1994, in Kalifornien, in einem heruntergekommenen Wohnbezirk mit endlosen Reihen billiger, aber haltbarer Plastikhäuser, die die Spießer längst aufgegeben hatten. Jerry hatte allerdings vor einiger Zeit Metallfarbe über alle Fenster gesprüht, um das Tageslicht draußen zu halten; der Raum wurde nun von einer mehrarmigen Stehlampe erleuchtet, in die er Punktstrahler geschraubt hatte. Jerry ließ die Punktstrahler Tag und Nacht brennen, um für sich und seine Freunde die Zeit abzuschaffen. Dieser Gedanke gefiel ihm – er liebte es, sich von der Zeit zu befreien. Denn indem er das tat, konnte er sich ohne jede Störung den wirklich wichtigen Dingen widmen. Und wichtig war zum Beispiel, dass jetzt zwei Männer auf dem Zottelteppich knieten und eine Wanze nach der anderen auflasen, um sie in eine endlose Batterie von Gläsern zu sperren. »Was springt dabei eigentlich für uns raus?«, erkundigte sich Charles Freck später an diesem Tag. »Ich meine, bezahlt uns der Arzt so ’ne Art Stückpreis für die Viecher, ’ne Fangprämie, ’n paar Mäuse?«
»Mir würd’s schon reichen, wenn dabei ein Gegenmittel herausspränge«, sagte Jerry. Obwohl die Schmerzen stets gleich blieben, waren sie jetzt unerträglich geworden; er hatte sich nie daran gewöhnen können, und er wusste, dass er sich, verdammt nochmal, auch nie daran gewöhnen würde. Ein unwiderstehliches Verlangen, wieder zu duschen, überwältigte ihn. »Hey, Mann«, keuchte er und richtete sich auf, »du machst weiter damit, die Viecher in die Gläser zu tun, während ich mal eben unter die Dusche springe, okay?« Er stürzte in Richtung Badezimmer davon.
»Okay«, sagte Freck. Seine langen Beine zitterten, als er sich zu einem der Gläser drehte, die Hände schalenartig zusammengelegt. Als Ex-Veteran hatte er seine Muskeln jedoch noch immer ganz gut unter Kontrolle – er schaffte es bis zum Glas, ohne umzukippen. Doch dann rief er plötzlich: »Jerry, hey, diese Wanzen machen mich irgendwie nervös. Mir gefällt das gar nicht, wenn ich hier so ganz allein bin.« Er stand auf.
»Dämlicher Angsthase!« Jerry lehnte sich einen Augenblick lang im Badezimmer an die Wand, schwer atmend vor Schmerzen.
»Könntest du nicht …«
»Ich muss erst ’ne Runde duschen!« Jerry knallte die Tür zu und drehte an den Reglern der Dusche. Das Wasser rauschte herab.
»Ich fürchte mich aber hier draußen.« Obwohl Freck lauthals brüllte, drang seine Stimme nur schwach an Jerrys Ohren.
»Dann hau doch ab und fick dich ins Knie!«, schrie Jerry zurück und stieg unter die Dusche. Zu was sind Freunde eigentlich gut?, fragte er sich verbittert. Zu gar nichts. Scheiße nochmal, wirklich zu gar nichts.
»Beißen diese Scheißviecher?«, schrie Freck, der jetzt offenbar direkt vor der Badezimmertür stand.
»Natürlich beißen sie«, sagte Jerry, während er sich Shampoo in die Haare rieb.
»Das hab ich befürchtet.« Eine Pause. »Hey, kann ich mal reinkommen und mir die Hände waschen, damit ich sie wieder abkriege? Und dann warten, bis du fertig bist?«
Scheiße im Quadrat, dachte Jerry voller Bitterkeit. Er sagte nichts, er schrubbte sich nur weiter ab. Dieser Bastard war es gar nicht wert, dass man ihm eine Antwort gab … Er kümmerte sich nicht mehr um Charles Freck, sondern nur noch um sich selbst. Kümmerte sich nur noch um seine eigenen lebenswichtigen, schrecklichen, dringenden Bedürfnisse, die ihn mit Haut und Haaren in Anspruch nahmen. Alles andere war zweitrangig. Mit Ausnahme des Hundes vielleicht. Jerry machte sich immer noch Gedanken über Max, den Hund.
Charles Freck rief einen Typ an, von dem er hoffte, dass er einen Posten Stoff im Angebot hatte. »Kannste mir auf die Schnelle zehn Ts rüberschieben?«
»Mann, ich sitz doch selbst auf dem Trockenen und versuch gerade, was ranzuschaffen. Sag mir Bescheid, wenn du was auftreibst, ich könnte dringend was gebrauchen.«
»Was ist denn mit dem Nachschub los?«
»Schätze, die ham ’n paar Lieferungen gekascht.«
Freck hängte ein. Während er deprimiert aus der Telefonzelle trat – kein Doper wickelte einen telefonischen Deal über seinen eigenen Anschluss ab – und langsam zu seinem daneben abgestellten Chevy trottete, spulte er in seinem Kopf eine Phantasienummer ab. In dieser Phantasienummer fuhr er an einer Discount-Drogerie vorbei, und die Discount-Macker hatten das ganze Schaufenster mit Langsamem Tod dekoriert: Langsamer Tod in Flaschen, Langsamer Tod in Dosen, Langsamer Tod in Gläsern und Badewannen und Bottichen und Schüsseln, Millionen von Kapseln und Tabletten und Fixen mit Langsamem Tod, Langsamer Tod gemixt mit Speed und Junk und Barbituraten und psychedelischen Drogen … eben alles, was das Herz begehrt. Und über der Auslage prangte ein riesiges Schild: HIER HABEN SIE KREDIT! Vom Rest des Textes ganz zu schweigen: BILLIG BILLIG BILLIG, DIE NIEDRIGSTEN PREISE IN DER GANZEN STADT!
In Wirklichkeit allerdings hatte die Discount-Drogerie für gewöhnlich nur nutzloses Zeug in der Auslage: Kämme, Flaschen mit ätherischen Ölen, Deosprays – immer den gleichen Schund. Aber ich möchte darauf wetten, dass diese Macker in den Hinterzimmern ihrer Läden Langsamen Tod unter Verschluss halten, reinen, ungepanschten, unverfälschten, unverschnittenen Langsamen Tod, dachte Freck, während er aus der Parklücke setzte und sich in den Nachmittagsverkehr auf dem Harbor Boulevard einfädelte. Ein Päckchen mit zwanzig Kilo drin, mindestens.
Er hätte für sein Leben gerne gewusst, wann und wie sie jeden Morgen das Zwanzig-Kilo-Päckchen mit Substanz T bei der Discount-Drogerie ausluden und woher der Stoff eigentlich kam – aus der Schweiz womöglich oder von einem fernen Planeten, auf dem eine weise Rasse lebte. Vielleicht wusste das auch nur der liebe Gott. Vielleicht lieferten sie den Stoff ja in aller Herrgottsfrühe aus, unter dem Schutz bewaffneter Wächter – unter dem Feuerschutz des Mannes, der da mit einem Lasergewehr rumlungert und so finster und drohend dreinschaut, wie es der Mann immer tut. Wenn irgendwer mir meinen Langsamen Tod klaut, dachte Freck, wobei er sich in den Kopf des Mannes versetzte, dann werde ich ihn ausradieren.
Vielleicht ist Substanz T ein fester Bestandteil aller Arzneimittel, die irgendwas taugen, dachte er dann. Eine kleine Prise hier und da, gemäß der geheimen, exklusiven Formel, die von den Herstellern der Substanz T in einem Tresor in ihrem Stammhaus in Deutschland oder in der Schweiz wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird. Aber in Wahrheit wusste er es besser: Die Behörden vernichteten alle (oder sperrten sie zumindest ein), die Substanz T verkauften oder transportierten oder konsumierten. Folglich würde auch die Discount-Drogerie – ja, die Millionen und Abermillionen von Discount-Drogerien – auf der Flucht erschossen oder unsanft aus dem Geschäft gedrängt oder eingesperrt werden. Vermutlich nur eingesperrt – Discount war eine einflussreiche Ladenkette. Aber wie erschießt man eigentlich eine Kette von Drogerien? Oder wie sperrt man sie in den Knast?
Dann haben die wohl doch nur den üblichen Kram, dachte er, während er über den Boulevard fuhr. Er fühlte sich lausig, weil er nur dreihundert Tabletten Langsamen Tod für Notzeiten wie diese zurückgelegt hatte, sorgfältig im Hinterhof unter der Kamelie vergraben, unter der Hybridkamelie mit den kühlen, großen Blättern, die auch im Frühling nicht braun wurden. Ich hab nur noch eine Wochenration, fuhr es ihm durch den Kopf. Was mach ich bloß, wenn ich auf dem Trockenen sitze? Scheiße!
Mal angenommen, dass allen Dopern in Kalifornien und Teilen Oregons der Arsch am selben Tag auf Grundeis geht. Wow!
Das war der absolute Hit unter den Horrorvisionen, die er manchmal in seinem Kopf abspulte. Und nicht nur er, sondern jeder Doper. Der ganze Westen der Vereinigten Staaten sitzt plötzlich zur gleichen Zeit auf dem Trockenen, und alle Doper gehen am selben Tag auf Turkey, vielleicht so gegen sechs Uhr an einem Sonntagmorgen, während sich die Spießer gerade feinmachen, um eine Runde beten zu gehen.
Ort: Die First Episcopal Church von Pasadena. Zeit: 8.30 Uhr vormittags am Grundeis-Sonntag.
»Liebe Pfarrgemeinde, so lasset uns nun Gott den Herrn anrufen und Ihn darum anflehen, dass Er Seine Gnade leuchten lasse über jene, die sich zu dieser Zeit mit Entzugssymptomen in Todesqualen auf ihren Betten winden.«
»Sein Wille geschehe«, bekräftigte die Gemeinde die Worte des Priesters.
»Doch bevor Er nun gnädiglichst eingreift und unsere Brüder und Schwestern mit einer größeren Lieferung von …«
Offenbar hatte die Besatzung eines Streifenwagens etwas an Frecks Fahrstil bemerkt, was ihm selbst noch gar nicht aufgefallen war; jedenfalls hatten sie ihren Standplatz verlassen und folgten dem Chevy nun dichtauf, bisher noch ohne Blaulicht und Sirene, aber …
Vielleicht fahr ich ja Schlangenlinien oder so was, dachte Freck. Scheiß Viehtransport, der klebt mir direkt an der Stoßstange. Bin gespannt, was die mir anhängen wollen.
BULLE: »Okay, Ihren Namen bitte.«
»Meinen Namen?« (MIR FÄLLT KEIN NAME EIN.)
»Sie wissen Ihren eigenen Namen nicht mehr?« Bulle gibt dem anderen Bullen im Streifenwagen ein Handzeichen. »Der Typ ist anscheinend ausgeklinkt.«
»Bitte, erschießen Sie mich nicht hier!« Charles Freck in seiner Horrorvision, die der Anblick des Streifenwagens im Rückspiegel ausgelöst hat. »Nehmen Sie mich wenigstens mit zur Wache und erschießen Sie mich da, wo es nicht alle Leute sehen.«
Um in diesem faschistischen Polizeistaat zu überleben, dachte er, musst du immer einen Namen parat haben. Deinen Namen. Jederzeit. Das ist das Erste, worauf sie achten. Wenn du deinen eigenen Namen nicht mehr zusammenkriegst, dann wissen sie, dass du auf einem Trip bist.
Am besten, entschied er, schere ich aus, sobald ich eine Parklücke sehe, und fahre freiwillig rechts ran, bevor die Bullen das Blaulicht blitzen lassen oder sonst was unternehmen, und dann, wenn sie neben mir anhalten, werde ich sagen, ich hätte ’n loses Rad oder sonst ’n Defekt.
Das finden die immer toll – wenn du auf diese Weise aufgibst, weil dir nichts mehr anderes übrigbleibt. Das ist so, als würdest du dich wie ein Tier zu Boden werfen und ihnen deine ungeschützte Bauchseite hinhalten. Ja, genau das werde ich tun.
Er scherte nach rechts aus und brachte den Wagen zum Stehen, als die Vorderreifen gegen den Bordstein stießen. Der Streifenwagen fuhr vorbei – ohne anzuhalten.
Für nichts und wieder nichts rausgefahren, dachte er. Jetzt werde ich meine liebe Mühe damit haben, wieder rückwärts rauszusetzen, weil der Verkehr so dicht ist. Er stellte den Motor ab. Vielleicht sollte ich einfach ein Weilchen hier sitzen bleiben und Alphameditation machen oder mich in höhere Bewusstseinszustände versetzen. Vielleicht indem ich mir die Bräute anschaue, die da so vorbeispazieren. Möchte wissen, ob’s irgendwo eine Firma gibt, die Geiloskope herstellt. Statt Alpha-Bioskopen. Geilheitswellen, erst sehr kurz, dann länger, größer, größer, bis sie schließlich über die Skala hinausschießen.
Das bringt alles nichts, begriff er dann. Ich sollte unterwegs sein, um herauszufinden, ob irgendwo Stoff zu bekommen ist. Ich brauche unbedingt Nachschub, sonst klinke ich bald wirklich aus, und dann werd ich überhaupt nichts mehr geregelt kriegen. Wenn’s mal so weit ist, werd ich nicht mal mehr am Bordstein sitzen können, so wie jetzt. Ich werde dann nicht nur nicht mehr wissen, wer ich bin, ich werde nicht mal mehr wissen, wo ich bin oder was um mich herum läuft.
Was läuft hier eigentlich? Was für einen Tag haben wir heute? Wenn ich nur wüsste, welcher Tag heute ist, würde mir auch alles andere wieder einfallen; es würde nach und nach in mein Gehirn zurücksickern.
Mittwoch, Downtown von L.A., Westwood-Bezirk: Direkt vor Charles Freck eine dieser riesigen Einkaufsarkaden, von einer Mauer umgeben, an der man wie ein Gummiball abprallt – außer man hat eine Kreditkarte dabei, mit der man durch den elektronischen Sperrgürtel gelangen kann. Da Freck für keine der Arkaden eine Kreditkarte besaß, kannte er das Innere der Läden nur vom Hörensagen. Offenbar gab es in den Arkaden eine ganze Reihe von Läden, die Qualitätsprodukte an die Spießer verkauften – vor allem natürlich an die Spießerehefrauen. Er sah zu, wie die uniformierten und bewaffneten Wächter am Haupttor die Kunden einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Die Wächter achteten darauf, dass der Mann oder die Frau auch wirklich zu seiner oder ihrer Kreditkarte passte und dass die Karte nicht geklaut, verkauft, gekauft worden war oder in betrügerischer Absicht benutzt wurde. Eine Menge Leute strömten durch den Haupteingang hinein, aber Freck vermutete, dass etliche davon nur einen Schaufensterbummel machen wollten. Die können doch nicht alle das brennende Verlangen haben, um diese Zeit einkaufen zu gehen, überlegte er. Es ist schon spät, kurz nach zwei. Zwei Uhr nachts. Die Läden waren hell erleuchtet. Wie alle seine Freak-Brüder und -Schwestern, die in dieser Nacht unterwegs waren, konnte Freck die Lichter von draußen sehen, Lichter wie bunte Funkenkaskaden, wie ein Vergnügungspark für große Kinder.
Auf dieser Seite der Einkaufsmall gab es nicht viele Geschäfte, die keine Kreditkarten verlangten und sich nicht von bewaffneten Wächtern schützen ließen. Nur ein paar Läden für alltägliche Besorgungen – ein Schuhgeschäft, ein TV-Shop, eine Bäckerei, ein Schlüsseldienst, eine Schnellwäscherei. Freck schaute zu, wie ein Mädchen, das ein kurzes Plastikjäckchen und eine Stretchhose trug, von Geschäft zu Geschäft schlenderte. Die Kleine hatte hübsche Haare, aber von hier aus konnte er ihr Gesicht nicht erkennen, und man musste schon das Gesicht sehen, um beurteilen zu können, ob eine Braut wirklich scharf war. Keine schlechte Figur, dachte er. Das Mädchen blieb eine Zeit lang vor einem Schaufenster stehen, in dem Lederwaren ausgestellt waren. Sie schien sich für einen mit Quasten verzierten Geldbeutel zu interessieren; Freck sah, wie die Kleine sich die Nase an der Schaufensterscheibe platt drückte und hin- und hergerissen den Geldbeutel anstarrte. Wetten, dass sie gleich reingeht und ihn sich zeigen lässt?, dachte er. Im nächsten Augenblick tänzelte das Mädchen tatsächlich in den Laden, ganz wie Freck es erwartet hatte.
Seine Aufmerksamkeit richtete sich dann auf eine andere Braut, die den Bürgersteig entlanggeschlendert kam. Sie trug eine gekräuselte Bluse und hohe Absätze, silberne Haare und zu viel Make-up. Versucht, älter auszusehen, als sie ist, dachte er. Vielleicht geht sie sogar noch auf die Highschool. Nach dieser Braut kam nichts mehr, was der Rede wert gewesen wäre. Freck machte den Bindfaden los, der die Klappe des Handschuhfachs an ihrem Platz hielt, und holte ein Päckchen Zigaretten heraus. Während er sich eine ansteckte, schaltete er mit der anderen Hand das Autoradio ein, einen Rock-Sender. Früher einmal hatte er sogar einen Stereo-Kassettenrekorder besessen, aber als er eines Tages mal wieder total abgefüllt gewesen war, hatte er nicht daran gedacht, den Rekorder mit ins Haus zu nehmen, und am nächsten Tag war das Ding verschwunden gewesen. Deshalb hatte er jetzt eben nur noch ein mickriges Radio. Und irgendwann würden sie ihm das wohl auch noch wegnehmen. Egal, er wusste ja, wo er praktisch umsonst ein neues Radio kriegen konnte, besser gesagt: ein gebrauchtes Radio. Im Übrigen war sein Chevy ohnehin reif für den Schrottplatz – die Dichtungsringe waren porös und die Kompression im Eimer. Vermutlich hatte er ein Ventil geschrottet, als er eines Abends mit einer Ladung guten Stoffs über den Freeway nach Hause gerast war. Manchmal, wenn er eine wirklich große Partie gemacht hatte, wurde er paranoid – nicht so sehr wegen der Bullen, sondern weil er befürchtete, dass andere Leute aus der Szene ihm den Stoff klauen könnten, irgend so ein Szenetyp, halb meschugge vor Turkey und dopegeil wie ’n Weltmeister.
In diesem Moment ging ein weiteres Mädchen vorbei, das Frecks Aufmerksamkeit erregte: schwarzes Haar, hübsch, ein aufreizend langsamer Schlenderschritt. Sie trug eine offene Bolerobluse und eine etwas verwaschene, weiße Baumwollhose. Hey, die kenn ich doch, dachte er. Das ist Bob Arctors Mädchen. Klar, das ist Donna!
Er stieß die Wagentür auf und schwang sich aus seinem Chevy. Das Mädchen warf ihm einen kurzen, misstrauischen Blick zu und ging weiter, ohne langsamer zu werden. Er folgte ihr.
Denkt bestimmt, ich will ihr an die Wäsche, dachte er, während er sich zwischen den Passanten einen Weg bahnte. Wie leichtfüßig sie einen Zahn zulegte. Er konnte sie jetzt kaum mehr erkennen – als sie einen flüchtigen Blick über die Schulter zurückwarf. Ein festes, ruhiges Gesicht … Er sah große Augen, die ihn abschätzig musterten. Bestimmt versuchte sie, seine Geschwindigkeit zu kalkulieren und festzustellen, ob er sie würde einholen können. Nicht, wenn sie weiter so ein Tempo vorlegt, dachte er. Mann, die bewegt sich ja wie eine Katze!
An der Ecke warteten die Leute darauf, dass die Fußgängerampel auf Grün schaltete; Autos bogen mit quietschenden Reifen nach links ab. Doch das Mädchen ging einfach weiter, schnell, aber würdevoll schlängelte sie sich zwischen den dahinschießenden Wagen hindurch. Die Fahrer starrten sie aufgebracht an – sie schien die wütenden Blicke nicht einmal zu bemerken.
»Donna!« Als die Ampel schließlich umschaltete, stürzte Freck hinter ihr her und holte sie ein. Trotzdem fing sie nicht an zu laufen, sondern ging einfach so zügig weiter wie bisher. »Bist du nicht Bobs Mädchen?« Irgendwie schaffte er es, sich ihr in den Weg zu stellen – um endlich ihr Gesicht genauer mustern zu können.
»Nein«, sagte sie. »Nein.« Sie kam auf ihn zu, kam genau auf ihn zu; und er wich zurück, weil er plötzlich bemerkte, dass sie ein kurzes Messer in der Hand hielt und dieses Messer genau auf seinen Magen gerichtet war. »Hau ab«, fauchte sie, wobei sie unbeirrt weiterging, ohne langsamer zu werden oder auch nur einen Augenblick lang zu zögern.
»Bestimmt bist du’s«, sagte Freck. »Wir haben uns mal auf seiner Bude kennengelernt.« Er konnte das Messer kaum sehen, nur ein winziges Stückchen der Klinge, aber er wusste, dass es da war. Sie würde ihn einfach niederstechen und dann weitergehen. Er wich immer weiter zurück, die Hände in einer abwehrenden Geste erhoben. Das Mädchen verbarg das Messer so geschickt in ihrer Hand, dass keiner der anderen Passanten es sehen konnte. Aber er, Charles Freck, sah es nur zu gut – die Klinge zielte genau auf ihn. Im letzten Augenblick trat er zur Seite – und das Mädchen ging einfach schweigend weiter.
»Hey, hör doch mal!«, sagte er zu ihrem Rücken und dachte: Ich bin mir ganz sicher, dass es Donna ist. Sie kommt bloß im Moment nicht drauf, wer ich bin und dass wir uns kennen. Hat wohl Angst, dass ich ihr an den Hintern grabsche. Heutzutage muss man verdammt vorsichtig sein, wenn man auf der Straße ’ne fremde Braut anquatscht. Die sind jetzt alle auf der Hut. Na ja, kein Wunder, wenn man bedenkt, was schon so alles passiert ist!
Heißes kleines Messer, dachte er dann. Wäre besser, wenn die Ladys nicht mit so was rumspielten; jeder Macker könnte ihr das Handgelenk umdrehen und die Klinge auf sie selbst richten, wenn er’s wirklich darauf anlegen würde. Ich hätt’s auch tun können. Wenn ich sie wirklich hätte anmachen wollen. Doch er stand einfach nur da und ärgerte sich. Ich weiß doch ganz genau, dass das Donna war!
Dann, als er zu seinem Wagen zurückgehen wollte, bemerkte er plötzlich, dass das Mädchen am Rand des sich dahinwälzenden Fußgängerstroms stehen geblieben war und schweigend zu ihm herüberstarrte.
Vorsichtig ging er auf sie zu und sagte: »Eines Abends hatten ich und Bob und noch so ’ne Braut ein paar alte Simon-and-Garfunkel-Bänder aufgetrieben, und du saßt da …« Sie hatte die ganze Zeit über Kapseln mit astreinem Tod gefüllt, eine nach der anderen, ganz systematisch. Über eine Stunde. El Primo. Numero Uno: Tod. Und als sie damit fertig gewesen war, hatte sie jedem eine Kapsel angeboten, und sie hatten sie eingeworfen. Alle – nur Donna nicht. Ich deale nur mit dem Zeug, hatte sie gesagt, wie soll ich denn noch ’n Schnitt machen, wenn ich die Dinger alle selbst schlucke?
»Ich dachte, du wolltest mir eins überziehen und mich dann ficken«, erwiderte das Mädchen.
»Nein. Ich hab nur gedacht, ich könnte dich …« Er zögerte. »Na ja, dich ein Stück im Wagen mitnehmen … Auf dem Bürgersteig?«, rief er dann ungläubig, als er begriff, was sie eigentlich gesagt hatte. »Am helllichten Tag?«
»Vielleicht in einem Hauseingang. Oder du würdest mich in einen Wagen schleifen.«
»Aber wir kennen uns doch«, protestierte Freck. »Und Arctor würde mich allemachen, wenn ich das täte.«
»Ich hab dich gar nicht erkannt.« Sie tat drei Schritte auf ihn zu. »Ich bin ’n bisschen kurzsichtig.«
»Dann solltest du Kontaktlinsen tragen.« Ihm fiel auf, dass sie klare, große, dunkle, warme Augen hatte. Was bedeutete, dass sie nicht auf Dope war.
»Hatt ich früher mal. Aber dann ist mir eine rausgefallen, in ’ne Schüssel mit Bowle. Du weißt schon, Acid-Bowle, auf ’ner Party. Das Ding ist bis auf den Boden gesunken und wahrscheinlich hat sie wer rausgeschöpft und getrunken. Hoffentlich hat’s ihm geschmeckt – ich hab immerhin fünfunddreißig Dollar dafür hinlegen müssen.«
»Kann ich dich denn nun irgendwohin mitnehmen?«
»Du willst mich ja doch nur im Wagen ficken.«
»Nein, echt nicht. Ich krieg im Moment sowieso keinen hoch, schon seit ’n paar Wochen nicht mehr. Muss an was liegen, womit die den Stoff strecken. Irgendwas Chemisches.«
»Mann, das ist ja ’ne heiße Ausrede. Aber damit ist mir schon mal einer gekommen. Alle ficken sie mich nur.« Sie verbesserte sich sofort: »Jedenfalls versuchen sie’s. So läuft’s nun mal, wenn man ’ne Lady ist. Ich hab gerade ’nem Typen ein Gerichtsverfahren angehängt, wegen Belästigung und Beleidigung. Mein Anwalt verlangt vierzig Riesen Schadensersatz.«
»Wie weit ist der Typ denn gegangen?«
»Er hat mir mit seinen Schmierfingern die Möpse betatscht.«
»Das ist aber keine vierzig Riesen wert.«
Gemeinsam gingen sie zu Frecks Wagen.
»Hast du was zu verkaufen?«, fragte er sie. »Ich brauch wirklich dringend was. Ehrlich gesagt, ich bin praktisch auf null runter, stell dir das mal vor, auf null! Ich wär schon mit wenig zufrieden – wenn du nur was lockermachen könntest.«
»Ich kann dir was besorgen.« »Tabletten. Ich drücke nicht.«
»Ja.« Den Kopf leicht gesenkt, nickte sie. »Aber die Dinger sind im Moment Mangelware – die Quelle ist zeitweilig ausgetrocknet. Wahrscheinlich hast du das selbst schon mitgekriegt. Ich kann dir nicht sehr viele besorgen, aber …«
»Wann?«, unterbrach er sie. Sie hatten mittlerweile den Wagen erreicht. Freck öffnete die Tür und stieg ein. Donna nahm neben ihm Platz. Und dann saßen sie da, Seite an Seite.
»Übermorgen«, sagte sie. »Aber nur, wenn ich diesen Typ irgendwie erwischen kann. Wird schon klappen.«
Scheiße, dachte Freck. Erst übermorgen. »Geht’s nicht eher? Bis, sagen wir mal, heute Abend?« »Allerfrühestens morgen.« »Wie viel?«
»Sechzig Dollar für hundert Stück.« »Mann, das ist aber ’n stolzer Preis.« »Dafür sind die auch echt Spitze. Ich hab schon früher welche von dem Typen bekommen – die sind wirklich nicht so wie das Zeug, das einem sonst angedreht wird. Mein Wort drauf, der Stoff ist echt sein Geld wert. Wann immer es geht, kaufe ich bei diesem Typen. Aber er hat nicht immer welche. Weißt du, der Typ hat gerade eine Tour in den Süden runter gemacht. Glaub ich zumindest. Er ist gerade erst zurückgekommen. Hat den Stoff selbst rangeschafft, ohne Zwischenhändler, darum weiß ich, dass die Tabletten mit Sicherheit gut sind. Und du musst mir nichts im Voraus bezahlen. Erst, wenn ich sie habe, Okay? Ich vertraue dir.«
»Ich leg nie Geld hin, ohne die Ware zu sehen.«
»Manchmal muss man’s aber.«
»Okay. Kannst du mir dann mindestens ein Hunderterpack besorgen?« Freck versuchte zu kalkulieren, wie viel er sich leisten konnte. Vielleicht konnte er in zwei Tagen 120 Dollar flüssig machen und dann zweihundert Tabletten von ihr kaufen. Und wenn er in der Zwischenzeit irgendwo einen besseren Deal machte, mit anderen Leuten, dann konnte er den Deal mit Donna ja wieder vergessen und bei denen kaufen. Das war der Vorteil dabei, wenn man nie Geld vorstreckte – das und die Tatsache, dass man nicht gelinkt werden konnte.
»Da hast du aber mächtig Glück gehabt, dass wir uns getroffen haben«, sagte sie, als er den Wagen startete und rückwärts auf die Straße setzte. »Ich treff mich in ungefähr ’ner Stunde mit so einem Macker, der mir vielleicht alles abkauft, was ich eben ranschaffen kann … Du scheinst ja ’ne ziemliche Pechsträhne gehabt zu haben, aber jetzt geht’s wieder bergauf.« Sie lächelte, und er erwiderte ihr Lächeln.
»Wär nur toll, wenn du sie eher kriegen könntest.«
»Okay, wenn’s klappen sollte …« Donna öffnete ihren Geldbeutel und holte einen kleinen Notizblock und einen Stift mit dem Aufdruck SPARKS AUTO-ELEKTROSERVICE heraus. »Wie kann ich dich erreichen? Und dein Name ist mir übrigens immer noch nicht eingefallen.«
»Charles B. Freck«, sagte er und gab ihr seine Telefonnummer – das heißt, eigentlich war es gar nicht seine, sondern die eines Spießerfreundes, über die er solche Kontakte immer laufen ließ. Sie schrieb die Nummer sorgfältig auf. Wie schwer ihr das Schreiben doch fällt, dachte er. Malt einen Buchstaben nach dem anderen hin. Die bringen den Mädchen in der Schule nur noch Scheiß bei. Hat wohl immer unter der Schulbank gesessen. Aber ’ne heiße Braut ist sie ja. Na ja, dann kann sie eben kaum lesen und schreiben, was soll’s? Was bei ’ner Braut wichtig ist, das sind handliche Titten.
»Ich glaube, ich erinnere mich jetzt wieder an dich«, sagte Donna dann. »Vage jedenfalls. Es ist alles irgendwie verschwommen, der ganze Abend, ich war ganz schön weggetreten. So richtig weiß ich eigentlich nur noch, wie ich das Pulver in diese kleinen Kapseln getan hab, richtig, Librium-Kapseln … Wir hatten das, was vorher drin war, weggeschüttet. Ich muss die Hälfte runtergekippt haben. Auf den Boden, mein ich.« Sie sah ihn nachdenklich an, wie er so am Steuer saß und fuhr. »Du scheinst ja ganz okay zu sein. Vielleicht können wir öfter miteinander ins Geschäft kommen? Du willst doch hinterher bestimmt noch mehr von dem Zeug, oder?«
»Sicher«, erwiderte Freck. Zugleich überlegte er, ob er wohl den Preis würde drücken können, wenn sie sich das nächste Mal sahen – er hatte so ein Gefühl, als ständen seine Chancen gar nicht mal schlecht. Doch selbst wenn er Donna nicht runterhandeln konnte, hatte er es wieder einmal geschafft. Was hieß: Er hatte eine neue Nachschubquelle aufgetan.
Glück ist, dachte er, wenn du weißt, dass du ein paar Pillen kriegen kannst.
Draußen, außerhalb des Wagens, strömten der Tag und all die geschäftigen Menschen, das Sonnenlicht und das pulsierende Leben der Stadt vorbei. Charles Freck war glücklich.
Irre, was er da durch Zufall entdeckt hatte, und das nur, weil sich eine Polizeistreife ohne besonderen Grund an seine Fersen geheftet hatte. Eine unerwartete neue Quelle für Substanz T! Was konnte er mehr vom Leben verlangen? Damit hatte er nun ungefähr zwei Wochen, nahezu einen halben Monat, bevor er krepierte oder wenigstens beinahe krepierte, was bei einem Entzug von Substanz T praktisch das Gleiche war. Zwei Wochen! Freck wurde es wunderbar leicht ums Herz, und für einen kurzen Augenblick roch er die erregenden Düfte des Frühlings, die durch das offene Seitenfenster hereinwehten.
»Willst du mitkommen, Jerry Fabin besuchen?«, fragte er sie dann. »Ich bring ihm eine Ladung Klamotten rüber in die staatliche Nervenklinik Nummer drei, wo sie ihn letzte Nacht eingeliefert haben. Ich bring jedes Mal nur ein bisschen rüber, weil’s ja immer noch möglich ist, dass er bald wieder rauskommt, und ich hab keine Lust, dann alles zurückkarren zu müssen.«
»Ich möchte ihn lieber nicht besuchen«, erwiderte Donna.
»Du kennst ihn? Jerry Fabin?«
»Jerry Fabin denkt, dass ich es gewesen bin, der ihn mit diesen Wanzen infiziert hat.«
»Blattläusen.«
»Nun, damals wusste er noch nicht, was das für Viecher waren. Ich halte mich besser von ihm fern. Als ich ihn zum letzten Mal sah, wurde er richtig bösartig. Es sind die Rezeptoren in seinem Gehirn, glaub ich. Es scheint mit den Rezeptoren zusammenzuhängen, das steht zumindest neuerdings in den Regierungsinfos.«
»Das lässt sich doch wieder in Ordnung bringen, oder?«
»Nein. Es ist irreversibel.«
»Die Leute in der Klinik haben mir gesagt, dass ich ihn besuchen dürfte und dass sie glauben, er wird wieder …« Freck machte eine hilflose Geste. »Dass er nicht …« Wieder bewegte er seine Hände hilflos hin und her; es war schwierig, in Worte zu fassen, was er über seinen Freund sagen wollte.
Donna blickte ihn besorgt an. »Du hast doch nicht etwa einen Schaden im Sprachzentrum? Eine Schädigung der – wie nennt man die Dinger doch gleich – der Hinterhauptslappen?«
»Nein«, sagte er. Mit Nachdruck.
»Hast du denn irgendwelche Schäden?« Sie tippte sich an den Kopf.
»Nein, es ist nur … Verstehst du das denn nicht? Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn ich über diese beschissenen Kliniken spreche. Ich hasse die Kliniken für neurale Aphasie. Einmal war ich in einer, um so einen Typ zu besuchen. Weißt du, der hat die ganze Zeit versucht, den Fußboden zu bohnern, und die Pfleger sagten, er würd’s nie schaffen. Ich meine, er konnt’s einfach nicht mehr auf die Reihe kriegen, wie man das macht … Was mich so unheimlich geschockt hat, war, dass er’s immer weiter versucht hat. Nicht nur so ’ne Stunde lang oder so, er hat’s immer noch versucht, als ich einen Monat später wieder hingefahren bin. So, als ob er’s immer wieder versucht hätte, wieder und wieder, wie da, wo ich ihn zuerst gesehen hab, bei meinem ersten Besuch. Er konnte einfach nicht kapieren, warum er’s nicht auf die Reihe bekam. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Ausdruck auf seinem Gesicht. Er war sich so sicher, dass er’s hinkriegen würde – wenn er nur endlich herausbekam, was er eigentlich falsch machte. ›Was mache ich denn bloß falsch?‹, fragte er die Pfleger immer wieder. Und es gab keine Möglichkeit, es ihm begreiflich zu machen. Ich meine, sie haben’s ihm erklärt – verdammt nochmal, sie haben’s ihm erklärt –, aber er kriegte es trotzdem immer noch nicht auf die Reihe.«
»Ich hab gelesen, dass die Wahrnehmungszentren im Gehirn zuerst den Bach runtergehen«, sagte Donna ruhig. »Wenn sich zum Beispiel einer ’nen miesen Schuss gesetzt hat. ’Ne zu hohe Dosis oder so …« Sie musterte den Wagen, der direkt vor ihnen fuhr. »Sieh mal, da ist einer von diesen neuen Porsches mit zwei Motoren.« Sie zeigte aufgeregt nach vorn. »Wow!«
»Ich kannte mal einen Typ, der sich einen dieser neuen Porsches frisiert hatte und dann damit auf den Riverside Freeway rausfuhr und ihn auf 75 hochjagte.« Freck gestikulierte wild mit den Händen. »Geradewegs in den Arsch von einem Sattelschlepper. Hat ihn gar nicht gesehen, nehme ich an.« In seinem Kopf ließ er eine Phantasienummer abspulen: Charles Freck, hinter dem Steuer eines Porsche, aber er bemerkte den Sattelschlepper rechtzeitig – alle Sattelschlepper. Und jedermann auf dem Freeway, dem Hollywood Freeway zur Hauptverkehrszeit, bemerkte ihn, Charles Freck. Schließlich konnte man diesen schlaksigen, breitschultrigen, gutaussehenden Macker, der da mit 200 Meilen pro Stunde über den Freeway brauste, auch gar nicht übersehen. Und den Bullen hing der Unterkiefer bis runter auf die Schuhe.
»Du zitterst ja.« Donna beugte sich zu ihm hinüber und legte ihre Hand auf seinen Arm, eine ruhige Hand, auf die er sofort ansprach. »Fahr langsamer.«
»Ich bin müde«, sagte Freck. »Ich war zwei Tage und zwei Nächte auf den Beinen und hab Wanzen gezählt. Hab sie gezählt und in Flaschen getan, bis ich vor Müdigkeit aus den Latschen gekippt bin. Und als wir dann am nächsten Morgen aufgestanden sind und uns fertiggemacht haben, um die Flaschen in den Wagen zu laden und sie zu diesem Arzt zu bringen, weil wir ihm die Wanzen zeigen wollten – da war nichts in den Flaschen drin. Leer.« Er konnte das Zittern jetzt selber spüren, konnte es in seinen Händen spüren, die auf dem Lenkrad lagen, konnte die zitternden Hände auf dem Lenkrad sehen, bei zwanzig Meilen pro Stunde. »Alle leer. Die ganzen Scheiß-Flaschen. Nichts drin. Keine Wanzen. Und dann hab ich’s endlich begriffen. Scheiße nochmal, ich hab begriffen, was mit seinem Gehirn los war. Mit Jerrys Gehirn.«
Die Luft roch nicht mehr länger nach Frühling – und Freck begriff, dass er dringend einen Hit Substanz T brauchte, weil es vielleicht schon später am Tag war, als er dachte. Oder war die letzte Dosis, die er eingepfiffen hatte, geringer gewesen als angenommen? Nun, zum Glück hatte er immer einen Notvorrat dabei, ganz hinten im Handschuhfach. Er spähte aus dem Fenster und hielt Ausschau nach einem freien Parkplatz, wo er anhalten konnte.
»Manchmal macht einem das Gehirn was vor«, sagte Donna wie aus großer Entfernung; sie schien sich zurückgezogen zu haben, schien weit weg zu sein. Freck fragte sich, ob ihr seine ziellose Fahrerei wohl auf die Nerven ging. Vielleicht lag es daran.
Ein weiterer Phantasie-Film spulte sich plötzlich in seinem Kopf ab, ganz ohne sein Dazutun: Er sah einen großen Pontiac, aufgebockt auf einem kippenden Wagenheber, und ein Bürschchen von vielleicht dreizehn Jahren mit langen, strohigen Haaren, das sich verzweifelt gegen den wegrollenden Wagen zu stemmen versuchte und dabei zugleich grell um Hilfe schrie. Er sah sich selbst zusammen mit Jerry Fabin aus dem Haus, Jerrys Haus, stürzen und die mit Bierdosen übersäte Auffahrt hinunterrennen. Er, Charles Freck, griff nach der Wagentür auf der Fahrerseite, um sie aufzureißen und dann auf das Bremspedal zu treten. Aber Jerry Fabin, der nur eine Hose trug und nicht einmal Schuhe anhatte – er hatte gerade geschlafen, und sein Haar war wirr und zerwühlt –, dieser Jerry Fabin also rannte zum Heck des Wagens und drängte den Jungen mit seiner bloßen, bleichen Schulter, die nie das Licht des Tages sah, in letzter Sekunde von dem Fahrzeug weg. Der Wagenheber rutschte endgültig ab und fiel um, das Heck des Wagens krachte runter, die Felge und das Rad rollten davon – aber dem Jungen war nichts passiert.
»Zu spät für die Bremse«, keuchte Jerry und versuchte, sich seine hässlichen, schmierigen Haare aus den Augen zu streichen. Er blinzelte. »Zu spät«, wiederholte er.
»Isser okay?«, rief Freck. Sein Herz hämmerte immer noch.
»Ja.« Jerry stand schwer atmend neben dem Jungen. »Scheiße!«, schrie er ihn dann an, um sich Luft zu machen. »Hab ich dir nicht gesagt, du sollst warten, bis wir’s zusammen machen? Wenn ein Wagenheber wegrutscht … Scheiße, Mann, du kannst doch keine fünftausend Pfund aufhalten!« Sein Gesicht zuckte. Der Junge, der von allen nur Rattenarsch genannt wurde, blickte ihn wie ein Häufchen Elend an. »Mann, ich hab’s dir doch wieder und wieder gesagt!«
»Ich wollte auf die Bremse treten«, sagte Freck, der plötzlich begriff, wie idiotisch er sich verhalten hatte, begriff, dass er einen Fehler gemacht hatte, der genauso schwerwiegend und tödlich gewesen war wie der des Jungen. Er, ein erwachsener Mann, hatte versagt, weil er unfähig gewesen war, richtig zu reagieren. Und genau wie der Junge suchte er nun nach Worten, um sein Versagen zu rechtfertigen. »Aber ich seh jetzt ein …«, begann er – und dann brach die Phantasie-Nummer ab; eigentlich war sie nur eine exakte Wiedergabe realer Ereignisse gewesen, denn Freck erinnerte sich noch genau an den Tag, an dem sich diese Sache abgespielt hatte, damals, als sie noch alle zusammenlebten. Jerrys guter Instinkt – ohne den hätte Rattenarsch eine Sekunde später unter dem Heck des Pontiac gelegen, mit zerschmettertem Rückgrat!
Und so war es weitergegangen: Alle drei trotteten in düsterer Stimmung zum Haus zurück, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, die Felge und den Reifen einzufangen, die immer noch die Straße hinunterrollten.
»Ich war eingeschlafen«, murmelte Jerry, als sie das abgedunkelte Innere des Hauses betraten. »Zum ersten Mal seit Wochen haben mich die Wanzen lange genug in Ruhe gelassen, dass ich’s geschafft hab. Ich hab seit fünf Tagen keinen Schlaf mehr gekriegt – bin immer nur rumgelaufen und rumgelaufen. Ich hab schon gedacht, sie wären vielleicht weg – und sie waren weg, wirklich. Ich hab gedacht, sie hätten endlich aufgegeben und wären woandershin gegangen, zu den Nachbarn vielleicht, raus aus dem Haus. Aber jetzt kann ich sie wieder spüren … Der zehnte Anti-Wanzen-Strip, den die mir verkauft haben, oder war’s der elfte – die haben mich wieder reingelegt.« Seine Stimme klang gedämpft, nicht wütend, gedämpft und irgendwie verwundert. Er legte seine Hand auf Rattenarschs Kopf und versetzte ihm einen kurzen, scharfen Schlag. »Du blöder Kerl! Wenn ein Wagenheber wegrutscht, dann nimm gefälligst die Beine in die Hand. Vergiss den Wagen. Stell dich bloß nicht hinter ihn und versuch ja nicht, dich einer solchen Masse entgegenzustemmen, sie mit deinem Körper aufzuhalten.«
»Aber Jerry, ich hatte Angst, die Achse …«
»Scheiß was auf die Achse. Scheiß was auf den Wagen. Dein Leben ist wichtiger.« Sie gingen durch das dunkle Wohnzimmer, sie alle drei – und die Vision eines längst vergangenen Augenblicks verschwamm und erlosch dann für immer.
Zwei
»Meine sehr verehrten Herren vom Anaheim Lions Club«, sagte der Mann am Mikrophon, »es erfüllt mich mit außerordentlicher Freude, dass wir dank der freundlichen Genehmigung der Behörden des Orange County heute Nachmittag einen Undercover-Rauschgiftermittler in unserer Mitte begrüßen dürfen. Nach einem einleitenden Referat unseres Gastes werden wir die einmalige Gelegenheit haben, ihn zu seiner Person und seiner Arbeit zu befragen.« Oh, wie er strahlte, dieser Mann mit dem rosa Waffelfiber-Anzug, der gelben Plastikkrawatte, dem blauen Hemd und den Schuhen aus Lederimitat! Ein so übergewichtiger wie überalterter Mann, der pausenlos lachte, als sei er überglücklich, auch wenn es wenig oder gar nichts gab, weswegen man glücklich sein konnte.
Der Undercover-Ermittler beobachtete ihn angeekelt.
»Nun, wie Sie bereits bemerkt haben werden«, fuhr der Versammlungsleiter fort, »können Sie den Mann, der hier zu meiner Rechten sitzt, eigentlich gar nicht richtig sehen, geschweige denn erkennen. Und das liegt an einer besonderen Vorrichtung, die er trägt – dem sogenannten Jedermann-Anzug. Diesen Anzug trägt unser verehrter Gast während seines unermüdlichen Einsatzes für Recht und Ordnung fast ständig. Den Grund dafür werden Sie in wenigen Minuten erfahren.«
Das Publikum, das in jeder nur denkbaren Hinsicht ein Spiegelbild des Versammlungsleiters war, betrachtete interessiert den Mann in seinem Jedermann-Anzug.
»Dieser Mann«, verkündete der Versammlungsleiter nun, »den wir einfach nur Fred nennen wollen, weil er unter diesem Decknamen die Informationen, die er sammelt, an seine Vorgesetzten weitergibt, dieser Mann also kann, sobald er einen Jedermann-Anzug anhat, weder durch den Klang seiner Stimme noch durch einen auf technischem Wege erstellten Stimmabdruck, noch durch sein Aussehen identifiziert werden. Würden Sie nicht auch sagen, dass er nur wie ein vager Fleck aussieht? Nicht wahr?« Bei diesen Worten verzog er sein Gesicht zu einem breiten Lächeln. Das Publikum nickte und lächelte konziliant zurück. Ja, das war wirklich lustig.
Der Jedermann-Anzug stammte aus den Forschungslaboratorien des Beil-Konzerns, eigentlich eine Zufallsentdeckung, die einem Angestellten namens S.A. Powers wie durch Zauberei gelungen war. Vor einigen Jahren hatte Powers mit enthemmenden Substanzen experimentiert, die direkt auf das Nervengewebe einwirkten, und eines Abends hatte er sich selbst eine als ungefährlich und nur schwach euphorisierend geltende IV-Injektion verabreicht – was wider Erwarten zu einem katastrophalen Abfall der GABA-Flüssigkeit in seinem Gehirn geführt hatte. Subjektiv hatte Powers die Folgen der Injektion so erlebt, als würden pausenlos geisterartig phosphoreszierende Phänomene an die gegenüberliegende Wand seines Schlafzimmers projiziert – eine mit irrwitziger Geschwindigkeit ablaufende Montage von Bildern, die damals in Powers den Eindruck zeitgenössischer abstrakter Gemälde erweckten.
Sechs Stunden lang hatte er überwältigt beobachtet, wie vor seinen Augen Tausende von Picassos vorbeirauschten, und im Anschluss daran war er mehr Bildern von Paul Klee ausgesetzt, als dieser Künstler während seines ganzen Lebens überhaupt geschaffen hatte. S.A. Powers, über den sich nun eine wahre Sturzflut von Modigliani-Gemälden ergoss, stellte die Hypothese auf (schließlich braucht man für alles eine Hypothese), dass die Rosenkreuzler diese Bilder auf telepathischem Weg auf ihn abstrahlten, wobei die telepathischen Impulse möglicherweise noch durch hochkomplexe Mikrorelais-Systeme verstärkt wurden. Doch als ihn dann Kandinsky-Bilder zu martern begannen, erinnerte er sich daran, dass sich das größte Kunstmuseum in Leningrad gerade auf solche nichtgegenständlichen Maler der Moderne spezialisiert hatte. Und daraus wiederum ließ sich die Schlussfolgerung ziehen, dass es die Sowjets waren, die versuchten, telepathischen Kontakt mit ihm aufzunehmen.
Erst am nächsten Morgen erinnerte sich Powers daran, dass ein drastischer Abfall der GABA-Flüssigkeit des Gehirns stets solche Phosphoreszenzphänomene erzeugte; demnach hatte also niemand versucht, auf telepathischem Weg – sei es mit oder ohne Mikrowellen-Verstärker – mit ihm in Verbindung zu treten. Aber immerhin brachte ihn dieses nächtliche Erlebnis auf die Idee für den Jedermann-Anzug! Powers’ Konstruktion bestand aus einer Quarzlinse mit unzähligen Facetten, die mit einem miniaturisierten Computer zusammengeschaltet war. Die Speicher dieses Computers enthielten bis zu eineinhalb Millionen enkodierter Abbilder partieller physiognomischer Charakteristika einer großen Anzahl von Menschen – Männer, Frauen, Kinder –, und der Computer projizierte diese Abbilder nach außen, auf eine hauchdünne, leichentuchähnliche Membran, die groß genug war, um einen durchschnittlichen Menschen zu umhüllen.
Wenn der Computer dann sein in einer Endlosschleife gespeichertes Programm durchlaufen ließ, wurde jede nur erdenkliche Augenfarbe, Haarfarbe, Nasenform, Gebissfiguration und Knochenstruktur des Gesichts in die Projektionsvorrichtung eingespeist. Worauf die Membran genau diese körperlichen Charakteristika annahm – bis auf das nächste Sample umgeschaltet wurde. Um seinen Jedermann-Anzug noch effektiver zu machen, programmierte Powers den Computer darauf, die Abfolge der körperlichen Merkmale, die auf der Membran erschienen, nach Zufallskriterien zu variieren. Und um den Kostenfaktor möglichst gering zu halten (den Leuten von der Regierung imponierte so etwas immer ganz besonders), verwendete Powers als Material für die Membran bisher unverwertbare Abfallprodukte eines großen Industrieunternehmens, das bereits Geschäftsbeziehungen zu Washington unterhielt.
Powers’ Konzeption machte den Träger des Jedermann-Anzugs (natürlich nur innerhalb des Limits von eineinhalb Millionen Sub-Bits, die der Computer speichern und miteinander kombinieren konnte) zu genau dem: zu jedem Mann und zu jeder Frau, und das in stündlichem Wechsel. Daher war es völlig sinnlos, den Träger – oder die Trägerin – eines solchen Anzugs beschreiben zu wollen. Natürlich hatte Powers auch seine eigenen, ganz persönlichen physiognomischen Charakteristika in den Computer eingespeist, so dass im rasenden Wirbel der fragmentierten Gesichtszüge zuweilen auch sein eigenes Gesicht an die Oberfläche kam, vom Computer zufällig aus den einzelnen Bestandteilen zusammengesetzt – ein Ereignis, das nach Powers’ Berechnungen pro Anzug durchschnittlich alle fünfzig Jahre eintreten würde, das heißt, wenn der jeweilige Anzug lange genug in Betrieb war. Einen größeren Anspruch auf Unsterblichkeit konnte Powers nicht erheben.
»Begrüßen Sie also mit mir den vagen Fleck!«, rief der Versammlungsleiter jetzt, und ein allgemeines Klatschen hob an.
Im Innern seines Jedermann-Anzugs seufzte Fred – der zugleich auch Robert Arctor war – und dachte: Das ist alles so fürchterlich. Einmal im Monat wählte das Amt für Drogenmissbrauch des Orange County einen Undercover-Ermittler aus und schickte ihn zu einer Versammlung von Hohlköpfen wie dieser hier. Heute war also er, Fred, an der Reihe, und während er den Blick über seine Zuhörer schweifen ließ, erkannte er, wie sehr er diese Spießer verabscheute. Sie fanden immer alles toll. Sie lächelten. Sie unterhielten sich großartig.
Wer weiß, womöglich setzte der Miniaturcomputer seines Jedermann-Anzugs in diesem Augenblick aus der unendlich großen Zahl von gespeicherten Komponenten S.A. Powers zusammen und projizierte ihn auf die Oberfläche der Membran.
»Aber Spaß beiseite«, sagte der Versammlungsleiter. »Dieser Mann hier …« Er hielt inne und versuchte krampfhaft, sich an den Namen zu erinnern.
»Fred«, meldete sich Bob Arctor. S.A. Fred.
»Ja, richtig, Fred.« Der Versammlungsleiter gewann seine Sicherheit zurück und nahm den Faden wieder auf, wobei er das Publikum anstrahlte. »Wie Sie hören können, ähnelt Freds Stimme einer jener Computerstimmen, die ertönt, wenn Sie unten in San Diego am Schalter einer Bank vorfahren – sie ist vollkommen tonlos, künstlich wie die eines Roboters. Mit dieser Stimme, die im Kopf des Zuhörers keinerlei bleibende Eindrücke hinterlässt, spricht Fred auch, wenn er seinen Vorgesetzten im Amt für Drogenmissbrauch Bericht erstattet.« Er legte eine bedeutungsschwere Pause ein und fuhr dann fort: »Sie müssen wissen, dass jeder Rauschgiftermittler mit seinem Einsatz ein unglaubliches Risiko eingeht. Es ist wohl kein Geheimnis mehr, dass es den Kräften, die hinter dem Drogenhandel stehen, überall in unserem Land gelungen ist, die für die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs zuständigen Behörden auf allen Ebenen zu infiltrieren. Zumindest nach Meinung der Experten dürfte an dieser Tatsache kein Zweifel mehr bestehen. Und genau darum ist der Jedermann-Anzug eine notwendige Schutzmaßnahme – damit das Leben dieser wagemutigen, ihrer Sache treu ergebenen Männer nicht in Gefahr gerät.«
Schwacher Applaus für den Jedermann-Anzug. Dann erwartungsvolle Blicke, die sich auf Fred im Innern seiner Membran richteten.
»Wenn Fred jedoch vor Ort, also in der Drogenszene, arbeitet«, fügte der Versammlungsleiter abschließend hinzu, während er sich schon vom Mikrophon entfernte, um Platz für Fred zu machen, »trägt er diesen Anzug natürlich nicht. Er kleidet sich dann wie Sie oder ich beziehungsweise legt zumeist die Hippie-Tracht an, die in den verschiedenen subkulturellen Gruppen üblich ist, in denen sich ein Rauschgiftermittler bei seinen Ermittlungen bewegt.«
Er gab Fred ein Zeichen, sich zu erheben und an das Mikrophon zu treten. Fred – Robert Arctor – hatte das schon mehrmals mitgemacht und wusste, was er zu sagen hatte und was anschließend auf ihn zukam: nämlich die ewig gleichen Arschloch-Fragen und das ewig gleiche Maß an dumpfer Beschränktheit. Es machte ihn wütend, dass er gezwungen war, hier seine Zeit zu verschwenden. Alles verlorene Liebesmüh … Und dieses Gefühl der Nutzlosigkeit, das er empfand, wurde mit jedem Mal stärker.
»Wenn ich Ihnen auf der Straße begegnen würde«, sagte er ins Mikrophon, nachdem der Beifall abgeklungen war, »würden Sie vermutlich sagen: Schon wieder so ein ausgeflippter Rauschgift-Freak. Sie wären angeekelt und würden sich von mir abwenden.«
Schweigen.
»Ich sehe nicht so aus wie Sie«, fuhr er fort. »Ich kann mir das nicht leisten. Mein Leben hängt davon ab.« Tatsächlich unterschied er sich in seinem Aussehen gar nicht so sehr von ihnen. Außerdem hätte er die Sachen auch dann angezogen, wenn es sein Job nicht erfordern würde. Ihm gefiel die Kleidung, die er da trug. Aber diese Ansprache, die er hier abspulte, war praktisch von A bis Z von anderen Leuten geschrieben und ihm dann zum Auswendiglernen vorgelegt worden. Zwar konnte er in gewissen Grenzen improvisieren, doch letztlich musste er sich an den Standardtext halten, den alle Rauschgiftermittler verwendeten, die öffentliche Vorträge hielten. Diese Regelung war vor Jahren von einem übereifrigen Abteilungsleiter eingeführt und später durch einen Erlass zur Norm erhoben worden.
Er wartete, bis das Auditorium seine Worte verdaut hatte. »Ich möchte mein Referat nicht damit beginnen«, sagte er dann, »Ihnen aufzuzählen, was ich in meiner Funktion als Rauschgiftermittler zu tun versuche. Sie wissen ja bereits, dass es mein Job ist, Dealer dingfest zu machen und vor allem die Quellen aufzuspüren, aus denen die illegalen Drogen stammen, die Drogen, die diese Dealer auf den Straßen unserer Städte und in den Gängen unserer Schulen hier in Orange County verkaufen. Nein, stattdessen möchte ich Ihnen zuerst sagen« – hier legte er eine Kunstpause ein, wie man es ihm in den Public-Relations-Kursen auf der Polizeiakademie beigebracht hatte –, »wovor ich mich am meisten fürchte.«
Nun hatte er seine Zuhörer im Griff – sie schienen nur noch aus offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen zu bestehen.
»Was ich Tag und Nacht fürchte, ist, dass unsere Kinder, Ihre Kinder und meine Kinder …« Wieder eine Kunstpause. »Ich habe zwei.« Dann besonders ruhig und eindringlich: »Sie sind noch klein. Sehr klein.« Darauf ließ er seine Stimme anschwellen, betonte jedes Wort: »Aber das schützt sie nicht davor, süchtig gemacht zu werden, um des bloßen Profits willen süchtig gemacht zu werden – von denen, die unsere Gesellschaft zerstören wollen.« Eine erneute Pause. »Zum gegenwärtigen Zeitpunkt«, fuhr er dann wieder etwas ruhiger fort, »wissen wir noch nicht, wer diese Menschen – oder besser: diese Tiere – sind, die sich unsere Kinder als Beute erkoren haben, so, als würden wir hier nicht in den Vereinigten Staaten leben, sondern in einem Dschungel irgendwo in einem fernen Land. Wir bemühen uns mit all unserer Kraft darum, die Identität dieser Männer aufzudecken, die dieses Gift, tagtäglich von mehreren Millionen von Männern und Frauen eingenommen, injiziert, geraucht, aus gehirnzerstörendem Dreck zusammenbrauen. Natürlich ist das eine langwierige Aufgabe, doch am Ende werden wir ihnen, so wahr uns Gott helfe, die Maske vom Gesicht reißen.«
Eine Stimme aus dem Publikum rief: »Macht sie fertig!«
Eine andere Stimme, ebenso enthusiastisch: »Schnappt euch die roten Schweine!«
Dann Applaus, der in immer neuen Wogen heranrollte und nicht mehr zu enden schien.
Robert Arctor zögerte. Starrte sie an, starrte die Spießer in ihren fetten Anzügen, ihren fetten Krawatten und ihren fetten Schuhen an und dachte: Substanz T kann ihre Gehirne nicht zerstören – sie haben keine.
»Sagen Sie uns, wie es ist!«, drang eine etwas weniger aufdringliche Stimme zu ihm herauf, die Stimme einer Frau. Arctor ließ seinen Blick über die Zuhörer schweifen und machte sie schließlich aus: eine Dame mittleren Alters, die nicht ganz so fett war und ihre Hände wie zum Gebet ängstlich gefaltet hatte.
»Jeden Tag«, sagte Fred oder Robert Arctor oder wer auch immer, »fordert diese Seuche ihren Tribut. Und täglich steigen die Profite – aber wohin sie fließen, werden wir …« Er brach ab. Selbst wenn sein Leben davon abgehangen hätte, hätte er den Rest des Satzes nicht mehr aus den Tiefen seines Gehirns heraufbaggern können, obwohl er ihn doch ungefähr Millionen Mal wiederholt hatte, auf der Akademie, bei all den vorangegangenen Vorträgen.
In dem großen Raum war es jetzt totenstill.
Er fuhr fort: »Nun, irgendwie dreht sich’s doch eigentlich gar nicht um die Profite. Es geht um etwas anderes. Und es spielt sich vor unser aller Augen ab.«
Er stellte fest, dass die Zuhörer keinerlei Unterschied bemerkten – obwohl er vom vorbereiteten Text abgewichen war und jetzt völlig frei improvisierte, das sagte, was ihm gerade in den Sinn kam. Doch wie sollten sie den Unterschied auch bemerken? Was wussten sie schon von dem, was um sie herum vorging? Letztlich interessierte sie das alles doch gar nicht. Die Spießer, dachte er, die in ihren riesigen, festungsgleichen Apartment-Komplexen leben, würden keine Sekunde zögern, das Feuer auf jeden Doper zu eröffnen, der mit einem leeren Kissenüberzug über der Schulter an ihren Mauern kratzt und versucht, ihre elektrische Uhr und ihren Rasierapparat und ihre Stereoanlage zu klauen – alles natürlich noch nicht abbezahlt –, damit er neuen Shit oder seinen nächsten Schuss kriegen kann. Denn wenn er den nicht kriegt, wird er möglicherweise sterben, einfach so, weil er den Entzugsschock und die damit verbundenen Qualen nicht durchsteht. Aber was kümmert das einen, solange man in seiner privaten Festung sitzt und durch die Schießscharten nach draußen späht, solange die Mauern unter Strom stehen und die Wächter genug Munition für ihre Kanonen haben?
»Stellen Sie sich einmal vor«, sagte Fred nun, »Sie wären ein Diabetiker und hätten kein Geld mehr für den nächsten Schuss Insulin. Würden Sie stehlen, um an das Geld zu kommen? Oder würden Sie sich einfach hinlegen und sterben?«
Schweigen.
Im Kopfhörer seines Jedermann-Anzugs meldete sich eine blecherne Stimme: »Ich glaube, Sie sollten sich besser an den vorbereiteten Text halten, Fred. Ich rate Ihnen das wirklich dringend.«
Über sein Kehlkopfmikrophon sagte Fred oder Robert Arctor oder wer auch immer: »Ich hab den Text vergessen.« Nur sein Vorgesetzter in der Zentrale, der nicht mit Mr. F (alias Hank) identisch war, konnte diese Worte hören. Der Vorgesetzte am anderen Ende der Leitung war Fred für die Dauer dieses PR-Einsatzes zugeteilt worden.
»Verstaaanden«, schepperte die Stimme im Kopfhörer. »Ich werde Ihnen den Text vorlesen. Sprechen Sie ihn bitte Wort für Wort nach, aber achten Sie darauf, dass die Pausen ganz natürlich wirken.« Ein kurzes Zögern und das Rascheln von Papier. »Wollen mal sehen … Jeden Tag steigen die Profite – aber wohin sie fließen, werden wir … Ungefähr da haben Sie aufgehört.«
»Ich habe einen psychologischen Block gegen dieses Zeug«, sagte Arctor.
»… bald herausfinden«, fuhr sein offizieller Souffleur fort, ohne auf Arctors Einwand zu achten. »Dann wird die ganze Strenge des Gesetzes die Hintermänner treffen – und wenn es so weit ist, möchte ich um keinen Preis der Welt in ihrer Haut stecken …«
»Wissen Sie eigentlich, warum ich einen Block gegen dieses Zeug habe?«, unterbrach ihn Arctor. »Weil es genau das ist, was die Leute zu den Drogen treibt.« Und er dachte: Der Grund dafür, dass man auf alles pfeift und ein Doper wird, warum man einfach alles aufgibt und angewidert das Weite sucht.
Dann jedoch ließ er seinen Blick einmal mehr über das Publikum schweifen und begriff, dass das auf diese Menschen dort unten nicht zutraf. Nur so konnte man sie überhaupt erreichen, diese Versammlung von Ignoranten, die in emotionaler Hinsicht so debil waren, dass man ihnen alles so erklären musste, wie es in der Grundschule üblich war: A steht für Apfel, und der Apfel ist rund.
»T«, sagte er also laut zu seinen Zuhörern, »steht für Substanz T. Und zugleich für Torheit und Trostlosigkeit und Trennung – Trennung deswegen, weil Substanz T dich von allen anderen Menschen, selbst von deinen besten Freunden, trennt und in einen Kosmos aus Isolation und Einsamkeit und Hass und Misstrauen stößt. T steht schließlich für Tod. Langsamer Tod, wie wir …« Er zögerte kurz. »… die Doper es nennen. Langsamer Tod. Vom Kopf an abwärts … Das wär’s dann.« Er ging zu seinem Stuhl zurück und setzte sich.
»Sie haben alles vermasselt«, knarzte sein Vorgesetzter, der Souffleur. »Ich erwarte Sie in meinem Büro. Sofort, wenn Sie zurückkommen. Zimmer 430.«
»Ja«, erwiderte Arctor. »Ich hab’s vermasselt.«
Die Zuhörer blickten ihn an, als hätte er vor ihren Augen auf die Bühne gepisst. Aber Arctor war sich nicht sicher, was diese Blicke eigentlich bedeuteten.
Der Versammlungsleiter stand auf und ging rasch zum Mikrophon: »Fred hat mich vor Beginn seines Vortrags darum gebeten, lediglich ein kurzes, einführendes Statement abzugeben und anstelle eines langen Referats lieber während der Diskussion ausführlich auf Ihre Fragen einzugehen. Nun« – er hob eine Hand – »gibt es Fragen?«
In diesem Moment kam Arctor noch einmal ungeschickt auf die Füße.
Der Versammlungsleiter nickte ihm zu. »Offenbar möchte Fred seinen Ausführungen doch noch etwas hinzufügen.«
Langsam und mit gesenktem Kopf schlurfte Arctor zum Mikrophon zurück und sagte: »Nur eines noch. Geben Sie ihnen keinen Tritt in den Arsch, wenn sie erst einmal an der Nadel hängen. Den Süchtigen, meine ich. Die Hälfte von ihnen, eigentlich fast alle, besonders die Mädchen, wussten nicht, worauf sie sich da einließen oder dass sie sich überhaupt auf etwas einließen. Versuchen Sie lieber, diese Menschen – uns alle – von der Nadel fernzuhalten.« Er blickte kurz auf. »Verstehen Sie, die lösen ein paar Tabletten in einem Glas Wein auf – die Händler, die Pusher, meine ich –, und dann geben sie den Fusel einem Mädchen, das fast noch ein Kind ist, und in dem Glas sind acht oder zehn Tabletten, und die Kleine wird bewusstlos. Und dann spritzen sie ihr einen Mex-Hit, zur Hälfte Heroin, zur Hälfte Substanz T … Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.« Er brach ab.
Ein Zuhörer rief: »Wie können wir sie aufhalten, Sir?«