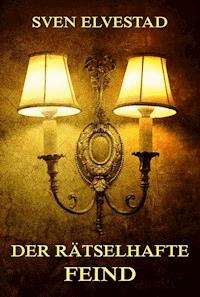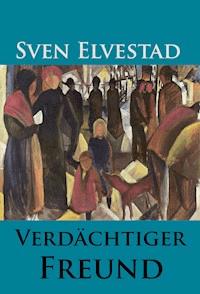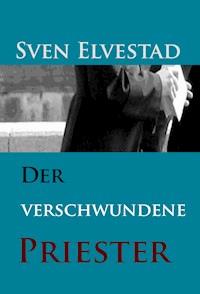2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In diesem klassischen Skandinavien-Krimi von Sven Elvestad geht es um einen Verbrecher, der nur schwer als ein solcher zu erkennen ist. Seine Verbrechen werden vor allem durch die Wirkung seiner Persönlichkeit auf andere Menschen herbeigeführt. "Robertson ist kein Verbrecher im gewöhnlichen Sinne, oder richtiger gesagt, seine Spezialität sind eine Art Verbrechen, die man mit einem anderen Namen bezeichnen muß, weil es bisher in der Kriminalität solches Phänomen nicht gegeben hat. Seine Persönlichkeit wirkt schreckerregend und unheimlich, abstoßend wie etwas Böses und Kaltes. Dennoch muß man zugeben, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt hat, daß er über einzigartige und teilweise unbekannte Kräfte und Eigenschaften verfügt." Haben wir es hier mit einem Psychopathen zu tun? – Ein Retro-Krimi für mutige Leserinnen und Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sven Elvestad
Der Fall Robert Robertson
Roman
DER FALL ROBERT ROBERTSON wurde zuerst veröffentlicht im Georg Müller Verlag, München 1923.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-634-3
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Übersetzung: Julia Koppel
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Der Fall Robert Robertson
Impressum
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
ApePoints sammeln
Links
Zu guter Letzt
I.
Wenn ich Robert Robertsons Bericht veröffentliche, wird der Leser nicht glauben wollen, daß es einen solchen Menschen tatsächlich gibt. Ich selbst war anfänglich im Zweifel und meinte, daß ich einer Mystifikation ausgesetzt worden sei. Darum beschäftigte ich mich längere Zeit nicht ernstlich mit dieser Sache, doch ließ sie mir keine Ruhe, beständig drängte sie sich mir in seltsam aufreizender Weise auf. Halbwegs gegen meinen Willen fühlte ich mich gezwungen, einzelne Punkte in Robertsons Erzählung mit Tatsachen aus der bekannten Dybhavn-Tragödie zu vergleichen, die seinerzeit den ganzen Norden wegen ihrer undurchdringlichen Mystik in Aufregung versetzte, und die man schließlich zu den unaufgeklärten Fällen legen mußte.
Folgende Schilderung des Phänomens Robert Robertson wird den Leser bald von der Notwendigkeit, ihn ernst zu nehmen, überzeugen. Und diejenigen, die nicht glauben wollen, daß ein Individuum wie Robertson in einem geordneten Staat leben kann, möchte ich an die Beispiele von Unmenschlichkeit erinnern, die gerade die neuere Zeit in so reichem Maße aufzuweisen hat. Alles, was Zivilisation heißt, hat sich ja als eine dünne Schale erwiesen, die überall platzt, und in dem allgemeinen Chaos sind bald hier bald dort Individuen aufgetaucht, mit Trieben und Instinkten, die, wie wir annahmen, seit Jahrhunderten längst unterdrückt waren.
Robertson ist kein Verbrecher im gewöhnlichen Sinne, oder richtiger gesagt, seine Spezialität sind eine Art Verbrechen, die man mit einem anderen Namen bezeichnen muß, weil es bisher in der Kriminalität solches Phänomen nicht gegeben hat. Seine Persönlichkeit wirkt schreckerregend und unheimlich, abstoßend wie etwas Böses und Kaltes. Dennoch muß man zugeben, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt hat, daß er über einzigartige und teilweise unbekannte Kräfte und Eigenschaften verfügt.
Als die Ereignisse, von denen hier die Rede sein soll, sich abspielten, mag er an die dreißig Jahre gewesen sein. Er ist in Norwegen geboren, sein Vater war Norweger, seine Mutter aber Engländerin. Frühzeitige Reisen im Ausland haben ihm ein internationales Gepräge verliehen. Er wirkt keineswegs auffallend, es ist sogar ein Teil seiner Begabung, daß er sich in jeder Gesellschaftsklasse heimisch fühlen kann. Nirgends ist man seiner sicher; in einem deutschen Offizierskasino, zwischen dem Pöbel auf einem Kai von Neapel, in einer Luxuskabine auf einem Ozeandampfer oder in einem bürgerlichen Kreis in Skandinavien kann man ihm begegnen. Überall paßt er sich seiner Umgebung spielend an.
Zu Anfang dieser Erzählung, vor drei, vier Jahren, finden wir ihn in Kopenhagen in einer Pension. Ich komme noch später auf die Form zurück, in der er mir seine Mitteilungen machte. Vorläufig will ich berichten, wie er seine Umgebung beobachtete und welches Gewicht er selbst auf dieses Studium legte.
*
Ich hatte noch keine acht Tage in der Pension gelebt, so erzählte er, als ich bereits sämtliche Bewohner in- und auswendig kannte. Eigentlich behagte es mir in dem Kreis recht gut, er war von der Art, in der ich nach Ausflügen in andersartigen Gegenden der Welt auszuruhen liebe. Die Gesellschaft besaß jene Mischung von Solidität und Ungezwungenheit, die beruhigend wirkt. Man traf dort auf Leute von heruntergekommenem Adel, auf Theaterleute, etwas Kunst, etwas Skandal, zweifelhafte Existenzen, und schließlich auf gute Bürgersleute, ja, sogar ein leiser Duft aus der Welt der Diplomatie fehlte nicht.
Ich versichere auf Ehrenwort, daß ich keine bestimmte Absicht mit meinem Einzug dort verband. Ich wollte nur zurückgezogen leben und mich ausruhen. Vor allen Dingen dachte ich nicht an berufsmäßige Geschäfte, hätte ich Geld verdienen wollen, würde ich ein ganz anderes Milieu gewählt haben. Geld hatte ich genug, jedenfalls so viel, daß ich ohne Sorgen leben konnte. Nach einer harten, arbeitsamen Periode wollte ich ganz ohne Beschäftigung sein, um meine Nerven zu beruhigen. Der Zufall aber wollte, daß mein Vorsatz nicht ausgeführt wurde.
Am 20. April zog ich in die Pension ein, und bereits Ende Juli war die Tragödie beendet, die zwei Menschen das Leben kostete. Während der ersten Tage ereignete sich nichts, was das schlafende Raubtier wecken konnte. Ich sage mit Absicht: Raubtier, denn wenn ich mich in einem Stadium der vollen Entwicklung meines Wesens befinde, fühle ich mich in der unerhörten Spannung, mehr meinem geheimnisvollen Tier als einem Menschen verwandt. In solchen Perioden leide ich an einer unerklärlichen und peinlichen Feindlichkeit gegen die Menschen im allgemeinen.
Wie genau erinnere ich mich noch des vorzüglichen und gemütlichen Mittagstisches der Pension in den milden Frühlingstagen! Die Gäste kamen nach und nach herein und sprachen entzückt über die frühzeitige Wärme, die den Apriltagen eine Junistimmung verlieh. Unwillkürlich stimmte die ungewöhnliche Milde des Wetters die Menschen liebevoll gegeneinander. Am Ende des Tisches saß die Wirtin. Von dieser Dame werde ich stets mit Hochachtung sprechen, so vorzüglich wie sie ihre Pension führte, überlegen, diskret, aber mit Verständnis und Wohlwollen. An ihrer Seite saß Fräulein Trappmeyer, eine etwas bejahrte Dame. Sie war Pianistin, hatte aber nie recht Erfolg gehabt; sie war verbittert und eifersüchtig und schrieb darum Musikkritiken in den Zeitungen. Neben ihr saß ein englischer Diplomat, der beständig darüber klagte, daß er um seinen Nachtschlaf kam (er wohnte neben einem norwegischen Schriftsteller). Dieser saß bei Tisch auch neben ihm und sprach selten ein Wort, er war nämlich taub und konnte der Unterhaltung nicht folgen. Nachts aber sprach er laut – Taube können ihre eigene Stimme ja nicht hören, wohl aber die Nachbarn. Neben ihm saß ein Geistlicher von der russisch-katholischen Kirche der Stadt, dann kam eine schöne, kürzlich geschiedene Frau aus der besten Gesellschaft, die in meiner Erzählung noch eine tragische Rolle spielen wird. Vor allen Dingen aber will ich die Hauptperson meiner Geschichte erwähnen, die an ihrer linken Seite saß: ein ganz gewöhnlicher Postsekretär, der aber den hochadligen Namen Marcus Friis-Brockenberg trug.
II.
Marcus Friis-Brockenberg oder, wie er gewöhnlich genannt wurde, Baron Marcus Friis war ein Typ, wie man ihn nicht selten in alten Kulturländern trifft, wo zahlreiche Adelsgeschlechter wohnen, deren Reichtümer eingegangen oder in wenigen Familien vereinigt sind. Als Folge davon gibt es viele verarmte Adlige, die ihren Unterhalt durch einen bescheidenen bürgerlichen Beruf verdienen. Sie übernehmen gern eine Arbeit, die den Eindruck macht, als gehöre sie zum Staatsorganismus, und die für knappen Lohn nicht zu viel Arbeit verlangt. Baron Friis gehörte dem Postwesen an und sein Gehalt war sicher so gering, daß nach Abzug der Pensionskosten nicht viel für den Adelsmann übrigblieb.
Er war zwischen Dreißig und Vierzig und hatte eine gewinnende Art, seine ganze Persönlichkeit aber war auffallend unbedeutend. Er gehörte zu der Sorte Menschen, die man unmöglich beschreiben kann, weil es ihnen an Anhaltspunkten dazu fehlt. Man erinnert sich ihrer nur auf Grund ihrer angenehmen Manieren und ihrer liebenswürdigen Augen. Schon oft habe ich mir ein ähnliches Äußere gewünscht, das jedes Erkennungszeichen entbehrt, es wäre mir bei meinen Experimenten sehr nützlich gewesen. Leider aber muß ich bekennen, daß ich ein stark persönliches Wesen besitze, mit ausgeprägten Zügen, die gleich ins Auge fallen.
Man brauchte kein scharfer Beobachter zu sein, um festzustellen, daß Marcus Friis bis über beide Ohren in Frau Dr. Gravenhag verliebt war. So hieß die geschiedene Frau, die neben ihm saß. Vielleicht ist es richtiger, wenn man sagt, daß die meisten Herren am Tische in sie verliebt waren, denn keiner konnte ihrer Schönheit widerstehen; Marcus Friis aber war tödlich getroffen. Man sah es an der nervösen Art, mit der er die ganze Zeit ihre Aufmerksamkeit zu fesseln und die Kurmacherei der übrigen auf andere Spuren zu lenken versuchte.
Der sonst so klatschsüchtigen Stadt war es nicht gelungen, der Ehescheidung von Herrn und Frau Dr. Gravenhag einen Skandal anzuhängen. Es war eine jener typischen Ehen der guten Gesellschaft, bei der eigentlich nichts Entscheidendes passiert, das Zusammenleben gefriert nur, sozusagen, bis es auseinanderkracht und die Eheleute mit Überdruß und vor Kälte zitternd auseinandergehen. Frau Merete hatte diese mondäne Pension aufgesucht, weil deren Mischung von Boheme und Bourgeoisie ihrem Temperament zusagte. Solche Pension ist immer voller Möglichkeiten, dort spielen sich stets seltsame Schicksale ab, und ein kleiner Skandal oder eine kleine Tragödie sind an der Tagesordnung.
Denn Merete Gravenhag gehörte zu den Frauen, die nach Tragödien dursten. Aus ihrer kühlen Eleganz, ihrem trägen und gleichgültigen Wesen, aus ihrer ganzen abweisenden Schönheit, vor allem aber aus der kalten Arroganz ihrer Augen leuchtet der Hunger nach Sensation. Katastrophen sind auf die Dauer das einzige, das die Intelligenz solcher Frauen befriedigen kann. Treffen keine ein, verschmachten sie vor Langeweile, und verfallen dem Morphium oder dem Patiencespiel. Schließlich pflegen sie sich mit ihrem Selbstmord zu befriedigen. Sie werden viel geliebt, lieben aber nie und hassen Kinder. Wie deutlich las man in Frau Meretens Augen das Bewußtsein, daß sie den Baron bereits mit Haut und Haaren besaß. Man sah es an dem verächtlichen, abweisenden lieblosen Seitenblick, der sicher auf den Unglücklichen wirkte, als ob eine Stahlklinge mitten durch ihn hindurchginge. Ihr ermunterndes Spiel mit den anderen Herren am Tische ließ indessen ahnen, daß sie ihrer noch nicht ganz sicher sei.
So war die Situation Anfang Mai. Es fiel mir nicht ein, in die Ereignisse einzugreifen, ich folgte ihnen nur wie ein interessierter Zuschauer. Im Grunde aber war es eine langweilige und tote Periode, in den Zeitungen nichts als die ungenießbaren politischen Nachrichten, und der Frühling ging seinen Gang – die Schönheiten der Natur aber haben nie Anziehung für mich gehabt. Als ich mich darum schließlich doch in die Sache mischte, geschah es hauptsächlich aus Langeweile. Dazu kam allerdings noch, daß ein Moment eintrat, das, wie ich mich ausdrücken möchte, zu meinem Fach gehörte. Ich entschloß mich zum Zeitvertreib ein wenig wieder mit Menschenschicksalen zu spielen, um für die größeren Aufgaben, die mich erwarteten, nicht aus der Übung zu kommen.
Wie bedeutungslos das Ganze für mich war, wird man begreifen, wenn ich sage, daß es sich anfangs nur um einen Postdiebstahl oder eine Betrügerei einfachster Art zu handeln schien. Doch sollten andere und merkwürdigere Dinge eintreffen. Wie gesagt, Baron Friis war bei der Post angestellt. Als ich entdeckte, daß seine Geldsachen nicht ganz in Ordnung waren, studierte ich seine Verhältnisse näher. Zuerst untersuchte ich seine Familienverhältnisse und erfuhr, daß er mit dem Hauptzweig der Familie nur ganz entfernt verwandt sei, also auf Hilfe von dort nicht rechnen konnte. Das Geschlecht der Friis-Brockenberg gehört überhaupt zu den unbemitteltsten des Landes. Wenn eine Unterschlagung entdeckt würde, blieb Marcus Friis nichts anderes übrig, als so unbemerkt wie möglich ins Loch zu kriechen.
Was hatte sich also ereignet? In dem Verhältnis zwischen Frau Merete und Baron Marcus war eine Veränderung eingetreten. Oder richtiger gesagt: es war ein Verhältnis geworden. Frau Merete behandelte Marcus Friis plötzlich ganz anders. Sie zeigte ihm nicht mehr diese unbeschreibliche Kälte, sie war offenbar ganz still in sein Leben, in sein Schicksal hineingeglitten, und Marcus Friis hatte mehr Sicherheit, mehr Form bekommen. Die Sache hatte sich mit großer Diskretion entwickelt, die Veränderung aber konnte auf die Dauer den Augen der Pensionäre nicht verborgen bleiben. Vor einer Tatsache zogen die anderen Ritter sich taktvoll zurück.
Während das Interesse der anderen erlahmt war, war das meine gewachsen. Ich witterte Aas, mein Instinkt war geweckt. Die Sache fing mit Mahlzeiten in teuren Restaurants und Autofahrten nach Nachbarstädten an. Dabei aber blieb es nicht. Marcus Friis streute Geld mit der Großartigkeit eines Edelmannes aus. Da dachte ich von ihr: Sie sind nicht sehr wählerisch, schöne Frau! Ist es wirklich ein Erlebnis für Sie, stolze und schöne Dame der Bourgeoisie, diesen kleinen Postsekretär zur Verzweiflung zu bringen? Wenn die Kassenunterschlagungen nun an den Tag kommen und die Geschichte mit Gefängnis oder einem Schuß endigt – ist das dann wirklich eine Befriedigung für Ihren Hunger nach Sensation? Fehlt dann nicht gerade jener Nimbus von Unheimlichkeit, der den Hauptbestandteil einer Sensation bildet?
Das Ganze paßte so wenig zu Frau Meretens kaltem Verstand, daß ich argwöhnte, es läge etwas anderes dahinter.
Und als ich dann eines Nachmittags einige Worte mit Marcus Friis im Rauchzimmer wechselte, ging mir eine Ahnung auf, daß sich hinter den Masken eine wirkliche Tragödie verbarg. Ich sah sein Gesicht im Sonnenschein, der durchs Fenster fiel, und in dieser scharfen Beleuchtung, in der jeder Zug klar zutage trat, durchschaute ich ihn.
III.
Am 8. Mai abends ging Marcus Friis mit Frau Merete durch. Der junge Baron hinterließ einen Brief an seine Vorgesetzten bei der Post, in dem er kurz und bündig erklärte, daß er auf unbestimmte Zeit, in unbestimmte Gegenden reise und sich bei der Post als entlassen betrachte. Seine Vorgesetzten bekamen einen Schreck und nahmen in aller Eile eine Untersuchung seiner Kasse vor, wobei es sich zeigte, daß alles in schönster Ordnung war. Man konnte seinen plötzlichen Abschied nicht begreifen, bis man erfuhr, daß eine Frau mit im Spiele sei. Anfangs war man überzeugt gewesen, daß in seiner Kasse etwas fehlen würde und wunderte sich sehr, daß er der Versuchung widerstanden hatte. Ich allerdings war nicht überrascht, denn den Verdacht, daß Marcus Friis die Postkasse betrog, hatte ich schon zu einem früheren Zeitpunkt fallen lassen.
Ich war dem Paare Tag für Tag mit Aufmerksamkeit gefolgt und hatte ausgerechnet, daß Marcus Friis in zwei Wochen sechstausend Kronen verbraucht haben mußte. Darauf hatte ich eine geheime Untersuchung in seiner Postabteilung vorgenommen. Auf Einzelheiten solcher Untersuchung will ich hier nicht eingehen, es würde eine zu lange Geschichte werden, wollte ich erzählen, wie ich das Vertrauen der Leute gewinne, so daß sie mir wertvolle Auskünfte geben. Ich behaupte, daß kein Detektiv so gut arbeitet wie ich, es gehört nämlich ein bis ins feinste trainierter psychologischer Apparat dazu. Genug, ich erfuhr, daß Marcus Friis keine Gelegenheit hatte, das Postwesen um größere Beträge zu betrügen.
Woher aber bekam er die beträchtlichen Summen? Sie kamen nicht mit der Post, sie wurden ihm nicht auf andere Weise geschickt, er hatte sie nicht geliehen. Er holte sie irgendwo. Ich kam auf die richtige Spur, an demselben Tage, an dem Frau Merete ihre Abreise vorbereitete. Sie leugnete, daß sie abreisen wollte, verbarg ihre Vorbereitungen aber nur halb; so ließ sie zum Beispiel einen Teil ihrer Sachen ganz offenkundig zur Aufbewahrung in einem Speicher abholen. Es war an jenem Tage, an dem ich Marcus Friis' Gesicht so deutlich im Fensterlicht beobachten konnte. Diese flackernde Angst in seinem Blick war für mich nicht mißzuverstehen. Er versuchte unter einer Maske von Sicherheit etwas zu verbergen. Am selben Abend aß das Paar in einem der ersten Restaurants zu Mittag. Er brachte seine Geliebte in einer Droschke mit zwei isländischen Pferden zur Pension zurück. Frau Merete ging auf ihr Zimmer, Marcus Friis aber fuhr mit dem Wagen wieder zur Stadt.
Ich konnte ihm leicht auf meinem Rad folgen, das in dem dunklen Frühlingsabend wie ein Schatten über den Asphalt glitt. Bei einer alten Weinstube, wo im Sommer auch im Garten serviert wird, stieg er aus. Der Garten war von alten Bäumen beschattet und machte einen düsteren Eindruck. Da der Abend kühl war, hatten die Gäste sich in das Wirtshaus zurückgezogen. Marcus Friis hatte unter einer alten Linde Platz genommen, er schien jemanden zu erwarten, denn er horchte auf Schritte hinter der Gartenmauer, und sah hin und wieder auf seine Uhr. Endlich kam der Erwartete. Es war ein Herr in einem Frühlingsüberzieher, von mittlerer Größe und elastischen Ganges. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, da es teils von einem breitrandigen Hut beschattet, teils von einem großen schwarzen Bart bedeckt war. Beides in Verbindung mit der runden amerikanischen Brille gab ihm ein ausländisches Aussehen. Er wußte, wo er seinen Mann zu treffen hatte, denn er ging geradeswegs durch den Garten auf den Platz zu, wo Marcus Friis saß.
Während sie zusammen sprachen, behielt der Fremde die ganze Zeit seinen großen Hut auf dem Kopf. Ich dachte gleich bei mir, daß der Mann verkleidet sei. Ein großer Hut, ein schwarzer Bart, dazu eine Brille sind die einfachste Form von Verkleidung und verraten sofort den Naiven und Unkundigen auf diesem Gebiet. Wenn man sich unkenntlich machen will, darf man nicht zu viel Sorgfalt auf sein Gesicht legen, dadurch zieht man nur die Aufmerksamkeit auf sich. Ich war viel unkenntlicher, wie ich dort saß, mit meinem gewöhnlichen Gesicht unter der Sportmütze, im dunkelblauen Jackettanzug, Radspangen an den Hosen, wie ein Mechaniker oder Telephonarbeiter, der sich auf dem Nachhausewege noch schnell einen Pilsener zu Gemüte führt.
Was die beiden sprachen, konnte ich natürlich nicht hören, nicht einmal ihre Stimmen drangen bis zu mir herüber. Aber aus den Gebärden allein kann man ja erkennen, ob ein Gespräch ernst oder vergnügt ist. Ich meinte zu verstehen, daß Marcus Friis einen Bescheid oder Befehl bekam, und daß der Fremde ihm seine Meinung eindringlich begreiflich zu machen versuchte. Ihr Beisammensein dauerte nur zehn Minuten, dann bezahlte Marcus Friis und sie verließen zusammen den Garten.
Auf der anderen Seite der Straße war ein Halteplatz für Droschken. Der Fremde winkte eine von ihnen herbei. Ich stand ganz in der Nähe über mein Rad gebeugt und tat, als ob ich Luft in die Gummireifen pumpte.
Marcus Friis sagte:
»Eigentlich wollte ich in dem schönen Frühlingsabend zu Fuß gehen.«
Der Fremde erwiderte:
»Nein, Sie fahren!«
Es war eine typisch dänische Stimme; schon daraus konnte man schließen, daß der Mann verkleidet war. Aber es war eine harte und befehlende Stimme. Friis fuhr davon. Der Fremde blieb stehen und blickte ihm nach, bis der Wagen verschwunden war. Er will ihn los sein, dachte ich bei mir, er will nicht, daß Friis sieht, wohin er selbst geht. Darauf winkte er eine zweite Droschke heran und fuhr in entgegengesetzter Richtung davon.
Ich folgte ihm auf meinem lautlosen Rad, nahm mir Zeit, und es wurde eine gemächliche und angenehme Fahrt. Friis hatte recht, es war ein schöner Abend.
IV.
Ich liebe es nicht, wenn ich arbeite, von ganz unvorhergesehenen Ereignissen überrascht zu werden. Nicht, weil ich fürchte, einer Situation nicht gewachsen zu sein, sondern weil eine Begegnung mit dem Überraschenden bedeutet, daß ich nicht alle Möglichkeiten ins Auge gefaßt habe. Das Unerwartete wirkt deshalb wie ein Selbstvorwurf auf mich. Diesmal aber nahm ich den Vorwurf leicht, denn die Überraschung war der Art, daß ich sie unmöglich hatte voraussehen können.
Der Mann mit dem großen Bart war ganz richtig maskiert. Es war nicht schwer, ihm zu folgen, weil er offenbar nicht mit einer Verfolgung rechnete, nachdem er sich Marcus Friis' entledigt hatte. Die Fahrt ging durch die belebtesten Verkehrsstraßen der Stadt, auf denen eine Menge Menschen unterwegs war, denn die Theater hatten gerade geschlossen, und der Mann, der auf seinem Rad hinter der Droschke herrollte, weckte darum keinerlei Aufsehen. Der Verfolgte wohnte im Osten der Stadt, wo die wohlhabenden Familien ihre Hauser haben. In eines derselben, einen Neubau, ging er hinein, ohne sich umzusehen und ließ die Haustür hinter sich ins Schloß fallen. Als die Droschke fort war, lag die Straße wieder in vornehmer Ruhe da, und es wäre ein leichtes gewesen, sich bei dem Portier eine Auskunft zu holen. Jetzt aber wußte ich ja, wo er wohnte, und wollte nichts riskieren.
Darum kehrte ich in die Pension zurück und ging zu Bett, in dem Bewußtsein, eine wertvolle Spur entdeckt zu haben. Die Hauptsache war für mich, daß das Auftauchen des Fremden der Sache eine tiefere Perspektive gegeben hatte; wäre es nur eine Kassenunterschlagung gewesen oder der krampfhafte Versuch eines schwachen Menschen, sich einige Tage des Rausches zu verschaffen, dann hätte ich mich zurückgezogen, ja vielleicht hätte ich meiner Natur Gewalt angetan und dem Armen geholfen. Etwas Ähnliches habe ich schon früher getan, aber das gehört zu einer anderen Geschichte … Bis auf weiteres nahm ich an, daß Marcus Friis von dem Fremden Geld erhielt, warum, das mußte ich ausfindig zu machen versuchen. Vor allen Dingen mußte ich die Identität des Fremden feststellen. Zeitig am nächsten Morgen war ich in dem Hause im Osten. Und hier traf ich auf die erste Überraschung. Im Hause waren fünf Wohnungen, eine in jedem Stockwerk. Ich las die Namen und notierte sie mir, indem ich die Treppe hinaufstieg. Im dritten Stockwerk bekam ich den Schock! Auf dem großen Messingschild stand mit einfachen lateinischen Buchstaben eingraviert: Dr. Louis Gravenhag.
Es war Frau Meretens geschiedener Mann. Es konnte ja ein Zufall sein, daß Dr. Gravenhag in demselben Hause wohnte, wie der Fremde. Mit solchem Zufall aber rechnete ich nicht, im Gegenteil, ich bekam den Eindruck von etwas Gefährlichem, als ich sah, wie das Dreieck Marcus Friis – Merete – Louis Gravenhag sich schloß. Was konnte das bedeuten?
Um neun Uhr verließ Louis Gravenhag das Haus, vermutlich, um sich auf Krankenbesuche oder in seine Klinik zu begeben. Ich erkannte gleich den berühmten Nervenarzt nach Bildern in Zeitschriften. Dem dunkelbärtigen Fremden aber glich er ganz und gar nicht. Dr. Gravenhag war blond und blauäugig wie ein echter Nordländer, wie … wie Marcus Friis, in der Eile fiel mir kein anderer ein, mit dem ich ihn vergleichen konnte. Frau Merete liebt die Augen ihrer Rasse, dachte ich bei mir. Vor seiner Tür blieb Dr. Gravenhag einen Augenblick stehen und zündete sich eine Zigarre an. Darauf begab er sich auf den Weg. Da erkannte ich ihn. Er war der Fremde.
Als er abends vorher den Wirtschaftsgarten verließ, hatte er sich auch eine Zigarre angezündet. Ebensowenig wie es zwei Menschen gibt, die genau dieselben Linien in der Hand haben, ebensowenig gibt es zwei Menschen, die sich auf dieselbe Weise eine Zigarre anzünden. Im Laufe der Jahre wird diese Geste zu einer individuell geformten Handlung, die eine ganze Reihe von Bewegungen umfaßt, von dem Griff in die Tasche nach dem Etui, bis zum Fortwerfen des Zündholzes. Wäre ich aber noch im Zweifel gewesen, brauchte ich nur Dr. Gravenhags Gang zu beobachten, diese raschen und energischen, etwas kurzen Schritte, um mich ganz davon zu überzeugen, daß der Fremde und er ein und dieselbe Person seien. Sobald ich darüber im klaren war, brauchte ich ihm nicht länger zu folgen, sondern ließ ihn in seine Klinik gehen. Aber ich war nicht wenig verdutzt über die ganze Situation. Gab Louis Gravenhag Friis Geld? Ja. Von anderer Seite konnte es nicht kommen. Aber warum? War seine geschiedene Frau, Merete, in die Sache verwickelt? Ich hatte von allen Seiten gehört, daß Dr. Gravenhag nur mit äußerster Kälte und Zurückhaltung von ihr sprach. Und weiter: wußte Dr. Gravenhag, daß Baron Friis Merete demnächst entführen wollte? War es vielleicht mit seinem Wissen … nein, hier stieß ich auf eine Reihe rätselhafter Umstände, die mich verwirrten.
In den letzten Tagen vor ihrer Abreise wurde es sogar den Mädchen in der Pension klar, daß etwas gärte. Die beiden Liebenden brauchten sich nicht mehr Mühe zu geben, etwas zu verbergen, denn alle flüsterten bereits davon, daß sie zusammen durchbrennen wollten, doch war es, als ob sie ihr Vorhaben mit romantischer Geheimnistuerei umgeben wollten. Ich mußte in diesen Tagen meinen ganzen Scharfsinn aufbieten, um den Faden nicht zu verlieren. Bereits am 7. abends hatte ich erfahren, daß Marcus Friis Karten für das Nordseebad Skagen gelöst hatte, wo das Paar sich vor Anfang der Saison ja recht ungestört aufhalten konnte.
Ich selbst hatte meine Rechnung in der Pension verlangt und meine Abreise nach Hamburg vorbereitet. Man glaubt vielleicht, daß es meine Absicht war, den Liebenden nach Skagen zu folgen. Weit gefehlt. Andererseits aber war es natürlich auch nicht meine Absicht, nach Hamburg zu reisen. Es war mir klar geworden, daß der Schwerpunkt der Ereignisse bereits damals bei Dr. Gravenhag lag, und ohne das Vorhaben der Liebenden aus dem Auge zu lassen, war ich auch Dr. Gravenhags Unternehmungen gefolgt.
Am 6. Mai abends war Dr. Gravenhag in Gentofte, einem kleinen idyllischen Fleck in der Nähe von Kopenhagen, gewesen, wo er eine möblierte Villa mietete, die sehr einsam in einem öden, verwilderten Garten lag. Dr. Gravenhag war verkleidet, genau wie an jenem Abend in dem Gartenrestaurant.
Am 8. reisten Merete und Marcus Friis nach Skagen.
Am 9. morgens bestieg ich den Zug nach Hamburg, aber ich verließ ihn bereits wieder in Roskilde und nahm ein Auto nach Gentofte, wo ich im Wirtshaus einkehrte.
V.
Die Villa, die Dr. Gravenhag gemietet hatte, war ursprünglich eine Gärtnerwohnung und gehörte zu dem in der Nähe gelegenen Gutshof. Vor mehreren Jahren aber war die Gärtnerwohnung und ein Teil des Gartens als selbständiges Besitztum abgetrennt worden. Der neue Besitzer aber, ein Spielzeugfabrikant aus Kopenhagen, hatte bereits nach kurzer Zeit das Grundstück verfallen lassen. Im Winter war das Haus verschlossen und unbewohnt, im Sommer wurde es vermietet. Diese zufälligen und wechselnden Einwohner hatten nichts zur Instandhaltung des Hauses und Gartens getan, die sehr verfallen waren. Im Frühling aber, wenn das grüne Laub der Bäume über die zerbröckelnden Mauern des Hauses fiel, atmete das Ganze doch eine gewisse Stimmung. »Lindenhof« hieß das Besitztum. Der Garten grenzte an den des Wirtshauses, von meinem kleinen Giebelfenster aus konnte ich mich jederzeit in seine Wildnis vertiefen, von dem Hause selbst aber sah ich nur etwas graues Mauerwerk hier und dort durch das dichte Laubwerk – und außerdem eine kleine Holzveranda, mit einer schiefen Tür, die immer offen stand, weil sie sich nicht schließen ließ.
Dieses Haus also hatte Dr. Gravenhag gemietet, aber zu welchem Zweck?
Im Wirtshaus wußte man nichts anderes, als daß er Barfod hieß und dänisch-amerikanischer Ingenieur war. Sogar einen falschen Namen also hatte er angegeben. Der Wirtshausbesitzer verwaltete die Villa für den Spielzeugfabrikanten, der in der Stadt wohnte, und hatte die ganze Miete für den Sommer im voraus erhalten.
»Wenn Leute nur bezahlen, können sie meinetwegen sein, was sie wollen,« sagte der Wirt. »Ich stecke meine Nase nicht in anderer Angelegenheiten, denn ich will selbst ungestört sein. Es ist ein feiner Herr, mit seinem langen Bart und der Brille, und er handelte nicht, sondern legte das Geld bar auf den Tisch.« Der Wirt rechnete auf einen hübschen Verdienst im Laufe des Sommers, denn der amerikanische Ingenieur hatte die Villa für einen kranken Verwandten gemietet, für den jeden Tag das Essen hinübergeschickt werden sollte.
Überhaupt war der Lindenhof und seine Umgebung – das Wirtshaus mit inbegriffen – wie geschaffen für geheimnisvolle Vorgänge, denn es lag abseits von den großen Verkehrsstraßen. Die Entwicklung war an dem Wirtshaus vorbeigegangen und hatte anderwärts größere und vornehmere Hotels geschaffen. Die niedrigen Stuben mit den matten Fenstern und den schrägen Decken trugen Spuren von jahrhundertaltem Staub. Hier drinnen wankte der dicke Wirt herum, feucht von morgens bis abends, und behandelte sich selbst als vornehmsten Gast. Wenn Gäste kamen, ließ er sich bei ihnen nieder und trank auf ihr Wohlsein. Mich begrüßte er gerührt morgens und abends mit dem Glas in der Hand, als ob ich soeben erst eingetroffen sei. Seine Frau, die wegen eines Hüftschadens schlecht gehen konnte, zeigte sich nie außerhalb der Küche, von der sie ein Teil geworden zu sein schien, immer von Dunst und Küchengeräuschen umgeben. Die Bedienung wurde von einem alten Knaben mit Namen Elias besorgt, der seine Pflicht ganz automatisch tat und nie den Mund öffnete.
So war meine Umgebung, in der es mir recht wohlgefiel. Mein Zimmer war rein und behaglich, Apfel- und Kirschblütenduft erfüllten es. Fast hätte ich mir einbilden können, daß ich mich hier niedergelassen hätte, um die Süße und den Frieden des Frühlings zu genießen. Unter der Stille aber spürte ich die Unruhe in meinem Gemüt, die die Vorahnung zu tragischen Ereignissen zu sein pflegt. Ich war in das Vorspiel eines Dramas hineingeraten, von dem ich jetzt noch nicht viel verstand. Es war, als ob ein Vorhang mich von der Seele des Dramas trennte; eine Wildnis, ein duftender Frühlingsmonat lagen zwischen mir und dem Rätsel des Lindenhofes.
Während mehrerer Tage hatte sich nichts anderes ereignet, als daß die Villa sich vorbereitete, die Gäste zu empfangen. Eines Nachmittags begab ich mich recht unauffällig hinüber, um mir die Einrichtung anzusehen. Sie war äußerst primitiv. Das Schlafzimmer lag im ersten Stock, es war das Zimmer mit der schiefen Tür vor der baufälligen Veranda. Die Möbel waren einfach, nur hier und dort ein besseres Stück. Alles aber trug das Gepräge von Verfall, verschlissene Teppiche, wackelige Stühle, zerbrochene Sprungfedern. Man hatte den Eindruck, als ob die Feindseligkeit der verschiedenen Mieter, denen nichts von dem Hause und den Möbeln gehörte, noch in den Tapeten hing. Ich sagte zu der alten Frau, die im Begriff war, reinzumachen: »Ziehen Sie doch die Vorhänge zurück, öffnen Sie die Fenster, damit hier Licht und Luft hereinkommen können.«
Sie aber antwortete, daß der amerikanische Ingenieur angeordnet habe, daß nichts verändert werden solle.
»Warum?« fragte ich verwundert, »hat er einen Grund dafür angegeben?«