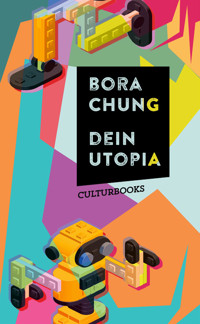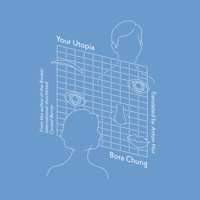11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Shortlist für den International Booker Prize »Jemand, der Stephen King oder Haruki Murakami liebt, ist mit dieser Erzählerin ganz blendend bedient.« Denis Scheck »Wir tun immer so, als wäre alles vollkommen normal. Aber das Leben ist nicht normal.« Bora Chung »Cooler, genial-verrückter K-Horror!« Ed Park »Diese zehn Geschichten sprengen unsere Vorstellungskraft: Sie sind atemberaubend, wild und verrückt, eine verblüffender als die andere.« Publishers Weekly Bora Chungs »Der Fluch des Hasen« entzieht sich jeder literarischen Schublade und verwischt auf einfallsreiche Weise die Grenzen zwischen den Genres, ob magischer Realismus, literarischer Horror, Phantastik oder Speculative Fiction. Es ist der faszinierende Auftritt eines Stars der koreanischen Literatur: fesselnde, unheimliche, hochintelligente Fabeln, die uns mit skurrilem Humor und (manchmal wortwörtlichem) Biss die sehr realen Schrecken und Grausamkeiten unserer modernen Gesellschaften vor Augen führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Bora Chungs »Der Fluch des Hasen« entzieht sich jeder literarischen Schublade und verwischt auf einfallsreiche Weise die Grenzen zwischen den Genres, ob magischer Realismus, literarischer Horror, Phantastik oder Speculative Fiction. Es ist der faszinierende Auftritt eines Shootingstars der koreanischen Literatur: fesselnde, unheimliche, hochintelligente Fabeln, die uns mit skurrilem Humor und (manchmal wortwörtlichem) Biss die sehr realen Schrecken und Grausamkeiten unserer modernen Gesellschaften vor Augen führen.
»Diese zehn Geschichten sprengen unsere Vorstellungskraft: Sie sind atemberaubend, wild und verrückt, eine verblüffender als die andere.« Publishers Weekly
Über die Autorin und die Übersetzerin
Bora Chung, geboren 1976 in Seoul, ist Autorin von mehreren Romanen und Kurzgeschichtensammlungen. Sie übersetzt zeitgenössische Literatur aus dem Russischen und Polnischen ins Koreanische, unterrichtete an der Yonsei-Universität u. a. Science Fiction Studies und ist Mitglied der »Science Fiction Writers Union of Korea«. »Der Fluch des Hasen« stand auf der Shortlist für den International Booker Prize 2022 und wurde in 16 Sprachen übersetzt.
Bora Chung
Der Fluch des Hasen
Storys
Inhaltsverzeichnis
Der Kopf
Gerade wollte sie die Toilettenspülung betätigen.
»Mutter.«
Sie drehte sich um. Aus der Kloschüssel ragte ein Kopf und rief nach ihr.
»Mutter.«
Die Frau sah ihn kurz an. Dann spülte sie. Der Kopf verschwand unter einem Wasserschwall.
Die Frau verließ das Badezimmer.
Einige Tage später begegnete sie im Bad erneut dem Kopf.
»Mutter!«
Die Frau wollte gerade wieder die Spülung betätigen, da stammelte der Kopf:
»Halt, nein, Moment!«
Die Frau hielt inne und sah in die Schüssel.
Eigentlich wäre es zutreffender, von der Erscheinung als einem Ding zu sprechen, das entfernt einem Kopf ähnelte. Es hatte ungefähr zwei Drittel von der Größe eines Erwachsenenschädels, erinnerte aber eher an eine Masse aus nachlässig zusammengeklatschtem gelben und grauen Ton, mit ein paar vereinzelten Strähnen nassen Haares. Ohne Ohren, ohne Augenbrauen. Dazu zwei Schlitze für die Augen, die so schmal waren, dass die Frau nicht sagen konnte, ob sie offen oder geschlossen waren. Eine fleischige Erhebung, die wohl die Nase darstellen sollte. Der lippenlose Mund war ein weiterer Schlitz. Ein Schlitz, der sich ungeschickt öffnete und schloss, während er sprach. Es war schwierig, seine schrille Stimme zu verstehen, unter die sich zudem noch das Gurgeln eines Ertrinkenden mischte.
»Wer zum Teufel bist du?«, fragte die Frau.
»Ich nenne mich Kopf«, antwortete der Kopf.
»Das ist naheliegend«, sagte die Frau. »Aber was machst du in meiner Toilette? Und warum nennst du mich Mutter?«
Ungelenk formte der Kopf mit seinem lippenlosen Mund die Worte:
»Ich wurde aus den Dingen geboren, die du in der Toilette hinuntergespült hast: ausgefallene Haare, Kot und Klopapier, mit dem du dir den Hintern abgewischt hast. Deshalb nenne ich dich Mutter.«
Die Frau wurde ärgerlich: »Ich lasse doch nicht etwas wie dich in meinem Klo hausen. Und ich hab dich auch nicht geboren, also hör auf, mich ›Mutter‹ zu nennen. Verschwinde, bevor ich den Kammerjäger rufe.«
»Ich verlange ja nicht viel«, fuhr der Kopf hastig fort. »Ich bitte dich nur darum, dass du weiterhin den Abfall, den dein Körper produziert, ins Klo spülst, damit ich auch den Rest meines Körpers herstellen kann. Dann gehe ich fort von hier und sorge für mich selbst. Kümmere dich einfach nicht um mich, und benutze die Toilette genau so, wie du es bisher getan hast.«
»Das ist meine Toilette«, sagte die Frau frostig. »Natürlich werde ich sie weiter so benutzen, wie ich es immer getan habe. Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass eine Kreatur wie du darin lebt. Die Vollendung deines Körpers ist nicht meine Angelegenheit. Es kümmert mich nicht das Geringste, was du machst. Ich erwarte nur, dass du hier nie wieder auftauchst.«
Der Kopf verschwand in der Toilette.
Aber er tauchte immer wieder auf. Nach dem Spülen lugte er über den Rand des Toilettensitzes und starrte die Frau an, während sie sich die Hände wusch. Immer wenn sie sich beobachtet fühlte, wanderten ihre Augen zur Toilette, und ihr Blick bohrte sich in die Schlitze, von denen sie nicht genau sagen konnte, ob sie geöffnet waren und ob sich Augen darin befanden. Die formlose Masse, die vorgab, ein Gesicht zu sein, versuchte einen Ausdruck hineinzulegen, aber es war unmöglich, ihn zu lesen. Der Kopf verschwand jedes Mal eilig im Abflussrohr, wenn die Frau sich ihm näherte. Sie klappte dann immer den Toilettendeckel runter, spülte und starrte noch eine Weile die Schüssel an, bevor sie ging.
Eines Tages hatte die Frau wie immer ihr Geschäft erledigt, ganz automatisch die Spülung betätigt und war gerade beim Händewaschen. Wie gewöhnlich erschien der Kopf über dem Toilettenrand. Die Frau fixierte ihn eine Zeit lang im Spiegel. Er starrte zurück. Normalerweise war der formlose Schädel unter den wirren Haarklumpen gelbgrau, aber jetzt schimmerte er seltsam rötlich.
Die Frau dachte daran, dass sie ihre Periode hatte.
»Du siehst heute so anders aus«, sagte sie zu dem Kopf. »Hat es vielleicht etwas mit meinem aktuellen Zustand zu tun?«
Der Kopf antwortete: »Mutter, natürlich hat der Zustand deines Körpers eine direkte Auswirkung auf mein Aussehen. Das liegt daran, dass meine ganze Existenz von dir abhängt.«
Die Frau zog sich die Unterhose herunter und riss die Binde raus. Sie klatschte dem Kopf die mit ihrem Blut verschmierte Einlage mitten ins Gesicht und drückte ihn die Toilette hinunter. Dann spülte sie.
Der Kopf und die Binde wirbelten einen Moment in der Toilettenschüssel herum, bevor sie in dem schwarzen Abflussloch verschwanden. Die Frau wusch sich noch mal die Hände. Dann übergab sie sich ins Waschbecken. Sie kotzte eine ganze Weile. Schließlich säuberte sie das Becken und verließ das Badezimmer.
Anschließend war die Toilette verstopft. Der Klempner präsentierte der Frau die Binde wie eine Trophäe und hielt ihr einen langen Vortrag darüber, dass solche Dinge nicht in die Toilette gehörten.
Von da an hielt die Frau den Deckel immer geschlossen. Außerdem gewöhnte sie sich an, immer wieder nach unten zu sehen, wenn sie auf der Toilette saß. Sie bekam Verstopfung.
Eines Tages, als sie gerade dabei war, rasch den Deckel zu schließen, erhaschte sie einen Blick auf den Kopf, der aus dem Abflussrohr lugte. Sie schlug den Deckel zu und spülte mehrere Male. Gerade wollte sie das Bad verlassen, da hob sie ihn doch noch einmal vorsichtig an und blickte direkt in die Augen des Kopfes, der sie aus dem Wasser anstarrte. Sein Haar schwamm um das Gesicht herum. Hastig ließ die Frau den Deckel fallen. Dann versuchte sie zu spülen, aber das Wasser wollte nicht ablaufen.
Die Frau erzählte ihrer Familie davon.
»Es ist ja nicht so, als würde das seltsame Etwas Eier legen. Warum ignorierst du es nicht einfach?«
Mehr hatte ihre Familie dazu nicht zu sagen.
Die Frau vermied es, das Badezimmer zu Hause weiter zu benutzen.
Doch eines Tages entdeckte sie den Kopf im WC ihrer Arbeitsstelle. Sie hatte gerade gespült und wusch sich die Hände, als sie im Spiegel den Kopf aus der Toilettenschüssel der Kabine spähen sah. Tags darauf kündigte sie ihren Job.
Ihre Verstopfung wurde mit der Zeit immer schlimmer. Zudem bekam sie eine Blasenentzündung. Der Arzt erklärte ihr, sie müsse regelmäßig zur Toilette gehen. Aber allein der Gedanke daran, dass jemand sie von unten beobachtete, während sie ihr Geschäft erledigte, und nur darauf wartete, ihre Ausscheidungen zu essen, machte ihr den Gang zur Toilette unerträglich.
Die Entzündung und die Verstopfung wurden nicht besser.
Nun, da sie ihre Arbeit aufgegeben hatte, schlug ihr die Familie vor, doch einen Ehemann zu suchen. Also ging sie zu einer Verabredung, die ihre Mutter arrangiert hatte. Der Mann war ein gewöhnlicher Angestellter in einem Handelshaus. Sein Lebenstraum bestand darin, eine nette Frau zu heiraten, Kinder zu haben und bis ans Ende seiner Tage ein beschauliches Dasein zu führen. Er wirkte bescheiden und verlässlich, wenngleich sich seine Fantasie darin erschöpfte, Dinge genau dort zu vermuten, wo sie hingehörten. In Gegenwart dieses Mannes empfand sie wegen ihrer misslichen Situation aufgrund der Toilettenangelegenheit stetige Nervosität. Der Mann missdeutete ihre nicht zu übersehende Verlegenheit. Er erklärte: »Ich finde es bei einer Frau attraktiv, wenn sie schüchtern und sittsam ist. Eine Frau wie Sie, die einem Mann gegenüber zurückhaltend auftritt, trifft man heutzutage nur sehr selten.«
Beinahe genötigt von den festen Absichten des Mannes, verlobten sie sich nach drei Monaten, und ein weiteres Vierteljahr später heirateten sie.
Die Frau sorgte sich wegen der Flitterwochen, aber zum Glück erschien der Kopf während der Reise nicht. Ihre erste Handlung nach dem Einzug in das neue gemeinsame Zuhause bestand darin, die Toilette zu überprüfen. Dort war nichts. Ihr neues Leben brachte ein wenig Erleichterung für ihre Blasenentzündung und die Verstopfung. Die Tage verliefen ohne Höhen und Tiefen und waren weder gut noch schlecht, was sie mehr oder weniger glücklich machte. Im Bestreben, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden, dachte sie immer weniger an den Kopf. Bald war sie schwanger und vergaß ihn gänzlich.
Doch einige Zeit nach der Geburt tauchte er wieder in ihrem Leben auf. Sie war gerade dabei, das Baby in einer Wanne zu baden.
»Mutter.«
Vor Schreck ertränkte sie fast ihr Kind.
Der Kopf hatte inzwischen die Größe eines durchschnittlichen Erwachsenenschädels. Das gelbgraue Gebilde ähnelte noch immer einem Klumpen, aber seine Augen waren etwas größer, sodass nun eindeutig ein Blinzeln zu erkennen war, und auch der Mund verfügte inzwischen über eine Art Lippen. Es gab fleischartige Ausstülpungen an beiden Seiten des Gesichts, dort, wo die Ohren sitzen sollten, und unter dem kaum erkennbaren Kinn hatte sich ein neuer Wulst gebildet, der der Anfang eines Halses zu sein schien.
»Mutter, ist das dein Kind?«
Die Frau stotterte: »Wie kann es sein, dass du hier auftauchst? Wer hat dir gesagt, wo ich bin?«
Der Kopf entgegnete: »Deine Ausscheidungen sind ein Teil von mir, ich weiß immer, wo du bist.«
Diese Antwort gefiel der Frau überhaupt nicht. Sie zischte: »Ich hatte dir gesagt, du sollst verschwinden. Wie kannst du es nur wagen, zurückzukommen und mich Mutter zu nennen! Und es geht dich gar nichts an, wessen Kind das ist! Aber gut, es ist meins. Sie ist die Einzige, die mich ›Mutter‹ nennen darf. Und jetzt geh weg! Ich sagte, verzieh dich!«
Das Baby begann zu weinen.
Der Kopf erwiderte: »Ich mag zwar auf andere Weise geboren worden sein als dieses Kind, aber auch ich wurde von dir erschaffen, Mutter.«
»Hab ich nicht gesagt, dass ich niemals so etwas wie dich erschaffen hätte? Verschwinde, hab ich gesagt! Wenn du dich weigerst, werde ich alles tun, was nötig ist, um dich loszuwerden!«
Sie knallte den Toilettendeckel runter und spülte. Dann tröstete sie ihr weinendes Kind und wischte die letzten Seifenreste fort.
Seit der Kopf in ihr Leben zurückgekehrt war, tauchte er hartnäckig immer wieder auf. Sie konnte fühlen, dass er sie von hinten anstarrte, wenn sie nach dem Spülen am Waschbecken stand. Aus den Augenwinkeln sah sie etwas Graugelbes, aber wenn sie sich ruckartig umdrehte, war es verschwunden, nur einige verräterische Haarbüschel blieben zurück.
Die Blasenentzündung und die Verstopfung kehrten zurück. Doch mehr als alles andere hatte die Frau Angst um ihr Kind. War der Kopf eifersüchtig auf ihre Tochter? Würde er das Mädchen belästigen? Allein der Gedanke daran, das Kind könne den Kopf zu Gesicht bekommen, war unerträglich. Sie wurde nervös, wann immer die Kleine ins Badezimmer gehen wollte.
Sie beschloss, den Kopf zu beseitigen.
Die Frau begab sich ins Badezimmer, erledigte ihren Stuhlgang und spülte. Dann wartete sie darauf, dass der Kopf erschien, während sie sich die Hände wusch. Als sich das gelbgraue Ding langsam über den Rand der Schüssel schob, sagte sie leise:
»Ich habe dir etwas mitzuteilen.«
Sie trocknete sich die Hände ab und ging vor der Toilette in die Hocke, damit sie auf Augenhöhe mit dem Gegenüber war.
»Du bist …«
Sie zögerte.
Der Kopf wartete.
Dann streckte sie kurzerhand die Finger aus und griff nach ihm. Sie zog ihn ohne Weiteres aus dem Toilettenbecken, wickelte ihn in eine Plastiktüte und warf sie in den Abfalleimer. Erleichtert wandte sie sich wieder ihrem Leben zu.
Die Atempause war allerdings nicht von Dauer. Sie war mit dem Kind im Badezimmer, als es passierte. Die Kleine war nun alt genug, um selbstständig auf die Toilette zu gehen. Zumindest wenn ihre Mutter sie durch die einzelnen Schritte führte: die Unterhose herunterziehen, sich auf die Toilettenbrille setzen, ihr Geschäft erledigen, sich den Hintern abwischen, die Kleidung wieder in Ordnung bringen, spülen und Hände waschen. Allerdings war die Kleine noch nicht groß genug, um das Waschbecken zu erreichen, weswegen die Frau sie hochhob, damit sie sich die Finger einseifen konnte. In diesem Moment erschien das wohlbekannte gelbgraue Etwas.
»Mutter.«
Die Frau wandte sich um und erblickte den Kopf. Schnell wusch sie die Seife von den Händen ihrer Tochter, trocknete sie mit einem Handtuch ab und schickte sie aus dem Badezimmer.
»Mutter.«
»Wie geht das? Wie kann es sein, dass du zurück bist?«
Der Angesprochene verzog seine Mundwinkel zu einem eigentümlichen Schmunzeln. »Ich habe den Müllmann, der mich gefunden hat, darum gebeten, mich in der Toilette hinunterzuspülen.«
Kommentarlos drückte die Frau die Spültaste. Der Kopf kreiselte kurz im Wasserstrudel, bevor er in der dunklen Öffnung verschwand.
Vor dem Badezimmer wurde sie von ihrem Kind mit Fragen bombardiert. Sie antwortete:
»Das ist eben ein Kopf. Wenn du ihn wiedersiehst, spül einfach.«
Der ungebetene Gast besaß die Frechheit, bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor ihr und ihrem Kind zu erscheinen und sie »Mutter« zu nennen. Sie beschloss, ihn ein für alle Mal loszuwerden.
Ihn wieder aus der Toilette zu ziehen, war einfach. Aber als sie ihn gerade in eine Tüte stecken und in die Mülltonne werfen wollte, zögerte sie. Der Kopf konnte schließlich sprechen. Wenn sie ihn wie letztes Mal einfach so wegwarf, könnte er erneut jemanden bitten, ihn im Klo runterzuspülen. Sie musste also dafür sorgen, dass er mit niemandem reden konnte.
Die Frau stopfte den Schädel in einen kleinen Behälter, den sie in eine sonnige Ecke auf dem Balkon stellte. Sie ging davon aus, dass der Kopf ohne Wasser oder weitere Ausscheidungen verdorren würde. Ihr fiel keine andere Methode ein, und sie wollte darauf auch keinen weiteren Gedanken verschwenden.
Ihren Mann und ihre Tochter warnte sie eindringlich davor, den Behälter zu berühren.
Der Gatte hatte keine Veranlassung, auf den Balkon zu gehen, aber die Kleine war neugierig. Sie ließ sich von ihrem brennenden Wunsch leiten, den Kopf genauer zu betrachten, schlich sich hin und sprach mit ihm. Die Frau tadelte ihr Kind gehörig und versteckte den Behälter samt Inhalt.
Ihr Mann hatte Urlaub genommen, und sie fuhren einige Tage lang weg. Nach der Rückkehr ging die Frau ins Badezimmer. Sie wusch sich gerade die Hände, als hinter ihr etwas auftauchte. Sie fuhr herum, schlug den Klodeckel zu und spülte.
Dann schalt sie ihre Tochter: »Das warst du, stimmt’s? Ich habe dir doch klar und deutlich gesagt, dass du es nicht anrühren sollst!«
Das Mädchen begann zu weinen. Der Ehemann mischte sich ein.
»Ach, das Ding in dem Behälter? Es bat mich, es in die Toilette zu kippen. Also habe ich es getan. War das vielleicht falsch?«
Die Frau seufzte und erzählte ihm die ganze Geschichte.
Ihr Mann blieb gelassen. »Ach, das spielt doch keine Rolle. Lass es einfach in Ruhe. Schließlich kriecht es nicht bei Nacht heraus und legt Eier im Haus.«
Die Frau träumte, dass sie sich in einem großen, weiß gefliesten Raum befand. Plötzlich tauchte hinter ihr der Kopf auf. Die Frau drehte sich erschrocken um. Da erschien er an einer anderen Stelle. Er war hier und dort und unvermittelt überall. Die Tochter stand neben ihr und zeigte jedes Mal entzückt auf ihn.
»Der Kopf! Der Kopf!«
Die Frau bat ihren Mann um Hilfe. Er saß zeitungslesend neben ihr.
»Ach, lass ihn einfach in Ruhe! Der spielt doch keine Rolle.«
Seine Worte wurden von den gefliesten Wänden zurückgeworfen und schwollen zu einem Echo an. Lass ihn einfach in Ruhe! Der spielt doch keine Rolle. Lass ihn einfach in Ruhe! Der spielt doch keine Rolle.
Der Hebel für die Toilettenspülung befand sich knapp unterhalb der Decke. Mit Mühe kletterte sie hoch, bis es ihr gelang, ihn herunterzudrücken. Wasser wirbelte um ihren Mann, das Kind und den Kopf. Die Frau wurde gemeinsam mit ihrer immer noch freudestrahlenden Tochter und ihrem unerschüttert zeitungslesenden Gatten in Richtung eines dunklen Lochs gezogen. Sie packte ihr Kind und versuchte mit aller Kraft, dem Sog zu entkommen. Da drang eine vertraute Stimme an ihr Ohr.
»Mutter.«
Sie sah hinunter auf ihr Kind. Auf dem kleinen Körper und dem zerbrechlichen Hals ihrer Tochter saß der riesige Kopf.
Panisch wachte sie auf. Sie stolperte ins Badezimmer. Vor der Toilette kauernd starrte sie in die reine, makellos weiße Porzellanschüssel und auf das dort stehende klare Wasser, das das dunkle Loch bedeckte. Sie stellte sich den Kopf darin vor und wohin das Loch führte.
Aber seit sie versucht hatte, den Kopf zu töten, tauchte er nicht mehr auf. Im Laufe der Zeit verschwanden auch ihre Albträume. Sie führte ein ruhiges Leben, indem sie für ihren Gatten und ihre Tochter kochte, den Abwasch erledigte, die Wäsche wusch, das Haus putzte, den Einkauf besorgte und sich in den Jahren voller ereignisloser Tage verlor. Ihr Ehemann machte Karriere, nicht schneller oder langsamer als andere. Er war weder besonders zartfühlend noch außergewöhnlich häuslich, aber er brachte am Geburtstag seiner Frau oder seiner Tochter immer einen Kuchen mit nach Hause, den er mit Kerzen dekorierte. Das Mädchen ging, wie jedes andere, zunächst auf die Grundschule, wechselte dann an die Mittelschule und besuchte schließlich die Oberschule. Ihre Noten waren mittelmäßig, weder gut noch schlecht. Sie war von angenehmem Äußeren, aber keine Schönheit. Ein typisches Schulmädchen, das Schwierigkeiten hatte, am Morgen aus dem Bett zu kommen, für Berühmtheiten schwärmte und sich vor dem Spiegel über Pickel aufregte.
»Komm zum Frühstück, sonst bist du zu spät.«
»Hast du meine Schulkrawatte gesehen?«
»Ich habe sie an die Türklinke deines Zimmers gehängt. Iss langsam, das ist besser für den Magen.«
»Schon gut. Ach übrigens, gestern habe ich den Kopf eines Menschen im Klo gesehen.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich habe ihn einfach runtergespült.«
»Sehr gut. Möchtest du noch etwas von der Suppe?«
»Danke, ich bin satt. Aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Wie wird man ihn los? Er ist so widerwärtig.«
»Vergiss ihn einfach! Spül ihn runter, wenn er auftaucht! Bist du fertig?«
»Klar. Bis später dann.«
»Hast du dein Pausenbrot eingepackt?«
»Ja, hab ich. Tschüss, Mama.«
»Gut, bis später.«
Die Tür fiel ins Schloss.
Lass ihn einfach in Ruhe.
Der spielt doch keine Rolle.
Die Frau begann den Tisch abzuräumen.
Mittlerweile studierte das Mädchen an der Universität. Die Frau konnte unterdessen nicht umhin festzustellen, dass sie Falten bekommen hatte und ihre Haut rau und spröde geworden war. Sie schenkte dem Mädchen Lippenstift, der ihr sehr gut stand, nur dass ihre Tochter kein Mädchen mehr war, sondern eine junge Dame. In dem vertrauten und doch so fremdartigen Gesicht erkannte die Frau die Züge ihres eigenen jüngeren Ichs wieder, wobei sie gleichermaßen Überraschung, Stolz, Liebe und Eifersucht empfand. Als sich ihre Tochter die Haare glättete und lila färbte, stellte sich die Frau vor den Spiegel und spielte heimlich mit den nachgefärbten schwarzen Locken ihrer Dauerwelle.
Sie verbrachte immer mehr Zeit allein zu Hause. Ihr Mann war in die Führungsetage befördert worden und versank in einem Berg von Arbeit. Auch ihre Tochter hatte genug mit ihrem eigenen Leben zu tun, weswegen die Familie sich tagsüber nur selten sah. Von Zeit zu Zeit kam ihr Mann etwas früher als gewöhnlich aus dem Büro zurück, und sie verbrachten einen ruhigen Abend zu zweit. Aber sie hatten selbst zu Beginn ihrer Beziehung keine feurige Liebesbeziehung gehabt, sodass sie nun auch nicht in romantischen Erinnerungen schwelgen konnten. Sie hatten den größten Teil ihres Ehelebens in einem Zustand emotionaler Distanz dahingedämmert, und nun war es zu spät, um einen ernsthaften Versuch zu machen, zärtlich miteinander zu sein. Gewöhnlich schwiegen sie sich beim Abendessen an, sahen schweigend fern, und ihr Mann ging ohne ein Wort als Erster zu Bett. Die Frau blieb noch eine Weile allein vor dem Fernseher sitzen. An den Tagen, an denen ihr Mann oder ihre Tochter spät heimkehrten oder wenn die beiden schon zu Bett gegangen waren, sah sie so lange fern, bis als Zeichen des nahen Programmendes die Nationalhymne gespielt wurde. Sie tat dies zum einen, weil sie keine bessere Beschäftigung hatte, zum anderen, weil sie glaubte, sie könne das eigenartige Gefühl der Leere in ihrem Herzen bekämpfen, wenn sie den Bildschirm nur lange genug anstarrte. Es war ein kleiner Winkel ihres Herzens, der zugleich voll und leer war, verhärmt und doch empfindsam. In einem kurzen Augenblick der Unachtsamkeit könnte dieser kleine Winkel plötzlich größer werden und sie verschlingen. Also sah sie fern und versuchte, ihr Herz und ihr Gehirn abzulenken, indem sie auf dem Bildschirm der Aneinanderreihung bedeutungsloser Szenen folgte. Aber ihre Gedanken sprudelten weiter, entfesselten tief in ihr eine Quelle und überschwemmten sie, so sehr sie sich auch bemühte, diese einzudämmen …
Eines Abends ging sie ins Badezimmer.
Wie üblich hatte sie ferngesehen und war wieder einmal allein im Haus. Sie musste auf die Toilette, schloss danach wie gewohnt den Deckel und spülte. Beim Händewaschen betrachtete sie sich im Spiegel. Tränensäcke, Falten, raue und trockene Haut. Ihr Haaransatz schimmerte grau. Sie fuhr sich mit der Hand durch die Strähnen und dachte darüber nach, bald nachfärben lassen zu müssen, da bemerkte sie, wie sich der Toilettendeckel bewegte.
Klack.
Eine nasse Hand schob sich aus der Schüssel und stieß den Deckel auf. Eine zweite erschien, und beide Hände klammerten sich an den Rand.
Die Frau beobachtete, wie der Hinterkopf eines Wesens aus der Toilettenschüssel aufstieg, die dichten, schwarzen Haare vor Wasser triefend.
Die zierlichen Hände spreizten ihre dünnen, langen Finger und stemmten sich gegen den Rand. Schmale, feingliedrige Schultern kamen zum Vorschein, die in einem anmutigen Schwung in lange, schlanke Arme übergingen. Das volle schwarze Haar reichte den geraden Rücken hinunter bis zu einer verführerischen Wespentaille, einem üppigen weißen Gesäß und festen Schenkeln, die in einer sanften Kurve bis zu den Knien flossen. Ein Knie erschien über dem Rand der Toilettenschüssel, und ein Fuß wurde aufgesetzt. Das Bein war lang und wohlgeformt, die Waden vorteilhaft proportioniert und die Fesseln zart. Die Muskeln spannten sich etwas bei dieser Bewegung. Der andere Fuß wurde herausgezogen, und seine herrlichen Zehen berührten den Badezimmerboden. Ein feuchter, nackter Körper schimmerte sinnlich im gelblichen Dämmerlicht der Raumbeleuchtung.
Die Frau starrte noch immer in den Spiegel. Als das Wesen aus der Toilette sich langsam umdrehte, erblickte sie im reflektierenden Glas ihr jüngeres Ebenbild neben sich. Ihr junges Ich lächelte dem gealterten zu. Nun wandte sich auch die Frau langsam ihrem jüngeren Ich zu.
Der Kopf war nicht länger nur ein Kopf. Ihr reifes Ich starrte in ihr eigenes jugendliches Gesicht, das sie weiterhin anlächelte.
»Mutter.« Die Stimme war ein bisschen hoch, doch es lag keine Spur mehr von dem gurgelnden Röcheln eines Ertrinkenden darin. »Erkennst du mich nicht?«
»Na ja …« Ein rostiges Quietschen entwich ihrem Mund.
»Wie erging es dir, Mutter?«
Darauf erwiderte die Frau nichts.
»Endlich habe ich meinen Körper vollendet. Wie ich es versprochen habe, werde ich mein Leben nun aus eigener Kraft führen. Ich bin hier, um Auf Wiedersehen zu sagen und dich um einen letzten Gefallen zu bitten.«
Das Wort erregte die Aufmerksamkeit der Frau: »Gefallen?«
»Sei unbesorgt!« Der Kopf lächelte aufmunternd. »Ich kann wohl kaum nackt in die Welt hinausgehen, oder? Es war schwer genug, meinen Körper fertigzustellen, mit dem, was du mir hast zukommen lassen, aber ich hatte keine Möglichkeit, mir Kleidung zu erschaffen, um mich anzuziehen. Das also ist meine letzte Bitte. Ich brauche bloß etwas, um meine Blöße zu bedecken, und schon bin ich verschwunden.«
Die Frau ging in Gedanken ihre Garderobe durch und wollte gerade das Badezimmer verlassen, da hielt der Kopf sie zurück.
»Ich will dir keine Umstände machen, du musst mir keine schönen Kleider bringen. Es reicht, wenn du ausziehst, was du gerade am Leibe trägst.«
Die Frau erwiderte: »Was denkst du dir? Willst du etwa, dass ich mich sofort meiner Kleidung entledige? Hier auf den kalten Fliesen? Du solltest nehmen, was ich dir gebe, warum bist du so fordernd?«
»Mutter, bitte beruhige dich.« Der Kopf blickte sie mit flehentlichen Augen aus seinem jugendlichen Gesicht an. »Ich habe von dir nie etwas anderes erhalten als das, was du ausgeschieden hast. Das ist meine erste und letzte Bitte. Wenn du mir jetzt die Kleider gibst, die du anhast, werde ich deine Wärme und deinen Geruch allzeit bei mir tragen, bis ich sterbe. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.«
Die Frau starrte ihr jüngeres Ich an, ihren jüngeren Körper. Dieses Wesen, das nicht in ihrer Gebärmutter entstanden und durch die Nabelschur genährt worden war, sondern allein aus den Ausscheidungen ihres Darms einen vollständigen Körper entwickelt hatte. Sie starrte auf das, was die ganze Zeit in dem dunklen Loch des weißen Porzellans verborgen gewesen war, sie gequält hatte und nun seine Unabhängigkeit erklärte. Wenn das wirklich der endgültige Abschied war und wenn sie sich wirklich nie mehr wiedersehen würden, konnte sie auf die paar Kleider doch wohl gut verzichten?
Während sich ihr junges Ich mit einem Handtuch abtrocknete, zog sich die Frau aus. Ihre Kleidung war nicht besonders modisch: eine Strickjacke, ein einfaches Kleid, ein BH, eine Unterhose und Socken. Das war alles. Nackt beobachtete sie ihr junges Ich, wie es die einzelnen Sachen aufhob und sich anzog. Unterhose. BH. Kleid. Strickjacke. Ihr junges Ich schien jedes Teil zu liebkosen. Zuletzt kamen die Socken an die Reihe, und die Strickjacke wurde zugeknöpft. Ihr älteres Ich fühlte einen Schauer über den nackten Körper laufen.
»Also gut. Jetzt, wo du meine Kleider hast, geh. Mir ist kalt und ich muss schnell etwas überziehen.« Sie wollte gerade das Badezimmer verlassen, um sich anzuziehen, da schnitt ihr junges Ich ihr den Weg ab: »Wo willst du denn hin? Dein Platz ist nicht da draußen.« Es wies auf die Toilette. »Er ist da drin.«
»Was soll das?«, protestierte ihr älteres Ich. »Ich habe dir meine Kleidung gegeben, als du mich darum gebeten hast! Ich habe alles getan, was du wolltest! Warum bist du so undankbar? Genug mit diesem Irrsinn, geh! Verschwinde einfach!«
Das Gesicht der Jüngeren verzog sich zu einem spöttischen Lächeln. »Das stimmt. Du hast mir alles gegeben, was ich verlangt habe, und alles, was dir noch geblieben ist, ist dein ausgemergelter Körper. Zu lange habe ich es dort unten all die Jahre ertragen, während du dein Leben genossen hast. Jetzt bist du dran, ins Klo zu gehen. Ich werde deinen Platz einnehmen und den Spaß haben, den du hattest!«
Ihr älteres Ich widersprach. »Du undankbare Person! Was gab es dort draußen schon zu genießen? Mein Leben ist so gewöhnlich wie jedes andere, aber du hast mir mit deinen Quälereien das letzte Stück Glück geraubt, das ich hatte! Da du behauptet hast, von mir abzustammen, habe ich Abscheu und Ekel unterdrückt und dich zu dem gemacht, was du heute bist. Wenn du dir nur einen Moment eingestehen würdest, wie sehr du mich behelligt hast, und ein bisschen Dankbarkeit dafür verspürtest, was ich trotz allem für dich getan habe, wäre es dann nicht deine Pflicht, still und leise zu verschwinden, jetzt wo du deinen Körper vollendet hast? Geh mir aus den Augen und tauche nie wieder auf!!«
Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht der Jüngeren. Mit blitzenden Augen zischte sie durch zusammengebissene Zähne, doch beherrscht, langsam und deutlich:
»Dankbarkeit? Welche Dankbarkeit sollte ich dir gegenüber empfinden? Habe ich darum gebeten, von dir erschaffen zu werden? Hast du dich je um mich gekümmert oder freundlich mit mir gesprochen, die ich unbestreitbar von dir abstamme? Du hast mich geboren, auch wenn ich es nicht gewollt habe, und du hast versucht, mich aus Hass und Abscheu zu töten! Was hast du mir denn außer deinen Ausscheidungen und sonstigem Abfall schon gegeben? Ich musste alle Arten von Demütigungen und Rückschlägen ertragen, um das zu bekommen, was ich für einen menschenähnlichen Körper brauchte. Aber jetzt ist er vollendet. Das ist der Tag, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe, in diesem dunklen Loch. Jetzt, wo ich zu dir geworden bin, werde ich deinen Platz einnehmen und ein neues Leben beginnen.«
Der Fluch des Hasen
»Gegenstände, die dafür bestimmt sind, mit einem Fluch belegt zu werden, sollten besonders hübsch sein«, pflegte mein Großvater zu sagen.
Und die Lampe war ausgesprochen niedlich. Sie hatte die Form eines Hasen, der unter einem Baum sitzt. Der Baum wirkte etwas plump, aber der Hase war mit großer Sorgfalt ausgestaltet. Die Spitzen der Ohren und das Schwänzchen waren ebenso tiefschwarz wie seine Augen, sodass sich der Körper schneeweiß dagegen abhob. Er bestand aus einem harten Material, aber das rosa Schnäuzchen und das Fell waren ganz fein und sorgfältig gearbeitet, um den Anschein von Weichheit zu vermitteln. Schaltete man die Lampe an, erstrahlte der Körper des Tiers hell, und man glaubte für einen Augenblick, der Hase wäre lebendig und würde jeden Moment mit den Ohren zucken oder das Näschen rümpfen.
Jeder Gegenstand hat seine Geschichte. Da stellt dieser hier keine Ausnahme dar, ganz besonders, weil er verflucht ist. In seinem Schaukelstuhl neben der Hasenlampe sitzend, erzählt mir mein Großvater dieselbe Geschichte, die er mir schon so oft erzählt hat.
Die Lampe war für einen seiner Freunde gemacht worden.
Dinge für den Eigengebrauch zu verfluchen, ist verboten, erst recht, wenn sie aus der Familienproduktion stammen. Dieses ungeschriebene Gesetz wird in unserer Familie, die aus der Anfertigung verfluchter Gegenstände ein Geschäft gemacht hat, von Generation zu Generation weitergegeben. Dieser Hase war jedoch die einzige Ausnahme.
»Die Familie meines Freundes betrieb eine Schnapsbrennerei«, beginnt mein Großvater auch dieses Mal. Und schließt wie immer die Frage an: »Weißt du, was eine Schnapsbrennerei ist?«
Natürlich weiß ich das. Schließlich habe ich die Geschichte schon hundertmal gehört, aber mein Großvater gibt mir nie die Gelegenheit, ihm zu antworten.
»Aus heutiger Sicht würde man sie einfach nur als eine Destille bezeichnen, doch damals war sie die größte Brennerei in der Gegend. Heutzutage findet man kein Familienunternehmen mehr, das einen solchen Schnaps herstellen kann. Aber das Unternehmen der Familie meines Freundes war so groß wie eine Fabrik, und die meisten Leute aus dem Dorf arbeiteten dort. In unserer Gegend genoss die Familie hohes Ansehen.«
Mein Großvater erinnert sich nicht daran, wie der Sohn einer so angesehenen Familie und er, in dessen Haus man sich mit der Herstellung unheilbringender Objekte beschäftigte, Freunde geworden sind. »Ich weiß es wirklich nicht mehr«, hat er mir mehrfach versichert. Die Familie meines Großvaters, also mit anderen Worten meine, bestand offiziell aus »Schmieden«. Und in der Tat fertigten wir landwirtschaftliches Gerät und allerlei Utensilien aus Metall oder reparierten sie, doch in der Nachbarschaft wusste auch noch das kleinste Kind, worin unsere eigentliche Profession bestand.
Jeder, der einer Beschäftigung im Umfeld dessen nachging, was man heutzutage wohlmeinend als »Okkultismus« bezeichnet – also Schamanismus, Wahrsagerei, Thanatologie –, wurde damals wie der niederste Pöbel behandelt. Diese Ausgrenzung war vollkommen ungerecht, aber leider Tatsache. Der Familie meines Großvaters, meiner Familie, wurden die einfachsten Gesten der Höflichkeit versagt. Die Leute wussten nicht, wie sie uns einordnen sollten. Wir waren weder Schamanen für Geisteraustreibungen, noch sagten wir die Zukunft voraus, und auch mit dem Geschäft eines Leichenbestatters hatten wir absolut nichts zu tun. Wir bewegten uns im Dunstkreis des Okkulten, aber niemand wagte auszusprechen, was wir taten. Unser metallverarbeitender Betrieb und die Reparatur und Herstellung von Ackergeräten ließ sich keiner Branche zuordnen. Dafür hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass wir jeden verfluchen würden, der uns in die Quere käme. Meine Familie hätte niemals einen Fluch über jemanden verhängt, den wir persönlich kannten, aber unsere Nachbarn wussten nichts von diesem ungeschriebenen Familiengesetz. Selbst wenn, hätte sie das nicht gekümmert. Jedenfalls versuchten sie, uns so gut es ging zu meiden.
»Aber meinen Freund schien das alles nicht zu scheren«, erklärte mein Großvater bei jeder Gelegenheit. Diesen Freund kümmerten weder die Gerüchte, die in der Stadt kursierten, noch das Geflüster der Leute oder die halb ängstlichen, halb neugierigen Blicke der Nachbarn. Der Junge aus der Schnapsbrennerei sah in den Kindern aus der Nachbarschaft von Haus aus seine Freunde, und es hätte für ihn keinen Grund gegeben, nicht mit einem von ihnen zu spielen, schon gar nicht wegen des Berufs der Eltern. Und da der Sohn der reichen, geachteten Schnapsbrenner-Familie meinen Großvater als Freund betrachtete, brachte das auch die anderen Kinder dazu, ihn zu akzeptieren.
»Seine Eltern hatten einen wachen Geist«, wurde mein Großvater nicht müde zu betonen. »Nie benutzten sie ihr Geld oder ihre Macht als Ausrede dafür, andere schroff zu behandeln. Sie verneigten sich so tief wie jeder sonst auch, wenn sie die Nachbarn grüßten, und sie waren immer die Ersten, die bei frohen ebenso wie bei widrigen Familienereignissen in der Nachbarschaft ihre Hilfe anboten.«
Heutzutage würde man diese Familie vielleicht als innovative Unternehmer bezeichnen. Über den anfänglichen Ansatz hinaus, für die Nachbarn einen Ballon Schnaps zu brennen, standardisierten sie das Produktionsverfahren, modernisierten den Herstellungsprozess und bauten ihr Vertriebsnetz sukzessive landesweit aus. Dann kam es zum Krieg in Korea, und die Familie floh in den Süden. Als sie nach den Kampfhandlungen zurückkehrte, lagen ihre Fabrik und die umliegenden Häuser in Trümmern. Aber die Familie ließ sich nicht entmutigen. Mehr als je zuvor war sie entschlossen, dies als Chance zu nutzen, noch einmal von vorne anzufangen, mit Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik und einem ausgefeilten Produktionsprozess. Der Freund meines Großvaters verstand den Ehrgeiz seiner Eltern und nahm das Familienunternehmen ernst.
»Wir dachten, er würde an der Universität Wirtschaftswissenschaften belegen, damit er eines Tages die Firma führen konnte, aber stattdessen studierte er Maschinenbau. Er sagte, er würde herausfinden, wie man Reiswein mit dem Geschmack einer handgemachten Herstellung aus lang gedämpftem Reis industriell produzieren konnte. Als erst neunzehnjähriger Junge, der gerade mal sein Abitur in der Tasche hatte, war er voller Tatendrang, das ganze Land mit dem Geschmack der hausgemachten Spirituosen zu erobern!«
Doch dann kam der Grüne Plan der Regierung und torpedierte sein Vorhaben. Im Mittelpunkt stand die Absicht der Staatsführung, Koreas Reisversorgung zu gewährleisten, und so wurde die Verwendung von Reis zur Alkoholherstellung verboten. Die traditionelle Methode – einer Mischung aus langsam gedämpftem und gemälztem Reis Wasser beizugeben und der Fermentierung ihren Lauf zu lassen – wurde durch den Einsatz von Ethanol ersetzt, einem industriell hergestellten Alkohol, der den Markt überschwemmte. Um diese abscheuliche Lösung genießbar zu machen, vermischten Getränkefirmen das hochprozentige Ethanol mit Wasser und künstlichen Aromastoffen.
Der Freund meines Großvaters war am Boden zerstört. Aber er gab nicht auf. Er war der letzte mehrerer Generationen von begnadeten Schnapsbrennern, die auf diesem Gebiet viel Wissen angehäuft hatten. Er akzeptierte die Haltung der Regierung, Reis zu einem kostbaren Gut zu erklären, da es wichtiger war, ihn zu essen, als zu trinken. So forschte er, soweit es die nationalen Regularien zuließen, an Produktionsmethoden, die sich an den traditionellen Verfahren orientierten und die alte geschmackliche Qualität hervorbringen konnten – Verhältnis der Zutaten, Alkoholanteil, Temperatur beim Fermentierungsprozess, Destillationsweise.
An diesem Punkt der Geschichte macht mein Großvater stets eine dramatische Pause, bevor er mich anstarrt und fragt: »Also, was, glaubst du, was dann passiert ist? Kannst du erraten, ob er Erfolg hatte oder scheiterte?«
Ich habe die Geschichte schon so oft gehört. Ich kenne die Antwort. Doch wie immer schüttele ich nur lächelnd den Kopf.
»Er hatte Erfolg. Er war ein kluger und ausdauernder Junge.« Daraufhin lächelt mein Großvater wehmütig. »Doch dann verlor er alles.«
Der Freund meines Großvaters richtete sein ganzes Augenmerk darauf, wohlschmeckenden, hochwertigen Alkohol zu entwickeln. Dabei übersah er, dass in der neuen Ordnung der Nachkriegszeit Kontaktpflege zu höheren Regierungsbeamten durch Einladungen, gelegentliche Schmiergeldzahlungen, Netzwerken oder Hintertreppengeschäfte wichtiger waren, als Produktqualität oder technische Ausstattung.
Zudem gab es ein sehr viel größeres Unternehmen, das den sich verändernden Spirituosenmarkt im Visier hatte. Ein Unternehmen, das ausgezeichnete Beziehungen zu Politikerkreisen unterhielt und über jahrelange Erfahrung mit geschäftlich motivierten Veranstaltungsprogrammen verfügte. Diese Firma besaß die Unverfrorenheit, ihre Mischung aus Alkohol und künstlichen Aromastoffen als »Volksgetränk« mit dem »Geschmack alter Tradition« zu bewerben. Die Verantwortlichen schalteten seriös klingende Anzeigen in Zeitungen und im Fernsehen, während sie gleichzeitig eine Verleumdungskampagne betrieben. Sie verbreiteten die Lüge, die Firma des Freundes meines Großvaters würde für industrielle Zwecke hergestellten Alkohol in ihre Getränke mischen. Sie behaupteten, dass jeder, der davon trinke, blind und lahm würde oder sogar einer Vergiftung erläge.