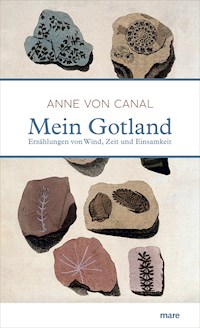Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Mare VerlagHörbuch-Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie oft kann ein Mensch von vorn beginnen? Ein reicher Stockholmer Vorort in den Sechzigerjahren: Laurits liebt das Spielen mit seinem besten Freund, das Schwimmen und Tauchen am Sommerhäuschen und vor allem die Klavierstunden bei Fräulein Andersson. Überall fühlt er sich wohler als in Gegenwart seiner überspannten Mutter und des dominanten Vaters, der für seinen Sohn eine Zukunft als Mediziner vorsieht. Doch als Laurits 18 wird, ist eine Karriere als Konzertpianist zum Greifen nah, und er spielt um sein Leben. Dann kommt alles anders als gedacht; Laurits findet seine Bestimmung als Arzt - und mit seiner großen Liebe Silja und der gemeinsamen Tochter Liis das Glück. Bis er Jahre später bei einem Familienfest erfahren muss, dass sein Leben auf Sand gebaut ist. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung... "Der Grund" erzählt die Geschichte eines Mannes, der immer wieder gezwungen ist, sich neu zu erfinden - und entwickelt dabei einen atmosphärischen Sog, dem sich der Leser nicht entziehen kann. Mit allen Sinnen erlebt man zusammen mit Laurits Licht und Schatten im großbürgerlichen Elternhaus zwischen Pflichterfüllung und Freiheitsdrang und begleitet ihn auf seiner Suche nach Aussöhnung, die ihn um die ganze Welt führt. "Ich habe mich in dieses Buch verliebt: Je näher ich ihm gekommen bin, desto ehrlicher hat es zurückgeschaut. Wunderbar!" Heikko Deutschmann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:8 Std. 0 min
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
mare
Anne von Canal
Der Grund
Roman
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Zitat Seite 7 aus: Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, hg. v. Richard Zenith, aus dem Portugiesischen übersetzt und revidiert von Inés Koebel, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2011, S. 475, © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
© 2014 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Simone Hoschack, mareverlag, Hamburg
Coverabbildung gettyimages / Sappington Todd
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Datenkonvertierung eBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-310-1
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-196-1www.mare.de
Für Tilman
Inhalt
45° 26′ 11″ N, 12° 23′ 35″ O
42° 46′ 28″ N, 15° 26′ 55″ O
42° 38′ 49″ N, 18° 4′ 51″ O
35° 53′ 9″ N, 15° 16′ 41″ O
36° 48′ 43″ N, 10° 17′ 84″ O
Freitag, 15. 10. 1976
38° 15′ 25″ N, 6° 42′ 32″ O
36° 42′ 30″ N, 4° 24′ 54″ W
Sonntag, 28. 6. 1992
38° 43′ 3″ N, 9° 6′ 59″ W
43° 22′ 00″ N, 8° 23′ 56″ W
Mittwoch, 28. 9. 1994
47° 35′ 12″ N, 5° 49′ 43″ W
50° 57′ 37″ N, 1° 21′ 18″ O
Mittwoch, 14. 9. 2005
Nachbemerkung und Dank
Über das Buch
Weitere eBooks aus dem mareverlag
»There is a silence where no sound may be, In the cold grave – under the deep, deep sea.«
Thomas Hood, Silence
»Ich wählte den falschen Fluchtweg. Über einen unbequemen Umweg gelangte ich genau an den Punkt, an dem ich mich bereits befunden hatte, und zum Entsetzen, dort leben zu müssen, kam noch die Erschöpfung, die jene Reise mit sich brachte.«
Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares
»Mayday, mayday.«
»Are you calling mayday? What’s going on?«
Rauschen. Keine Antwort.
»Can you reply?«
»Yes. Good morning. Sprechen Sie meine Sprache?«
»Ja. Ich spreche Ihre Sprache.«
»Gut. Wir haben hier ein Problem. Schwere Schlagseite. 20 bis 30 Grad nach Steuerbord, glaube ich. Können Sie uns zu Hilfe kommen?«
»Können Sie uns Ihre Position durchgeben?«
Knistern.
»Wir haben Blackout. Wir können sie gerade nicht bestimmen. Ich kann es nicht sagen.« Der Mann spricht schnell. Er klingt hektisch.
»Okay. Verstanden. Wir ermitteln sie selbst.« Fünf Minuten vergehen.
»Hallo! Kommen Sie uns zu Hilfe?«
»Es ist schwierig, von hier aus Ihre Position zu bestimmen. Können Sie uns sehen?«
»Ja. Wir hören Sie. Wir haben Blackout …« Stille. Dann:
»Ich gebe Ihnen jetzt unsere Position durch …« Rauschen.
»Ungefähr 58° Nord. Und …«
»Hallo? Hören Sie mich?«
»Ja. Also. 59° und 22 Minuten.«
»Verstanden. Und Longitude?«
Rauschen.
»21° 40′ Ost. Es ist schlimm hier. Sehr schlimm jetzt.« Der Mann ruft.
»Wir sind unterwegs.«
»Ja …«
»Hallo. Können Sie uns noch hören? Können Sie uns hören?«
Es kommt keine Antwort mehr.
Wenige Minuten später verschwindet das Schiff vom Radar der Küstenwache.
Überlebende berichten, dass an Bord ausgelassene Stimmung herrschte, obwohl viele Passagiere seekrank waren und sich in ihre Kabinen zurückzogen. Die Tanzgruppe trat trotz heftigen Seegangs auf, der Entertainer sang bis nach Mitternacht, und die Karaoke-Bar war gut besucht.
Mitten in die gute Laune kam der erste Schlag. Das Schiff erbebte. Wenige Minuten später folgte eine zweite heftige Erschütterung. Irgendjemand sagte: »Jetzt haben wir einen Eisberg gerammt.« Die Umstehenden lachten.
Dann kippte plötzlich der Raum.
Stühle flogen, ein Kühlschrank machte sich los, Gläser stürzten aus den Regalen und rissen die Barfrau um.
Panik brach aus.
Es gab nicht mehr oben noch unten.
Unterhalb des Autodecks drang das Wasser mit Macht durch jede Öffnung herein, die es finden konnte. Es nahm sich die Menschen im Schlaf und auf der Flucht. Wenn nicht der Verstand, dann trieb der Instinkt die Rettungssuchenden nach oben.
Türen fielen für immer zu, und die langen Kabinengänge wurden zu unüberwindbaren Schächten in den Abgrund. Überall riefen und weinten Leute.
Die Lampen flackerten noch ein paarmal und erloschen dann. Die Schreie wurden lauter. Als habe an dem Licht alle Zuversicht gehangen.
In der Schwärze der Nacht, in tosendem Sturm, reckte das weiß-blaue Schiff um 01.48 Uhr ein letztes Mal den Bug in die Luft und versank nach weniger als einer Stunde mit einem lauten Seufzer. Mit ihm verschwanden die Wünsche und Träume, die Sehnsüchte, Sorgen, Ängste und Pläne all jener, die an Bord geblieben waren.
Der Vollmond kam hervor und beleuchtete die gespenstische Szenerie, die sich den im eiskalten Wasser treibenden Schiffbrüchigen bot. Sie starrten in die Dunkelheit und wunderten sich über die eigentümliche, brüllende Stille, die auf das spurlose Verschwinden des Stahlkolosses gefolgt war.
Viele von ihnen ertranken in den Stunden darauf in der unerbittlichen, vom Wind gepeitschten See, viele erfroren, weil die Kraft sie noch vor der Hoffnung verließ, und nur wenigen gelang es, sich auf einer Rettungsinsel zu halten. Dort klammerten sie sich aneinander, während Welle für Welle sie überspülte. Manche erinnern sich, dass der nahe Tod um ein Vielfaches verlockender schien, als noch weiter in der eisigen Kälte auszuharren.
Stunde um Stunde verging. Die Schreie waren längst verstummt, als die letzten Überlebenden endlich den Rotor eines Helikopters hörten.
Aber für über achthundertfünfzig Passagiere und ihre Familien an Land kam jede Hilfe zu spät.
45° 26′ 11″ N, 12° 23′ 35″ O
12. 08. 2005
14.00 Uhr
Hier bin ich wieder. Sechs Quadratmeter für mich allein. In jedem modernen Gefängnis haben die Insassen mehr Platz. Aber das spielt keine Rolle, ich brauche nicht mehr. Und ich will gar nicht mehr. So klein ist meine Welt. Sechs Quadratmeter. Ein überschaubarer Raum. Vier Wände in Beige, eine winzige Nasszelle, ein ovales Fenster aus Achtfachglas. Nicht zu öffnen. Die Tür macht ein dumpfes Geräusch, wenn sie ins Schloss fällt. Angenehm endgültig. Als könnte niemand mehr rein, sobald der mechanische Türschließer sie zugedrückt hat. Es hat mich richtig erleichtert, dieses Klicken. Endlich allein. Noch zwei Stunden bis zum Künstlermeeting. Bis dahin muss ich irgendwie einen klaren Kopf bekommen. Vielleicht hilft es, das aufzuschreiben. Es muss helfen. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll.
Wir haben schon abgelegt, fahren mit langsamer Fahrt hinaus in die Lagune. Weg von Venedig.
Mir soll’s recht sein.
Dabei mag ich diese Stadt, womöglich war sie in den letzten fünf Jahren sogar eine Art Zuhause. Aber nach allem, was heute Morgen passiert ist, glaube ich nicht, dass ich wieder dorthin zurückkehre. Rosa hat alles kaputt gemacht. Und ich verstehe einfach nicht, warum.
Sie muss ja geahnt haben, wie ich reagiere. Sonst hätte sie doch mit ihrer Verkündung nicht bis zur letzten Minute gewartet – bis ich abreisefertig mit dem Koffer im Flur stehe. Gedanklich längst auf dem Schiff. Bei meiner Arbeit.
»Aspetto un bambino, Lorenzo.«
Sie weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Und sie weiß nichts über mich. Lorenzo! Das ist doch alles Quatsch.
Ich habe sie wirklich sehr gern. Aber ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass eine Beziehung nicht infrage kommt. Keine Beziehung. Nicht mit ihr, und auch nicht mit einer anderen. Und erst recht kein Kind! So waren die Regeln. Ich habe ihr doch nie Hoffnungen gemacht. Dazu war sie mir viel zu nah. So nah, wie es eben ging, wie ich es ertragen konnte. Manchmal sogar näher. Manchmal, wenn sie in meinem Arm gelegen hat, den Kopf auf meiner Brust …
Ja, ich wusste, dass sie sich eine Familie wünscht, und sie wusste, dass ich dafür nicht der Richtige bin. All die Jahre hat sie das akzeptiert, hat mich nie gedrängt, keine Fragen gestellt. Und ich habe ihr vertraut. Das ist das Einzige, was ich mir vorzuwerfen habe. Ich kann kein Kind mit ihr haben. Überhaupt kein Kind. Sie hat doch verhütet –
Ich will nicht für immer bei ihr einziehen, in Venedig sesshaft werden, morgens im Laden stehen und Blumen verkaufen, abends im Caffè Florian Dienst schieben und zwischendurch das Kind füttern. Sie erwartet doch nicht, dass ich mit ihr heile Welt spiele?
Es gibt keine heile Welt, und ich kann sie nicht für sie erfinden.
Am liebsten möchte ich mir das Herz rausreißen. Die Gedanken abschalten. Dieses Gefühl muss weg. Ich brauche wirklich einen klaren Kopf. Schließlich habe ich hier einen Job. Wenigstens den möchte ich behalten.
18.30 Uhr
Ein Lichtblick: Die Künstlertruppe scheint so weit ganz in Ordnung zu sein. Zauberer, Tänzer, Sänger, das volle Programm. Außer mir sind noch zwei weitere Pianisten dabei, Mike und Frank. Beide deutlich jünger als ich. Gehört man mit Mitte vierzig jetzt auch schon bei den Klavierspielern zur alten Garde? Wahrscheinlich sollen sie die jüngere Klientel bedienen, während ich das gesetztere Publikum übernehme. Irgend so etwas wird Johanna sich dabei gedacht haben, als sie uns besetzt hat. Wenn sie für die Künstlerbetreuung an Bord zuständig ist, geht selten etwas schief. Wie oft sind wir in den vergangenen neun Jahren zusammen gefahren? Sechs Mal? Sieben Mal? Die Touren waren immer gut, nicht bloß problemlos, sondern auffallend gut. Ihr gelingt es, einem das Gefühl zu geben, dass man eine größere Aufgabe hat, dass es bedeutsam ist, was wir tun. Ihre umarmende Freundlichkeit ist ein echtes Trostpflaster. Ihr Lachen sollte es auf Rezept geben.
42° 46′ 28″ N, 15° 26′ 55″ O
13. 08. 2005
01.30 Uhr
Arbeiten hilft wirklich gegen fast alles. Der Abend ist gut gelaufen. Bin todmüde, aber trotzdem aufgedreht, wie eine Spieluhr. In meinem Hirn scheinen Unmengen Adrenalin unterwegs zu sein und fröhlich die Synapsen zu verstopfen.
Das Publikum heute Abend war leicht zu durchschauen. Ich hatte die Leute schnell an der Angel. Aber man kann sich durchaus fragen, was sie erwarten, wenn sie in den Pub kommen, und über der Bar läuft ein Leuchtschriftband aus einem anderen Jahrhundert, das verkündet:
Heute Abend für Sie an den Tasten: LAWRENCE ALEXANDER!
Klingt wie Brandy Alexander. Klingt wie speckiger Anzug mit durchscheinenden Ellenbogen. Klingt wie gescheiterte Existenz. Klingt erbärmlich und wie alles, was ich nicht sein will. Vielleicht sollte ich mir mal was Neues einfallen lassen. Die Leute sind schließlich nicht hier, um Mitleid mit mir zu haben.
Der Mann an den Tasten. So nennt man mich.
Don’t shoot me, I’m only the piano player.
Auf der Platte ist auch Crocodile Rock. Drei Akkorde, und die Engländer wippen alle mit. Laaaalalalalalaaaaa. Es scheint niemanden zu kümmern, dass ich die hohen Töne nicht immer einwandfrei treffe. Singen ist nach wie vor nicht meine Disziplin, aber wenigstens macht es mir nichts mehr aus.
Blablabla. Gerade komme ich mir vor wie ein Kind, das alleine durch den dunklen Wald läuft und laut plappert und singt, um seine Angst zu verscheuchen.
Ich hätte mir besser eine Flasche Whisky von dem kleinen Küchen-Filipino geholt. Dann gingen bei mir vielleicht irgendwann die Lichter aus, Rosa würde verschwinden, und dieses ungenau eingestellte Radio in meinem Kopf, das drei Frequenzen gleichzeitig sendet, würde endlich verstummen. Ruhe.
42° 38′ 49″ N, 18° 4′ 51″ O
08.30 Uhr
Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe. Drei Stunden, maximal vier. Die Schultern tun mir weh, das Genick auch. Bin wie durch die Mangel gedreht. Bräuchte mindestens einen doppelten Espresso, aber den Anblick von fremden Menschen kann ich jetzt beim besten Willen nicht ertragen. Die Passagiere machen sich für den Landgang bereit. Dubrovnik. Weltkulturerbe in drei Stunden. Die Stadtmauer, das Zollhaus, das Rathaus. Über den Stradun schlendern. Erste Souvenirs kaufen. Fotos machen. Ohne mich.
Noch eine halbe Stunde, dann sind die meisten von Bord, und ich kann in aller Ruhe frühstücken gehen. Muss mir unbedingt einen Wasserkocher und Instantkaffee besorgen. Für den Notfall.
12.25 Uhr
Zwei Stunden Klavier gespielt. Ich kann immer noch völlig versinken, wenn ich die Metamorphosen spiele. Es beruhigt meine Nerven. Mein Herz. Den Kopf leeren, bis nichts mehr existiert als Töne und alles in Bedeutungslosigkeit zerfließt. Manchmal glaube ich, Klavierspielen ist die einzige Fähigkeit, die mir geblieben ist. Das Einzige, was mich hält. Jetzt fühle ich mich besser, klarer. Zumindest bin ich ein bisschen ruhiger als gestern und in der Lage, rational zu denken.
Ich war vielleicht etwas unfair, Rosa gegenüber. Natürlich trägt sie nicht die alleinige Verantwortung für diese Katastrophe. Das weiß ich wohl. Aber ich frage mich immer noch, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wahrscheinlich hätte ich nicht zulassen dürfen, dass sich dieses häusliche Gefühl breitmacht. Ich habe mich nicht an meine eigenen Regeln gehalten. Habe Brücken gebaut, obwohl ich genau weiß, wie schmerzhaft es ist, sie abzubrechen. Ich habe mich von Rosas Nestwärme einlullen lassen.
Ja. Es war schön, nach einer langen Reise im Hafen von Venedig anzukommen – die Stadt ist die einzige, die ich länger als drei Tage ertrage, sie ist ein Zwischenzustand, nicht Land, nicht Meer. Es war schön, dort von Bord zu gehen und am Piazzale Roma mit einem festen Ziel ins Vaporetto zu steigen, mit einem Schlüssel in der Tasche, der in eine Haustür passt. Es ist schön, wenn einer aufschaut, lächelt und sagt: »Ich hatte das Gefühl, dass du bald kommst.« Es ist schön, von Leuten gegrüßt zu werden. Eine Stammkneipe zu haben. Kein Zweifel. Von mir aus hätte es so weitergehen können. Selbst der einsamste Wolf freut sich gelegentlich an einem Rudel.
Aber ich habe die Alarmglocken ignoriert. Es ist genau das eingetreten, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte: Erwartungen, Verletzungen, Enttäuschungen. Jetzt muss ich die Konsequenzen ziehen. Für die Notbremse ist es ja wohl zu spät.
15.40 Uhr
Mittschiffs Steuerbord habe ich eine stille Ecke zwischen zwei Rettungsinseln gefunden. Windschatten und kein Zutritt für Passagiere. Allerdings hat hier schon vor mir jemand Ruhe gesucht: Ein weißer Plastikstuhl ist an der Reling festgebunden. In der Ecke ein paar Zigarettenkippen. Vermutlich verbringt hier einer vom Service seine kurzen Raucherpausen, das Lord Nelson Restaurant ist ja gleich um die Ecke. Aber seit ich da bin, hat sich niemand blicken lassen. Hier sitze ich seit einer Stunde und höre auf das tiefe Stampfen der Dieselmotoren. Der Grundton der nächsten zwei Wochen. Alles vibriert leise. Bin sogar kurz eingeschlafen.
Langsam stellt sich mein Organismus wieder auf Schiffstempo um. Von Stundenkilometer zu Knoten. Die Gleichförmigkeit der Tage. Ich war selten froher, diesen Job zu haben. Ein oder zwei Dienste am Tag. Dazwischen Zeit und keine Verpflichtungen, keine Fragen.
Wenn rundherum kein Land zu sehen und die Wasseroberfläche eine dunkelgraue Wüste ist, kommt es mir manchmal so vor, als würde sich das Schiff nicht bewegen. Als stünde alles still. Wir, die Welt, der Augenblick. Für immer. So ähnlich müssen sich Raumfahrer in der schwarzen Schwerelosigkeit fühlen. Aber in Wahrheit pflügt das Schiff durch die Zeit, der Bug ist schon Zukunft, das Heck längst Vergangenheit. Es gibt nur eine Richtung und kein Zurück. Voraus ist immer noch Hoffnung. Achtern nie. Wer sich umdreht, erstarrt zur Salzsäule. Vor Schreck. Vor Schmerz. Das war schon zu Lots Zeiten nicht anders. Warum sollte man also zurückschauen?
20.10 Uhr
Der Five o’Clock Tea wird hier um halb fünf serviert. Weiß der Himmel, warum. Das ist echte Kreuzfahrtlogik. Ich hab eine Stunde Wallpaper im Salon gespielt und mich zwischen gefälligen Melodien unsichtbar gemacht. Unaufdringliches Klaviergeflüster zum Füllen peinlicher Gesprächspausen. Die Musik ist meine Tarnkappe. Ich wünschte, ich könnte sie ewig tragen. Verschwinden und trotzdem alles sehen. Ein paar Passagiere sind mir aufgefallen. Ein älterer Herr, ich tippe auf Unternehmer im Ruhestand. Er wirkt zurückhaltend, hat aber eine enorme physische Präsenz. Er war gestern Abend auch schon im Old Major. Dann ein Mittelstandsehepaar, lower-upper-middle class, oder wie hat Orwell das so schön genannt? Wahrscheinlich Kreuzfahrtanfänger. Unbeholfen wie Leute in geliehenen Kleidern. Könnte auch sein, dass sie die Reise gewonnen haben. Außerdem ein stilles Paar Ende dreißig, das merkwürdig fehl am Platze scheint – als wollten sie eigentlich woanders sein, als wären sie gar nicht wirklich da. Und dann war da noch dieser Junge. Er kann höchstens elf, vielleicht zwölf Jahre alt sein, saß ganz alleine bei diesem fürchterlich langweiligen Tee-Event, ohne Spielzeug. Kein Nintendo, keine Kopfhörer. Er guckt nur. Jedes Mal, wenn ich zur Glastür schaue, warten seine Augen im Spiegelbild schon auf mich. Und dann schneidet er Grimassen. Ich kenne dieses Spiel: Wer zuerst lacht, hat verloren.
Als wollte er mich auf die Probe stellen. Wie ich reagiere, wenn er mich aus dem Konzept bringt. Als wüsste er, dass ich lieber unsichtbar wäre.
35° 53′ 9″ N, 15° 16′ 41″ O
14.8. 2005
02.10 Uhr
Ich werde nicht mehr an Rosa denken. Und nicht an dieses Kind. An kein Kind. Es hätte nie so weit kommen dürfen. Nie. Ich habe nichts gegen Kinder. Im Gegenteil. Ein kleines Bündel frischen Lebens im Arm zu halten, ist ein so unerhört schönes Gefühl. Ich weiß das. Aber ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Dazu kann mich niemand zwingen. Ich werde Rosa regelmäßig Geld schicken. Solange ich Engagements habe, ist mein Verdienst gut, außerdem brauche ich nicht viel. Sie wird zurechtkommen, dafür kann ich sorgen. Alles andere muss sie allein regeln.
Wann habe ich die falsche Abzweigung genommen? Wann? Wann hat sich entschieden, dass alles so kommen musste? Ich habe doch immer nur versucht, aus allem irgendwie das Beste zu machen. Ist es denn wirklich meine Schuld? Vor dieser Wand ende ich, renne mir die Stirn daran blutig. Heute mache ich nicht den gleichen Fehler wie gestern Abend. Mein Freund Johnnie Walker ist bei mir und stößt mit mir an.
06.30 Uhr
Schrecklicher Traum kurz vor dem Aufwachen: Johanna hatte ein Baby, das sie während des Künstlermeetings gestillt hat. Alle anderen saßen im Kreis um sie herum und sahen ihr dabei zu. Ihre Brüste waren riesig. Und plötzlich war das Baby kein Baby mehr, sondern der Junge aus der Bar. (Er trug dieselbe grüne Baseballkappe wie gestern Nachmittag, daran habe ich ihn wohl erkannt.) Irgendwann hat Johanna mich zu sich gewinkt, sie wollte, dass ich an der anderen Brust trinke. Aber ich konnte nicht. Ich habe mich geekelt. Als ich aufgewacht bin, hatte ich den Geschmack von Muttermilch noch auf der Zunge. Hätte mich fast übergeben.
Ich muss an die frische Luft.
Meine Finger sind geschwollen. Mein Hirn wahrscheinlich auch. Den Rest, der noch in der Whiskyflasche war, hab ich in den Ausguss gekippt. Das Zeug hat alles noch schlimmer gemacht. Es hat einfach nur nach Kummer geschmeckt. Plötzlich habe ich mich wieder gefühlt wie damals. Wund. Dumpf und stumpf und trotzdem nicht betäubt. Dort wollte ich nie wieder landen. Das habe ich hinter mir. Auch die Sache mit Rosa wird mich nicht wieder dorthin bringen.
Der Wind tut mir gut, der Ausblick auch. Macht den Kopf leichter. Der Himmel glänzt wie Plexiglas. Glatt und poliert. Schnurgerade ans Meer geschweißt und an der Naht fast weiß. Die Luft hat sich spürbar verändert, man kann Afrika riechen. Das Meer macht sich bemerkbar, mit längeren Wellen, dunklerer Farbe, die Oberfläche sieht nicht mehr so ölig aus, wie es für die Adria typisch ist. Größerer Wasseraustausch. Weniger Salz. Brennt aber wahrscheinlich trotzdem in den Augen.
Noch ist alles still an Bord. An Seetagen schlafen die Leute meistens länger. Ich werde noch ein paar Bahnen schwimmen, ehe das Tagesprogramm beginnt – auch wenn man sich in diesem Pool vorkommt wie ein Goldfisch in einem winzigen Glas, das auf dem Badewannenrand steht.
14.24 Uhr
Dieses Kind verfolgt mich. Plötzlich sehe ich den Jungen überall: In der Crew-Messe, in der Bibliothek, selbst unten im Wäschelager. Die grüne John-Deere-Kappe ist nicht zu übersehen. Heute Morgen war er am Pool, dann beim Sektfrühstück auf dem Sonnendeck. Er hält sich mit einer Selbstverständlichkeit in meiner Nähe auf, die mich ganz unruhig macht. Dabei tut er nichts, was mich ärgern könnte, es gibt keinen Grund, ihm böse zu sein. Er ist einfach nur da, hört zu und sieht mich dauernd an. Aus irgendeinem Grund provoziert mich das ungemein. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, damit ich ihn nicht verscheuche wie einen bettelnden Hund.
Johanna sagt, er gehöre zu einem Techniker, den die Reederei an Bord geschickt hat, um irgendwas zu kontrollieren. Kein Wunder also, dass er so herrenlos durch die Gegend streunt … Aber warum ist er dann nicht da, wo die spannenden Dinge passieren? Wieso hört er sich lieber einen so gut wie grauhaarigen Klavierspieler an, als die Giganten im Maschinenraum zu bestaunen?
Heute ist bunter Abend in der Ocean-Lounge. Sicher sitzt er dann auch wieder da.
23.40 Uhr
Der Tag war ununterbrochen von Menschen bevölkert. Ich habe mich mitziehen lassen. Bin mit dem Strom geschwommen und habe mich dabei ein wenig ausgeruht. Mich von mir selbst erholt.
Das stille Paar war im Old Major Pub. Sie sprechen kaum miteinander. Es wirkt wie eine Übereinkunft. Kein Vorwurf in der Luft, keine Gleichgültigkeit. Die Frau ist sehr speziell. Nicht im klassischen Sinne schön, aber sie hat etwas Trauriges an sich, was sie schön macht. Wie ein Tulpenstrauß, kurz bevor die Blüten zu welken beginnen. Ich habe für sie gespielt. Für die Tulpe. Vielleicht hat sie es ja gemerkt. Ihren Begleiter durchschaue ich nicht – obwohl seine Augen auffallend hell und klar sind, sehe ich darin keine Emotion.
Der Unternehmer heißt Mr Holland und hat sich inzwischen als Musikkenner und Besitzer eines Autohandels erwiesen. Etwas an seiner Art ist mir vertraut und sympathisch, auch wenn er von der Statur irgendwie an Vater erinnert. Manchmal lassen sich solche Leute zu merkwürdigen Vertraulichkeiten hinreißen: Er sagte, er habe leider nie die Chance gehabt, Klavier spielen zu lernen. Dafür habe seinen Eltern das Geld gefehlt. »Sie haben Glück gehabt«, hat er gesagt. Tja. Für manche mag das so aussehen.
Irgendwann in den frühen Morgenstunden werden wir Tunis erreichen.
36° 48′ 43″ N, 10° 17′ 84″ O
15. 08. 2005
10.20 Uhr
La Goulette. Das Schiff ist wie leer gefegt. Wie froh die meisten von ihnen sind, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Als wären sie eingesperrt gewesen. Nach einem Seetag wollen fast alle an Land. Mir ist das gleich. Was für einen Unterschied macht es, ob ich Tunis sehe oder nicht? Für mich wäre es ein Albtraum, mich in dieser Hitze durch die vollgestopfte Altstadt zu drängeln. Das macht mich erst matt, dann aggressiv. Es reicht mir, mein Ei vor der Skyline von Hongkong zu köpfen – Dschunke fahren muss ich nicht. So einfach ist das.
Rosa hat nicht verstanden, warum ich so gut wie nie von Bord gehe. »Du hast die ganze Welt bereist, aber nichts von ihr gesehen.« Den Satz habe ich oft von ihr gehört. Und manchmal hat sie mich selbstzufrieden genannt. Aber was weiß sie schon von meinem Leben? Sie kennt vier oder fünf von tausend Puzzleteilen und schließt daraus auf das gesamte Motiv. Ich mache ihr deshalb keinen Vorwurf, schließlich habe ich es ihr ja auch nicht gezeigt. Aber gewarnt habe ich sie.
13.17 Uhr
Der kleine Plagegeist heißt Henrik, so viel habe ich inzwischen in Erfahrung gebracht. Als ich zum Üben in der Bar war, hat er sich reingeschlichen. Erst habe ich ihn gar nicht bemerkt. Was will er bloß von mir? Er legt eine Beharrlichkeit an den Tag, die bewundernswert wäre, wenn sie mir nicht so auf die Nerven ginge.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich als Kind die Nähe von Erwachsenen gesucht habe. Warum auch – sie waren doch immer nur mit sich selbst beschäftigt. Außer Frida vielleicht, und dem alten Oscar.
16.00 Uhr
Die Tulpe stimmt mich wirklich nachdenklich. Etwas in ihrem Wesen rührt mich. Wir sind im Pool aneinander vorbeigeschwommen wie zwei Tiere unterschiedlicher Art, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Stille Toleranz und die Gewissheit der Anwesenheit des anderen. Es war nicht unangenehm. Wenn ich genau darüber nachdenke, war es vermutlich das erste Mal auf dieser Reise, dass ich mich in der Gegenwart von jemand anderem richtig wohlgefühlt habe. Entspannt. Als Henrik – wer sonst – mit einer Arschbombe dazwischengeplatzt ist, habe ich zum ersten Mal ein richtiges Lächeln auf ihrem Gesicht gesehen. Breit und offen. Sie ist nicht nur schön, wenn sie traurig ist. Geredet haben wir nicht.
23.13 Uhr
Den Jungen bin ich erst mal los, glaube ich.
Ich muss ins Schwarze getroffen haben. Er sah aus wie ein angeschossenes Reh, als ich nach seiner Mutter gefragt habe. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Dieses dumme Ja-Nein-Fragespiel war immerhin seine Idee. Und was soll ich sagen, ich habe die Regeln nicht gemacht – bei einem Nein ist nun mal der andere dran. Ich habe oft genug Ja gesagt. Ja, ich mag Star Trek, ja, ich trinke Weißwein, ja, ich war schon mal in New York. Aber was geht es ihn an, ob ich als Kind schon Klavier gespielt habe?
Nirgendwo steht, dass man einen Plagegeist nicht nach seiner Mutter fragen darf.
Er hätte ja ebenfalls lügen können.
Freitag, 15. 10. 1976
Die Tür ging auf, ein kalter Luftzug.
»Victor Alexander Laurentius Simonsen, bitte«, sagte eine Frau. Sie hatte ein Vogelgesicht, spitz und überlegen wie eine Elster, mit wachen Augen.
Laurits stand auf und wischte sich die Hände an den Hosenbeinen ab. Er fühlte sich, als wäre er gerade aus dem Koma erwacht. Ihm war schwindelig, sein Gehirn wie in Watte verpackt und seine Ohren – etwas war mit seinen Ohren. Die Gespräche auf dem Flur, die Schritte auf dem Steinboden, die Toilettenspülung, deren ununterbrochenes Rauschen ihn in der vergangenen Stunde eigentümlich beruhigt hatte – alles klang dumpf, kilometerweit weg. Einen Moment lang fürchtete er, ohnmächtig zu werden, doch der unnachgiebige Blick der Frau ließ das nicht zu.
Sie winkte ihn ungeduldig zu sich heran, und während er versuchte, wieder in der Wirklichkeit zu ankern, verzog sie das Gesicht zu einem Lächeln, das trotz aller bemühten Freundlichkeit aussah, als wollte sie ihm im nächsten Moment den Schnabel in die Halsschlagader stoßen. Ihr Mund bewegte sich.
»Kommen Sie, Sie sind an der Reihe.«
Langsam erkannte er den Flur wieder, die Tür, die er seit einer Ewigkeit angestarrt hatte, und ihm fiel ein, warum er hierhergekommen war. Es war wegen Fräulein Anderssons Worten: »Du kennst deine Grenzen, Laurits. Überschreite sie.«
Er würde Pianist werden.
In der Stunde, die vergangen war, seit er bei dem schwerhörigen Mann an der Rezeption das Anmeldeformular ausgefüllt, seine Lackschuhe angezogen und auf dem Flur Platz genommen hatte, war sein ursprünglich solides Selbstvertrauen wie eine Kerze in einem zugigen Fenster flackernd heruntergebrannt.
Drei Mal war er seither auf der Toilette gewesen.
Zuletzt hatte er sich Wasser ins Gesicht gespritzt, um sich ein wenig zu beruhigen. Er hatte sich auf dem Waschbecken abgestützt und im Spiegel verfolgt, wie die Tropfen über sein fahles Gesicht liefen, hatte sich in die braunen Augen geschaut und nichts als Unsicherheit gesehen. Was war mit seinen sonst so starken Konzertnerven passiert?
Die dunklen Locken klebten feucht an seiner Stirn, und er wusste nicht, ob es Schweiß war oder Wasser. Ausdruckslos starrte sein Spiegelbild ihn an. Er erkannte sich kaum. Kniff die Augen zusammen und versuchte, den eigenen Blick zu fixieren.
Wieso hatte er eigentlich diese Schlupflider? Niemand in der Familie seiner Mutter hatte solche fleischigen Oberlider, die einfach so nach innen verschwanden, nein, sie hatten allesamt große, fein geschnittene Augen, die noch dazu von einer fast unnatürlich grünen Farbe waren. Die Augen seines Vaters waren zwar braun, genau wie seine, aber auch sie hatten nicht diese dreieckige Hundeaugenform. Sie waren groß und klar. Vor ein paar Jahren hatte der Professor einmal vorgeschlagen, Laurits’ kleinen kosmetischen Fehler, wie er es nannte, zu beheben. »Ein einfacher Schnitt, Sohn«, sagte er. »Wir entfernen die überschüssige Haut und Muskulatur der Oberlider, und schon wird ein richtiger Mensch aus dir.« Doch dieser Eingriff hatte nie Priorität bekommen.
Laurits’ ausgeprägte Kinnpartie hingegen war eindeutig Amys Erbe, ebenso wie die schmale Oberlippe, über deren Mitte sich ein für seine Begriffe viel zu tiefes Grübchen bis zur Nase zog. Er mochte diese Delle nicht. Beim Rasieren machte sie jedes Mal Schwierigkeiten, und außerdem dominierte sie sein Gesicht auf unangenehme Weise. Laurits sah dem Tropfen zu, der im Zeitlupentempo von der Nasenspitze zur Lippe rollte. Er fing ihn mit der Zungenspitze auf – salzig.
Schnell fuhr er sich mit den Händen übers Gesicht, zog ein Papierhandtuch aus dem Spender und trocknete sich ab.
Er betrachtete seine Hände. Lange, schmale und doch kraftvolle Finger, Männerhände schon, und so sauber, wie Fräulein Andersson es vom ersten Tag an von ihm verlangt hatte. Die Halbmonde auf den ordentlich gefeilten Fingernägeln strahlten rund und gleichmäßig. Er streckte die Arme vor sich aus, bewegte die Handgelenke und die Finger und war etwas beruhigt, als er kein Zittern wahrnahm. Noch einmal drehte er den Hahn auf, ließ sich das heiße Wasser über den Puls laufen und sah zu, wie die Haut sich rötete.
Die Zeit war geschlichen.
Und dann hatte die Elster seinen Namen ausgerufen.
Er sah die Frau an und drückte sich, ohne sie aus den Augen zu lassen, an ihr vorbei in den großen Saal.
Die Luft war schlecht, das fiel ihm als Erstes auf. Der Angstschweiß seiner Vorgänger hing sauer im Raum, aber in diesem Augenblick half ihm das sogar. Ein bekannter Geruch, ein vertrautes Gefühl. Die Ruhe, die er schon verloren geglaubt hatte, grüßte aus einer fernen Ecke seines Gehirns und signalisierte, dass sie noch da war. Das Türschloss klickte leise hinter ihm und verbannte den Rest der Welt nach draußen.
Eine Sekunde absoluter Stille. Nachhall vieler Stunden am Flügel.
Die Tür wurde noch einmal geöffnet. Laurits drehte sich um. Ein Mann in einem grauen Kittel, vermutlich der Hausmeister, kam herein und reichte der Frau einen Zettel. Sie nahm das Papier entgegen und versuchte, mit leisen Schritten den Raum zu durchqueren, doch ihre Absätze klapperten umso lauter.
Ein schneller Blick durch den Raum. In der Mitte des Saals stand ein beleuchteter Flügel. Ein Steinway. Das war gut, auch bei Fräulein Andersson hatte er immer auf dem Steinway gespielt. Und unter den Fenstern, im Gegenlicht, saßen wie schwarze Figuren eines Schattentheaters die fünf Juroren.
»Sind Sie Victor Alexander Laurentius Simonsen?«, fragte eine Männerstimme.
Er konnte nicht ausmachen, wer gesprochen hatte. Die Elster saß rechts am Rand. Sie hatte ein Klemmbrett auf den Knien und machte sich Notizen. Offenbar gehörte sie nicht zur Jury.
Er räusperte sich. »Ja«, antwortete er mit klarer Stimme.
»Geburtsdatum?«, fragte der undefinierbare Mann.
»4. August 1958.«
»Sie sind noch sehr jung, Herr Simonsen. Gerade mal achtzehn. Sind Sie sicher, dass Sie schon so weit sind?«
»Ja.«
Plötzlich setzte ein einzelner Sonnenstrahl die Jurorenbank ins Rampenlicht, und die Männer bekamen Gesichter. Allerweltsgesichter, aus denen eine ernüchternde Gleichgültigkeit sprach. An ihren Mienen war nichts abzulesen. Nur ein alter Glatzkopf sah ihn durch seine Hornbrille naserümpfend an, als ob etwas nicht stimmte.
»Sie haben sich da ja ein schönes Programm ausgedacht«, sagte er. »In welcher Reihenfolge wollen Sie spielen?«
»Romantik, Etüde und Wiener Klassik. Aus Schuberts Impromptus Nummer vier das Allegretto in As-Dur, Chopins Ozeanetüde Opus 25, Nummer 12, und den ersten Satz aus Haydns Sonate in Es-Dur.«
Papierrascheln. Blättern. Husten.
»Also. Bitte schön.«
Laurits nickte, zupfte an seiner Fliege. Seine Mutter hatte darauf bestanden. Ein Schlips wäre ihm lieber gewesen, mit dieser Fliege fühlte er sich falsch, ganz falsch, er hätte nicht auf sie hören sollen, hätte diese Fliege unterwegs einfach wegwerfen sollen, doch jetzt war es dafür zu spät.
Jetzt kam es nur noch auf ihn an, auf sein Spiel, sein Können, seinen Willen.
Er ging hinüber zum Flügel. Im schwarzen Lack spiegelten sich die Lampen, helle Scheinwerfer, die auf ihn herunterstrahlten. Vorsichtig, wie man einem fremden Pferd zum Kennenlernen über die Stirn streicht, berührte er die glatte Oberfläche. Er setzte sich, stellte an der Bank die richtige Höhe ein und überprüfte den Abstand zum Instrument, dann atmete er durch die Nase ein und legte die Hände auf die Tasten. Sie waren kühl und eben und vertraut.
Er hatte keine Zweifel, nur ein Ziel.
»Du siehst großartig aus. Wie ein erwachsener Mann«, hatte seine Mutter gesagt, als es nach einem zähen Vormittag und einem mühsam überstandenen Mittagessen endlich an der Zeit gewesen war, sich auf den Weg zur Bushaltestelle zu machen. Er schlang sich den Schal um den Hals und zog seinen Parka über das Anzugjackett.
»Willst du keine Mütze anziehen?«, fragte sie.
»Brauche ich nicht«, antwortete er.
Obwohl es seit Kurzem merklich kühler geworden war und der Herbst schon in den Blättern leuchtete, ließ er an so einem wichtigen Tag lieber Luft an seine »Hippie-Locken«, wie sein Vater seine Frisur bezeichnete.
Seine Mutter nahm sein Gesicht in ihre immerkalten Hände, kam ganz nah. Ihr Atem roch nach Pfefferminz.
»Ich bin so stolz auf dich. Ich habe immer gewusst, dass du es schaffst«, sagte sie und lächelte gequält. »Und du bist sicher, dass ich dich nicht fahren soll?«
»Mama. Das hatten wir doch geklärt.«
»Nun«, sagte sie und richtete sich mit einer schnellen Bewegung die Frisur. Bestimmt zum fünften Mal, seit sie in der Halle standen.
Er musste hier weg.
Immer wieder hatte sie angeboten, ihn zum Konservatorium zu begleiten, hatte sich geradezu aufgedrängt. Er wusste, dass es ihr größter Wunsch und ihr größter Triumph gewesen wäre, dabei zu sein, wenn er aller Welt (also der Jury des Konservatoriums und dem Professor) bewies, was in ihm steckte. Doch allein der Gedanke, außer sich selbst auch noch ihre Überreiztheit ertragen zu müssen, ihren unruhigen Blick, die aufgeregten Flecken an ihrem Hals und ihr fast manisches Geplapper, hatte ihm den Magen verknotet. Er hatte sich für den Bus entschieden. Natürlich war sie verletzt gewesen. Aber er hatte dem Impuls, ihr zuliebe und aus alter Gewohnheit doch noch einzulenken, widerstanden. Zum ersten Mal in seinem Leben ging es allein um ihn, und nichts lag ihm ferner, als sich das damit verbundene Hochgefühl von der unglücklichen Präsenz seiner Mutter verderben zu lassen.
Laurits rang sich ein Lächeln ab und schluckte weitere Bemerkungen. Er versuchte, sich loszumachen, doch Amy hing an seinem Arm wie eine Ertrinkende, umklammerte ihn eisern. Ihre Stimme war leise, als sie sagte:
»Weißt du, Laurits, du hast von uns beiden das Beste geerbt: den Fleiß deines Vaters und meine Liebe zur Musik.«
Er biss sich auf die Lippen.
Dumm nur, dass diese Liebe schon lange nur noch eine Behauptung war und Mutter die Ginflasche viel mehr schätzte. Dumm nur, dass sein Fleiß seinen alten Herrn in den vergangenen dreizehn Jahren noch weniger interessiert hatte als Frauenrechte in Kenia oder Pinguinkolonien am Südpol.
Ja. Laurits liebte die Musik. Und er war fleißig gewesen. Bis hin zu Krämpfen in den Fingern und Blutgeschmack im Mund. Er war gut. Aber das war nicht das Verdienst von Amy und Magnus Simonsen.
Laurits griff nach der braunen Aktenmappe, die ihm schon seit Jahren als Schultasche diente. Das Leder der Tasche beulte sich unschön aus, sie schien schwer, viel schwerer, als die Konzertschuhe und die Noten wogen. Er richtete sich auf. Innerlich und äußerlich.
»Ruf mich an, sobald du Bescheid weißt, ja?«, sagte Amy.
»Ja, Mutter, natürlich.«
»Hast du auch Kleingeld für den Münzfernsprecher?«
»Mama!«
Er wandte sich ab.
»Mach’s gut, Schatz«, sagte sie. Und rief nach einer Sekunde in die entstandene Leere: »Viel Erfolg!«
Ohne Zögern hatte Laurits seine Mutter, die Villa und den Odinvägen hinter sich zurückgelassen, hatte sich, als er die kiesbedeckte Auffahrt hinunterging, nicht umgedreht und war den Weg zur Bushaltestelle in Ruhe gegangen. Die kalte Luft roch nach Laub, und die Birken streckten ihre goldbehängten Arme in den klaren Himmel. Von der Station am Valhallavägen waren es dann nur noch ein paar Schritte durch den herbstlich bunten Park gewesen, bis er das moderne Gebäude der »Ackis« erreicht hatte. Über dem Vordach der Hochschule prangte groß eine mit einer Krone versehene, stilisierte Laute. Dort wollte er hin. Seine Füße waren leicht, und er dachte Musik.
Mit aller Leichtigkeit, die er aufbieten konnte, ließ er die ersten Sechzehntel von Schuberts Allegretto so selbstvergessen über die Tasten kullern wie seinerzeit Pelles bunte Glasmurmeln über den staubigen Vorplatz der Djursholmer Kapelle.