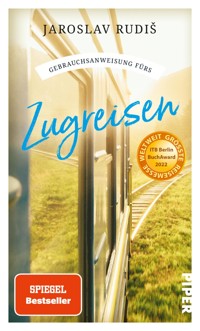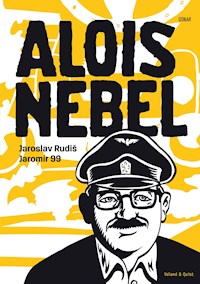9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Himmel unter Berlin ist eine Welt für sich, dort spinnt seit hundert Jahren die U-Bahn ihre Netze, bewahren unzählige Tunnel und Bunker geheime Geschichten, strömen tagaus, tagein unzählige Menschen durch. Die Musiker nicht zu vergessen, die diese Unterwelt mit Klängen füllen. Einer von ihnen ist aus Prag dahin geraten: Petr Bém, ein junger Deutschlehrer, auf der Flucht vor seinem alten Leben und voller Sehnsucht nach einem neuen. Als er im Untergrund Pancho Dirk kennenlernt, der von Musik besessen ist, gründen die beiden eine Band und nennen sie U-BAHN, weil es um Schwärze, Krach und Tempo geht. Dann verliebt sich Petr in Katrin, die Tochter eines Zugführers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jaroslav Rudiš
Der Himmel
unter Berlin
Roman
Aus dem Tschechischen von Eva Profousová
Zum Buch
Dort, wo die Berliner U-Bahn seit hundert Jahren ihre Netz spinnt, lernt Petr Bém, ein junger Prager Deutschlehrer, Pancho Dirk kennen, der von Musik besessen ist. Die beiden gründen eine Band und nennen sie »U-BAHN«, weil es um Schwärze, Krach und Tempo geht.
Fast zeitgleich verliebt sich Petr in Katrin, die Tochter eines Zugführers. Erst durch sie erschließt sich ihm der Bauch der Stadt – jener Stadt, die sich an der Oberfläche rasend schnell verwandelt, während in ihren Schächten und Tunneln unzählige Geschichten fortdauern. Wie ein moderner Orpheus taucht Petr mit seiner Gitarre in die Schattenwelt ein, zollt Bob Dylan Tribut, kämpft gegen die John-Lennon-Friedensmafia und tröstet den Zugführer Günter, dem fünf Selbstmörder auf der Seele lasten. Mit jedem Tag fühlt sich Petr mehr bei sich, in seinem neu entdeckten Rech.
Jaroslav Rudiš gelang mit seinem Debütroman in Tschechien ein überwältigender Erfolg. Kein Wunder, enthüllt er doch mit Witz und Poesie, was im Verborgenen liegt – eine faszinierende Stadt unter der Stadt.
Zum Autor
JAROSLAV RUDIŠ, geboren 1972, ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatiker und Musiker. Er studierte Deutsch und Geschichte in Liberec, Zürich und Berlin und arbeitete u.a. als Lehrer und Journalist. Seine aus dem Tschechischen übersetzten Romane erschienen im Luchterhand Literaturverlag und bei btb. »Winterbergs letzte Reise«, der erste Roman, den Jaroslav Rudiš auf Deutsch geschrieben hat, wurde 2019 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Für sein Werk wurde er außerdem mit dem Usedomer Literaturpreis, dem Preis der Literaturhäuser sowie dem Chamisso-Preis/Hellerau ausgezeichnet. Zuletzt erschien die Erzählung »Weihnachten in Prag«, illustriert von Jaromír 99. Rudiš lebt in Berlin und in Lomnice nad Popelkou im Böhmischen Paradies, wo er herkommt.
Inhaltsverzeichnis
FÜR DENISA
Mein besonderer Dank gilt dem Journalisenkolleg der Freien Universität Berlin für das Stipendium.
GERÄUSCHE
Es sind Geräusche, die einem in Erinnerung bleiben. Durch sie wird das Geschehene sortiert, verworfen und wieder gefunden. Die Welt ist ein Tonstudio, unsere Ohren die Antenne. Wir fahren, wohin sie uns lenken. Ich stehe am Fenster, den Hörer in der Hand, und warte.
«Mácha. Ich höre?» Ich sage: «Guten Tag. Bém hier. Herr Direktor, ich wollte sagen, dass ich heute Nachmittag nicht zur Besprechung komme. Ja ... morgen komm ich auch nicht … Eigentlich nie wieder … Also tschüs dann … Und seien Sie nicht böse.»
Aus dem Hörer donnert es zurück: «Was … Wie nicht … Wer … Was ist los … Bém, was soll der Quatsch?»
Ich lege den Hörer auf den Rand des Blumentopfes, setze Kaffeewasser auf und lasse Mácha in die Pflanzen hineinblubbern.
«Hallo-Hallo-Hallo. Wie stellen Sie sich das vor? Ausgerechnet am Anfang des Schuljahres. Sind Sie noch da?
Mensch, was ist denn los? Wachen Sie doch auf … Was Sie da machen, ist eine ziemliche … Ich krieg noch ’ne … Hallooooo … Verdammt …»
Klick.
Ein kurzer Moment Stille, zerstückelt durch ein schwaches Piepen am anderen Ende der Leitung. Dann pfeift der Wasserkessel, und hinter den Fenstern rattert der Bummelzug nach Nymburk.
Ich legte den Hörer zurück, goss Wasser auf, machte das Fenster zu. Und wartete ab, wann sich der Direktor der Grundschule in Jindřišská zurückmelden würde. Dass er sich melden würde, war mir klar.
Unter den Fenstern donnerte der Schnellzug nach Liberec, eine alte Diesellok, dahinter zwei gammelige Waggons. Das Telefon klingelte zum zweiten Mal.
Wenn ich abnehme, werde ich wohl bleiben. Werde mich unterkriegen lassen. Ich bin keine Kämpfernatur.
Nach zwei Minuten klingelte es zum dritten Mal.
Ich habe nicht weggehen wollen.
Zum vierten Mal.
Ich habe weggehen müssen.
Ohne genau zu wissen, warum und wohin.
Ich machte mich auf, meine Sachen zu packen. Die Gitarre. Und die Stimmgabel. Schrieb einen Brief, wenn man die paar Zeilen so nennen kann: Lasst es euch gut gehen. Ich werde mich melden. Tut mir Leid. Ich muss weg und so weiter, aus der Hosentasche fischte ich etwas Geld heraus und legte es auf den Tisch. Das Sparbuch auch. Es hört auf das Passwort Elvis ist tot. Das stand auf der Klotür geritzt, im Bunker, wo Žeňa und ich uns die Nächte um die Ohren gehauen haben, als es dort anfangs so super gut lief. Žeňa fand es klasse.
Elvis ist tot.
Der Bunker ist tot.
Unsere damalige Band Drobný za bůra – Für eine Hand voll Wechselgeld – ist auch tot, und mein Bruder hat nie wieder eine andere Band gegründet. Dafür hat er eine Familie und eine Tapezierfirma gegründet.
Žeňa lebt.
Und bald nicht mehr allein.
Wahrscheinlich will ich deswegen weg. Weil ich Schiss davor habe.
Ich kippe den Kaffee aus, das Telefon klingelt wieder. Ich spüre die Hitze aufsteigen. Wenn ich nervös bin, höre ich besser und kriege davon manchmal Nasenbluten.
Das Blut tropft ins Waschbecken. Hinterm Fenster brummt die Rangierlok, sie schiebt die Postwaggons von einem Bahnhof zum anderen. Den Kopf nach hinten gebeugt, kucke ich nach oben, hinter den Boiler, und spüre, wie sich meine Kehle mit dem bitteren und klebrigen Saft füllt. Der Schimmelfleck an der Decke sieht aus wie Australien.
Ein monotones Dröhnen: Der Boiler hält die Zeit an.
Ich schließe ab und werfe den Schlüssel in den Briefkasten. Dreißig Sekunden später breche ich ihn mit meinem Taschenmesser wieder auf, hole den Schlüssel, öffne die Wohnung und prüfe, ob kein Wasser im Badezimmer läuft.
Es war abgedreht. Die Gasleitung auch. Das Telefon protestierte nicht mehr. Und das Radio schwieg. Der Ostrava-Express unter meinem Fenster legte an Geschwindigkeit zu. Neun, ach was, zehn Waggons! Ich knallte die Tür zu. Verließ das Haus und rannte unter den ausgestreckten Brückenpfeilern die Příběnická hinunter, bis zum Tunnel, der Straßenbahnen verschlingt und Wolken von Staub ausspuckt.
Hinter dem Tunnel liegt ein Park, neben dem Park ein Bahnhof. Von diesem Bahnhof aus fahren Züge in eine Stadt, aus der einst mein Onkel, der kein richtiger Onkel war, gekommen ist, und sein Auto, das kein richtiges Auto war, vor unserem Haus stehen ließ, um über die Mauer der westdeutschen Botschaft zu klettern, wo die Flüchtlinge weder Cola noch Dead-Kennedys-T-Shirts oder echte Levis verteilt bekamen, sondern nur Tee, Kaffee und belegte Brote.
Ich ging schnell. Dicht an der dunklen Tunnelwand entlang.
PANCHO DIRK
Pancho Dirk kenne ich seit zwei Monaten. Katrin seit einem. Pancho Dirk hat sie als Erster kennen gelernt. Ich war dabei, als er sie anbaggerte. Das hätte mich beinah das Leben gekostet. Und ich war dabei, als er versuchte, sie ins Bett zu kriegen. Das hätte ihn beinah die Ehre gekostet. Aber für Leute wie Pancho Dirk bedeutet ein Laufpass noch lange nicht das Aus.
Wir sind uns in der U-Bahn begegnet, wie man hier die Metro nennt. In der U5 sind wir uns begegnet, am Bahnhof Weberwiese. Beide hatten wir eine Gitarre dabei, ich Zigaretten, er das Feuerzeug.
Er fragte, wo ich her sei, und ich war der erste Tscheche, den er je im Leben gesehen hatte, allerdings stellte sich bald heraus, dass er damit das Leben nach 89 meinte, denn vorher war er öfters mit seinen Eltern am Mácha-See und in der Hohen Tatra gewesen. Bestimmt die Sorte ostdeutsche Touris, die zum Lungenbraten mit der obligaten Sahnesauce Pommes und zum Schnitzel Knödel mit Rotkohl bestellt haben, noch heute kriegen die Kellner davon einen Rappel, genauso wie die tschechoslowakischen Touris einen Rappel kriegten, als sie auf Rügen zwei Stunden lang vor einem Wirtshaus anstehen mussten, bloß um Schnitzel mit brauner Sauce und ein kleines Bier mit grünem Sirup vorgesetzt zu bekommen. Mein Vater sagte, daran könne man sehen, wie unterschiedlich doch unsere beiden Kulturen sind, die tschechische und die ostdeutsche.
Pancho Dirk sagt, jetzt habe man kein Geld mehr fürs Reisen, und wenn, dann würde er lieber ans Meer oder nach Amsterdam fahren, der Osten würde immer mehr verosten. Er fragt mich, was es denn in Tschechien Tolles gebe, außer Prag natürlich, der goldenen Stadt an der Moldau, und da klingt er plötzlich wie ein Neckermann-Reiseleiter.
Prag ist nicht golden. Prag ist tot. Zumindest für mich. Ich frage ihn, was es in Berlin Tolles gebe. Uns beiden fällt nichts Nennenswertes ein. Nichts, was toller wäre als das übliche Zeug – Bier, alte Brücken oder junge Frauen. Höchstens, dass in Prag die Metrostationen alle wie Krematorien wirken, während die Berliner U-Bahnhöfe dem Auge mehr Abwechslung bieten: Der eine sieht aus wie Neuschwanstein, ein anderer wie ein verlassener Bunker, ein dritter erinnert an ein gekacheltes Badezimmer. Damit meine ich den Bahnhof Weberwiese.
Pancho Dirk fragt, was für Pläne ich habe, wo ich wohne und so weiter, worauf ich sage, dass ich vor einer Woche gekommen bin, mir in Friedrichshain ein Hostelzimmer mit drei Amerikanern teile, die kein Bier trinken, sondern nur Hasch rauchen und sich über dem Stadtplan streiten, wo genau der West- und wo der Ostsektor gewesen ist und wie lange man wohl brauchen würde, um die Berliner Mauer zu überwinden, wenn die noch stünde. Vor lauter Kiffen haben sie von Berlin noch nichts gesehen, mit Ausnahme des Stadtplans.
Und dann erkläre ich Pancho, dass mein Plan darin besteht, keinen Plan zu haben, und er bietet mir an, bei ihm zu übernachten, und am nächsten Tag bietet er mir an, einfach dazubleiben, kosten würde es 280 im Monat, bloß im Winter müsse ich für die Kohle was drauflegen, aber der Winter sei im Moment noch weit weg, obwohl, wie weit entfernt er jetzt auch immer sei, so lange würde er dann dauern, darauf sollte ich mich gefasst machen, doch jetzt sei erst September, ich könne das Zimmer also inklusive Couch, Schrank, Tisch und Stuhl ruhig nehmen.
Darauf ließ ich mich ein.
Eine Woche später bot er mir an, ihm ab und zu bei Umzügen zu helfen, gerade sei ihnen einer ausgefallen, auf diese Weise könne man in zehn Tagen Geld für einen Monat bequemes Leben verdienen, in der U-Bahn spiele er nur, um in Form zu bleiben. Und dann beschlossen wir, eine Band zu gründen, da wir ohnehin die gleichen Idole verehrten: Bowie, die Ramones oder Iggy Pop. Pancho hatte sogar einen geheimen Probenraum.
Er schlug auch gleich vor, die Band U-BAHN zu nennen, weil wir uns da kennen gelernt hatten. Und weil der Name alles beinhaltet, was für eine Punk-Rock-Band von Bedeutung ist, also Schwärze, Krach und Tempo. Auch darauf ließ ich mich ein.
Jetzt steht er neben mir und kocht Kaffee. «Ein echter Kaffee muss im Herzen Trommel schlagen, wie gute Akkorde auch.» Pancho füllt die Espressokanne bis zum Rand, schraubt den oberen Teil auf, macht den Herd an und wartet, lässig an den Herd gelehnt.
Pancho Dirk wartet ständig. Auf eine Frau, auf einen Job, auf eine Band, mit der er endlich den Durchbruch schafft. Er ist ein Jahr jünger als ich. Wurde in Thüringen geboren, in Mühlhausen, hat das Abi und steht auf Frauen.
Warum er sich Pancho Dirk nennt, wenn er Dirk Müller heißt? Weil er ein großer Spieler ist.
Eine Freundin von ihm erzählte mir später, er habe als Helfer für das Rote Kreuz ein halbes Jahr in Macondo verbracht. Sie erzählte es voller Bewunderung.
«Verstehste? Ein ganzes halbes Jahr hat er dort Mullbinden zugeschnitten, Mücken bekämpft und Vitamine an Indianer verteilt. So was würde ich nicht bringen», sagte Ulrike und tauchte ihre Nase ins Bier, die Augen auf Pancho Dirk geheftet, der sie gar nicht wahrnahm.
Bierschaum rann ihr über das Kinn.
«So was würde ich nicht bringen», wiederholte sie.
Ulrike war nicht auf den Kopf gefallen. Über Macondo hatte sie lang und breit nachgedacht. Auf der Karte Südamerikas habe es noch niemand entdeckt.
Ich sagte ihr, das habe noch gar nichts zu bedeuten. Wenn die Geschichte es verlangt, müssen selbst Karten manchmal lügen. Man nehme nur all diese Stadtpläne aus der DDR-Zeit. Anstelle Westberlins zeigten die doch nur einen weißen Fleck. Als ob inmitten der Stadt ein riesiger Krater oder See vor sich hin starren würde. Hinter der Mauer war etwas gewesen, das nicht existieren durfte. Und trotzdem war zu hören und zu spüren, wie es atmete, seufzte und schrie, wie es sich wand und spannte, wie es stank und duftete.
Wie gesagt, Pancho Dirk steht auf Frauen. Seine Leidenschaft gilt zwar der Musik, aber sein größtes Hobby ist Ficken. Punk-Rock dient als Mittel zum Zweck. Wie ein neuzeitlicher Minnesänger greift Pancho Dirk zu seiner E-Gitarre, um das Frauenherz bloßzulegen und zu stoßen und zu stoßen.
Keiner würde es je zugeben, doch hinter der Gründung jeder bedeutenden Band stand stets das Ficken. Nur deswegen schwitzten sich die Stones oder die Beatles auf der Bühne halb tot – um sich einen halbwegs melodischen Song abzuringen, den sie dann als Köder hinwarfen … Nur mit wahrer Hingabe kommt man ans Ziel.
Wer, wie ich immer, behauptet, er mache das bloß aus Spaß, lügt. Auch ich habe nur das eine im Sinn. Aber es zuzugeben fällt nicht leicht.
Die Eroberung, Erprobung, Unterwerfung und Entsorgung einer Frau teilte Pancho Dirk in drei Phasen ein.
Die erste nannte er Kontaktaufnahme.
Diese Phase umfasste alles vom ersten Blickwechsel über das Flirten inklusive Tuchfühlung bis zum Angebot, den Club oder die Bar zu verlassen, um hinter der Tür von Panchos Wohnung in der Zelterstraße 6 zu verschwinden. Im gleichen Eingang soll mal Nina Hagen gewohnt haben, was Pancho Dirk als Wink des Schicksals auslegt. Damit allein hat er sogar die eine oder andere Frau ködern können.
Die zweite Phase nannte er Montage.
Sie schloss den Akt an sich ein. Da es sich um die wichtigste Etappe des ganzen Spiels handelte, wurde sie in mehrere Schritte unterteilt. Das alles hatte sich Pancho Dirk in ein Heft notiert, das er unter seinem Bett versteckte.
Die letzte Phase nannte er Demontage.
War das Material ermüdet, ließ die Spannkraft nach oder erwies sich die Montage als reine Routine, wurde die Frau einfach weggeschickt, nachdem man ihr eingeschärft hatte, bloß nicht zurückzukommen. War diese Phase aber spannend, ja innovativ verlaufen, zeigte sich Pancho Dirk durchaus bereit, die Montage fortzusetzen: Er gab der Frau seine Telefonnummer.
Im Idealfall wurde die Frau auf Stand-by gebracht, so, wie man abends die Glotze ausmacht, um sie am nächsten Morgen beim Frühstück einfach anschalten zu können.
«Und das ist die größte Schinderei», verriet mir Pancho Dirk.
So cool, wie Pancho Dirk tut, ist er nicht immer.
Einmal saßen wir in der U-Bahn, und er musste plötzlich, ganz dringend. Kein Wunder, denn davor im Café M, als wir unsere Band-Philosophie diskutierten und Frauen ins Visier nahmen, die nach uns, vor allem aber nach ihm kuckten, hatten wir mehr als ein Bier getrunken.
Und nun steckten wir ohne Strom in der U2 fest, irgendwo zwischen Alex und Rosa-Luxemburg-Platz.
Zehn Minuten.
«Wir bitten noch um etwas Geduld», krächzte der Lautsprecher.
Pancho Dirk schlug die Beine übereinander. Ich konnte sehen, dass er litt. Neben mir lag eine aufgeschlagene Boulevardzeitung – in Berlin wie in Prag die beliebteste U-Bahn-Literatur.
Um Pancho auf andere Gedanken zu bringen, begann ich daraus vorzulesen. Doch die Meldung, der Herr der Erdkugel sei beim Fußballkucken beinah an einer Brezel erstickt, zog nicht. Ebenso wenig die Information, die Rentnerin M. D. habe am Parkplatz vor dem Steglitzer Supermarkt beobachtet, wie ein bärtiger Terrorist einen Zentner Kartoffeln in seinen Kofferraum schaufelte. Zum Lachen brachte ihn nicht einmal, dass die Berliner Polizei vierundvierzig Polizeipferde der Schlachtbank opfern musste, weil der Senat komplett pleite war. Nicht einmal über die für den Transport zum Schlachthof notwendigen Mittel verfügte er.
Achtzehn Minuten.
«Wir bemühen uns, die Störung so rasch wie möglich zu beheben.»
Pancho Dirk lief rot an. Nervös kaute er auf seinen Lippen herum.
Die Meldung, aufgrund des finanziellen Engpasses müsse der Senat auch das Polizeiorchester auflösen, welches den Ruhm der Berliner Polizei bis nach Petersburg, Madrid und zum Kmoch-Festival in Kolín verbreitet hatte, brachte Pancho Dirk auch keine Linderung. Der Held von Macondo konnte diesmal von Glück reden, dass hier keine Frauen Maulaffen feilhielten.
Mit jedem Augenblick schien er einer Ohnmacht näher zu sein.
Fünfundzwanzig Minuten.
«Leider konnte die Störung immer noch nicht behoben werden. Bitte bewahren Sie Ruhe.»
Pancho Dirk stand auf und klopfte an die Tür zum Zugführerraum. Er flüsterte dem Mann dahinter etwas ins Ohr, der aber schüttelte nur den Kopf.
«Nein?», rief Pancho Dirk und lief noch röter an.
«Nicht mal ’ne Dose, ’ne stinknormale Cola-Dose? Dann lassen Sie mich in den Tunnel raus. Ich kann nicht mehr!»«Auf keinen Fall. Unter normalen Umständen ist das strengstens untersagt. Aber … wenn du bei der Stromleitung aufpasst. So weit wie möglich vom Zug!» Der Fahrer wurde lockerer, als er sah, dass wir im ersten Wagen die Einzigen waren.
Der Seitentür entwich zischend die Luft. Pancho Dirk auch. Er beugte sich nach hinten, fummelte am Hosenlatz, irgendwie ging das nicht, verdammte Knöpfe, der Zug hupte und setzte sich in Bewegung. Die Tür fiel zu.
«Scheiße», schrie er. Das brachte Linderung.
Pancho Dirk fragte mich: «Was will der amerikanische Präsident mit den Pferden?» Dann fuhr er nach Hause, um sich umzuziehen.
Ich holte mir einen Döner.
Eine halbe Stunde später war Pancho Dirk wieder da. Weite Jeans, schwarzer Pulli, Lederjacke. Er warf den Seitenscheitel zurück, ganz der Coole.
Die Frau, die in der Glastür des Clubs der Polnischen Versager stand, hatte ihn bestimmt sofort bemerkt, mich jedenfalls nahm sie kein bisschen wahr. Dünn und lang stand sie da, leicht gekrümmt, sie trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Stern und einen engen Rock. Über ihrem schmalen Gesicht leuchtete das helle Haar wie eine Krone. Meine Großmutter würde sagen: eine Naschkatze und dass solche Frauen ja bekanntlich nicht viel taugten. Warum aber Männer wegen solcher Frauen andere Frauen verlassen, konnte meine Großmutter nicht erklären, und ich hätte mich auch nie getraut nachzufragen. Überhaupt traue ich mich meistens nicht zu fragen.
Pancho Dirk versuchte so zu kucken, als kucke er überhaupt nicht, aber ich kenne ihn schon viel zu gut. Seine Augen glänzten.
Wir bestellten Wodka. In den Lautsprechern pulsierten Loops der polnischen Band Im Angesicht Der Zivilisation Stehen Wir. Wir standen im Angesicht einer niedrigen Bar, über die sich gedämpftes blaues Licht ergoss. Auf dem Kühlschrank stapelten sich Flaschen kreuz und quer. Das Bier war wahrscheinlich warm. Auf dem Herd köchelte Bigos vor sich hin, der ganze Raum roch etwas säuerlich, ähnlich wie der Schimmel, den ich in meinem Žižkover Badezimmer zurückgelassen hatte. Wir bestellten noch zwei Wodka.
Pancho Dirk tanzte ab. Ich schloss die Augen und dachte an jenen Sommer, als ich unterwegs nach Estland an den Masurischen Seen Halt gemacht hatte, und an die stämmige Polin, mit der ich die ganze Nacht bis zum Morgengrauen durchgesoffen hatte.
Wir lagen auf dem Rücken, die Nasenspitzen in den Himmel gebohrt. Während sie sich mit Dunkelheit füllten, redete die Frau, Marina hieß sie, unentwegt.
«In Polen gibt es zwei Sorten Mann. Die eine kommt mit einer Flasche Wodka zur Welt, das ganze Leben lang säuft sie und raucht, um dann an Lungenkrebs zu krepieren wie mein Opa. Die andere wird mit einer Kippe im Maul geboren und geht an ihrer Säuferleber zugrunde. So wird mein Vater enden.»
Allen hier Anwesenden müsste das bekannt vorkommen. Vielleicht sogar allzu bekannt.
Die Musik floss von Ohr zu Ohr, wand sich durchs Hirn und füllte die Seele mit Melancholie. Ich warf den Kopf zurück und kippte den Wodka runter.
Als ich die Augen wieder aufmachte, stand eine verhärmte Vierzigjährige in abgerissenem Trägerkleid und weißem Pelzmantel vor mir. Sie sagte keinen Ton. Abrupt schob sie mir eine Nummer der Obdachlosenzeitschrift Die Stütze vors Gesicht. Ich lehnte höflich ab.
«Kauf’s doch, du Arsch. Oder du weißt schon, was Bautzen ist?», schrie mich ein untersetzter Typ an, zirka Ende dreißig, mit kurzen Locken und auffallend kleinen Augen. So klein, dass sie kaum zu erkennen waren.
«Du weißt, was Bautzen ist, Blödmann? In der Schule ihr habt das nicht gelernt! Kannst darüber dort was lesen! Aber du weißt immer Bescheid, was?»
Alle wussten Bescheid, nur ich nicht. Das war Igor. Und Igor liebte Terror.
Und Bautzen?
Ich suchte die Festplatte in meinem Kopf ab, Verzeichnis Geographie und Geschichte. Es ging, wenn auch etwas schleppend, weil mein Hirn immer tiefer im Zubrowka versank.
Bautzen? Bautzen … Bautzen!
Da ist es also:
I. Stadt in der Lausitz, die einst zu den Ländern der Böhmischen Krone gehörte. Heute das östliche Ende von Euroland.
II. Frühere Bezeichnung: Budissin; tschechisch: Budyšín.
III. Sehenswürdigkeiten: die schöne Burg, mit einem Turm, der jederzeit ins Tal herabzustürzen droht. Einmal waren wir mit unserem Onkel dort. Er hat uns Bratwurst ohne alles gekauft, weil am Stand das Brot ausgegangen war.
IV. Wichtiger Eisenbahnknotenpunkt.
V. Nationale Minderheiten: Lausitzer Sorben; manche von ihnen sprechen noch Sorbisch und verfassen sorbische Bücher.
VI. Einst das berüchtigtste politische Gefängnis der DDR, wohl schlimmer als Valdice und ekliger als Mírov.
Keiner wusste, warum Igor immer wieder von Bautzen anfing. Nicht, dass man sich nicht getraut hätte, ihn zu fragen, aber es hat keinen interessiert.
Igor war sensibel. Igor war ein russischer Jude. Igor kam aus Moskau, wo er sich als Zeitungsschreiber versucht hatte. Igor mochte die Deutschen nicht, sie hatten die Hälfte seiner Vorfahren hingemetzelt. Die Russen mochte er auch nicht, unter Stalin hatten sie die andere Hälfte totgeschossen. Vor allem aber mochte Igor die Westdeutschen nicht. Diese digitalen Besserwisser, die sich das Leben hinterm Stacheldraht in etwa so gut vorstellen konnten wie wir das Leben auf dem Mars. Diese Großkotze, nach deren Pfeife hier alle tanzen mussten, auch er als Emigrant, der von der Stütze lebte.
Anfang der Neunziger hatte Igor seinen Koffer samt Schreibmaschine gepackt und war in den Zug gestiegen, um sich in Marzahn niederzulassen. Vielleicht gefiel ihm der Name – erinnerte ihn an Marzipan. Wurzeln hat Igor allerdings nicht geschlagen. Das Schreiben ging ihm nicht von der Hand, auf eine richtige Arbeit war er nicht heiß, und sein schleppender slawischer Akzent wehte ihn von ganz allein weit in den Osten zurück. Das war Igor bewusst, und so redete er nicht viel. Nur zu sich selbst oder ein paar Freunden.
Meistens schwieg er, ging häufig an die Spree und sah, wie sich sein Gesicht in der Wolga widerspiegelte. Er aß deutsche Soljanka mit zerschnippelten Würstchen und roch russischen Borschtsch. Er lebte hier und auch wieder nicht. Aber zurück wollte er um keinen Preis. Igor wurde immer bitterer. Das alles erklärte mir später Pancho Dirk.
Wenn Igor getrunken hatte, riss er das Maul auf und ließ seine gestaute Wut ungefragt in die Umgebung schwappen.
Igor trank häufig. Dann floss ihm der Wodka nicht in den Magen oder in die Leber, sondern stieg ihm in die Wangen. Derart aufgedunsen waren sie, dass seine Augen darin fast spurlos versanken.
«Hey du! Du weißt, was Bautzen? Woher kommst du, Lümmel? Aus München!?! Wer denkst du, du bist, du Bayerisch-Affe?», schrie Igor mich an, und all die polnischen und nicht polnischen Versager, Schiffbrüchigen und Loser, die aus der ganzen Welt in diesen Club geströmt waren, sie alle drehten sich um und warteten grinsend auf die Theatervorführung, in der ich neben Igor die Hauptrolle spielte. Pancho Dirk tanzte auf der anderen Seite, eine Flasche Bier in der Hand, und überließ mich meinem Schicksal. Beziehungsweise Igors Schicksal. Die dünne Frau mit dem roten Stern lachte ihn an, und ab und zu warf sie mir einen Blick zu. Sie schien ebenfalls zu warten. Pancho Dirk flüsterte ihr etwas ins Ohr.
«Ich? Ich, na ja, ich komme aus Prag, aus Žižkov», stammelte ich, als Igor mich an der Gurgel packte.
Igor hielt inne.
«Gutt. Gutt, du Maladets. Dann du weißt, was Bautzen. Du weißt Bescheid über furchtbaren Kommunismus. Nicht wie der Pack hier!», schrie er. Er ließ mich los und patschte mir mit seiner verschwitzten Hand in den Nacken.
«Davaj vodku popjom, jetzt trinken wir. Mein Nachbar immer sagte, er hat die Tschechoslowakei zweimal gerettet. Einmal von die germanski Faschisti, 1945, und einmal von die amerikanski Kontrarevollutioneri, das 1968. Das erste Mal hat er viel Armbanduhr mitgebracht, das zweite Mal Jeans, und immer schöne Erinnerung an Frauen, sie legten sich von alleine unter ihn, mein Nachbar war schöner Mann, russki Marlon Brando, vielleicht er hat Haufen Kinder bei euch, weil, wenn mein Nachbar geschossen, dann hat er auch getroffen. Er immer sagte, die Slawen müssen zusammenhalten, das ist unsere einzig Chance in der Welt, unser Schicksal und Rettung vor die germanski und amerikanski Hydra. Ich damals schmunzelte, aber heute glaube ich, er war Recht. Ach damals … eine Armbanduhr hat er mir geschenkt. Aber sonst Nichtsnutz», sagte Igor, dann zog er sich wie eine Spinne in ihr Versteck in seinen Sessel in der Ecke zurück.
«Und du lass ihn. Nichtsnutz!», schrie er Pancho Dirk zu, der sich in der gleichen Ecke mit der wunderschönen Frau hin und her wiegte. Sie hing an seinem Hals und streifte mich ab und zu mit Blicken.
Wir gingen zur U-Bahn. Nächster Zug erst in zwanzig Minuten! Also machten wir uns auf einer Bank breit, sogen die dicke Luft ein und hörten dem Surren der Ventilation zu. Auf der Anzeigentafel blinkte orange eine Entschuldigung. Pancho Dirk rauchte. Abwechselnd lutschte er an seiner Bierdose und umarmte den roten Stern.
Er war betrunken.
Sie auch.
Und ich erst.
Er erzählte ihr, dass er in Macondo beinah an Schlaflosigkeit erkrankt wäre, eine Erfahrung, die ihr besser erspart bleiben sollte. Und dass der amerikanische Präsident vierhundert Pferde erschießen lassen wollte, weil der Krieg immer teurer wird und der Regierung das Geld ausgeht. Den Trauerakt würde das Berliner Polizeiorchester begleiten.
Der rote Stern blickte ins Leere, als wisse er weder über das hier Bescheid noch darüber, was passieren würde, wenn später die Tür von Panchos Zimmer hinter ihm zufiele.
Aber ich wusste inzwischen, dass der rote Stern Katrin hieß und nichts und niemanden liebte außer Island.
Welche Phase Pancho Dirk mit Katrin erreichte, weiß ich nicht genau. Aber weit konnten sie nicht vorgedrungen sein.
Sie verschwanden hinter der Tür. Dann muss Katrin wohl unter das Bett gegriffen und das Heft herausgeholt haben. Sie begann darin zu lesen. Laut. Und dann begann sie, noch lauter zu lachen: «Pancho, du bist vielleicht ’n Blödmann! So was hab ich noch nie erlebt, was du da zusammenschreibst.»
Theatralisch getragen las sie vor: Lucy, 28. Im Bett kein besonderes Engagement, weder selbständig noch spontan. Erfahrungshorizont gleich null, an mir gemessen sowieso. Kein Orgasmus, dafür eine Menge Gefühlsduselei …
«Pancho, was bist du für ’n Idiot …», lachte Katrin auf der anderen Seite der Wand. «Ja, Männer sind eben doch nur Nähmaschinen.»
Ich schwebte schon auf halbem Weg zum Traumhimmel, aber Katrins Lachen zog mich wieder herunter. Ich ging in die Küche, um eine zu rauchen, wegzuhören war unmöglich.
«An dir gemessen sowieso, ja? Na, das möchte ich mal sehen, bloß nicht heute, da müsste ich mich wegschmeißen vor Lachen, morgen auch nicht, da müsste ich immer noch lachen … Meinst du in echt, dass ich mit dir ins Bett wollte? Ja … wollt ich.»
Das brachte Pancho Dirk aus der Fassung. Wortlos zog er seine Jacke an und ging zum Nachtbus, der ihn in die Stadt bringen sollte. Vielleicht zu einer anderen Tür, vielleicht zu einer anderen Frau, vielleicht nur auf ein Bier.
Katrin kam in die Küche, sah mich an, und vor lauter Verlegenheit fing ich an zu lachen. Da wurde sie ganz steif. Zog eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie an und musterte kritisch unsere vier Küchenwände.
Sie lehnte sich an den Kühlschrank: «’ne ziemlich üble Bude, die ihr da habt. Immerhin ist das Klo geputzt, sonst ist so eine Männer-WG doch ein einziger Unfallbereich. Was die Hygiene betrifft, meine ich. Kein Bock auf irgendwelche Filzläuse. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen, dieser Pancho und du?»
«Es gibt Dinge, die kann man sich nicht aussuchen», sagte ich und erzählte ihr von unserer schicksalhaften Begegnung am Bahnhof Weberwiese.
«Ach. Wie romantisch.» Katrin rümpfte spöttisch die Nase. «Zwei Loser trollen sich so lange durch die Welt, bis sie übereinander stolpern. Und das ausgerechnet hier. Kommst du wirklich aus Prag?»
«Ja. Schon mal da gewesen?»
«Einmal, mit meinen Eltern … aber ich weiß nur noch, dass es Sommer war, wir standen aufm großen Platz mit so ’ner riesigen Ritterstatue, Papa erzählte was von sowjetischen Soldaten, die dort mit Maschinengewehren herumgefeuert hätten, bis ich Angst kriegte und das Eis runterfallen ließ. Mama wollte mir kein neues kaufen, weil dort am Stand ’ne schrecklich lange Schlange war. Ich muss so ungefähr sieben gewesen sein, das Eis war ganz anders als bei uns, Wassereis, lila mit Heidelbeergeschmack. Den Geschmack hab ich immer noch auf der Zunge. Das ist Prag für mich – Heidelbeereis und ein komisches Gefühl von Angst. Und du, bist du früher schon mal in Berlin gewesen?»
«Ja, öfters. Das erste Mal war ich auch nicht viel älter als du, wir sind zu meinem Onkel gefahren, der in Köpenick wohnte. Und dann sind wir ins Zentrum, mit der S-Bahn zum Alex …»
«Echt? Und woran erinnerst du dich noch?»
An den riesigen Turm, sage ich, von oben habe die Stadt ausgesehen wie aus einem Baukasten. Und an den Palast der Republik, wo wir ein Eis gegessen hatten; den brachte uns der Onkel später als Geschenk mit, so eine Plastikschachtel, im Sandkasten haben wir daraus eine Piratenstation gebaut und dann mit einer Schleuder zerschossen.