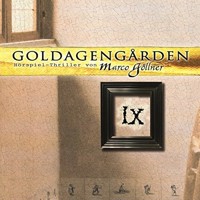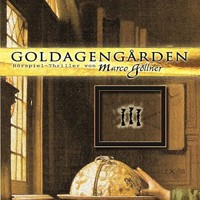9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Oma hat mal gesagt: «Kannstes halt nich allen recht machen. Aber dafür bisse auch nich da!» Der Bestseller-Autor Marco Göllner wuchs bei Oma Martha auf, einem echten Original der Generation Kittelschürze. In einem Haushalt, in dem sich alle auf eines verlassen konnten: Oma Martha hatte alles und jeden im Griff. An sie erinnern Göllners wunderbar lakonische, heitere Episoden aus jenen Jahren tief in der deutschen Provinz. Marco Göllner nimmt uns in diesem Buch mit in seine Kindheit und erzählt von einer Frau, die ihr Leben lang nach 4711 roch, die weltbesten Püfferken (Kartoffelpuffer) machte und deren Kittelschürze jeden Superhelden-Umhang alt aussehen ließ: «Perlt alles ab.» «Ein Blitz! Oma zählte erneut: ‹Einnzwanzich, zweinzwanzich, dreinzwanzich, viernzwanzich ...› Rommsti-wommsti-bommsti!!! Und noch bevor die Scheibe im Fensterrahmen aufgehört hatte zu zittern, wiederholte Oma leise: ‹Zieht langsam wieder wech.› Zwischen Omas Füßen am Fuße der Treppe stand eine Plastiktüte. Sie stand nicht von allein, sondern deshalb, weil sich in ihr ein Aktenordner und mehrere Umschläge mit papiernem Inhalt befanden. Das war das, was Oma auf jeden Fall im Fall des Falles aus dem Haus retten wollte. Es war die ‹Jewittatüte› – darin die wichtigsten Unterlagen wie Stammbuch, Sparbuch, Gesangbuch und Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, Seepferdchenurkunde und andere brisante Zettel, auf denen stand, ‹was wem jehöan tut, also mir›, so Oma.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Marco Göllner
Der Junge hat doch nichts davongetragen?
Über dieses Buch
SPIEGEL-Bestseller-Autor Marco Göllner wuchs bei Oma Martha auf, einem echten Original der Generation Kittelschürze. In einem Haushalt, in dem sich alle auf eines verlassen konnten: Oma Martha hatte alles und jeden im Griff. An sie erinnern Göllners wunderbar lakonische, heitere Episoden aus jenen Jahren tief in der deutschen Provinz. Marco Göllner nimmt uns in diesem Buch mit in seine Kindheit und erzählt von einer Frau, die ihr Leben lang nach 4711 roch, die weltbesten Püfferken (Kartoffelpuffer) machte und deren Kittelschürze jeden Superhelden-Umhang alt aussehen ließ: «Perlt alles ab.»
Vita
Marco Göllner ist Lipper und fünf Jahre alt. Beides bis heute. Geboren wurde er 1971 im bekloppten Herford (Preußen!), weil sein Vater sich verfahren hatte. Großgeworden allerdings ist er in Bad Salzuflen, Ortsteil Aspe, (Lippe!), wo er die ersten Lebensjahre bei seiner Oma Martha verbrachte. Heute lebt er im Teutoburger Wald und in Berlin und ist seit Jahren Superheld im Sparten-Medium Hörspiel ― als Regisseur und Autor. Der strammen Masse wurden er und seine Stimme durch die Intros von «Fest & Flauschig» bekannt, dem Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Umschlagabbildung privat
Umschlaggestaltung zero-media.net, München
Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
ISBN 978-3-644-00294-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Mama und Papa
Die mich wollten
und dann hatten
und noch haben,
und das hammse jetzt davon!
Amus Göll Na
Als ich ankam, kam ich in ein Haus voller schwarz gekleideter Menschen. Und nahm ungewollterweise einen Platz ein, welcher kurz zuvor unerwarteterweise frei geworden war. Doch das wusste ich damals natürlich nicht.
In meiner Erinnerung ist meine gesamte Kindheit ein langer, heißer Sommertag. Mit regelmäßig Weihnachten. Und ich lang und dünn, also schlaksig, und somit absolut unbeschwert. Und glücklich.
Was sicherlich daran lag, dass ich damals noch nicht alles verstand. Wann tut man das eigentlich? Kommt das noch?
Und sicherlich lag es auch daran, dass von Erwachsenenseite vieles von mir ferngehalten wurde. Was rückblickend sehr vorausschauend war. Dafür bin ich sehr dankbar.
Die Erinnerung an meine Kindheit ist warm und heiß. Wie einer dieser Windstöße, die einem ab und an satt ins Gesicht drücken, wenn man am Ende des Sommers durch reife Kornfelder rennt. Ich blicke mich um und sehe meine Freunde und meine Familie im Licht eines langen Sonnenuntergangs, die Konturen zerfranst durch goldenen Schein, ein Flirren in der Luft, dampfende Schatten, einzelne Haare streben aus Frisuren, lösen sich auf in weißglühendem Glanz.
Die Erinnerung an meine Kindheit fühlt sich so an, wie die Fotografien aus dieser Zeit aussehen. Wohlig und satt und prall und fett und schön. Und an den richtigen und wichtigen Stellen scharf. Ein Großwerden in Kodachrome.
Ich bin fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre alt und trage Hosen mit Schlag und eng anliegende T-Shirts und habe Sommersprossen. Im Gesicht und an den Armen. In rund und nicht so rund und klein und nicht so klein. Sommersprossen! Selbst an Weihnachten.
Es ist das Ende der siebziger Jahre. Die jungen Frauen tragen kurze Röcke an langen Beinen, hohe Schuhe unter tiefen Ausschnitten und haben Haare unter den Armen. Die jungen Männer haben eigentlich nur Haare. Lang und überall.
Ich lebe in Aspe. In Bad Salzuflen. In Lippe. Und mehr kenne ich nicht. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, dass es sich «nicht gehört», mit sechzehn Jahren ein Kind zu bekommen. Hätte ich es gewusst, hätte ich gefragt, warum man denn mit sechzehn Jahren ein Kind bekommen kann, wenn sich das doch «nicht gehört».
Ich weiß nicht, dass Mama in der Berufsschule ausgelacht und verspottet wurde, weil sie unter und in diesen und anderen Umständen dort auflaufen musste.
Ich weiß nicht, dass der Vater von Papa zu ihm gesagt hat, er müsse das Mädchen nicht heiraten, wenn er nicht wolle. Nicht mit siebzehn Jahren. Er, Opa, werde für alles aufkommen.
Ich weiß nicht, dass die gesamte Familie, auch Oma, eine vehemente Meinung zu dieser Schwangerschaft hatte (und das ist ein Euphemismus) und dass genau diese Meinung nicht die Meinung meiner Eltern war, sodass sie kämpfen mussten.
Und ich weiß auch nicht, dass die Mutter von Mama, die, in zweiter Ehe verheiratet, über eine Stunde entfernt wohnte, sich sehr aufregte, als sie von der Schwangerschaft erfuhr. Und kurz darauf starb. Am 3. August 1971. Siebenundsiebzig Tage vor meiner Geburt. Sie wurde nur 35 Jahre alt.
Ihr Gehen und mein Kommen wurden von dem einen und dem anderen in einen natürlichen Zusammenhang gebracht. Ich wusste davon nichts. Viele Jahrzehnte lang nicht. Und war deshalb unbeschwert.
Als ich ankam, hieß ich Marco Teiwes. Das ist der Mädchenname von Mama. Meine Eltern heirateten ein halbes Jahr nach meiner Geburt, und Mama und ich nahmen den Nachnamen von Papa an. Die beiden bekamen nach mir noch zwei weitere Kinder, haben mittlerweile fünf Enkel und sind bis heute zusammen. Nunmehr bald fünfzig Jahre.
Als ich ankam, kam ich in ein Haus voller schwarz gekleideter, trauriger Menschen. Und als sie mich sahen, fingen sie an zu lächeln. Weil ich doch so süß war.
Jewittatüte
Oma saß in geblümtem Nachthemd und elfenbeinfarbener Strickjacke mit dem Popo auf der zweiten Stufe der Treppe nach oben. Ihre Füße steckten in hellbraun-dunkelbraun karierten Hausschuhen und standen noch immer im Erdgeschoss. Sie sah durch das nahe Fenster sorgenvoll hinauf in den eben noch hell erleuchteten, jetzt aber wieder schwarzen Himmel und zählte: «Einnzwanzich, zweinzwanzich, dreinzwanzich …»
Dann gab es einen mächtigen Donner: Rommsti-Wommsti-Bommsti!!!
Die Fensterscheibe zitterte im Rahmen, und wir alle mit ihr. Das Glas wegen der Druckwelle, der irgendwo in der Ferne verdrängten Luft, wir anderen wegen Erschreckung. Dann war absolute Stille. Zumindest im Treppenhaus.
Draußen stürzte derweil weiter eifrig Wasser gen Boden, und Oma sagte leise: «Zieht langsam wieder wech.»
Niemand erwiderte etwas. Das ganze Haus saß so da wie Oma und schaute angstvoll durchs Fenster hinaus in die stockdunkle Nacht.
Ich hockte zwei Stufen über und somit hinter ihr. Biggi und Banda, meine rechte und meine linke Hand, die sich dann und wann miteinander oder auch mit mir unterhielten, waren verstummt und leichenblass und hatten sich vor Nervosität rechts und links in Omas Schultern verbissen. Welche die rechte und welche die linke Schulter war, wusste ich nicht. Und es war mir in jenem Moment auch völlig egal.
Rückblickend muss ich anmerken, dass es allgemein auch absolut völlig egal ist. Man kann siebenundvierzig Jahre alt werden, ohne dass man je wirklich gewusst hat, wo genau jetzt rechts und wo genau links ist. Es bringt einem keinerlei Nachteile. Außer vielleicht in wenigen Momenten in der Fahrschule. Aber ansonsten ist es absolut und völlig egal! Wenn man sich umdreht, ist es sowieso wieder die andere Seite, warum also sollte man es sich überhaupt merken?
Auf der einen Seite neben mir saß meine Großcousine, hatte das Pflaster mit dem schwarzen Punkt, welches sonst eines ihrer beiden Augen verdeckte, hochgeklappt und stierte in Stereo nach draußen.
Auf der anderen Seite saß mein Großcousin und wippte mit dem Oberkörper vor und zurück, als müsste er dringend zur Toilette. Mund und Augen standen ihm weit offen, und er starrte in dieselbe Richtung wie seine Schwester.
Zwei Stufen aufwärts saßen ihre Eltern, Onkel Friedlich und Tante Creme. Er völlig ruhig und nichts sagend und nichtssagend und sie ihre Hände ineinander reibend. Hochwahrscheinlich hatte sie wegen Aufregung zur Beruhigung auf dem Weg zur Treppe kurz an ihrem Tiegel mit Handcreme innegehalten, die Hände flott hineingetaucht und versuchte nun, sich durch massiven Druck die Handcreme in die Hände hineinzupressen. Sie hielt den Mund geschlossen, dennoch ragten ihre bemerkenswerten Zähne wie eine schlecht tapezierte gelbliche Wand heraus. Hätte es auch hier drinnen geregnet, mein Großcousin hätte trotzdem im Trockenen gesessen.
Unten neben Oma, auf der fensterabgewandten Seite, saß Mama, auf ihrem Arm mein Bruder.
Üttchen, Omas kubikmetrige Schwägerin, mit der sie zusammenlebte, stand direkt neben den beiden, klammerte sich beidhändig an die Streben des Handlaufs der Treppe nach oben und blickte zwischen zweien von diesen hindurch hinaus ins Dunkel. Offenbar hatte sie sich auf dem Weg aus dem Bett heraus zur Treppe wegen Eiligkeit ihre Perücke falsch herum aufgesetzt. Die Nackenwellen ihrer Dauerhaube drückten auf den oberen Rand ihrer Brille und diese tief ihre Nase hinab, was ihr einen seltsam grimmig bösen Blick verlieh.
Hinter Üttchen hockte Didi an die Wand gelehnt, Mamas Bruder. Er sah so besorgt aus wie selten. Wahrscheinlich überlegte er, ob er das Mofa untergestellt hatte oder eben nicht.
Es war mitten in der Nacht, jegliches Licht im Haus war gelöscht worden. Denn es war: Gewitter!
Und Gewitter war das Zweitschlimmste, was passieren konnte, hatte Oma mir erzählt, aber das hatte sie gesagt, als kein Gewitter war, denn wenn Gewitter war, durfte man nicht reden, oder wenn, dann nur ganz leise, denn der Blitz könne uns hören, hatte Oma mit großen Augen und erhobenem Zeigefinger angefügt.
Ich hatte natürlich wissen wollen, was denn dann das Erstschlimmste wäre, das passieren konnte, wenn Gewitter das Zweitschlimmste wäre, das passieren konnte, und Oma hatte mir erklärt, das Allerschlimmste wäre, wenn die Bomben fielen.
Die einzigen Bomben, die ich kannte, waren Wasserbomben, und die waren ja eigentlich gar nicht schlimm, sondern lustig. Zumindest für den, der sie warf. Der andere, der, der getroffen wurde, war dann meist nass, wegen Wasser und Heule.
Ich hatte Oma also gefragt, was denn die Bomben, von denen sie redete, machen würden, und Oma hatte geantwortet, dass die einen ganz, ganz lauten Knall machen würden, Rommsti-Bommsti, und dann wäre alles rundherum kaputt. Völlig klotten.
Mir war der Unterschied jedoch noch nicht so richtig klar gewesen, und ich hatte erwidert, dass das Gewitter doch auch Rommsti-Bommsti machen würde, und Oma hatte bestätigt, ja, das wäre wohl so, aber das Rommsti-Bommsti beim Gewitter wäre ja nicht das Gefährliche, sondern der Blitz vorneweg. Wenn der irgendwo einschlagen würde, dann würde der zwar auch alles kaputt machen, völlig klotten, aber dass der irgendwo einschlagen würde, sei häufig doch schon sehr selten, trotzdem würde es beim Gewitter natürlich ständig Rommsti-Bommsti machen, aber da gehe ja nichts bei kaputt. Wenn allerdings die Bomben fielen, dann könne man sicher sein, dass dann nichts mehr sicher war und bei jedem Rommsti-Bommsti auch was kaputt gehen würde. Insofern seien die Bomben schlimmer als jedes Gewitter.
Wann die Bomben denn wieder fallen würden, hatte ich wissen wollen, und Oma hatte gesagt, das würde man nicht wissen. Im Moment sei es aber wahrscheinlicher, dass Gewitter kommen würde. Anstatt Bomben. Also dies Jahr noch.
Da Gewitter von der Gefährlichkeit her nicht zu unterschätzen war, war es in jenem unserem Haus dort in Aspe, Bad Salzuflen, Lippe, ungeschriebenes, aber häufig von Oma laut ausgesprochenes Gesetz, dass sich alle und jeder und jeder und alle sofort und unverzüglich nach Ertönen des ersten Donners in den Hausflur auf die Treppe begab und begaben, auch die wenig Begabten, denn so dösig könne man gar nicht sein, das nicht zu verstehen, sagte Oma. Der Hausflur inklusive Treppe sei groß genug, um alle Bewohner zu beherbergen, und dazu noch nahe der Haustür, falls man fliehen müsste, und das Wichtigste, da mit Gewitter ja auch Wetter einhergehen würde, er sei trocken, wusste Oma. Mitzunehmen sei lediglich das, was man tragen und sich dabei noch bewegen könne und was man auf jeden Fall vor eventuellem Feuer retten wollen würde. Kurz gesagt: Das Wichtigste muss mit, alles andere bleibt, wo es ist! So Omas Ansage.
Flacker-Flacker-Flacker! Ein Blitz!
Die Gesichter meiner Verwandten wurden mehrfach kurz und kräftig erhellt, ich sah entsetzte, angstvolle verzerrte Grimassen ringsum. Oma zählte erneut: «Einnzwanzich, zweinzwanzich, dreinzwanzich, viernzwanzich …»
Rommsti-Wommsti-Bommsti!!!
Und noch bevor die Scheibe im Fensterrahmen aufgehört hatte zu zittern, wiederholte Oma leise: «Zieht langsam wieder wech.»
Zwischen Omas Füßen am Fuße der Treppe stand eine Plastiktüte. Sie stand nicht von allein, sondern deshalb, weil sich in ihr ein Aktenordner und mehrere Umschläge mit papiernem Inhalt befanden. Das war das, was Oma auf jeden Fall im Fall des Falles aus dem Haus retten wollte.
Es war die «Jewittatüte» – darin die wichtigsten Unterlagen wie Stammbuch, Sparbuch, Gesangbuch und Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, Seepferdchenurkunde und andere brisante Zettel, auf denen stand, «was wem jehöan tut, also mir», so Oma.
Andere Familienverbünde waren von ihr angehalten worden, es ebenso zu halten wie sie, und wehe, wenn nicht!
So war es also kein Wunder, dass Tante Creme ebenfalls mit einer Plastiktüte zwischen den Füßen dasaß. Diese war in der Dicke allerdings schlanker als jene von Oma, unten dafür aber mit einer enormen Ausbuchtung. Ich tippte auf einen Reserve-Kübel Handcreme.
Üttchen hielt nichts in Händen, außer den Streben des Treppenlaufs. Oma hatte gesagt, die zwei Zettel von ihr würde sie noch mit in ihre «Jewittatüte» reinkriegen, sie solle sich mal auf anderes konzentrieren. Dass Üttchen aber nun so gar nichts in den Händen hielt, machte mich irgendwie ein bisschen traurig. Ich tröstete mich damit, dass sie ja vielleicht das Treppengeländer mitnehmen wollte.
Mama hatte noch keine eigene «Jewittatüte», (was sich allerdings in den Jahren drauf ändern sollte, eine Änderung, die bis heute anhält), stattdessen hatte sie ja meinen Bruder auf dem Arm.
Ich war kurz davor zu sagen, Oma hätte ja gesagt, wir sollten nur das mitnehmen, was wir tragen könnten und uns auch noch bewegen könnten und dass das beides auf meinen Bruder wegen mächtiger Pummeligkeit wohl kaum zuträfe, aber eben nur kurz davor. Denn mein Bruder besaß in seinen sehr jungen Jahren sehr viel Speck um seinen eigentlichen Körper drum herum. Mama hatte gesagt, das sei Babyspeck. Papa hatte gefragt, von wie vielen Babys denn? Und Oma hatte gesagt, das sei Schmull. Schöne weiche, weiße Haut von enormer Dicke und Dichte, die das Kind hervorragend abfedern würde, wenn es stürzte. Wobei ich mich fragte, wie man stürzen konnte, wenn man den ganzen Tag bloß faul herumlag.
Meine Großcousine hielt eine Puppe mit langen blonden Haaren im Arm inklusive einer Bürste für ebendiese Haare, mein Großcousin hatte vier oder fünf Figuren seiner dunkelgrünen Plastiksoldatenarmee in Händen und sein Vater, Onkel Friedlich, den nagelneuen Elektrorasierer, den er von seiner Frau letztes Jahr zu Weihnachten bekommen hatte. Wahrscheinlich hatte sie ihm den rausgelegt.
In Didis einer Hand blitzte der Schlüssel vom Mofa auf, dem alten von Üttchen, das nun gern und oft, also eigentlich immer, von ihm gefahren wurde, und mit der anderen Hand umfasste er krampfhaft sein letztes Geburtstagsgeschenk, einen Tankgutschein von Texaco.
Ich war zu viert. Während Biggi und Banda weiterhin fest in Omas Schultern verbissen waren, klammerte sich, dank kleiner quadratischer Klettaufnäher am Ende seiner zarten, lieblichen Ärmchen, ein grüner Frosch um meinen Hals. Zu diesem später mehr.
Da Gewitter immer plötzlich und unerwartet auftrete und, so selten es auch dazu komme, häufig in der Nacht, so Oma, sei die für diesen Zweck erstellte Tüte wegesnah und griffbereit zu platzieren, sodass man sie auf dem Weg ins Treppenhaus auch im Dunklen finden würde, sie aber trotzdem bei Helligkeit nicht zu sehen wäre, um eventuelle, etwas im Schilde führende, uneingeladene Unholde, namentlich Einbrecher, nicht sofort mit der Nase darauf zu stoßen.
Oma war eine Meisterin darin, diese von ihr selbst aufgestellte Regel, regelgerecht und -konform umzusetzen. Die Neugierde motivierte mich jahrelang dazu, den Weg von ihrem Bett bis ins Treppenhaus sehr genau abzusuchen, aber die «Jewittatüte» fand ich nie.
Aber (!) wenn Gewitter kam, stand Oma, noch bevor der erste Donner verklungen war, mit der Tüte unterm Arm im Schlafzimmer, schlug meinen Federberg zur Seite und flüsterte eindringlich: «Komm! Es kommt! Und bisse leise! Der Blitz hat Ohan!»
Höan
Apropos Ohren. Also, apropos «hören». Oma deutete mit ihrem Zeigefinger auf die Schuhe, die mittig im Flur standen, und fragte: «Wen höan die Treter?»
«Ich!», rief ich, sprang vom Sofa auf, schlug kurz die Hacken zusammen und meldete mich.
Oma machte große Augen und legte den Kopf erwartungsfroh in den Nacken. «Ja, höan die denn da hin?»
«Nee», meinte ich kopfschüttelnd und lächelte wissend.
«Ja, wo höan die denn hin?», fragte Oma interessiert.
«Anne Füße», erwiderte ich und nickte knapp.
Oma ließ sich Zeit, wollte der Angelegenheit anscheinend auf den Grund gehen. «Ja, und wennse da nich anne sind?»
Verdammich! Sie hatte mich kalt erwischt. Ich wusste es nicht! Wohin gehörten Schuhe, wenn sie nicht an den Füßen waren? Es blieb mir nichts anderes übrig, als sie mit dem jämmerlichen Versuch einer Gegenfrage aus dem Konzept zu bringen und sie zu einer Replik zu veranlassen, die mich der Antwort näher bringen täte. Ich breitete also die Arme aus und sagte laut und deutlich und mit großen Augen und ebenso großer Geste: «Ja, wennse da nich anne sind, wo höan die denn dann hin?!»
Doch Oma ließ sich nicht aufs Glatteis führen. Sie stemmte die Hände in die Hüften, wobei die Kittelschürze sich nichts anmerken ließ und jeglichen Faltenwurf verweigerte, und sagte: «Jenau das hab ich grad jefracht.» Und wartete.
Mistekiste.
Ich ließ die Arme sinken. Nun konnte der Angelegenheit bloß noch mit Logik beigekommen werden. In meinem Kopf ratterte es so laut, dass man es draußen hören musste.
Ausschlussverfahren! Wenn Oma fragte, wohin die mittig im Flur platzierten Schuhe gehörten, wenn man sie nicht an den Füßen trug, mussten die mittig auf dem Flur platzierten Schuhe auf jeden Fall an ebenjenen Platz nicht gehören. Also antwortete ich: «Auf jeden Fall gehören sie nicht mittig auf den Flur.»
«Jenau», sagte Oma.
Punkt für mich. Ich lächelte erleichtert.
Doch Oma war noch nicht zufrieden: «Also? Wo höan die hin?»
Mein Lächeln fiel in sich zusammen, mein Kopf knickte nach vorn. Ich sah auf meine unbeschuhten Füße hinab, und mir wurde klar, ich kam um die Wahrheit nicht länger drum herum. Betroffen und leise und traurig gab ich zu: «Ich weiß es nicht.»
«Auf jeden Fall nicht mittig aufn Flur», wusste Oma.
Das wussten wir jetzt. Dass sie da falsch waren.
«Nächstes Mal, wenn ich die ausziehe, dann stell ich sie auf jeden Fall auf keinen Fall mittig auf den Flur.»
«Jut», sagte Oma und wandte sich zum Gehen.
Jetzt allerdings wollte ich doch noch die Antwort wissen: «Und wo höan die jetzt hin, Oma?»
Oma drehte sich zu mir um, sah mich erst streng an, schüttelte dann sachte den Kopf, wieder diesen mir allzu bekannten Blick im Gesicht, eine Mischung aus Mitleid und Misstrauen, und sagte: «Das is ja woh chanz klar, wo die hinhöan!»
Sie deutete mit dem Zeigefinger in Richtung Schuhe. «Woanders!»
Ach so!
Oma war so schlau. Dass ich da nicht von selbst drauf gekommen war! Ich schlug mir mit der flachen Hand vor die Stirn und sagte vorwurfsvoll: «Dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin!»
«Jau», sagte Oma, das würde sie auch wundern, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen sei, aber wundern würd sie bei mir ja schon lange nichts mehr, und damit ging sie in die Küche.
Ich räumte meine Schuhe nach woanders und pfiff dabei eine kleine Melodie.
Wie war ich darauf gekommen? Und woher kannte ich die? Ach ja!
Flöttkern
Willi Tödheide war immer am Flöttkern. Sobald er die Straße überquert hatte und durchs Tor trat, fing er an zu pfeifen.
«Fuüü – fü, fü, fü, fü, fü, fü!»
Der erste Pfiff war etwas länger und schraubte sich über seine Dauer hinweg eine grobe Oktave nach oben, die folgenden sechs Pfiffe waren kurz und alle gleich lang und tonhöhentechnisch auf ebenjenem zuvor erreichten Ton. Es klang ein bisschen so, wie wenn man Hühner zum Futter ruft.
«Puuuutt – putt, putt, putt, putt, putt, putt!»
Als hätte jemals irgendjemand Hühner zum Futter rufen müssen! Die kamen doch schon angelaufen, wenn die bloß sahen, dass man mit Futter angelaufen kam. Ich entschied damals, dass dieses Putt-putt-putt-Gerufe nur einer dieser verzweifelten Versuche des Menschen war, mit Tieren zu kommunizieren. Das Tier machte, was es sowieso machte, und der Mensch glaubte, es täte es wegen ihm oder seiner Ansprache. So ein Blödsinn! Außerdem hatten Hühner ja nicht mal Ohren, das sah doch jeder.
Willi Tödheide war ganz schlecht zu Fuß. Er hatte irgendwas mit der Hüfte und deshalb immer einen Stock an seiner Seite. Wenn er ging, sah es immer ein bisschen so aus, wie wenn Elvis tanzte. Nur dass Elvis schneller tanzte und Willi Tödheide im Vergleich unglaublich langsam. Mit seinem fröhlichen Flöttkern kündigte er also schon von weitem an, dass er uns gleich besuchen käme. Also bald. Also irgendwann heute noch. Wenn’s gut lief.
«Fuüü – fü, fü, fü, fü, fü, fü!»
Oma, Üttchen und ich konnten Willi zwar nicht sehen, hörten ihn aber aus der Ferne nahen. Wir saßen im Hof, und die beiden hatten gerade angefangen Erbsen auszukrüllen. Das ist, wenn man die kugelrunden grünen Bewohner aus ihren länglichen grünen Schoten befreit und anschließend beides nach Form sortiert: die runden ins Töpfchen, die schlanken ins Kröpfchen. Ich saß daneben und half. Ich öffnete eine Schote und warf einen Blick hinein. Die sahen aus wie Vater, Mutter, Kind, Kind, Kind, Kind, Kind … Wäre Üttchen noch etwas kleiner gewesen und grün und ohne Ecken, hätte man meinen können, das sei ihre Familie. Was gar nicht so abwegig gewesen wäre, denn Üttchen hatte zehn Geschwister.
«Fuüü – fü, fü, fü, fü, fü, fü!»
«Willi kommt», sagte Üttchen.
«Jau», sagte Oma. «Habbich jehöat. Ich wette, der kommt erst umme Ecke, wennwa mitte Erbsen feddich sind.»
«Das wett ich auch!», sagte Üttchen.
So wetteten die beiden immer. Oma sagte: «Ich wette …», und dann kam irgendwas, und Üttchen sagte: «Das wett ich auch!»
Zwei Jahre vorher hätte ich beinahe mal gefragt, um was sie denn wetten würden, sie hätten ja gar keinen Einsatz genannt, was ich dann aber nach kurzem Nachdenken sein ließ. Mir war aufgegangen, dass sie ja dasselbe wetteten. Immer. So würden sie natürlich immer beide gewinnen und brauchten keinen Einsatz. Und keine der beiden musste sich ärgern. Das war ja schlau! Auf der anderen Seite konnten natürlich auch beide verlieren und bekamen dann auch nichts vom jeweils anderen. Das war ja dumm! Aber sie hatten ja auch um nichts gewettet. Das war dann wieder schlau!
«Fuüü – fü, fü, fü, fü, fü, fü!»