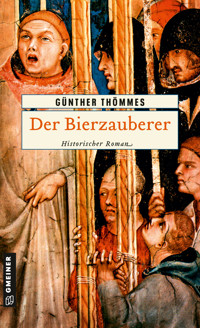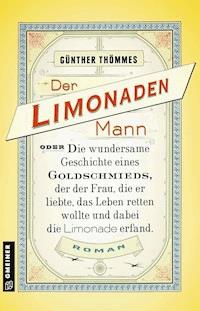
Der Limonadenmann oder Die wundersame Geschichte eines Goldschmieds, der der Frau, die er liebte, das Leben retten wollte und dabei die Limonade erfand E-Book
Günther Thömmes
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Der hugenottisch geprägte Jacob entwickelt sich vom einfachen Bauernsohn zum gefragten Goldschmied, Juwelier und Gentleman. Sein Weg führt ihn von Hessen über Genf nach London. Als Erstem gelingt ihm, nach jahrelanger Tüftelei, die Erzeugung künstlichen Mineralwassers. Gegen alle Widerstände hat er Erfolg. Doch kann seine Erfindung auch der Frau, die er liebt, das Leben retten? Und nebenbei auch noch einen Mann aus dem Weg räumen, der kein Mitleid verdient? Heute ist Jacobs Nachname weltbekannt, er selbst wurde jedoch - zu Unrecht - fast vergessen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
3. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung von:
»Schriftproben«, Aktiengesellschaft für Schriftgiesserei und Maschinenbau, Offenbach am Main, 1892. In: de Jong, Purvis, Tholenaar: »Type: A Visual History of Typefaces and Graphic Styles, Vol. 1, 1626–1900«;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomological_Watercolor_POM00006408.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1783_Johann_Jacob_Schweppe.jpg; http://www.drinkingcup.net/wp-content/uploads/2012/04/1767-Schweppes-Geneva-Aparatus11.jpg
ISBN 978-3-8392-5766-1
Zitate
Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen,
als daß gute Menschen gar nichts tun.
Edmund Burke (1729–1797), irisch-englischer Staatsmann und romantischer Denker
Das, was wir »bös« nennen, ist nur die andere Seite vom Guten.
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Verzeichnis der auftretenden Personen
In der Reihenfolge ihres Erscheinens:
Der britische König Wilhelm IV.
Her Royal Highness Princess Alexandrina Victoria of Kent
Die Gräfin Antoinette Albertine Johanna von Wallenschnudt
Harald, der Dorftrottel
Der hessische Landwirt Conrad Schweppeus
Der Hugenotte Antoine Roget
Hubertine, Antoines Gattin und Cousine 3. Grades
Conrads Frau und Antoines und Hubertines Tochter Eléonore geb. Roget
Jacob Schweppeus, die Hauptfigur
Der Kesselflicker Balthasar Apitzsch
Der Kasseler Goldschmiedemeister Johann Ludwig Wiskemann
Johanna Isabella Eleonore, Freiin von Poppy, verw. von der Groeben und von Bieleburg, spätere Lady Makepeace-Keay
Benjamin, der betrunkene Kutscher
Samuel Kornhammer, Juweliermeister zu Kassel
Der Londoner Uhrmacher Ahasuerus Blindganger
Der Kasseler Drucker und Verleger Johann Martin Lüdicke
Der Genfer Bijoutiermeister Jean-Louis Dunant
Posthum: Johann Conrad Richthausen, Freiherr von Chaos
Max Alfred von Bartenstein, Bürokrat aus Wien in Genfer Diensten
Jacobs Tochter Colette, Freiin von Bieleburg
Der berühmte Genfer Arzt Théodore Tronchin
Der berühmte Pariser Professor Jacques Alexandre César Charles
Dessen Assistent Guillaume Belcombeux
Der Genfer Mechaniker Nicholas Paul
Dessen Vater Jacques Paul
Der Dorfrichter Pierre Gueule
Der Genfer Apotheker Henri-Albert Gosse
Der englische Arzt William Belcombe
Baronet Sir Howard Makepeace-Keay, Ritter des Königs und Offizier bei der Britischen Armee
Leonie, eine brave Hündin
Der englische Dichter, Botaniker, Arzt und Erfinder, Dr. Erasmus Darwin, Großvater des berühmten Charles Darwin
Der englische Flaschenentwickler William Francis Hamilton
Thomas Hodgson, Kapitän im Dienste der Ostindien Kompanie
Dr. Francis Chandler, Offizier und Arzt in Fort William, Bengalen
Drei spätere Geschäftspartner:
Henry Lauzun
Francis Lauzun sowie
Robert George Brohier
1. Kapitel: Wilhelm IV.
Der König hatte Blähungen. Er saß an seinem imposanten Schreibtisch in einem großen, seidenbespannten, aber schrecklich unbequemen, italienischen Stuhl und fühlte sich alles andere als wohl.
Um wie viel lieber läge ich jetzt in einer Seemannshängematte, in der ich mir meine Leibschmerzen wegfurzen könnte, dachte er, während er ungeschickt an seinem Kragen nestelte, als wolle er sich mehr Luft verschaffen. Dann würden vielleicht auch meine wirklich üblen Kopfschmerzen verschwinden.
Es versteht sich von selbst, dass niemand der Anwesenden an den königlichen Gedanken teilhaben konnte. Auch seine achtzehnjährige Nichte Victoria nicht, die zusammen mit einer älteren Dame zu ihrer Linken jetzt vor ihm stand; einer Dame, die er noch nie gesehen hatte. Sogar im Sitzen überragte der bullige, rotgesichtige Monarch seine zierliche, zukünftige Nachfolgerin. Victoria wusste den verkniffenen Gesichtsausdruck König Wilhelms IV. aus guter Erfahrung heraus dennoch zu deuten und fragte mitfühlend:
»Was bedrückt Euch, Majestät? Habt Ihr wieder Leibdrücken?«
Der König nickte dezent.
Victoria drehte sich um und ging in dem ihr eigenen, seltsam hoppelnden Gang zwei Schritte nach hinten. Trotz seiner Schmerzen schmunzelte der König, wie jedesmal, wenn er seine Nichte von hinten sah. In Gedanken verglich er sie immer mit einem dieser kleinen Ponys von den Shetlandinseln, ganz im Norden seines Reiches, sowohl von der Größe wie auch von der Gangart her. »Tölt«, fiel ihm respektlos dazu ein; ein geschmackloser, unangebrachter Herrenwitz über die junge Prinzessin, die in nur wenigen Jahren die mächtigste Frau der Welt sein sollte. Victoria winkte unauffällig mit der rechten Hand, und wie aus dem Nichts stand ein Diener neben ihr, mit einem silbernen Tablett in der Hand, auf dem eine Flasche lag und ein Glas stand. Victoria nahm die seltsam geformte, ovale, kleine Glasflasche beinahe liebevoll in die Hand und drehte den schmucklosen Korken heraus. Es zischte leicht, dann goss Her Royal Highness Princess Alexandrina Victoria of Kent eine leicht gelbliche Flüssigkeit ins Glas. Sie ging wieder nach vorne und reichte es ihrem Onkel, dem König von England.
»Trinkt das hier. Das wird Euch gut tun.«
Wilhelm IV. schnupperte misstrauisch an dem Glas, verspürte ein leichtes, angenehmes Prickeln in der Nase und nippte vorsichtig. Mit Genuss trank er das Glas in einem Zug leer.
»Was ist das? Das schmeckt großartig. Erfrischend und prickelnd. Ist das eine neuartige Patentmedizin?«
»Dieses Getränk ist der Grund, warum wir beide heute hier sind. Gräfin Antoinette Albertine Johanna von Wallenschnudt«, wobei Victoria auf die alte Dame zu ihrer Linken zeigte, »und ich.«
So langsam dämmerte es dem König. Da war doch was gewesen? Leider war sein Gedächtnis nicht mehr das allerbeste. Wie das eines Siebzigjährigen halt, der Zeit seines Lebens kein Saufgelage ausgelassen hatte und um keine Flasche Wein einen Bogen gemacht hatte. Sein heutiger Kater machte es zudem nicht besser.
»Hilf meinem Gedächtnis auf die Sprünge, liebe Victoria«, murmelte er so leise, dass es in den hinteren Reihen des Audienzzimmers nicht zu hören war.
»Ich hatte Euch doch seit einigen Jahren bereits von diesem Getränk vorgeschwärmt. Seit fünf Jahren haben wir es bereits hier bei Hofe. Ich finde es wundervoll. Ich möchte dieses Getränk am liebsten immer am Hof haben. Jederzeit. Nun habe ich es Euch für ein Royal Warrant vorgeschlagen. Ihr solltet seinen Herstellern die königliche Empfehlung erteilen. Das höchste Prädikat unseres Königreiches.«
»Das stimmt. Und heute ist der Tag?«
Schon verspürte er die eigenartige Wirkung des Getränks. Der Aufruhr in seinem Magen schien friedlicher zu werden. Andererseits spürte er, wie sich die Gase sammelten und zum Ausbruch drängten. Er gab dem Druck und dem Drängen mit einem mächtigen Rülpser nach. Danach fühlte er sich wie befreit. Entspannt. Er grinste wie ein Schuljunge.
Gräfin Antoinette Albertine Johanna von Wallenschnudt trat einen Schritt vor, näher an des Königs Schreibtisch. Ihre ungewöhnlich tiefe Stimme hatte etwas Beruhigendes.
»Eure Majestät, ich möchte Euch herzlich danken für das königliche Privileg. Es ist zwar nicht meine Firma, die Ihr damit auszeichnet, ich bin mittlerweile zu alt für derartige Geschäfte, aber mein Herz hängt sehr an diesem Getränk. Und an dieser Flasche.« Nun nahm sie die leere Flasche, die entfernt an eine römische Weinamphore erinnerte, strich verträumt mit den Fingern über die Namensgravur am Bauch der Flasche, über den eigenartig geformten, runden Boden und legte die Flasche wieder zurück auf das Tablett. »Es hat meiner Mutter einst das Leben gerettet.«
»Wie soll ich das verstehen, Gräfin von Wallenschnudt?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Erzählt sie mir. Kommt heute Abend mit Victoria zum Diner.«
Dann unterschrieb und siegelte der König die vorbereitete Erklärung zur Königlichen Empfehlung.
Das Diner war vorbei, die Gäste zogen sich zurück. König Wilhelm IV., Oberhaupt des Hauses Hannover, winkte seiner Nichte und der Gräfin von Wallenschnudt zu und bat sie, sich zu ihm ans Kaminfeuer zu setzen.
»Und nun erzählt mir Eure Geschichte. Von dem geheimnisvollen Getränk. Ich platze vor Neugier.«
»Das Getränk ist weniger geheimnisvoll, als dass es eine überaus spannende Geschichte hat.«
Die Gräfin nippte an ihrer Teetasse.
»Sie beginnt in einem kleinen Ort in Hessen-Kassel, vor über einhundert Jahren.«
»Hessen-Kassel? Gehört das auch zu meinem Köngreich Hannover?«
»Das nicht, Majestät, aber der Ort, an dem alles begann, liegt gleich an der Grenze zu Hannover. Sein Name ist Witzenhausen.«
»Witzenhausen?« Der König lachte. »Was soll das für ein Name sein? Nichts und niemand heißt so. Und kennen tut es auch niemand.«
»Das mag sein. Niemand kennt Witzenhausen.«
2. Kapitel: Conrad Schweppeus
Witzenhausen war ein winziger Marktflecken in einer trostlosen Gegend an der nordöstlichen Grenze des Fürstentums Hessen-Kassel gelegen. Trostlos trotz lange bestehender Stadtrechte deswegen, weil sich die ganze Region nur sehr langsam von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges erholte. Während die größeren Orte und Städte, allen voran das einen Tagesmarsch nach Osten entfernte Kassel, schon wieder an der Schwelle zum Wohlstand standen, ging es den Menschen auf dem Land mehr schlecht als recht.
Witzenhausen bestand im Grunde nur aus einem fast quadratischen Marktplatz, von dem in alle vier Himmelsrichtungen Strassen wegführten, die jedoch zur Hälfte bald schon an der baufälligen Stadtmauer endeten. Vier Straßen führten kreuz, vier Straßen quer, aber nur jede Zweite von ihnen führte zu je einem Stadttor hinaus. Auf einem zweiten, kleineren Platz im Südwesten stand die Marienkirche, in der nordöstlichen Ecke das kleine Kloster St. Wilhelmi. Vor dem nördlichen Tor floss gemächlich die Werra vorbei; ein Flüsschen, das neben der Landwirtschaft die beste Einnahmequelle der Bürger Witzenhausens darstellte; durch Fähren, Maut, Stapelrecht und Schiffshandel. Nur einen kleinen Fußmarsch entfernt vom anderen Ufer begann das erheblich wohlhabendere Kurfürstentum Hannover. Das höchste Gebäude neben dem Kirchturm war einer der Türme als Teil der runden Stadtmauer, der Diebesturm, der immer gut gebucht war. Die meisten Häuser innerhalb der Mauern hatten ein Feld und einen Garten dabei, denn fast alle Witzenhäuser waren Bauern, auch die, die sonst einem anderen Beruf nachgingen. Die hauptberuflichen Bauern, also die meisten von ihnen, hatten zusätzlich noch Felder jenseits der Stadtmauer.
Wie in allen Orten, in denen es innerhalb der Stadtmauern noch Bauernhöfe gab, stank es entsetzlich. Es stank zu dieser Zeit eigentlich in jeder Stadt, immer und überall. Eine Melange von Fäulnis und Fäkalien waberte durch die Straßen, im Winter wie im Sommer. An warmen Tagen war es unerträglich. Größeren Städten, durch die ein Fluss lief, oder wo die Bauern bereits vor den Kaufleuten und Handwerkern kapituliert hatten und vor die Tore ausgewandert waren, ging es ein klein wenig besser.
Aber diese kleinstädtische Mischung aus tierischem und menschlichem Dung, welche die zahlreichen Misthaufen für die Myriaden von Fliegen attraktiv machten, mit der bräunlich-dunklen Brühe, die aus den Misthaufen herauslief und die Fugen zwischen den Pflastersteinen ausfüllte – da, wo es Pflastersteine gab –, oder sich unterschiedlos mit dem Schlamm der anderen Wege vermischte, das konnte einem an warmen Sommertagen schier den Atem rauben. Nicht nur den seltenen Besuchern von auswärts.
In der Mitte des Marktplatzes stand das Rathaus, das mitsamt seines gotischen Portals im Dreißigjährigen Krieg stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, sowie ein großer, rechteckiger Brunnen mit langen, steinernen Wasserrinnen, dessen tagtägliche Bewachung die Aufgabe des Dorftrottels Harald war. Sofern er nicht die Misthaufen ordnete und neu sortierte. An den Wasserrinnen tränkten die durchreisenden Kaufleute oder Soldaten ihre Pferde, bevor sie weiterreisten, während sie selbst im einzigen Gasthof des Ortes einkehrten, der an der Ostseite des Marktplatzes gelegen war; praktischerweise gleich neben dem einzigen Freudenhaus Witzenhausens. Die Wenigsten blieben länger als unbedingt nötig.
Um den Marktplatz herum gruppierten sich auf der Nordseite die Fachwerkhäuser der wenigen wohlhabenden Bürger, zumeist Schiffer-Kaufleute. Der Amtmann besaß sogar ein Haus, das komplett aus Stein gebaut war. An der Südseite des Marktplatzes stand seit einigen Generationen das Haus der Familie Schweppeus, ein einfaches, leicht windschiefes Bauernhaus inmitten anderer einfacher, leicht windschiefer Bauernhäuser, mit einem Geschoss und einem Heuboden obendrauf. Die Wände waren vor zwei Generationen aus Holz und unbehauenen Steinen aufgerichtet und dazwischen einigermaßen unfachmännisch mit Stroh und Lehm befüllt und verputzt worden. Der Boden bestand aus rohen, ungeschliffenen Holzplanken. Familienoberhaupt der Bauernfamilie Schweppeus zur Zeit dieser Erzählung war Conrad Schweppeus. Er war groß gewachsen, schlank an der Grenze zur Magerkeit, fast glatzköpfig und völlig humorlos. Zumindest nach der Meinung aller anderen Menschen. Er selbst fand das nicht, aber da er eher ein Eigenbrötler war, fehlten ihm sämtliche Vergleichsmöglichkeiten. Manche Menschen behaupteten, er wüßte nicht einmal, was Humor sei, daher könne er ihn auch nicht vermissen.
Der fehlende Humor passte jedoch bestens zu seiner Religion, denn alle Mitglieder der Familie Schweppeus waren fromme Protestanten, soweit man zurückdenken konnte. Arbeiten, beten und in der Bibel lesen, mehr brauchte es nicht für ein sinnerfülltes Dasein. Nüchtern blieb Conrad Schweppeus dabei Zeit seines Lebens. Er braute nicht einmal Bier, so wie einhundertundsechsunddreißig andere Familien in Witzenhausen es taten. Also beinahe jeder Fünfte. Dafür müsste man nämlich im Notfall, beziehungsweise Kriegsfall, »beweibte Soldaten« unterbringen und verköstigen. Und dabei, so mutmaßte Schweppeus, ginge es des Nachts sicher drunter und drüber. Das war nichts für ihn, und Bier mochte er sowieso nicht.
Der Hüter des evangelischen Glaubens in Hessen-Kassel war Wilhelm VIII. von Hessen. Er regierte das Fürstentum als Statthalter für seinen Bruder Friedrich, der lieber Schwedenkönig war als ein unbedeutender Hessenfürst. Es ist fraglich, ob Wilhelm VIII. den kleinen Ort Witzenhausen überhaupt kannte, obwohl er doch zu seinem Reichsfürstentum gehörte. Aufgehalten hat er sich dort jedenfalls während seiner gesamten Regierungszeit nicht eine Minute. Die Witzenhäuser ihrerseits waren dennoch mächtig stolz darauf, dass ihr Stadtschultheißenamt mit seinen insgesamt dreihundert-zweiunddreißig Häusern bereits vor einigen Jahrzehnten mit dem Amt Ludwigstein vereint worden war, wodurch Witzenhausen ganz hochoffiziell zum Hauptort des Amts Witzenhausen geworden war. Mit ihrem Stolz standen die Witzenhäuser allerdings ziemlich alleine da, denn der Rest der Welt weigerte sich beharrlich, vom Amt Witzenhausen, mitsamt seiner Haupt- und Nebenorte, auf irgendeine Art und Weise Notiz zu nehmen.
Dem frommen Protestanten Conrad Schweppeus konnte das nur recht sein. Er wollte lediglich seine Ruhe haben, und im Herbst eine Ernte einfahren, gut genug, um sich und seine Frau Eléonore ernähren zu können und keinen Hunger zu leiden. Als er zum Ende des viel zu milden Winters, Mitte März, in seinem Haus an der Südseite des Marktplatzes dieses kleine, schreiende Bündel Mensch in seinen mächtigen, derben Händen hielt, wusste er beim besten Willen nicht, was er damit anfangen sollte. Sein erster Gedanke war: Jetzt brauche ich einen Morgen Land mehr, um einen zusätzlichen Esser durchzubringen. Sein zweiter Gedanke war: Warum schreit das so laut?, und sein dritter: Es stinkt.
3. Kapitel: Antoine und Eléonore Roget
Es war nicht einfach, im siebzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Frankreich zu leben, wenn man Hugenotte war. Trotz des Toleranzediktes von Nantes. Die Stimmung war unheilschwanger und konnte jederzeit in Pogrome ausarten. Die Rogets hatten dennoch bereits seit beinahe einhundertundfünfzig Jahren tapfer durchgehalten. Niemals wurde gefragt, ob es das wert sei, für seinen Glauben so zu leiden, so gedemütigt und schikaniert zu werden. Eventuell sogar getötet zu werden am Ende. Die Hugenotten waren schlau, hatten mit der Zeit gelernt sich zu verstellen, falschen Freunden zu misstrauen und unter sich zu bleiben. Im unzugänglichen Gebiet der Cevennen waren sie den Truppen des Königs gegenüber sowieso klar im Vorteil. Jeder Besuch der Obrigkeit machte lange vor der Ankunft schon die Runde durchs Dorf. In aller Ruhe wurden die Gesangbücher und protestantischen Bibeln in die Geheimverstecke der doppelten Fußböden geräumt, predigende Besucher von auswärts in die Wandverstecke gepackt und den Soldaten des Königs heuchlerisch Treue und Ehrerbietung vorgespielt. Lange war dies gut gegangen. Schließlich war es dann dennoch so weit gewesen. Nachdem König Ludwig XIV. mit der Révocation, der Kündigung des Toleranzediktes, den Katholizismus wieder zur Staatsreligion gemacht hatte, hatten die Hugenotten alle religiösen und bürgerlichen Rechte eingebüßt. Sofern sie nicht konvertierten. So hatten auch die Rogets sofort und folgerichtig beschlossen, den ewigen Anfeindungen und Verfolgungen zukünftig und endgültig aus dem Weg zu gehen, indem sie auswanderten. Mit dem Kleinkind Antoine im Leiterwagen – die anderen Geschwister sollten erst später, in der neuen Heimat, zur Welt kommen – hatte man sich auf den langen Weg von Millau in den Cevennen nach Norddeutschland gemacht. Preussen hatte sich noch immer nicht ganz von den Verheerungen des Dreißigjährigen Kriegs erholt, und um das Land wieder zu bevölkern, hatte man in Frankreich intensiv um hugenottische Fachkräfte geworben. Die preussische Toleranz in Religionsfragen hatte sich schnell herumgesprochen unter den geplagten, französischen Protestanten. Antoines Eltern waren allerdings bereits in Hessen-Kassel, besser gesagt: in Witzenhausen, hängengeblieben, sie hatten es erst gar nicht bis Preussen geschafft.
Aber auch hier waren sie freundlich empfangen worden. Man hatte ihnen eine Parzelle Land zugeteilt, außerhalb der Stadtmauern, ebenso ein Haus in zweiter Reihe, nicht direkt am Marktplatz und noch eine Spur windschiefer als die Häuser in der ersten Reihe, und auch das strohgedeckte Dach leckte ein wenig mehr in die Wohnräume als die der ersten Reihe. Die Rogets freute es dennoch, denn sogar ein Startkredit war ihnen zur Verfügung gestellt worden. Antoine war ganz ohne Angst vor Verfolgung aufgewachsen, die meisten der folgenden Geschwister – zehn an der Zahl, ebenso. Bis auf die drei, die ihre Geburt oder das Kleinkindalter nicht überlebt hatten.
Nachdem die Eltern beide recht jung und plötzlich verstorben waren – ein grässlicher Unfall, bei dem ein betrunkener Kutscher, eine Katze und ein Gewitter eine tragende Rolle gespielt hatten –, hatte Antoine mit siebzehn Jahren den Hof übernommen und war in der Folgezeit, um das Gedächtnis an seine Eltern und die hugenottische Verfolgung in der alten Heimat zu pflegen, leicht exzentrisch geworden. So dachten zumindest die anderen Leute in Witzenhausen über ihn.
Denn Antoine Roget hatte sich nach dem Tod seiner Eltern angewöhnt, sich nach Franzosenart, also erheblich vornehmer zu kleiden als die anderen, die durchschnittlichen, eingeborenen Witzenhäuser. Im Gegenzug, und wohl um einen wirklich authentischen Franzosen darzustellen, obwohl er seit seinem dritten Lebensjahr nicht mehr im Land seiner Geburt gewesen war, wusch er sich auch nach Franzosenart, nämlich überhaupt nicht mehr. Dafür parfümierte und puderte er sich wahrscheinlich mehr als jeder andere Mann im Fürstentum, den Fürsten eingeschlossen.
Da er, wenngleich er nicht trank, rote Backen hatte und eine dick geäderte Nase im Gesicht trug, sorgte der Kontrast aus weissem Puder und roten Adern für reichlich Gespött unter den Leuten. Vor allem, wenn sie zusahen, wie er, gekleidet mit Schnallenschuhen, Rüschenhemd und Pariser Gehrock, nicht nur durch Witzenhausen stolzierte, sondern in diesem Aufzug auch hinter seinen Ochsen und seinem Pflug herstapfte. Mit der Zeit war sein Hemd grau geworden vom Dreck des Alltags, die Fingernägel schwarz gerändert, der Rock starrend vor Schmutz. Nachdem seine Haare schon recht bald begonnen hatten, ohne ihn auszukommen, fügte er seiner kuriosen Erscheinung noch eine weiß gepuderte Perücke zu. Und zwar eine altmodische, lange Allongeperücke, wie sie selbst in Frankreich außer den Richtern niemand mehr trug. Er war schon bald eine lokale Berühmtheit. Fast so bekannt wie Harald, der Dorftrottel. Seine kleine, untersetzte Statur tat ein Übriges.
Die Kinder sangen Spottverse über den Mann, der aussah wie ein Trinker, aber jeden Trunk verschmähte. Und versuchten ihn zu reizen, weil sie sehen wollten, wie seine Perücke im Laufen wegflog. Das gelang ihnen jedoch nicht. Oder zumindest nur äußerst selten.
Antoine war ruhig, fleißig und besonnen, nur die Körperhygiene und seine ausgefallene Kleidung unterschieden ihn von seinen Mitmenschen.
Mit der merkantilistischen Wirtschaft des Fürsten hatte er nichts am Hut, er wollte in Ruhe seinen Hof bewirtschaften und ohne allzu große Sorgen überleben. Insofern unterschied er sich um nichts von den Eltern des Conrad Schweppeus, mit denen er flüchtig bekannt war, und die eine Reihe näher am Marktplatz wohnten. In der Regel blieben die Hugenotten Witzenhausens aus alter Hugenotten-Gewohnheit jedoch unter sich. Zumindest die erste Generation der Eingewanderten, die sich auch mit der deutschen Sprache schwerer taten als ihre Kinder.
Länger als die meisten heiratsfähigen Männer Witzenhausens blieb er Junggeselle. Eine Tatsache, die ihm zum sonstigen Spott auch noch den unterschwelligen, unausgesprochenen Vorwurf der Homosexualität einbrachte. Erst mit vierundreißig Jahren heiratete er Hubertine, eine grobschlächtige, leicht übergewichtige und nicht sonderlich wählerische Hugenotten-Bauerntochter, die zufällig auch noch seine Cousine dritten Grades war. Sie brachte immerhin etwas Reinlichkeit in seine Garderobe, wenngleich nicht ihren Gatten häufiger zum Waschtrog. Ein Jahr später erblickte seine Tochter Eléonore das Licht der Welt. Bei der Geburt verstarb Hubertine, danach wollte ihn keine Witzenhäuser Frau mehr heiraten. Antoine unterschätzte schlichtweg das Hygieneproblem.
So zog er Eléonore alleine groß und lehrte sie alles, was er wusste. Sie wurde ein hübsches, tüchtiges, aber auch zartes Mädchen, so ganz das Gegenteil ihrer Mutter.
Eléonore merkte bald, dass sie bei den anderen Kindern beliebter war, wenn sie sich öfter als einmal im Jahr wusch, so wie ihr Vater. Der ließ sie gewähren, ohne seine eigenen Angewohnheiten zu ändern. Als Eléonore sechzehn Jahre alt wurde, und somit alt genug war, suchte er ihr einen passenden Ehegatten.
Er fand ihn in der Person des Conrad Schweppeus.
So übersiedelte Eléonore mit sechzehn Jahren in die erste Reihe am Marktplatz, Südseite. Direkt am Brunnen.
Und wurde Mitte März Mutter des kleinen, schreienden, stinkenden Bündels Mensch, über das sich sein Vater Conrad gleich nach der Geburt seine drei Fragen stellte.
4. Kapitel: Der kleine Jacob
Der kleine Jacob sollte erst einmal für einige Jahre ein Einzelkind bleiben. Ungewöhnlich für diese Zeit. Jedoch, selbst wenn er da bereits hätte sprechen können, beschwert hätte er sich kaum.
Conrad kümmerte sich wenig bis gar nicht um seinen Nachwuchs, während Eléonore überwältigt war vom Angebot anderer Kümmerer in der Familie. Denn Antoines Eltern waren nicht alleine ausgewandert, sondern die ganze Sippe hatte Südfrankreich verlassen. Auch Antoines Geschwister waren fruchtbar und hatten sich fleißig vermehrt, und so wurde der kleine Jacob durch die Seite seiner Mutter von einer Unmenge an Hugenottentanten, Hugenottenonkeln, Hugenottencousinen und Hugenottencousins verwöhnt, gehätschelt, bespielt und geküsst. Lediglich die Hugenottenoma Hubertine, die ja bereits im Kindbett verstorben war, fehlte.
So lernte Jacob von klein auf neben dem hessisch-deutschen Dialekt Witzenhausens auch Französisch, die Sprache seiner Großeltern, an der die Hugenotten trotz der Verfolgung in Frankreich immer noch festhielten.
Sobald Jacob schulreif war, änderte sich fast alles. Seit zwanzig Jahren galt in Hessen-Kassel die allgemeine Schulpflicht, und so musste Jacob mit sechs Jahren zum ersten Mal das elterliche Haus am Marktplatz verlassen und mit fremden Kindern zusammen sein. Statt »Jacob« wurde er ab dann nur noch »Schwepp« gerufen. Das gefiel ihm weniger, und so bemühte er sich intensiv darum, dass seine Mitmenschen seinen Namen korrekt aussprachen. Mit der Betonung auf dem zweiten »e« und dem abgehackten »-us« am Ende. Leider meist vergebens. Sogar sein Lateinlehrer nahm seinen selbst verfassten Hinweis »Schweppe-us wie De-us, nicht Schweppeus wie Zeus« nicht so recht ernst, und die Kinder auf dem Schulhof sangen es umgekehrt, wenn sie spöttisch ein demütigendes Ringelreihen um den kleinen Jacob veranstalteten: »Schweppeus wie Zeus, nicht Schweppe-us wie De-us.«
Abgesehen von den Schwierigkeiten seiner Mitmenschen mit seinem Nachnamen verlebte Jacob jedoch eine einigermaßen zufriedene Kindheit. Er spielte mehr drinnen als im Freien, bastelte gerne und zeigte bereits früh Interesse für technisches Spielzeug, was er sich in der Regel selber baute. Die drei Brüder und zwei Schwestern, die ihm Jahre später folgten, waren so viel jünger, dass er sich Zeit seines Lebens wie ein Einzelkind vorkam.
Wenn er sich draußen aufhielt, dann saß er meist bei Harald, dem Dorftrottel, am Dorfbrunnen und half ihm, die Wassertropfen zu zählen. Einer Beschäftigung, der Harald bereits seit vielen Jahren mit vollem Einsatz nachkam; das Arrangieren der Misthaufen hingegen überließ Jacob dem fleißigen Harald zur Gänze alleine. Am Brunnen sitzend, beobachteten und zählten sie auch die Besucher des Freudenhauses – die fast immer von auswärts kamen. Nur ab und zu kommentierte er seine Erkenntnisse daheim, wenn sie beispielsweise den Amtmann dort gesehen hatten. Oder einen Gildemeister. Dann herrschte peinlich berührtes Schweigen am Tisch, das mit einem Gebet für die armen Sünder beendet wurde.
Manchmal, wenn das Wetter besonders schön war, gingen sie baden. Es gab einen kleinen Teich vor der südlichen Stadtmauer, in dem einige Frauen, auch Eléonore, regelmäßig ihre Wäsche wuschen. Die meisten Jungen vergnügten sich im Sommer in der Werra, was aber aufgrund des vielen Verkehrs dort nicht ganz ungefährlich war. Jacob verbrachte seine Zeit gerne mit dem etwa vierzig Jahre älteren Harald, also verbot es sich von selbst, mit den anderen in die Werra zu springen. Besonders die Waschtage liebten sie. Wenn Eléonore mit dem Leiterwagen und dem schweren hölzernen Waschtrog heranrumpelte, war das große Abenteuer nicht mehr weit entfernt. Sobald Eléonore den Trog nicht mehr brauchte, fuhren Jacob und Harald damit auf hohe See, also in den Teich hinaus. Harald hatte einen grotesk lang und stämmig geratenen Rumpf, jedoch enorm kurze Beine mit riesigen Quadratlatschen, so dass er im Ausgleich von Rumpf und Beinen normale Männergröße erreichte. Mit Hilfe seiner großen Füße und der kurzen Beine stand er auch in einem stark schwankenden Waschtrog seemännisch fest. Mit einem Tuch, das Harald mit seinen ebenfalls etwas zu klein geratenen Händen und Armen wie ein Segel hielt, während Jacob mit einem Reisigbesen ruderte, als ginge es um ihrer beider Leben, fühlten sie sich wie wilde, kühne Piraten auf den Weltmeeren. Beide konnten nicht schwimmen, sich nur gerade so über Wasser halten, im Hundepaddelstil. Mehr als einmal kenterten sie, zum Schrecken von Jacobs Mutter, die die beiden nicht mehr sah und nach Hilfe für die Ertrinkenden rief. Bevor sie dann prustend und lachend aus dem kopfüber schwimmenden Bottich auftauchten, unter dem sie sich versteckt hatten. Jacob bemerkte dabei fasziniert, wie man unter dem umgedrehten Bottich atmen konnte, weil das Wasser die Luft nicht verdrängte. »Man sollte doch meinen, dass der Bottich versinkt und uns die Luft ausgeht.« Harald brummte nur. »Ich will nicht ertrinken.«
Von seinem Vater hatte Jacob die große Statur geerbt, von seiner Mutter die schlanke Zartheit an allen Gliedern. Von seinem Großvater Antoine kam ein leichter Hang zur Exzentrik, die sich immer stärker äußerte, je älter er wurde, sowie, eventuell, die große Nase. Er brauchte sein Gesicht jedoch gar nicht zu pudern wie sein Großvater, er war auch so immer leichenblass. Wie ein Kind, das ständig die Sonne scheute. Was er auch tat. Früh schon erkannten die Eltern, dass Jacob nicht wirklich zum Bauern geboren war. Zu intelligent war er, und zu schwächlich an Körperkräften. »Der Herrgott hat etwas anderes vor mit dem Bengel«, war von nun an ein Satz, den Eléonore des Öfteren aus dem Mund ihres Gatten hören musste.
Der Merkantilismus des Fürsten, der seinem Großvater so gleichgültig gewesen war, sollte dann dem zwölfjährigen Jacob seine große Berufschance bieten. Der Fürst baute und investierte mittlerweile gigantische Summen in sein Fürstentum, oftmals mit geliehenem Geld. Mit dem Herkules, dem Oktogon und anderen Prunkbauten stattete er Kassel als Herrschaftssitz prächtig aus. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges schienen irgendwann einmal selbst auf dem Lande weitgehend überwunden, die Bevölkerung wuchs endlich wieder. Und ein Beruf, der typisch war für den steigenden Wohlstand, war der des Goldschmieds. Unmengen an Blattgold wurden benötigt und verarbeitet, sowohl für Ornamente an den Prachtbauten wie auch für die stets steigende Produktion goldverzierten Porzellangeschirrs. Von Silbergeschirr, silbernen Kannen und Bechern konnte der Hof ebenfalls nicht genug bekommen.
Die erste Porzellanwerkstatt war in Kassel schon siebzig Jahre zuvor eingerichtet worden, und sie konnte die Nachfrage nach Schüsseln, Tellern und Krügen längst nicht mehr abdecken. So hatte der Landgraf Wilhelm VIII. nach Meissener Vorbild kurzerhand eine große Porzellanmanufaktur gegründet. Bald schon war er es jedoch leid, dazu derart viel Geld für Goldschmiedearbeiten aus Augsburg, dem Zentrum der Goldschmiedekunst, auszugeben. Also wurde auch hier der eigene Nachwuchs gesucht und gezielt gefördert.
Der Hugenottenzug hatte nicht nur viele Menschen ins Land gebracht, sondern auch Wissen und Handwerkskunst. Die Handschuh- und Perückenmacherei, Gold- und Silberschmiedekunst, das waren Gewerbe, die es vorher auf hohem Niveau im Fürstentum Hessen-Kassel nicht gegeben hatte. So profitierte einer vom anderen. Der Fürst gab das Geld, die Hugenotten ihr Wissen, und alle arbeiteten gemeinsam an dem einen Ziel: Wohlstand für alle. Oder zumindest für die meisten.
Conrad Schweppeus gelang es, mit dem jungen Goldschmiedemeister Johann Ludwig Wiskemann, der selber erst seit Kurzem als Meister der Goldschmiedekunst selbstständig war, eine Lehrstelle für Jacob zu vereinbaren.
Die Zünfte waren immer unbedeutender geworden, und die Goldschmiedekünstler waren die Ersten, die auf freie Ausübung ihres Gewerbes im Fürstentum pochten. Und die damit Erfolg hatten. Die hohe Nachfrage nach Lehrlingen brachte auch den Vorteil, dass Conrad Schweppeus für die Ausbildung Jacobs nichts bezahlen musste außer Kost und Logis.
So sollte Jacob Schweppeus an seinem zwölften Geburtstag Witzenhausen verlassen und nach Kassel gehen, um dort eine fünfjährige Ausbildung als Goldschmied zu beginnen.
Doch dazu kam es vorerst nicht.
5. Kapitel: Balthasar Apitzsch
Denn während Jacob so dahinwanderte, unterwegs nach Kassel, begegnete er einem seltsam anmutenden Gefährt, voll beladen mit Gerümpel, Kesseln, Kannen und Werkzeug, das sich heftig schaukelnd seine Bahn über den mit Pfützen übersäten und von tiefen Löchern durchzogenen Weg brach. Jacob sprang schnell zur Seite, als die Kutsche laut klappernd vorbeirumpelte. Auf dem Kutschbock saß ein kleiner Mann von etwa dreißig Jahren, mit kleinen, schalkhaften Augen, geflickter Hose und Hemd sowie einem viel zu großen Hut auf dem Kopf. Jacob grüßte artig, der Kutscher antwortete.
Danach war Jacob wie vom Erdboden verschwunden. Niemand wusste, wo er abgeblieben war. War er einfach abgehauen? War er tot, hatte er unterwegs einen Unfall gehabt? War er ertrunken? Überfallen und ausgeraubt? Oder war er krank geworden und an der Ruhr krepiert? Aber wie sollte das geschehen auf der kurzen Strecke von Witzenhausen nach Kassel, die ja nur einen guten Tagesmarsch ausmachte?
Die Familie war ratlos, ganz Witzenhausen bestürzt. So ein freundlicher, aufgeweckter Bursche konnte sich doch nicht einfach so in Luft auflösen!
Es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis Anfang März des nächsten Jahres, bis sich das Rätsel auflöste.
Urplötzlich stand der kleine Mann mit dem großen Hut zusammen mit Jacob, der in dem einen Jahr sichtlich gewachsen war, in der guten Stube der Familie Schweppeus. Der Mann grüßte kurz, nahm demütig seinen Hut in die Hand und begann zu reden:
»Ich bin Euch eine Erklärung schuldig. Mein Name ist Balthasar Apitzsch, ich bin ein herumreisender Kesselflicker. Wie Ihr wisst, dürfen wir Kesselflicker, die anderswo auch Drouineure genannt werden, keiner Stadt näher als eine halbe Meile kommen. Daher arbeiten wir immer nur auf dem platten Lande. Als mir unterwegs Euer aufgeweckter Sohn begegnete, habe ich ihn überredet, mit mir zu reisen. Glaubt mir bitte, ich hatte nichts Unrechtes dabei im Sinn; ich suchte lediglich einen Mitreisenden zur Unterhaltung, dem ich unterwegs einiges beibringen könnte. Ich bin weder ein Störer noch ein Pfuscher.«
Er bat um etwas zu trinken. Conrad und Eléonore saßen immer noch wie versteinert auf der Bank, hin- und hergerissen zwischen Freude über das Wiedersehen und Ärger über den wunderlichen Kesselflicker und seine noch wunderlichere Erzählung. Eléonore goss einen Schluck verdünnten Wein in einen Tonkrug, Conrad grummelte nur: »Fahrt fort mit Eurer abenteuerlichen Geschichte.«
Balthasar holte Luft.
»Zuerst wollte er nur ein paar Tage mit mir reisen, bis wir einmal in der Nähe von Kassel stehen blieben. Um dann wieder alleine weiter zu wandern. Euer Sohn erzählte mir unterwegs, dass Ihr ihn zum Goldschmied ausbilden lassen wolltet, weil er für die Landwirtschaft zu zart sei. Daraufhin habe ich ihm angeboten, mit mir zu kommen. Ich könnte ihm ebenso beibringen, mit Metall zu arbeiten. Mit nützlicherem Metall als eitlem Tand und Schmuck. Da sagte er zu. Und ich muss sagen: Er war äußerst gelehrig.«
Er nahm erneut einen Schluck aus dem Becher, rülpste kurz und fuhr fort:
»Das ist aber auch der Grund, warum wir wieder hier sind: Euer Sohn ist so reich gesegnet an Geist und Talent, dass es an einen Kesselflicker verschwendet wäre. Daher bitte ich Euch demütig um Verzeihung dafür, dass ich Euren Sohn für ein Jahr mitgenommen habe. Ich glaube nicht, dass es ihm geschadet hat, ganz im Gegenteil, er hat viel gelernt. Aber von mir kann er nichts mehr lernen. Nehmt noch diese Geldbörse« – er hielt Conrad einen klimpernden Lederbeutel entgegen – »das hat er sich redlich verdient. Dieser talentierte Bursche kann jetzt hoffentlich immer noch die Goldschmiedekunst erlernen. Da ist er weit besser aufgehoben.«
Er ging zu Jacob, legte ihm freundschaftlich beide Hände auf die Schultern, nickte ihm zu und drehte sich auf dem Absatz um.
Einige Momente später hörten sie, wie die Kutsche laut scheppernd davonfuhr. Sie sahen ihn nie wieder.
Jacob verlor seinen Eltern gegenüber niemals ein einziges Wort über dieses Jahr. Was er erlebt hatte, wo sie gewesen waren. Nur was er gelernt hatte, das sahen sie bald. Besser gesagt: Die Resultate hinterher. Denn innerhalb von wenigen Tagen reparierte er in seinem Elternhaus alles, was sich in den vergangenen, vielen Wochen an kaputten Pfannen, gesprungenen Töpfen und sonstigem Metallzeug angesammelt hatte.
6. Kapitel: Johann Ludwig Wiskemann
Es bedurfte nur wenig Überredungskraft, und noch weniger Münzen von Conrad Schweppeus, um Jacob erneut eine Lehrstelle als Goldschmied zu beschaffen. Noch immer war die Nachfrage in Hessen-Kassel größer als das Angebot, und Meister Wiskemann war sogar ein klein wenig beeindruckt von Jacobs tolldreister Kesselflicker-Geschichte. Mit einem Jahr Verspätung ging es also los mit der Goldschmiedelehre. Gleich von Anfang an merkte Wiskemann, dass er mit Jacob einen besonderen Jungen in der Werkstatt hatte.
»Wo steht denn der Amboss?« war Jacobs erste Frage, als er zum ersten Mal in Wiskemanns Werkstatt eintrat.
Wiskemann lachte. »Das kommt noch, du vorwitziges Bürschlein. Jetzt zeige ich dir erst einmal deinen Schlafplatz.«
Jacob durfte im ersten Lehrjahr auf einer Bank in der Küche schlafen. Dadurch wurde er zwar immer als Erster geweckt, war aber in der Nähe des wärmenden Feuers.
»Du bist mein erster Lehrling, deswegen fehlt mir noch die Erfahrung damit. Am besten frag nicht viel rum, sondern mach einfach, was du für richtig hältst. Außer natürlich, es geht um Gold oder Silber. Da fragst du schon.«
Johann Ludwig Wiskemann war eine unauffällige Erscheinung von mittlerer Größe und Statur, mit dunkelbraunen Haaren und einem dünnen Schnauzbart. Er redete gerne und viel, aber nur mit mittlerer Lautstärke, brüllte nie und war warmherzig und humorvoll. Er war in allem gutes, bescheidenes Mittelmaß, außer in seinem Handwerk. Da war er ein Meister, zwar ein junger noch. Aber einer, der von sich reden machen sollte in naher Zukunft.
Später am ersten Arbeitstag kam der Meister lächelnd auf die Eingangsfrage seines Lehrlings zurück.