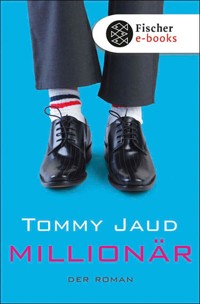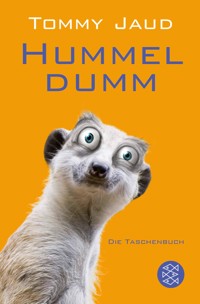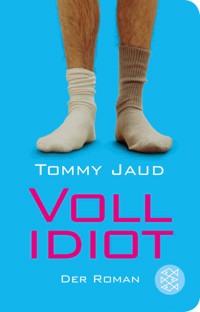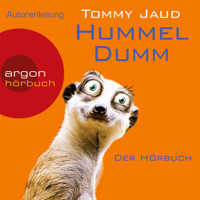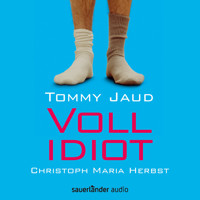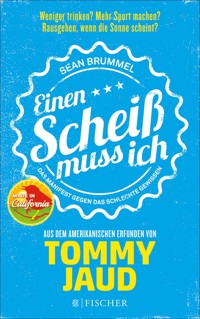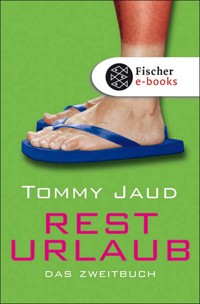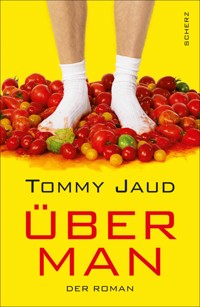4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Mann kann vor seinen Problemen fliehen – zumindest nicht mit seiner Mutter. Es läuft nicht gut für Nico Schnös, 47, den überforderten Controller mit der kaputten Brille. Warum gibt ihm seine Mutter seit dem Tod des Vaters täglich durch, was sie kocht und wie sie putzt? Was genau treibt Nicos Frau in dieser seltsamen Kuschelsekte, und warum flüchtet im Großraumbüro sogar der Saugroboter vor ihm? Als er bei einem Wutanfall eine Kaffeetasse auf den Finanzvorstand wirft, schickt sein Chef ihn in den Zwangsurlaub: Entweder Nico kommt entspannt zurück, oder er ist seinen Job los. Der kanarische Ferienclub ist paradiesisch schön – doch sämtliche Entspannungsversuche gehen nach hinten los. Vielleicht hätte Nico nicht ausgerechnet seine hyperaktive Mutter mitnehmen sollen: »Eine Zimmerkarte reicht, mein Sohn und ich machen eh alles zusammen!« Bald schon ahnt Nico: Paradies und Hölle können sehr nah beieinander liegen. Für alle, die Humor und Ferien mögen. Für alle, die schon mal mit den Eltern oder mit erwachsenen Kindern im Urlaub waren – oder es niemals vorhaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tommy Jaud
Der Löwe büllt
Roman
Über dieses Buch
Kein Mann kann vor seinen Problemen fliehen – zumindest nicht mit seiner Mutter.
Nico Schnös versteht die Welt nicht mehr. Warum werden alle um ihn herum immer dümmer? Warum versinkt seine Frau Mia plötzlich in Meditationen statt mit ihm und einem Glas Wein in der Netflix-Couch? Und warum gibt ihm seine Mutter seit dem Tod seines Vaters täglich durch, was genau sie kocht und putzt?
Bald ist Nico so gestresst, dass er seine Zahnschienen im Wochentakt durchknirscht. Im Großraumbüro flieht sogar der Saug-Roboter vor ihm. Und am Altglascontainer fragt man ihn schon, wie sein Restaurant heißt. Als Nico im Büro eine Tasse auf den Finanzvorstand wirft, schickt sein Chef ihn in den Zwangsurlaub: entweder Nico kommt wieder runter, oder er ist seinen Job los – als Beweis muss er das Passwort für seinen Fitness-Tracker rausrücken.
Nach erstem Zögern will Nico die Chance nutzen, er will es sich und der Welt beweisen: In nur einer Urlaubswoche wird er alles nachholen, was er zu Hause nicht schafft – Sport machen, ausschlafen, gesund essen und weniger trinken. Als Mia sich weigert, ihren Mann zu begleiten, nimmt Nico trotzig einfach seine einsame Mutter mit. Relaxen und gleichzeitig was Gutes für die Mama tun, das kann doch nicht so schwer sein. Nur hat Nicos Mutter eine ganz eigene Vorstellung davon, wie »ihr Schatz« sich am besten entspannt.
Der Roman für alle, die schon einmal mit ihren Eltern im Urlaub waren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über spontanen Urlaub und merkwürdige Mitreisende hat Tommy Jaud schon zwei Bestseller-Romane geschrieben: Nach ›Resturlaub‹ und ›Hummeldumm‹ ist ›Der Löwe büllt‹ die perfekte Ferienlektüre für alle, die schon mal mit ihren Eltern verreist sind – und für Leute, die sich auch ständig fragen, warum sie sich nicht entspannen können.
Der gebürtige Franke Tommy Jaud lebt und arbeitet noch immer freiwillig in Köln. Wenn er gerade mal keine Romane, Drehbücher oder Mails an Behörden schreibt, fährt er Mountain Bike mit seiner Frau, versucht zu meditieren oder verliert im Tennis gegen seinen Lektor. In einen Ferienclub traut er sich vorerst nicht mehr.
»Eine Zimmerkarte reicht, wir machen eh alles zusammen.«
Rosi Schnös
Für Wolfgang †
1
Warum wartet man fast eine Stunde, nur um in einer Achterbahn zu sitzen, die mit dem gnadenlosesten Katapultstart der Welt wirbt? Warum lässt man sich minutenlang und kopfüber in einer afrikanischen Überschlag-Riesensalatschleuder um die eigene Achse wirbeln, haarscharf an Wasserfontänen und Feuergarben vorbei? Und warum lässt man sich in einem Pappmaschee-Turm erst hundert Meter in die Höhe schießen, um dann, ganz oben, kurz vor dem freien Fall, auf die Kompetenz des TÜV Rheinland zu hoffen?
Ganz einfach: weil es einen Heidenspaß macht, die Kollegen mal kreischend und lachend in der Achterbahn zu sehen statt grübelnd vor dem Computer. Weil Wolfis dünne Ausreden vor einfach jedem Fahrgeschäft wieder für tagelange Lacher im Büro sorgen werden und natürlich weil unser verbissener Chef einfach nicht verlieren kann. Selbst im putzigsten Kinderfahrgeschäft kämpft Tim mit seinem Militärhaarschnitt, als ginge es um sein Leben.
Klar, die Attraktionen sind inzwischen alle so gebaut wie ein Hollywood-Film mit uns als Held. Erst starren wir hilflos und voller Respekt auf das Fahrgeschäft, aber dann nehmen wir unseren ganzen Mut zusammen und lassen uns auf das Abenteuer ein. Überwinden die Angst, schauen kurz dem Tod in die Augen und treten dann nach der Schlacht siegreich vor unser mitgereistes Volk und verkünden:
»Jetzt mal ehrlich, Leute, das ist doch scheiße, wenn ich keine einzige Maus treffe, da stimmt doch was mit den 3D-Brillen nicht!«
Gut. Für Tim und die Kinderattraktion Maus au Chocolat, wo man aus kleinen Wagen heraus mit Schokoladenspritzen auf virtuelle Mäuse schießt, gilt meine Theorie vielleicht nicht. Ich wurde übrigens Erster, zusammen mit Wolfi, und natürlich werden wir das Siegerfoto im Büro so hängen, dass Tim es jeden verdammten Tag sieht. Selbst jetzt, wo wir schon im berüchtigten Freifallturm Mystery Castle auf den engen Sitzschalen klemmen und die Gurte festschnallen, hadert er noch immer mit sich: »Letzter, also echt!«
»Es ist ja auch für Kinder gemacht!«, grinse ich noch, da geht es schon los. Die schweren Schulterbügel fahren runter, und als Wissenschaftler verkleidete Mitarbeiter prüfen hektisch, ob Gurte und Bügel geschlossen sind.
Kollegin Elena tippt mich an, sie sieht besorgt aus.
»Und was genau passiert jetzt, Nico?«
»Na ja … sie katapultieren uns hoch, und dann lassen sie uns wieder fallen, das ist eigentlich alles.«
»Und wenn da irgendwas versagt?«
»So wie unser Chef eben?«, lache ich.
»Hab ich gehört!«, kann Tim gerade noch zurückkeifen.
Kunstnebel quillt aus dem Boden, dramatische Musik setzt ein, und die Wissenschaftler geben letzte Anweisungen.
»Brillen, Schlüssel, Kappen – alles, was runterfallen kann, bitte vor eure Sitze legen!«
In Windeseile landet allerlei Zeugs vor den Füßen der Leute. Ich nehme meine ohnehin schon angeknackste Brille ab und lege sie in meine Kimba-Kappe, als mein Handy klingelt. Ausgerechnet jetzt. Auf dem Display das Foto meiner lächelnden Mutter, wie sie glücklich in ein Stück Schokolade beißt. Wie immer gehe ich ran.
»Nico! Bin ich froh, dass ich dich erwische!«
»Mama! Is schlecht gerade, weil ich bin in ’nem Fahrgeschäft und werd jede Sekunde –«
Nicht jede Sekunde.
Jetzt!
Mit einem ohrenbetäubenden Lärm werden wir nach oben geschossen. Elena schreit, als würde man ihr den Magen rausreißen, Tim beißt die Zähne zusammen, und ich kralle mich mit meinem Magen auf sechs Uhr an Handy und Bügel fest.
Wir sind oben an der Turmspitze. Kleben ängstlich auf unseren Sitzschalen, die Füße baumeln im Nichts. Ein kalter Luftzug geht, Lichtblitze zucken. Aus den Lautsprechern wummert ein unheilverkündender Bass. Sonst gespannte Stille. Angespannte Muskeln. Starre Blicke. Wissen ja alle, was gleich passiert. Erst jetzt bemerke ich, dass ich mein Handy noch immer aufs Ohr drücke.
»Mama? Was ist denn?«
»Papa ist gerade gestorben.«
»Hahahaha!«, lacht der irre Wissenschaftler, und weitere Blitze zucken. Ich vernehme ein Klickgeräusch, und dann rase ich zu fauchendem Donnergrollen in wahnwitziger Geschwindigkeit in eine schier endlose Tiefe.
2
Wie sagt man so schön: das Jahr kannste in die Tonne kloppen! Konnte ich auch. Endlich im Flieger. Flucht nach vorne. Und die Stadt mit K muss ich auch nicht mehr sehen, wir sind nämlich eben durch die dicke Wolkendecke durch, und wolkentechnisch versteh ich den lieben Gott: lieber mal den Deckel drauf, wir wollen unseren Müll ja auch nicht sehen. Besser Musik an und ›Hey Kölle, do bes e Jeföhl!‹
Die Frage is nur, welches: Liebe? Angst? Stolz?
Also, Liebe kann’s nicht mehr sein nach dem letzten Jahr, dann schon eher Angst. Die Angst, ungewollt Teil eines sinnfrei gekachelten Nichts zu sein. Stolz? Auf was genau sollte man stolz sein in einer Stadt, deren Stadtrundfahrten genau zwei Stopps haben: eine große, schwarze Kirche mit Gerüst und das Schokomuseum. Let’s face it: Köln ist nicht mehr als eine in die Jahre gekommene, selbstverliebte Großstadt-Simulation. Wär so gerne Metropole, ist aber halt doch nur irgendwas zwischen Museum und Mülltonne.
Und ich?
Bin ein Mann auf dem Weg, hat mir ein kauziger Psychiater gesagt. Das hab ich als professionelle Hilfestellung für mein Leben dankbar angenommen und bin sofort gegangen. Aber das war ja noch vor dem Vorfall im Büro, der mich überhaupt erst hierhergebracht hat. Jetzt muss ich mich entspannen. Durchatmen, neue Kraft tanken, die Dinge richten. Fern der Heimat und mit Abstand. Und ich hab ein gutes Gefühl, denn während der Dom immer kleiner wird, das Stadion zur Schachtel und der Rhein zum Strich, geht mein Puls schon runter von 90 auf 83. Das sind nachprüfbare Zahlen, und die besagen: Ich entspanne mich schon!
»Schatz? Magst du einen Zitrone-Ingwer-Bonbon?«
Und das, obwohl ich mit meiner Mutter fliege.
»Danke«, antworte ich lächelnd und bemerke den Abdruck des Zeitschriftennetzes vom Vordersitz auf meinem nackten Knie, »aber Zitrone-Ingwer ist nicht so mein Geschmack.«
»Die sind auch zuckerfrei.«
»Das ändert aber nichts am Geschmack, oder?«, gebe ich zu bedenken.
»Doch! Die mit Zucker sind viel süßer!«, insistiert meine Mutter, und sofort vermeldet die Fitnessuhr eine geringfügige Entspannungseinbuße. »Immer locker durch die Hose atmen«, hat meine Frau Mia mir geraten. Ja, das mag für Ruhrpott-Mütter gelten, aber wie steht’s mit Witwen aus Pulheim? Offenbar nicht so gut, denn unter den kurzen, weißen Haaren meiner Mutter verhärten sich die Gesichtszüge.
»Willst du jetzt einen Bonbon oder nicht?«, fragt sie grummelig, denn das mag sie nicht, wenn man ihre Fürsorge nicht annimmt. Ich wiederum finde es immer nett, wenn man ein Nein auch mal akzeptiert.
»Mama. Ich hasse Ingwer, und das weißt du.«
»Ja, aber ich dachte, wenn Zitrone dabei ist, magst du ihn vielleicht?!«
Meine Uhr zeigt nun wieder einen Puls von 90.
»Ich mag ja auch keine Schildkrötenkotze, wenn Schokolade dabei ist!«
»Also, das ist ja jetzt wirklich ekelhaft!«, entrüstet sie sich und steckt die Bonbontüte zurück in ihre riesige orangene Stoffhandtasche. Ich grabe meine Zähne tief in die Unterlippe. Meine Mutter wendet sich ab.
102.
Na prima. Jetzt ist sie beleidigt, und das wird auch bis zum Atlantik so bleiben, wenn keiner nachgibt. Also tätschle ich ihre Hand, setze ein freundliches Gesicht auf und sage:
»War ein blödes Beispiel, Mama. Lass uns einfach nicht mehr über Ingwer reden.«
»Ich hätte dir erst gar keinen Bonbon anbieten sollen!«
»Stimmt! Das war ein Riesenfehler!«, antworte ich trotzig, verschränke meine Arme, friemel mein Nasenspray aus der Jeanstasche und nehme zwei von meiner Mutter skeptisch beäugte Pumpstöße pro Nasenloch.
»Was??«, frage ich genervt.
»Nichts …«, sagt sie und schaut wieder in ihre Zeitschrift.
Gut, denke ich mir, schließe die Augen und stelle mir vor, wie es sich anfühlen würde, könnte ich den Sitz ein klein wenig nach hinten kippen. Also ohne von den Knien meines dauerbrabbelnden Hintermanns erdrückt zu werden. Soll ich meinen Idiotenschutz-Kopfhörer aus dem Gepäckfach holen? Nur, dann müsste ich meine Mutter bitten aufzustehen. Sie sitzt da, wie von einer Betonfachfirma in den Sitz gegossen. Als Steinmonument mit komplett neuer, modischer Kurzhaarfrisur. Irgendwas zwischen Birgit Schrowange und Jamie Lee Curtis. Erst war ich entsetzt – schließlich wollte ich ja mit meiner Mutter in den Urlaub und nicht mit Birgit Schrowange.
»Das ist ein Pixie-Cut, Nico. Der ist total im Trend! Findest du nicht gut?«
»Doch, doch. Gut! Nur ungewohnt«, hab ich geflunkert, weil ich ja will, dass die Mama eine gute Zeit hat mit mir im Urlaub nach dem schlimmen Jahr. Daher ist auch unser Bonbon-Zwist vielleicht ein wenig albern.
»Mama?«
»Ja?«
»Das ist lieb, dass du mir Bonbons anbietest, ich mag halt einfach nur keinen Zitrone-Ingwer-Geschmack.«
»Es ist alles gut, und du hast recht.«
Mein Gott, wie ich diesen Satz hasse! Weil nämlich gar nichts gut ist und ich natürlich gar nicht recht habe in ihren Augen, doch statt das einfach mal zuzugeben, beendet Frau Mutter ihre ingwereske Scheindebatte wie der hinterletzte Politiker. Und natürlich bemerkt sie, dass ich meine Arme verschränke und auf das knutschende Pärchen in der Sitzreihe neben uns starre.
»Was stöhnst du denn jetzt, Nico? Freu dich doch lieber, dass dein Chef dir so eine schöne Reise schenkt.«
»Hast ja recht.«
»Du darfst wirklich nicht so negativ denken. Nicht dass du noch vor mir stirbst!«
»Wieso?«, frage ich verwundert, »was wäre denn dann?«
Nur meine Mutter ist noch verwunderter als ich.
»Wieso?! Na, dann bin ich ja ganz alleine!«
»Und was ist dann mit mir?«
»Nix! Du bist dann ja tot!«
Ich atme ein, und ich atme aus. Dann ziehe ich das Bordmagazin aus dem Netz des Vordersitzes, gewinne so 20 Millimeter kostbaren Sitzabstand und beginne zu blättern. Aha: Phoenix wird das 17. Condor-Ziel in Nordamerika. Da bin ich aber froh! Meine Mutter nicht. Sie schaut mich immer noch an.
»Also, das würde ich nicht schaffen, wenn du vor mir stirbst!«
Stöhnend stecke ich das Magazin zurück in die Sitztasche.
»Ich sterbe nicht vor dir – versprochen!«
»Das kann man nicht versprechen. Es sei denn, du willst mich umbringen …«
»Wie kommst du denn darauf?«, frage ich perplex.
»Das stand in so einem Artikel im Internet, dass es meist die Söhne sind, die ihre Mütter umbringen.«
»Ich werde dich nicht umbringen, und ich werde versuchen, nicht vor dir zu sterben, Mama.«
Meine Mutter tätschelt glücklich meine Hand.
»Danke, mein Schatz!«
Noch über drei Stunden Flugzeit. Meine Mutter sitzt direkt neben mir in der Mitte. Ich dachte ja, der Fensterplatz wäre toll für sie, damit sie rausschauen kann und ihre Ruhe hat, doch mein gut gemeinter Vorschlag kam nicht wirklich gut an.
»Bitte, Nico, tu mir das nicht an! Wenn das Flugzeug kaputtbricht, dann werde ich doch rausgesaugt wie ein Krümel …«
»Das wird nicht passieren, und wenn doch, rette ich dich mit deiner Krümelbürste!«
»So ein Quatsch! Außerdem zieht’s wie Hechtsuppe am Fenster, und ich will ja nicht ausgerechnet dann krank werden, wenn du mal Zeit für mich hast.«
»Was? Ich besuch dich fast jede Woche!«
»Der Frank wohnt sogar wieder bei seiner Mutter.«
»Deswegen ist er ja auch tablettenabhängig.«
Jetzt sitze ich am Fenster und meine Mutter direkt neben mir in der Mitte. Der Gangplatz war für meine werte Frau Mama nämlich auch eher Bedrohung als Sitz, weil sie bei RTL gesehen hatte, dass sich besonders am Gang jede Menge multiresistente Keime tummeln. Mein Argument, dass ihr Platz ja eigentlich unser freier Mittelsitz sei, weil wir Premium Eco fliegen, wollte sie nicht wirklich gelten lassen.
»Wenn es unser freier Mittelsitz ist, kann ich mich da ja hinsetzen, oder?«
»Ja, aber eigentlich ist er ja deswegen frei, damit man mehr privacy hat!«
»Ich kann kein Englisch!«
Und ich kann mich keinen Millimeter bewegen, weil ich nun halt trotz Upgrade zwischen einem hessischen Dauerbrabbler und einem holländischen Riesen klemme wie ’ne Scheibe Schinken in einem Rewe-Sandwich. Links das eiskalte Flugzeugfenster, auf dem einst freien Mittelsitz meine Ingwer-Mutter mit beiden Armen auf der Lehne.
»Mama, kann ich vielleicht …?«
»Die Armlehnen gehören immer dem Mittelsitz, stand in der Brigitte!«
»Und so ein bisschen ragst du halt schon in meinen Sitz!«
»Mir schmeckt’s halt! Und ich bin ja trotzdem fit, findet der Dr. Parisi! Zweiundneunzig werde ich, hat er gesagt!«
»Ich freu mich …«, sage ich und stelle mir kurz die kommenden 18 Jahre vor. Werden wir dann beide gleich schnell kauziger, oder hole ich noch auf?
Mutter und Sohn. Sie 74, ich 47 – man kann die Ziffern einfach rumdrehen, aber ähnlicher macht uns das nicht. Vorhin, beim Check-in, als sie vom Klo kam und plötzlich vor mir stand, da hab ich mich sogar erschrocken: ›Wer zum Teufel ist die pummelige, traurige Frau mit der beigen Fleece-Weste und dem weißen Kurzhaarschnitt?‹. Nur hat mich die pummelige, traurige Frau ganz genauso erschrocken angeschaut in dem Moment, und bestimmt hat sie sich gedacht: ›Wer zum Teufel ist der hektische Obdachlose mit der zerfledderten Löwenkappe und dem geklebten Brillenbügel?‹. Vermutlich sind wir einfach noch ein wenig angespannt. Ist unsere längste Zeit zusammen, seit ich in die Tiefe gerauscht bin im Phantasialand und Papa ›in die Stille gegangen ist‹, wie die Japaner sagen. Ich bin bei ’nem japanischen Autokonzern, daher weiß ich, wie die sagen. Meine Mutter mag das mit dem ›in die Stille gehen‹, weil es nicht so schlimm klingt wie ›gestorben‹ oder ›tot‹ – oder ›kapott‹, wie der Kölner sagt. Klingt erst mal hart für Außenstehende, aber so herzlos ist das ›kapott‹ jar nit jemeint, der Kölner kann nämlich auch Trost spenden, dann sagt er so was wie: ›Maach dir keine Kopp, ming Jong, wat fott es, es fott.‹
Aber Schluss mit der Trübsal! Ich hol mir jetzt meinen Schallschutz-Kopfhörer, setze mich zum Gang und dann entspanne ich mich einfach mit meiner Urlaubsplaylist. Charlotte Gainsbourg. »Rest«. Ich mag ihre Stimme, vor allem wenn sie französisch singt. Irgendwie beruhigend, als dürfte man seinen Kopf in den warmen Schoß einer liebevollen Frau legen. Das Lied läuft keine Minute, da klopft meine Mutter gegen den Kopfhörer.
Ich nehme ihn ab.
»Bei Ingwer musst du immer schauen, dass er nicht aus China kommt.«
»Da … werd ich mal drauf achten, danke.«
Meine Mutter wirkt zufrieden. Ich setze den Kopfhörer wieder auf, lausche Charlotte Gainsbourg und schiele auf meine Fitnessuhr. 109. Einhundertneun? Ich nehme den Kopfhörer wieder ab.
»Mama, damit ich’s verstehe: Du klopfst an meinen Kopfhörer, um mir zu sagen, worauf ich beim Ingwerkaufen achten muss? Obwohl ich gar keinen Ingwer mag?«
»Na ja, über irgendwas müssen wir doch reden!«
»Also, von mir aus eigentlich nicht …«
»Am besten ist der aus Peru! Im Restaurant würde ich da immer fragen. Die Gundi hat neulich auch gefragt, und stell dir vor – die Bedienung hatte keinen Schimmer, wo sie ihren Ingwer herhaben!«
»Wahnsinn!«, sage ich und genehmige mir zwei Hübe Nasenspray.
»Das gefällt mir nicht, dass du so viel Nasenspray nimmst!«, merkt meine Mutter kritisch an.
»Ohne Spray krieg ich aber keine Luft!«
Als wäre das ihr Stichwort, greift meine Mutter in ihre Handtasche, ohne hineinzuschauen natürlich, und holt eine bläuliche Plastikflasche mit Knubbelrüssel raus, die sie mir präsentiert wie einen Goldbarren. Ich weiche angewidert zurück.
»Was zum Teufel ist das?«
»Meine Reisenasendusche! Frisch desinfiziert. Ich füll sie dir auch auf und schüttel sie durch, damit sich das Salz verteilt. Dann kannst du aufs Klo damit und … warum starrst du mich denn jetzt so an?«
Ja, da hat sie ausnahmsweise mal recht: Ich starre sie an. Und ich muss an diesen Artikel denken, in dem es um Söhne geht, die ihre Mütter umbringen – irgendwie würde ich ihn plötzlich gerne mal lesen.
»Mama? Warum hast du so was im Handgepäck?«
»Also manchmal versteh ich deine Logik nicht. Damit ich meine Nase durchspülen kann natürlich, was dachtest du denn?«
»Nichts natürlich, wie immer. Und ich will auch gar nicht wissen, wie das funktioniert!«
»Also, man hält den Rüssel an das eine Nasenloch, und dann fließt das Salzwasser durch die Nasenhöhle durch, und aus dem anderen Nasenloch kommt dann halt alles raus, was die Nase verstopft hat, also zum Beispiel –«
»Mama, danke, reicht! Und steck das Ding weg!«
»Wenn der Schmodder gelb ist, dann bist du erkältet!«
»Aufhören!«
»Also, irgendwie mache ich ja alles falsch …«, seufzt meine Mutter enttäuscht.
»Machst du nicht, ich will nur keine … vergiss es! Guck, da, das Essen kommt!«
»Echt?«
Nicht ohne ein drittes Mal gegen mein Knie zu dözen, überreicht mir ein übellauniger Steward zwei heiße Aluschalen. Wir öffnen sie und schauen ein wenig ratlos auf deren Inhalt. Käse, Reis und irgendeine Gemüse-Lumumpe. Meine Mutter schiebt die Nasendusche zur Seite und piekst in den Käse.
»Ist das dieser Quietschekäse? Dieser … Hayali?«
»Halloumi, meinst du. Hayali moderiert das Morgenmagazin. Leider.«
»Also wenn er beim Essen quietscht, dann ist es Hayali, sagt die Birgit!«
Meine Mutter piekst selig in den Käse. Er quietscht.
»Ah! Es ist tatsächlich Hayali!«
»Na dann!«
Leider ist der Lumumpen-Verteiler inzwischen drei Reihen hinter uns und somit zu weit weg für eine Beschwerde. Hauptsache, der Mama geht’s gut. Und es geht ihr gut. Bei Löwen heißt es ja immer, du darfst sie streicheln, während sie fressen. Meine Mutter hört auf zu streiten, wenn das Essen kommt. Aber irgendwann ist so eine kleine Aluschale halt auch mal leer. Recht schnell sogar im Fall von meiner Mama Rosi.
»Darf ich dich denn mal was fragen, mein Schatz?«
»Klar!«, sage ich.
»Das schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum, aber ich hab mich nicht getraut, weil du so viel Stress hast.«
»Mama! Du kannst mich immer alles fragen.«
»Aber du musst versprechen, dass du nicht wieder ausflippst oder mit irgendetwas wirfst!«
»Mama, bitte, wie stellst du mich denn hin?«, frage ich empört.
»Also gut. Hast du dir denn schon was überlegt für den Todestag vom Papa? Was wir da machen?«
Ich lege die Gabel in die leere Aluschale. Wische meinen Mund sauber. Schaue erschrocken zu meiner Mutter.
»Der Todestag ist im Urlaub?«
»Nico, ich bitte dich, ich dachte, deswegen fliegen wir dahin. Weil der Papa und ich da so oft waren und damit ich nicht alleine bin, hast du gesagt!«
»Absolut!«, lüge ich, »aber ich war ja noch nie da, und du kennst den Club doch viel besser und weißt was Papa da gerne gemacht hat.«
»Also eigentlich hat er da gar nichts gern gemacht.«
»Und warum ist er dann immer wieder mitgekommen?«, frage ich verdutzt.
»Komisch!«, murmelt meine Mutter nachdenklich, »das hab ich ihn nie gefragt.«
Vielleicht hätten wir ja im Vorfeld doch ein wenig genauer über den Urlaub sprechen sollen. Findet meine Fitbit auch. 114!
»Also … wir könnten eine ganz besonders schöne Kerze kaufen, sie anzünden am Strand und an den Papa denken.«
»Die bläst der Wind doch sofort wieder aus!«
»Dann … könnten wir eine ganz besonders schöne LED-Kerze kaufen, sie einschalten am Strand und an den Papa denken?«
»Der Papa mochte so künstliche Kerzen doch gar nicht!«
Ich nehme meine Brille ab, rubbel mir die Augen und überprüfe den Klebestreifen am Bügel. Ich merke, wie ich meine obere Zahnreihe in die Unterlippe drücke. Auch so ein Stresszeichen, hat mein Zahnarzt gesagt, nachdem ich die dritte Knirschschiene durchgebissen hatte, und deswegen schläft auch Mia oft nicht mehr neben mir, weil ich mich beim Schlafen angeblich anhöre wie eine Straßenbahn in der Kurve. Und wegen des Schnarchens natürlich und dem Beingezappel. Und wegen der anderen Geräusche. Als ich meine Brille wieder aufsetze, bemerke ich, dass meine Mutter mich noch immer erwartungsvoll ansieht.
»Ich überleg mir was, versprochen.«
»Gut!«
Ich setze den Kopfhörer wieder auf und schaue auf den Bildschirm über uns: Noch zwei Stunden 37 bis zur perfekten Entspannung: Sommer, Sonne, Strand und Ausschlafen im beliebtesten Ferienclub der Kanaren. Was soll da schon schiefgehen?
3
Und da steh ich nun am Fenster im Haus meiner Eltern, schaue raus in die Einfahrt und fühle mich wieder wie der kleine Junge, der auf seinen Papa wartet, wenn er von der Arbeit kommt in seinem hellen Anzug und mit dem braunen Aktenkoffer.
Wo zum Teufel ist die Zeit hin? Ist das alles jetzt wirklich schon vierzig Jahre her? Gab’s nicht eben noch Abendbrot mit Schinken, Käse und Gürkchen und danach Kimba, der weiße Löwe im Fernsehen?
Eben noch.
So fühlt sich’s an. Tatsache ist, dass ich 47 bin und nicht auf meinen Vater warte, sondern auf den Pfarrer. Meine Mutter ist noch immer völlig durch den Wind, und wenn sie gerade mal keinen Beileidsanruf annimmt, dann wirbelt sie durchs Haus wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ein Telefonanruf nach dem anderen und jedem muss sie die gleiche Geschichte mit der Waschanlage erzählen und dass er noch leben würde, wenn sie ihn nicht dorthin geschickt hätte, und dass sogar die Polizei an der Waschanlage war und bei ihr auch, aber einmal die Woche müsse man doch das Haus durchsaugen und das wäre doch angenehmer für beide, wenn er dann nicht im Weg steht.
Und natürlich versichern meiner armen Mutter alle, dass das, was da in der Waschanlage passiert ist, nicht ihre Schuld sei. Doch meine Mutter hadert. Mit sich, dem Schicksal und dem Staubsauger, vor einer Woche erst habe sie überlegt, einen leiseren zu kaufen ohne Kabel und dann …
»Selbst wenn«, tröste ich meine Mutter, »es holt ja unseren Georg nicht zurück!«
Mir selbst geht es den Umständen entsprechend gut. Mia unterstützt mich am Telefon und einmal war sie auch hier, aber da fühlte sie sich fehl am Platze, und irgendwie war es auch so: Sterben ist Privatsache. Seit zwei Tagen schlafe ich nun schon wieder in meinem alten Kinderzimmer, spiele neue Firmware auf den Router meiner Mutter oder schmiere Brote mit Schinken, Käse und Gürkchen. Das Kim-Wilde-Poster hängt noch immer, ein seltsames Gefühl beim Aufwachen.
Meine Mutter schläft so gut wie gar nicht. Wenn ich in die Essecke komme, sitzt sie immer schon da mit einem Glas Tee und ohne Licht und schaut mich vorwurfsvoll an.
»Dass du schlafen kannst, Nico!«
»Ja, dann trink halt mal einen Wein mit!«
»Um die Zeit?«
»Ich meine natürlich, am Abend.«
»Also, um die Zeit schon Wein, das wär ja Wahnsinn!«
Irgendwie reden wir aneinander vorbei, und so richtig helfen kann ich meiner Mutter nicht, merke ich. Ich bin einfach nur bei ihr, versuche, sie zum Essen zu überreden, und fahre mit ihr zu den Terminen, die so anstehen.
Es sind eine Menge Termine. Wenn mein Papa gewusst hätte, was so eine Beerdigung für ein Gehampel ist, dann hätte er sicher noch ein paar Jahre drauf gelegt. Das Organisatorische hat ohnehin Bestatter Uli in die Hand genommen. Uli, ausgerechnet Uli, mit dem ich zusammen auf der Schule war, und dann seh ich ihn jetzt wieder, doch statt ein Bier zu trinken und über die alten Schulzeiten zu quatschen, suchen wir wie in Trance einen Pappelsarg mit Kordelmotiv aus und eine biologisch abbaubare Urne. Uli tröstet meine Mutter und mich, und er macht es gut, es ist ja sein tägliches Geschäft, und sterben müsse schließlich jeder, sonst wäre ja irgendwann die Schlange vor der Achterbahn zu lang. Da hat er recht.
Sonst macht Uli noch in Immobilien. Also, falls mit dem Haus was anstehen sollte – einfach melden. Oder wenn ich mal wieder eine Party mache in Pulheim, DJ sei er nämlich auch. Wohnen, Feiern, Sterben – sicherer kann man beruflich eigentlich nicht fahren. Bei der Todesanzeige tue ich mich schwer, Uli schickt mir Vorlagen als pdf, sie tauchen in meinem Maileingang zwischen einer Netflix-Serienankündigung und dem Newsletter des Kölner Weinkellers auf: Netflix hat die Serie »Wer zuletzt kocht …« hinzugefügt und das Frühlingswein-Angebot mit sechs Flaschen zum Preis von fünf gilt nur noch bis Montag.
Soso. Na dann.
Und wieder klingelt das Telefon, doch dieses Mal sagt meine Mutter, dass ich rangehen soll, sie könne nicht mehr. Also erzähle ich die Geschichte. Dass alles wie aus heiterem Himmel kam und viel zu früh und die Sanitäter ihn nicht reanimieren konnten, ja, tatsächlich, in der Autowaschanlage … und wie die meisten Anrufe endet auch dieser mit einem betroffenen: »Da sieht man mal – so schnell kann’s gehen!« und in meinem Fall:
»Gut, dass Sie da sind. Ihre Mutter braucht Sie jetzt. Aber wenn Ihnen mal die Decke auf den Kopf fällt, kommen Sie gerne jederzeit vorbei!«
Ich bedanke mich und lege auf.
»Wer war das denn?«, krächzt meine Mutter schwach.
»Eine Frau Jarck von Fielmann.«
»Fielmann? Da war ich ja ewig nicht. Die wollen uns doch nur in den Laden ziehen!«
Noch bevor ich widersprechen kann, klingelt es schon an der Haustür. Es ist der Pfarrer.
»Frank Korn, der Pfarrer. Mein herzliches Beileid!«
»Danke. Nico Schnös, der Sohn. Kommen Sie rein.«
Der Pfarrer ist jünger als ich und sehr viel größer, aber mindestens genauso gestresst. Wegen der kurzen Haare und dem Vollbart sieht er auch gar nicht wie ein Pfarrer aus, sondern wie ein Basketballer, den man wegen einer Sportveranstaltung in Hemd und Jackett gesteckt hat.
»Gut, dass Sie da sind«, sagt er mit warmer Stimme, »Ihre Mutter braucht Sie jetzt!«
»Gut, dass Sie da sind«, bedanke ich mich, frage dann aber: »Warum eigentlich?«
»Ja, ohne Trauergespräch keine Trauerfeier. Darf ich die Schuhe anlassen?«
»Natürlich!«, antworte ich.
»Die Schuhe bitte ausziehen!«, knarzt es aus der Küche.
Gut, dass ich da bin.
»Ich hab eben erst durchgewischt!«
Meine Mutter braucht mich jetzt.
Zu dritt sitzen wir bei Leitungswasser und einer bereits geöffneten Ritter Sport Joghurt am Esstisch. Meine Mutter hat vergessen, Kaffee zu machen, und ich die Puddingteilchen von Merzenich. Als ich die dicke grüne Kerze anzünde, fällt mir auf, dass die Streichholzschachtel wohl ein etwas älteres Mitbringsel von der Frankfurter Buchmesse ist, es steht ›Stirb ewig‹ drauf und ›Der neue Roman von Peter James‹. Ich lasse die Schachtel unauffällig verschwinden. Zu spät, der Basketball-Pfarrer hat’s gesehen.
»Guter Thriller!«, schmunzelt er und findet es auch nicht schlimm, dass es nichts zu essen gibt bei uns.
»Ich hatte ein Brötchen eben nach dem Religionsunterricht, und normalerweise werde ich auch vollgestopft mit Torte und Schnaps, von daher bin ich ganz froh, dass Sie nicht bei Merzenich waren.«
»Stopp!«, protestiert meine Mutter und hebt die Hand, »zu Merzenich wollte mein Sohn! Ich hab nur den Kaffee vergessen. Aber Tuc haben wir noch!«
Sie springt auf und holt eine Packung Salzkekse – und ihre rote Krümelbürste.
»Wie gesagt: tut mir leid, Herr Pfarrer. Mehr ist gerade nicht im Haus.«
»Gar nicht schlimm!« Der Pfarrer öffnet die gelbe Packung mit den Salzkeksen, und die Krümelbürste kommt zum Einsatz.
»Praktisch, oder?«
»Absolut. Und ganz ohne Strom!«, stimmt Pfarrer Korn ihr zu. In meiner Jeanstasche kneift ein Peter-James-Streichholz. Irgendwie hab ich mir das alles würdevoller vorgestellt.
»Wollen Sie nicht doch noch einen Kaffee?«, fragt meine Mutter, »dann spring ich gerade auf!«
»Du springst jetzt mal nirgendwohin!«, entfährt es mir ein wenig barsch, und der Pfarrer zückt dankbar ein schwarzes Notizbuch:
»Vielen Dank, ich brauch wirklich keinen und muss auch gleich weiter zu einem achtzigsten Geburtstag.«
Wir schauen den Pfarrer beide an.
»Entschuldigung … Da hab ich nicht nachgedacht. Bin auch seit sechs Uhr auf den Beinen.«
»Nicht schlimm!«, sagt meine Mutter und erhält vermutlich zum Dank ein Blatt mit dem Ablauf der Bestattungsfeier.
»Aber erzählen Sie mir doch lieber mal, was Ihr Ehemann und Vater für ein Mensch war. Ich hab nur mal eine Couch bei ihm gekauft vor Jahren, und in die Kirche hat es ihn ja nicht so recht gezogen, von daher weiß ich gar nicht viel.«
Ich kratze mich am Kopf und schaue auf die leere Seite des Notizbuchs. Was mein Vater für ein Mensch war? Wie soll man das denn so spontan beantworten? Denkt sich vermutlich auch meine Mutter, die das Blatt mit dem Ablauf der Trauerfeier studiert, so als hätte gar keiner gefragt.
»Ich lese hier ›Bibelspruch‹ als dritten Punkt, könnte man den weglassen?«
Der Pfarrer legt seinen Salzkeks zurück auf die Tischdecke. »Den Bibelspruch weglassen?«
»Ja!«, bestätigt meine Mutter und greift zur Krümelbürste.
»Ich könnte den Bibelspruch kurz halten und in die Begrüßung packen.«
»Das wäre nett!«
Der Pfarrer schreibt etwas in sein Notizbuch, isst den Keks, und schon rattert die Krümelbürste meiner Mutter. Ich sage nichts. Dafür hat meine Mutter gleich die nächste Frage:
»Und dieses Glaubensbekenntnis? Muss das sein?«
»Mama …!«, stöhne ich, doch der Pfarrer nickt mir verständnisvoll zu.
»Nun, also … das ist normalerweise schon ein Bestandteil der Trauerfeier, aber … ich bestehe jetzt nicht drauf.«
»Weil ich ja gar nicht mehr glaube«, erklärt uns meine Mutter entschuldigend.
»Aber beerdigt wird doch der Papa, oder?«, gebe ich zu bedenken.
»Verbrannt!«, korrigiert meine Mutter, »das war explizit sein Wunsch.«
Ich nehme mir einen Keks und die Krümelbürste vorsichtshalber gleich dazu, Pfarrer Korn probiert die Ritter-Sport.
»Wie sieht’s denn mit dem ›Vater unser‹ aus, Frau Schnös, könnten Sie damit leben?«
»Ja!«, sagt meine Mutter, »aber können wir’s ein wenig umformulieren?«
»Was stört Sie denn?«, fragt der Pfarrer irritiert.
»Dieses schlimme ›Vergib uns unsere Schuld‹, das muss raus, weil … also nicht dass die Leute das darauf beziehen, dass ich ihn in die Waschanlage geschickt hab.«
Ich schaue zum Pfarrer.
»Darf ich das denn erwähnen in meiner Predigt, also wie er gestorben ist?«
»Auf keinen Fall!«, sagt meine Mutter, und ich: »Warum denn nicht?«
Der Pfarrer scheint Kummer gewohnt und macht sich eine Notiz. »Ich lasse es weg. Aber noch mal zurück zu Ihrem Georg. Was war er für ein Mensch, was hat er gerne gemacht?«
Meine Mutter und ich sammeln uns kurz, und dann beginnt sie.
»Er war gern in der Natur. Auf den Pulheimer Feldern, auf der Glessener Höhe oder auch an den Seen. Da konnte er stundenlang sitzen. Deswegen dachten wir zuerst auch an eine Seebestattung.«
Ich räuspere mich. »Der Uli hat uns doch erklärt, dass damit das Meer gemeint ist«, entschuldige ich mich, meine Mutter hört es gar nicht. »Und er wollte ja auch immer, dass ich mitkomme, aber da hab ich gesagt, woher soll ich die Zeit nehmen, ich muss ja auch den Haushalt zumindest einigermaßen im Griff haben.«
Pfarrer Korn notiert. Ich frage mich, was er da notiert.
»Und immer hat er mir Blumen mitgebracht, da hab ich mich gefreut. Und er hat mir auch oft Zettel geschrieben. Erst neulich war da einer auf meinem Kopfkissen, da hat er geschrieben, dass er mich … liebt.«
Spricht’s und bricht in Tränen aus. Ich nehme die Hand meiner Mutter und ziehe ein Taschentuch aus meiner Hose. Seit zwei Tagen hab ich immer welche dabei.
»Alles gut, Mama, lass es raus«, sage ich.
»Man soll es ja aber eben nicht rauslassen!«, schluchzt meine Mutter.
»Und das stand wo?«, frage ich, »In der Brigitte?«
»Im Stern!«, schluchzt sie.
»Na dann …,« stammle ich, »lass es nicht raus!«
Tatsächlich beruhigt sich meine Mutter in kurzer Zeit, schnäuzt sich die Nase und greift wieder zum Ablaufplan der Trauerfeier.
»Und wie haben Sie Ihren Vater gesehen?«, fragt mich nun der riesige Pfarrer, für den unsere Stühle viel zu klein sind.
Wie mein Vater war. So recht weiß ich nicht, was ich sagen soll, denn wirklich nahe waren wir uns in den letzten Jahren gar nicht mehr. Ich habe ja mein eigenes Leben im Büro und mit Mia, und meine Eltern hatten halt ihres hier in Pulheim. Schuldbewusst blicke ich zum Pfarrer, der inzwischen die rote Krümelbürste untersucht.
»Ich bin nicht mehr so an ihn rangekommen, wenn ich ehrlich bin. Wenn man mal was fragte, war immer alles gut. Der Spaziergang war herrlich, der Sonnenuntergang malerisch und Rosi sowieso die Beste. Gesundheitlich angeblich immer alles top, sein Arzt hätte applaudiert. Ich war neulich noch beim FC mit ihm, das war irgendwie … na ja … nicht so schön.«
»Dem Papa hat der Nachmittag mit dir gefallen«, sagt meine Mutter überrascht.
»Ja?«, sage ich, fühle mich plötzlich gar nicht mehr so gut und schaue auf die Uhr. In einer halben Stunde müssen wir zur Stadt Pulheim wegen der Grabstelle. Muss man das Grab kaufen oder mietet man das? Wenn ja, wie lange, und gibt’s teure und nicht so teure Lagen? Hätte ich ja mal Uli fragen können, hab ich keine Ahnung. Und keine Lust sowieso. Der Pfarrer hat zu Ende notiert und seinen Stift zur Seite gelegt. »Und ich soll wirklich nicht darauf eingehen, wo es passiert ist?«
»Was wollen Sie denn sagen?«, frage ich, »›zwischen Aktiv-Schaum und Heißwachs ist er von uns gegangen‹?«
Der Pfarrer legt die Bürste zur Seite und macht sich eine Notiz.
»Sie haben recht, ich lasse es. Und … haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht, welche Kleidung Ihr lieber Georg im Sarg tragen soll?«
»Das hat der Uli schon gefragt, und da hab ich Papas Schlafanzug rausgelegt und die Schlappen.«
Ich starre meine Mutter an.
»Seinen Schlafanzug?«, wiederhole ich erschrocken.
»Ja, was denn sonst, er schläft doch jetzt!«, antwortet meine Mutter verständnislos.
»Aber wir haben einen offenen Sarg, Mama. Damit sich alle von ihm verabschieden können! Haben wir doch mit Uli besprochen.«
»Vielleicht wäre es dann ja besser, er trägt etwas, was er gerne anhatte und … wie die Leute ihn kennen«, schlägt der Pfarrer vor. Meine Mama überlegt, sagt aber nichts.
»Was ist denn mit dem dunkelblauen Hemd?«, springe ich ein, »das hatte er doch gerne an!«
»Aber das kannst du doch noch anziehen!«
»Mama! Ich zieh doch nicht Papas Sachen an!«
»Warum denn nicht? Er hat deine doch auch angezogen!«
»Da war ich ja aber auch nicht tot!«
»Das hat doch mit Totsein nichts zu tun!«
Ich schließe kurz die Augen und atme durch. Die Sache ist schlimm genug – wenn ich jetzt die Nerven verliere, macht es das nicht besser. Also sage ich: »Vielleicht das grüne Polo?«
»Ein Hemd mit kurzen Armen? Nico, wir haben April!«
»Mama! Der Papa friert nicht mehr! Und selbst wenn – es ist ja eine Feuerbestattung!«
Während der Pfarrer mich noch amüsiert anschaut, ist meine Mutter schon einen Gedanken weiter.
»Das weiß ich, aber deswegen muss er ja nicht im Sarg liegen wie ein Busfahrer!«
Die Kerze geht aus, und Pfarrer Korn blickt auf. Schweigen am Tisch. Schließlich sage ich: »Was haltet ihr denn von seinen Wandersachen? Karo-Hemd, Wanderhose und seine Lederwanderschuhe? Das war doch typisch für ihn!«
Pfarrer Korn hebt mahnend die Krümelbürste. »Faaaalls es der Bestatter noch nicht erwähnt hat: Schuhe dürfen leider nicht mit verbrannt werden. Gürtel übrigens auch nicht.«
»Was? Das ist ja wie am Flughafen!«, poltere ich, doch der Pfarrer ist noch gar nicht fertig: »Und weil Sie Wanderhemd gesagt haben: Bei der Kleidung müssten Sie auf natürliche Materialien achten. Also Baumwolle, Leinen …«
»Sekunde mal!«, unterbreche ich empört, »über die A1 brettern täglich hunderttausend Diesel-LKW, aber wenn das Lieblingswanderhemd meines Vaters einen Polyesteranteil von zehn Prozent hat, dann darf er’s nicht tragen im Sarg?«
»Das ist leider richtig«, sagt der Pfarrer betreten.
»Was ist denn mit seiner Kamera?«, fragt meine Mutter.
»Mama! Die ist doch auch aus Kunststoff!«
»Aber keine Kleidung. Der Pfarrer hat ›Kleidung‹ gesagt!«
Ich nehme einen Schluck Wasser und spüre, wie die Wut in mir aufsteigt. Der Pfarrer bemerkt es und greift reflexartig zur Krümelbürste.
»Wo gehen die Krümel da eigentlich hin?«, fragt er.
»Es gibt da so ein Fach, ist aber schwer zu öffnen«, antwortet meine Mutter, »wollen Sie das mal sehen?«
»Nicht unbedingt«, antwortet der Pfarrer »und wegen der Kleidung – wenn Sie da noch mal in Ruhe überlegen wollen …?«
»Keine Sorge!«, zische ich, »wir werden selbstverständlich die Feinstaubemissionen meines Vaters innerhalb der gesetzlichen Richtwerte halten.«
»Und es bleibt jetzt eigentlich auch nur noch eine Frage für die Trauerfeier, weil sein Lieblingslied, das hab ich ja schon als Datei erhalten …«
Ich nicke betreten. Cracklin’ Rosie von Neil Diamond. Zu einer Feuerbestattung. Und dann noch Neil Diamond, der schwulstige Schlagercowboy. Da wird doch die evangelische Kirche sicher mahnend die Hand … –
»… und Cracklin’ Rosie ist kein Problem. Meine letzte Frage wäre daher, ob einer von Ihnen vor der Predigt noch ein paar persönliche Worte sprechen möchte.«
Meine Mutter winkt ab – ein Ding der Unmöglichkeit.
»Und Sie, Herr Schnös? Möchten Sie etwas loswerden vor der Gemeinde?«
»Darauf«, sage ich und zerknülle die leere Ritter-Sport-Verpackung zu einer Kugel, »darauf können Sie Gift nehmen!«
4
Eine knappe halbe Stunde noch bis zur Landung. Ich schaue steinalte Looney Tunes-Filmchen auf dem Kabinendecken-Bildschirm, meine Mutter liest den Artikel ›Funkstille – wenn Kinder ihre Eltern verstoßen‹ in der Brigitte Woman. Sie liest. Ich schaue die Abenteuer vom Kojoten und dem Roadrunner. Dem Puls tut’s gut. ›Meepmeep!‹ Was auch immer mich halt ablenkt von Todestagen, Nasenduschen und dass es nun mal kein normaler Urlaub ist, sondern irgendwie ein Zwangsurlaub. ›Meepmeep!‹, macht der Roadrunner und meine Mutter ›Tocktock‹ am Kopfhörer. Mal wieder. Ich nehme ihn ab und blicke in ein verdutztes Gesicht.
»Dass du so was schaust!«
»Erinnert mich halt an meine Kindheit«, erkläre ich bemüht freundlich, denn bei aller Liebe, die bisherige Reise hat mich schon ein paar Nerven gekostet.
»Aber hast du nicht immer diesen Stuntman gekuckt, den mit den vier Fäusten? Und Magnum?«
»Colt Seavers meinst du und das Trio mit vier Fäusten!«
»Sagt mir nichts. Kimba, der weiße Löwe hast du auch gekuckt. Weißt du noch?«
»Ja, aber ich setze jetzt den Kopfhörer wieder auf und schaue weiter, okay?«
Es ist nicht okay. Denn offenbar war meine Mutter nicht ein Jahr lang alleine in ihrem Haus, sondern einhundert, sonst würde sie ja auch mal aufhören zu reden.
»Nicht unterhalten?«
»Aber Mama! Wir können uns doch nicht eine Woche nonstop unterhalten jetzt! Und wir haben doch alles besprochen: Ich denke über den Todestag nach, und wenn ich irgendwann Lust auf Ingwer hab, dann kauf ich peruanischen.«
»Mach das!«
Okay. Sie ist beleidigt. Aber wenn ich mein Reisewohl auch nur ansatzweise im Auge behalten will, dann muss ich jetzt damit leben. Ich setze also den Kopfhörer wieder auf und blicke hoch zum Bildschirm, wo der Roadrunner zu amerikanischer Orchestermucke in der typischen ›The End‹-Linse verschwindet. Wie? Das war’s jetzt? Offensichtlich. Ein Satellitenbild mit den Kanaren poppt auf dem Schirm auf mit unserem Flugzeug drauf.
›Tocktock‹ macht’s am Kopfhörer.
Genervt schaue ich zu meiner Mutter und erschrecke mich: Sie ist plötzlich ganz blass. Also nehme ich den Kopfhörer runter.
»Nico, ich hätte ihn trotzdem nicht zum Autowaschen schicken dürfen!«, sagt sie traurig.
»Mama, wie oft noch? Du weißt, dass du nicht schuld bist!«
»Das sagen alle, aber es hilft mir nichts, so fühl ich mich nun mal. In der Waschstraße hatte er ja seinen Herzinfarkt, dabei war das Auto gar nicht wirklich schmutzig.«
»Warum ist er denn dann hingefahren?«
»Weil ich in Ruhe das Haus saugen wollte, das ist doch nicht normal, oder?«
»Nein. Aber schuld bist du trotzdem nicht.«
Ich greife ihre Hand und drücke sie. Kurz darauf ruckelt und poltert es, und ein paar Idioten klatschen Applaus. Gepäckfachgeschubse, Jackengeziehe und Smartphonegepiepse. Ich schalte meins auch ein. Leider. Es ist eine Nachricht von meinem Chef.
Ich hab dich im Auge. Und nicht vergessen: Vertrauen ist gut, Controlling ist besser;-) Gruß, Tim
Ich antworte mit dem Daumen-nach-oben-Emoji. Das Kotz-Emoji wäre nur einen Klick weiter rechts gewesen.
Als wir mit unserem Gepäck aus dem Flughafengebäude treten, riecht es nach Kerosin, Insektiziden und diesem ekelhaft süßlichen Südländer-Tabak. Vor allem aber ist es unfassbar heiß: 31 Grad steht auf einer Infotafel.
»Haste gesehen?«, lächle ich meine Mutter an, »31 Grad! Und in Köln regnet’s!«, doch so richtig gelöst wirkt sie nicht. Mein Blick streift die anderen Gäste, die mit uns auf dem Weg zu Busstopp Nummer 11 sind. Ich sehe einen alleinreisenden Silberkopf im lindgrünen Polohemd, zwei schlurfende, männliche Millennials mit Smartphone vor der Nase, ein mittelaltes Pärchen, das genauso gekleidet aus der Drehtür einer Unternehmensberatung taumeln könnte, und einen ebenso dürren wie nervösen Geschlechtsgenossen mit ängstlichem Blick und geducktem Gang. Aber egal, tröste ich mich, wir machen ja schließlich keine Rundreise durch Namibia, und der Club ist groß, das wird sich verlaufen.
Dann sind wir und die anderen Pauschalgespenster an Stopp 11, und meine Mutter kämpft offenbar mit den Tränen.
»Mama, was geht vor in deinem Kopf?«
»Ich hab jetzt gerade gedacht, dass ich das alles besser schaffe!«
»Und jetzt?«
»Hab ich mir gerade vorgestellt, dass vielleicht unser Georg gleich noch rauskommt aus dem Flughafen mit seinem blauen Koffer …«
»Ich hab seinen blauen Koffer jetzt. Der Papa ist im Himmel und schaut uns zu!«, versuche ich sie zu trösten.
»Es gibt keinen Himmel …!«, schluchzt sie.
»Doch«, sage ich, »du musst nur hochschauen!« Ich bemerke, dass ich zum ersten Mal genervt bin. Ja, der Papa ist tot. Und ja, es ist traurig. Aber wenn ich, wenn wir jetzt eine Woche durchflennen, hab ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern auch noch meinen Job.
»Entschuldigung, die Dame?«
Der gepflegte Herr mit dem silbernen Haar und dem lindgrünen Polo hat ein Taschentuch gezückt und bietet es meiner Mutter mit sonorer Stimme an. Am Arm hat er eine funkelnde Rolex mit blauem Zifferblatt und Datumslupe. Okay, denk ich mir. Geld hat er. Aber Geschmack? Nur auf die Tatsache, dass die Rolex keinen Puls misst, bin ich ein wenig neidisch.
»Danke!« Meine Mutter reißt ihm das Taschentuch aus der Hand wie meine Rewe-Kassiererin den Pfandbon. Und dann schnäuzt sie rein wie ein indischer Elefant. Der Polohemdherr betrachtet es eher amüsiert als angewidert.
PFFFFFFFFFFTTTT!
»Danke!«, sagt meine Mutter zum lindgrünen Silberkopf, gibt mir aber das Taschentuch. Ich entsorge es in einem Abfalleimer direkt neben uns und sehe, wie der Herr es wieder herausfischt.
»Ägyptische Baumwolle …« entschuldigt er sich, und meine Mutter wuschelt mir durchs Haar, als wär ich sieben.
»Weißt du was, Nico? Ich bin so froh, dass ich dich noch hab!«