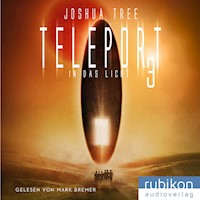4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Los Angeles liegt in Trümmern. Während die Stadt abgeriegelt wird, um eine unbekannte Verseuchung einzudämmen, kämpfen die Überlebenden gegen merkwürdige Vorkommnisse unter der toxischen Staubwolke. Unter ihnen sind auch Lee und Branson. Der Astronaut muss einen Ausweg finden, um seinen Flug zu Cassandra nicht zu verpassen und der Kapitän sieht sich einer furchtbaren Wahrheit gegenüber, die er nicht länger leugnen kann und will. Doch das Grauen in Los Angeles ist nur ein Vorgeschmack darauf, was im fernen Ulan-Ude in Sibirien längst Realität ist: die vom russischen Militär abgeschottete Stadt ist verloren und mit ihr all seine Bewohner. Zu den letzten Lebenden gehört Jenna, die um jeden Preis herausfinden will, was dort geschehen ist und welche Machenschaften die von ihr gejagte Geheimorganisation umtreiben. Ihr bleibt nicht viel Zeit, denn Russland will sich der Verseuchung ein für alle Mal entledigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Meteor 3
Joshua Tree
Inhaltsverzeichnis
Vorwort4
Kapitel 1: Jenna7
Kapitel 2: Branson25
Kapitel 3: Lee39
Kapitel 4: Jenna57
Kapitel 5: Branson69
Kapitel 6: Lee81
Kapitel 7: Jenna103
Kapitel 8: Branson115
Kapitel 9: Lee127
Kapitel 10: Jenna143
Kapitel 11: Branson165
Kapitel 12: Jenna179
Kapitel 13: Branson195
Kapitel 14: Jenna213
Kapitel 15: Lee225
Kapitel 16: Lee243
Kapitel 17: Lee255
Kapitel 18: Lee267
Nachwort297
Glossar299
Personenverzeichnis303
Vorwort
Liebe Leser,
dies ist nun schon der dritte Teil von »Der Meteor«. Normalerweise sind Bücher aus meiner Feder, die sich mit der Zahl »3« schmücken, die letzten einer Trilogie. In diesem Fall verhält es sich anders. Vorerst abschließend wird der nächste, vierte Band sein. Das möchte ich erklären: In der Vergangenheit gab es häufig Rückmeldungen von Lesern, die sich eine weniger schnelle Beendigung des Lesestoffs gewünscht hätten (vor allem bei der Ganymed-Trilogie und Vernichtung). Im Fall von »Der Meteor« habe ich beschlossen, nicht sklavisch eine bestimmte Anzahl an Büchern festzulegen, sondern die Geschichte so groß zu erzählen, wie sie nun einmal erzählt werden muss. Dazu gehört in diesem Fall ein vierter Band. Und noch eine Anmerkung, da einige erboste Rezensenten gerne »Gier« unterstellen, weil man »Seiten strecke« und nicht zum Ende komme: Das Gegenteil ist der Fall. Je höher die Zahl auf einem Band, desto weniger verdient der Autor. Mir ist es stets wichtig, in meinem Rhythmus zu schreiben, das bedeutet meistens (aus meiner Sicht) rasante Handlung, keine ewigen Exposés, sondern direkt in medias res zu gehen, so, wie ich auch gerne lese.
Trotzdem habe ich mich bemüht, in diesem vorliegenden Band mehr Fragen zu beantworten und einen kleinen Zwischenabschluss zu liefern.
Für die wissenschaftliche Beratung zu diesem Band danke ich ganz herzlich Dr. Annika Krämer-Kühl und meinem Kollegen Dr. Ralph Edenhofer.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und sende herzliche Grüße von meinem Schreibtisch auf Zypern,
Ihr Joshua TreePeyia, 23. November 2020
Kapitel 1: Jenna
Der Birkenwald erinnerte an die Kulisse eines dystopischen Endzeitfilms mit verwaschenen Bildern. Immer wieder wackelte Jennas Sichtfeld, wenn der Lada-Kleinbus mit seiner starken Federung über Bodenwellen oder Sandhaufen auf dem kleinen Waldweg hinwegsetzte und um die Kurven polterte. Die weiße Rinde der Bäume wirkte krank und fahl unter der apokalyptischen Düsternis, die über der Szenerie lag. Viele der Blätter waren bereits welk oder lagen größtenteils auf dem unebenen Boden, auf dem Sträucher, Moos und nachwachsende Triebe tagsüber um das spärliche Angebot an Sonnenlicht kämpften, von dem es selbst unter besseren Voraussetzungen als einer unbekannten Verseuchung und Rußwolken einer heranziehenden Feuerfront nicht besonders viel gab. Alles um sie herum schien vom Kampf gegen widrige Bedingungen gezeichnet zu sein, jeder Ast knotig wie sehnige Gliedmaßen, jedes Blatt klein aber kräftig, als wolle sich die Vegetation stur gegen die Tatsachen stellen.
Durch die beiden runden Glasscheiben vor ihren Augen sah für Jenna alles unwirklich aus, als sehe sie einen Film oder durch die Linsen eines Fernglases. Auch ihre Atmung war nicht mehr leise, sondern ein stetes Rauschen im Auf und Ab ihres Brustkorbs, gefiltert durch die Gasmaskenkartusche vor ihrem Mund. Sie schwitzte latent, obwohl es nicht besonders warm war. Komplett in grünes Gummi gehüllt, fühlte sie sich abgeschnitten von der Wirklichkeit, was sie einerseits beruhigte und ihr andererseits ein Gefühl der Entrücktheit verlieh, das ihr ganz und gar nicht gefiel. Sie lebte davon, mittendrin zu sein bei allem, was sie tat. Ihre Stärke war, dass sie sich in jede Situation hineindenken und dann anpassen konnte, ohne an vordefinierte Ecken ihrer Persönlichkeit zu stoßen, die sie davon abhielten, das Nötige zu tun. Dazu gehörte vor allem, sich in Gegebenheiten einzufügen, als sei sie ein Teil davon. Aber wie sollte ihr das mit einem Gummianzug und einer Maske, die sie hermetisch von ihrer Umwelt abschotteten, gelingen? Sie konnte keine Gesichter mehr lesen, keine Stimmen mehr analysieren, da alles verzerrt war, es gab keine Laute zu interpretieren, keine Gerüche, keine Intuition, die im Moment all ihrer Sensoren entledigt war.
Ist mir all das nicht schon viel früher abhandengekommen?, dachte sie und spürte das Gewicht von Xenia – selbst in einem Chemieschutzanzug – an ihrem Arm deutlicher als zuvor. Sie weinte nicht mehr, doch Jenna bemerkte, dass sie noch immer unter stummen Schluchzern erbebte. Sie wusste, dass sie einen taktischen Fehler gemacht hatte, als sie das Mädchen vor ihren Entführern rettete. Sie hatte sich angreifbar und erpressbar gemacht, sobald sie Mitgefühl und eine gewisse Sympathie für sie zugelassen hatte. Den Grund dafür kapierte sie noch immer nicht so recht. Lag es an den Medikamenten, die ihren Verstand mit einer Art wirkstoffschwerem Nebel gedämpft hatte? Oder waren es die Albträume und Erinnerungen gewesen, die sie so weichgekocht hatten, dass eine jahrzehntelang antrainierte Schale aufgebrochen war, von der sie gar nichts wusste? Was sie all die Jahre hatte zufrieden und ausgeglichen sein lassen, war nicht zuletzt eine Aussage ihrer psychologischen Betreuerin in der Agency gewesen, die ihr stets volle Einsatzbereitschaft bescheinigt hatte. Die Botschaft lautete in etwa: Verdrängung ist ein wirkmächtiger Mechanismus unseres Gehirns, um die psychische Stabilität wiederherzustellen. Wer verdrängt und nicht lediglich aktiv beiseiteschiebt, kann sehr wohl zufrieden und glücklich sein, nicht etwa nur auf Kosten der Wahrhaftigkeit, wie manche es gerne kaputtreden. Die Frage ist nur, ob sie im Verdrängen effektiv sind und nicht ausschließlich zwanghaft wegsehen. Sie, Agent Haynes, sind eine Meisterin der Verdrängung, und dazu muss ich Ihnen aus fachlicher Sicht gratulieren. Ich testiere Ihnen volle Einsatzbereitschaft.
Ob sie mir das jetzt und hier auch bescheinigen würde? Einer Agentin, die ihre eigenen Regeln im Einsatz aus dem Fenster wirft? Zweimal hintereinander? Erst mit Feyn, jetzt mit einer jungen Schatzsucherin?, dachte sie und seufzte in sich hinein. Instinktiv drückte sie die Schulter von Xenia etwas fester und zog sie weiter an sich. Die beiden Schichten dicken Gummis, die sie voneinander trennten, quietschten dabei. Es war ein unangenehmes Geräusch. Wie ist das passiert?
Ihre Gedanken kamen zu einem jähen Halt, als sie die ersten Zeichen der Verseuchung sah. Zunächst waren es bloß einige weiße Blätter an den Bäumen, die nicht zu dem schmutzigen Grau der Birkenrinde passten, dann kamen dünne Fäden hinzu, kaum dicker als ein Bindfaden, die sich von den Ästen bis zum Boden spannten. Je weiter sie durch den Wald fuhren, desto dichter wurden sie, desto mehr Laub und schließlich ganze Sträucher waren bedeckt. Sie waren wie von einem strahlend weißen Tau überzogen, der gleichzeitig antiseptisch und bedrohlich-krank aussah. Jede Faser von Jennas Körpers wollte instinktiv flüchten, warnte sie davor, auch nur einen Meter weiterzufahren. Und doch schluckte sie all das herunter, akzeptierte, dass es sich mit dem schwerer werdenden Stein verband, den sie bereits seit längerem in ihrem Magen spürte.
»So sieht es in den ersten Stunden nach der Verseuchung aus«, rief Nadja von vorne über das Poltern des Wagens hinweg. Sie saß auf der kurzen Sitzbank neben dem Fahrer, zusammen mit einem anderen Kollegen, während sie hinten auf zwei breiten Kisten hockten und immer wieder nach etwas zum Festhalten greifen mussten, um nicht hin und her geworfen zu werden.
»Stunden?«, fragte Jenna ungläubig und musste noch einmal mit lauterer Stimme anheben, um durch ihre Gasmaske Gehör zu finden.
»Ja, es geht sehr schnell. Zumindest bei allem, was einen Stoffwechsel hat. Die Reproduktionsrate des fremden Erregers ist allerdings in Phytoorganismen deutlich höher als in Tieren oder Menschen. Wir haben noch keine schlüssige Theorie, woran das liegen könnte. Erste Hinweise deuten auf ihren besonderen Stoffwechsel hin.«
»Photosynthese.«
»Ja. Allerdings haben Pflanzen auch kein Immunsystem in dem Sinne, wie wir Menschen. Dort könnte der andere Unterschied liegen. Phytoorganismen schützen sich meist sehr spezifisch vor bestimmten Feinden wie Parasiten«, erklärte Natalja und wurde von einem ihrer Kollegen unterbrochen, der Jenna gegenübersaß.
»Abwehrstoffe. Entweder sie sind sehr spezifisch, oder komplett unspezifisch.«
»Unspezifisch? Also wie unser Immunsystem?«
»Ja und nein. Unser Immunsystem greift erst einmal alles an, was nicht als körpereigenes Protein erkannt wird. Gegen diese Mikroorganismen bildet es dann allerdings sehr spezifische Antikörper, die exakt auf die jeweilige Erregerform zurechtgeschnitten sind und dadurch hocheffektiv werden. Bei einem Baum beispielsweise ist die Reaktion ebenfalls erst einmal unspezifisch, richtet sich gegen alle Angreifer in Form von Harz. Harz klebt Verletzungen in der Rinde zu, eine amorphe, lipophile Substanz, die erstaunlich effektiv ist. Fettlöslich und von ungeordneter Molekülstruktur lässt es sich kaum von Schädlingen wie Insekten überwinden. Sie kleben fest, die Wunde ist verschlossen. Ich heiße übrigens Anton.«
»Und was bedeutet das?«, wollte Jenna wissen. »Dass wir Glück haben, nicht zu harzen?«
»Nein. Es bedeutet lediglich, dass unser ausgefeiltes Immunsystem etwas länger an einem aussichtslosen Kampf festhält und das Leiden damit streckt«, gab Anton zurück, woraufhin Schweigen einkehrte. Jenna sah wieder aus dem Fenster und musste mit Erschrecken feststellen, dass die wenigen Minuten, die sie sich abgewandt hatte, eine deutliche Veränderung der Vegetation mit sich gebracht hatten: Die Bäume waren nur noch aufgrund ihrer Umrisse als solche zu erkennen, sahen mit einem Mal aus wie Nachbildungen aus porösem Gips. Es war, als würden sie durch eine Winterlandschaft fahren, allerdings ohne den Zauber, den diese versprühte. Stattdessen gab es hier instinktive Angst. Erst jetzt bemerkte sie, dass die bedrückende Atmosphäre, die sie seit dem Zugunglück verspürte, nicht etwa auf das Unglück zurückging, sondern diesem Ort zu eigen war. Jeder Fleck da draußen, jeder Atemzug hier drinnen, alles atmete Angst, fiebrige, unspezifische Angst. Sie durchdrang alles.
Jenna war mit ihr vertraut, hatte mehr als zwei Wochen auf der Flucht vor jemenitischen Rebellen verbracht, gejagt durch eine Steinwüste, in menschenunwürdigen Verstecken, immer mit Fantasien darüber im Hinterkopf, wie sie entdeckt und zu Tode gefoltert wurde. Wenn sie nicht achtsam war, würde die Angst ihr zuerst Lebenskraft entziehen, dann Antrieb, Hoffnung und Durchhaltevermögen. Es war wie langsam in einer Wüste zu verdursten und mit jedem Schritt schwächer zu werden.
»Sie sind nicht wirklich Französin, oder?«, fragte Anton, und Jenna musste einige Male blinzeln, ehe sie verstand, dass er sie die ganze Zeit angesehen haben musste.
»Pourquoi penses-tu ça?«
Der Russe beugte sich etwas nach vorne. »Ich spreche kein Französisch, aber ich kenne Leute wie Sie.«
»Leute wie mich?« Wieder einmal fluchte sie innerlich darüber, dass sie es mit einer Gestalt in kompletter Vermummung zu tun hatte und weder Stimmlage noch Mimik lesen konnte.
»Ja. Wir sind vom Wissenschaftskorps, aber immer noch Soldaten. Ich erkenne Spezialeinsatzkräfte, wenn ich sie sehe. Sie sind keine Wissenschaftlerin.«
»Nein, bin ich nicht«, gab sie zu und atmete erleichtert durch.
»Es ist mir egal, wissen Sie?«
»Was genau?«
»Ob Sie zum westlichen Militär gehören, oder zu wem auch immer«, antwortete Anton. »Über eintausend von uns wurden gefragt, ob wir freiwillig an den Untersuchungen in der Containment-Zone teilnehmen würden. Wir vier waren die Einzigen, die sich gemeldet haben. Ein Einsatz ohne Wiederkehr am aktuell gefährlichsten Ort des Planeten ist nicht besonders reizvoll. Aber Sie …ich habe gesehen, wie Sie reagiert haben, als wir Ihnen beim Zug mitgeteilt haben, dass niemand mehr hier raus kommt. Sie wussten es nicht, aber Sie haben es akzeptiert.«
»Wir tun alle, was das Beste ist.«
»Zumindest die hier Anwesenden«, brummte er.
»Was bringt es dir, dich über die Feiglinge aufzuregen, Anton?«, rief Natalja von vorne. »Die sind da draußen, wir sind hier drinnen. So sind jetzt nun einmal die Fakten. Außerdem haben die meisten von ihnen Familien. Ich kann sie verstehen. Wir kommen jetzt in die Vororte.«
Jenna drehte wieder den Kopf, damit sie rausschauen konnte. Die letzten Bäume ließen sie hinter sich und fuhren auf dem Schotterpfad zwischen die ersten Häuser – kleine, heruntergekommene Bauten aus altem Holz und Wellblechdächern, die von Grünspan und Moos überwuchert waren. Einige von ihnen hatten amateurhaft zusammengebaute Verandas vor den Eingangstüren, andere Vorgärten mit rostigen Schaukeln. Auch hier war das Gras schneeweiß, die Sträucher waren bizarre Gebilde und die dunkelrote Wolkendecke war deutlich bedrohlicher. Sie schien aus sich selbst heraus zu glühen, als wollte sie die Fremdartigkeit dieses Ortes unterstreichen. Sibirien war für Jenna schon immer eine unwirkliche Region im Nirgendwo gewesen, eine letzte Wildnis auf der Erde. Jetzt aber wähnte sie sich auf einem anderen Planeten.
Sie fuhren an einem zweistöckigen Backsteinhaus vorbei, das von einer Art weißem Geflecht überzogen war. Auf einem Stuhl auf der Veranda saß eine halb verweste menschliche Gestalt mit aufgerissenen Augen und Mund, aus denen kreidebleiche Stalagmiten emporwuchsen. In einem anderen Vorgarten saßen sechs Leichen aufrecht im Kreis. Sie hatten sich kurz vor ihrem Tod offenbar an den Händen gehalten. Auch ihre Köpfe waren nach hinten in den Nacken gekippt, mit langen, fingerdicken Fäden, die aus ihren Körperöffnungen ragten, als hätten sie sie aufgespießt.
»Meine Güte«, hauchte Jenna. »Dieses Zeug ist überall.«
»Ja. Die Verseuchung befällt alles, was einen Stoffwechsel hat. Sie erkennen an den Baumaterialien, dass sie weitgehend frei davon sind«, antwortete Natalja. »Diese Bereiche der Stadt sind erst seit wenigen Tagen infiziert und deshalb noch deutlich als verseucht erkennbar.«
»Was bedeutet das?«
»Sie werden es sehen. Bei den Opfern hier handelt es sich um Leute, die ihre Grundstücke nicht verlassen wollten. Als die ersten Warnungen ausgegeben wurden, gab es noch die Bemühungen der örtlichen Feuerwehr und Polizei, alle Bewohner in Zentren zusammenzubringen und vor der Verseuchung zu schützen. Aber das war ein Fehler, da es sich um eine höchstinfektiöse Substanz handelt.«
»Ein perfekt organisiertes Superspreader-Event«, kommentierte Anton. »Die Bilder waren scheußlich. Überall aufbrechende Körper. Mütter, die ihre Kinder an der Hand halten, während diese platzen, und alles rennt schreiend auseinander – bis zu den großen Zäunen, die eigentlich dazu gedacht waren, die Infizierten draußen zu halten. Eine Schande.«
»Es war gut gemeint«, widersprach Natalja. »Die Behörden wollten alle Gesunden zusammenbringen und unter Kontrolle halten, damit sie sich nicht anstecken. Aber zu der Zeit haben wir noch mit Temperaturmessungen gearbeitet. Wie sich herausstellte, ist das während der ersten zwei Tage der Infektion keine gute Methode .«
»Welche Praktiken sind denn vielversprechender?«, wollte Jenna wissen.
»Das ist eine gute Frage. Möglicherweise Stuhlproben.«
»Ist das Ihr Ernst?«
»Ja. Der Erreger greift nicht die Schleimhäute an, sondern wandert an ihnen bis in den Darm und kapert die dort lebenden Bakterien an den Darmzotten.«
»Im Grunde besteht unser Immunsystem aus rund anderthalb Kilo Eiweiß, unter anderem in den Darmzotten«, meldete sich Anton wieder zu Wort. Er hob eine behandschuhte Hand und wackelte mit den nach oben gestreckten Fingern. »Die können Sie sich wie eine Art Wiese in der Dünndarmschleimhaut vorstellen. Sie filtert Nährstoffe aus der Nahrung und sendet sie weiter durch ein feines Gefäßsystem in den Blutkreislauf.«
»Wie ein Filter?«
»Ja. Die Darmzotten sind voller Lymphozyten, also einem großen Teil des Immunsystems und kämpfen von dort aus in einer der Haupteintrittspforten gegen Krankheitserreger. Nach dem Wenigen, was wir bis jetzt wissen, kapert der Erreger die Bakterien im Dünndarm, die zu Kopien ihrer selbst werden. Davon gibt es immerhin etwa zehn Millionen Individuen pro einem Gramm Kot.« Anton rutschte noch etwas weiter nach vorne und schob die Finger seiner linken Hand von oben in die der rechten. »Die Erregerlast ist jetzt extrem hoch, und der Angriff auf die Lymphozyten gleicht damit einem Blitzkrieg. Der Kampf währt ein paar Tage, dann wurden sämtliche weißen Blutkörperchen in den Darmzotten übernommen. Da sie ihre Arbeit nicht mehr erledigen, bekommen die Infizierten jetzt Durchfall, falls sie sich nicht ohnehin schon erbrechen müssen, sobald sie etwas zu sich nehmen. Wirklich krank und schwach sehen sie aber erst in der Folge aus.«
»Denn jetzt beginnt der Kampf auch mit den restlichen Leukozyten im Blutkreislauf. Anders als die erste unspezifische Immunabwehr der Lymphozyten in der Darmschleimhaut, funktionieren die normalerweise so, dass sie spezifisch den Erreger angreifen. Sie erkennen jetzt also die Cassandra-Phagen ...«
»Cassandra-Phagen?«, unterbrach Jenna die Biochemikerin.
»Es ist doch wohl klar, dass der Asteroid uns das eingebrockt hat, oder? Dieser Erreger stammt nicht von der Erde. Und es ist ein Phage, zweifelsfrei. Es handelt sich um ein Virus – zumindest ähnelt es einem in allen Belangen, es hat keinen eigenen Stoffwechsel – und kapert Bakterien, um sich mittels ihres Stoffwechsels zu vermehren.«
»Aber zurück zur Sache«, meinte Anton ungeduldig. »Die Plasmazellen – oder B-Lymphozyten – produzieren massenweise Antikörper, um der Infektion Herr zu werden. Sie scannen quasi die Oberflächenstruktur des Eindringlings und stellen die passenden Schlüssel für das Schlüsselloch her, wenn Sie so wollen.«
»Hier kommen allerdings auch die T-Lymphozyten ins Spiel, die sich an die Plasmazellen binden und Zytokine ausscheiden. Hier liegt der Grund, weshalb die Befallenen keine Chance haben. Normalerweise dauert die Bereitstellung von genügend Antikörpern bis zu einigen Wochen, und dann kommt es erst zu einem Immungedächtnis. Diese Zeit haben sie aber nicht. Denn der Cassandra-Phage greift an dieser Stelle gleich mehrfach an.«
»Sorry«, unterbrach Jenna Natalja und hob abwehrend ihre freie Hand. »Sie verlieren mich.«
»Das Wichtigste ist das Interleukin-6«, versuchte sich Anton an einer Erklärung. »Es synthetisiert bedeutende Proteine für die akute Immunantwort in der Leber. Der Cassandra-Phage greift hier als Erstes an und blockiert es. Das ist ein einzigartiger Vorgang, der so gar nicht funktionieren dürfte. Viren arbeiten normalerweise stumpf mit immergleichen Kopien. Die mutieren zwar, aber das liegt an einem natürlichen evolutionären Prozess, nicht an ihrer Programmierung.«
»Der Erreger nutzt den Körper der Patienten gegen sie?«, fragte Jenna.
»Ja, aber das tun sie immer. Das Besondere ist die Spezifität, die es in dieser Form normalerweise nicht gibt.«
»Sie haben also keine Erklärungen.«
»Nein«, gab Anton zu. »Aber sehr viele Fragen.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Oh, wir haben über ein gut ausgestattetes Feldlabor verfügt«, sagte Nadja.
»Das klingt unangenehm nach Vergangenheitsform.«
»Ja, wir haben keinen Zugang mehr.«
»Was bedeutet das?«
»Das werden Sie gleich sehen.«
Jenna runzelte die Stirn und sah wieder hinaus. Sie fuhren mittlerweile über eine Asphaltstraße zwischen größeren Reihenhäusern im Sowjetstil der Sechziger- und Siebzigerjahre. Der Fahrer lenkte ihren Kleinbus um verlassene Autos, Müll und Schrott wie umgekippte Einkaufswagen, einige aufgeplatzte Leichen und sogar um ein totes Pferd herum. Ihr fiel sofort auf, dass die Fenster rechts und links der Straße nur gähnende schwarze Löcher waren, die das diffuse Tageslicht aufzusaugen schienen.
»Was ist mit den Fensterscheiben?«
»Die meisten sind zerborsten, als das Meteorfragment abgeschossen wurde«, sagte Anton. »Ziemlich unheimlich, nicht wahr? Ich habe immer das Gefühl, dass diese Leere in den Fenstern mich beobachtet.«
»Das sind nur Fenster«, brummte Jenna und runzelte die Stirn, als sie nach links abbogen und sich ein riesiger Platz neben ihnen auftat. Es gab hier keine Bäume, aber einen riesigen Haufen aufgeschichteter Stämme und Äste sowie gelbe Bulldozer, die vor einem ehemaligen Restaurant geparkt waren und verwaist schienen. Vor einem Riesenrad, das inmitten einer verbrannten schwarzen Fläche stand, war ein olivgrünes Zelt aufgebaut, das mindestens die Hälfte eines Fußballfeldes bedeckt hätte. Was Jenna die Sprache verschlug, waren allerdings die mehreren hundert Gestalten, die sich in einem dichten Ring aus Körpern drumherum drängten. Schulter an Schulter mit ungewaschenen, teilnahmslosen Gesichtern und schmutziger Kleidung.
»Was zur Hölle ist das?«, hauchte sie. »Sind das …Einwohner?«
»Ja.« Natalja legte dem Fahrer eine Hand auf den Arm und der bremste den Wagen, bis sie zum Stillstand kamen. Dann öffnete sie die Tür. »Kommen Sie. Es ist ungefährlich.«
Jenna warf noch einmal einen Blick hinaus, schätzte die Entfernung zu der Mauer aus Menschen auf etwa einhundert Meter und schob Xenia sanft von sich. Die junge Frau ließ es über sich ergehen und krümmte sich über ihre Knie zusammen, die sie fest an sich zog.
Durch die Schiebetür, die Natalja Jenna öffnete, kletterte sie hinaus, ohne die reglosen Gestalten aus dem Blick zu lassen.
»Das sieht aus wie in einer Zombieapokalypse.«
»Erschreckend, oder? Am Anfang lag das Feldlabor zwei Blocks hinter der Absperrung der Containment-Zone, die mitten durch die Stadt verlief. Fahrzeugsperren, Stacheldraht, Soldaten – das volle Programm. Wir hatten hier zweihundert Mitarbeiter und jede Menge hochmodernes Gerät.« Die Russin deutete auf das weitläufige grüne Zelt, dessen Planen im leichten Wind flatterten und ein dezentes Knattern von sich gaben, das zur Atmosphäre der absoluten Einsamkeit und des um sich greifenden Todes passte. »Dann wurde die Barriere an mehreren Stellen durchbrochen. Es gab einfach nicht genügend Soldaten, und einige von ihnen waren vermutlich selbst infiziert. Jedenfalls gab es immer mehr Nester diesseits der Zone, und es wurden alle abgezogen, die nicht freiwillig weiterarbeiten wollten. Nun befindet sich die Absperrung in den Wäldern westlich der Stadt, wo ein ganzer Landstrich abgefackelt und vermint wurde. Niemand kommt jetzt noch rein oder raus, und die Flammenwand aus dem Südosten haben Sie ja schon mit eigenen Augen gesehen. Der Kreml macht hier alles platt.«
»Und was ist mit denen da?«, Jenna deutete auf die Zombies.
»Die sind gestern aufgetaucht, kamen von überall, als wir mit dem Wagen nach Vorräten gesucht haben. Unsere Kollegin Maya war noch da drin. Gestern früh waren wir noch zu sechst.«
»Und wo ist die sechste Person?«
Natalja zögerte. »Wladimir hat versucht, zu ihr durchzudringen. Sie waren verheiratet.«
»Waren?«
»Zuerst haben diese Infizierten da nichts getan, doch als er versucht hat, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, haben sie ihn mit bloßen Händen totgeschlagen. Es …« Ihr Gegenüber geriet ins Stocken. »Es war grauenhaft.«
»Warten Sie.« Jenna wandte sich der Wissenschaftlerin zu. »Sie haben gesagt Infizierte. Diese da sind infiziert?«
»Ja. Sie müssen es sein. Alles hier, was keinen Typ 1b Vollschutzanzug trägt, wird von der Phage angegriffen.«
»Aber Sie müssen die Dinger doch auch abnehmen? Zum Essen zum Beispiel?«
»Bleichmittel und stark chlorhaltige Mischungen haben sich als effektiv erwiesen, wenn wir die Anzüge damit großzügig abspritzen. Wir haben ein Dekontaminationszelt in dem Haus dort errichtet.« Natalja deutete auf ein unscheinbares Reihenhaus mit großen Schaufenstern im Erdgeschoss, etwa einhundert Meter weiter die Straße hinauf. »Es ist improvisiert, aber funktioniert bisher. Keine Dauerlösung, aber das brauchen wir auch nicht.« Sie zeigte mit dem Daumen hinter sich in Richtung der pechschwarzen Rußwand, die aus der Ferne auf sie zurollte.
Jenna wandte sich wieder den reglosen Infizierten zu, die das Zelt umringten. »Ich verstehe das immer noch nicht. Wie kann es sein, dass die befallen sind? Die anderen von dem Phage betroffenen Bewohner waren alle von diesem weißen Zeug durchdrungen.«
»Diese hier nicht. Auch wenn Anton vermutet, dass sie es vielleicht waren. Der Phage scheint unterschiedliche Auswirkungen zu haben, wahrscheinlich in Phasen, die wir noch nicht kennen. Fakt ist, dass es nicht alle Infizierten tötet. Einige stehen wieder auf. Sie sind nicht generell aggressiv, soweit wir das sehen können, agieren aber größtenteils gemeinsam und greifen gezielt zu Gewalt.«
»Was meinen Sie damit? Ich dachte, sie seien nicht aggressiv.«
»Wir haben mindestens einen Mord unter ihnen beobachten können.«
»Aber diese weiße Substanz, das RS-66 ist doch der Phage, oder? Warum haben wir dann noch Leichen damit gesehen?«
»RS-66?«, fragte Natalja irritiert. »Was ist das?«
»So heißt die Substanz, die Sie hier erforschen. Sie stammt aus einem Labor in Tunguska.«
»Was? Was reden Sie da?«
»Es wurde von Golgorow Systema heimlich entwickelt und an entführten Testsubjekten erprobt.«
Die Biochemikerin wandte sich nun gänzlich ihr zu und starrte sie durch die Sichtfenster ihrer Maske an. »Wer sind Sie?«
»Jemand, der Antworten braucht, denn ich glaube, dass soeben Los Angeles infiziert wurde.«
Washington D.C., Oval Office
»Ja, du hast mich gewarnt!«, bellte Präsident Joe Walker seinen Verteidigungsminister an, der gerade von zwei gehetzt wirkenden Frauen im Hosenanzug das Gesicht gepudert bekam. Neben ihm stand der gesamte Generalstab bei den Sofas versammelt und wurde ähnlich versorgt. »Aber nicht davor!«
»Joe, ich …«
»Nein! Komm mir nicht mit Joe!«, fuhr Walker ihm über den Mund, das Gesicht rot vor Zorn. »Halb Los Angeles liegt in Trümmern, der Rest brennt oder steckt unter einer Staub- und Aschewolke, die halb Kalifornien bedeckt.«
»Unsere Meteorologen gehen davon aus, dass Ostwinde das alles über den Pazifik blasen, und …«
»Ach, das soll mich jetzt beruhigen? Damit es freie Sicht für Satellitenbilder und Kamerateams gibt, die zeigen, wie überall zerschmetterte Leichen rumliegen und die Verletzten zwischen Plünderern und Flüchtenden elendig verrecken?« Der Präsident scheuchte seine Kosmetikerin mit wütenden Handbewegungen fort und griff nach einem Zettel auf seinem Mahagonischreibtisch. Vor Zorn bebend wedelte er damit vor Cummings’ Gesicht herum. »Weißt du, was da steht? Das sind die vorläufigen Schätzungen der Opferzahlen. Mindestens zehntausend Tote beim Einschlag, weitere vierzigtausend durch die Schockwelle. Und das sind konservative Schätzungen! Hast du eine Idee, von wie vielen weiteren die Rede ist, die an ihren Verletzungen durch umherfliegende Trümmer und Glassplitter sterben werden? Einhundert- bis zweihunderttausend. Jetzt sag mir, Walter: Wie soll es die richtige Entscheidung gewesen sein …«
Der Präsident stockte und sah zu den hektisch umherhuschenden Frauen und Männern mit Puder und Make-up, ehe er sich auf die Unterlippe biss und seinen Verteidigungsminister anstarrte.
»Es war ein Fehler«, zischte er. »Du hättest mir niemals den Einsatz empfehlen sollen.«
»Ich bin der Leiter des Pentagons«, entgegnete Cummings. »Ich habe anhand der mir vorliegenden Informationen einen Vorschlag unterbreitet.«
Walker verbiss sich einen scharfen Kommentar. Der kaum verhohlene Subtext seines Ministers war nur allzu deutlich, und darauf verschnupft zu reagieren, wäre nicht gerade präsidial gewesen.
Ja, ich weiß, dass die Entscheidung bei mir lag, danke!, knurrte er innerlich. Cummings schien sein Schweigen unangenehm zu sein.
»Mr. President, ich habe kurz nach den Hinweisen auf eine chemische Verseuchung des Hafens einen Anruf von Montgomery bekommen. Er …«
»… ist der CIA-Direktor. Was hat der damit zu schaffen? Es geht ja schließlich nicht um feindliche Agenten, was?«, blaffte Walker.
»Nein, aber er hat direkte Informationen einer seiner besten Agenten erhalten, dass ein Biowaffenanschlag auf Los Angeles immanent ist, der die gesamte Stadt verseuchen wird, wenn wir das Problem nicht von Anfang an effektiv eindämmen.«
»Ein einziger Bericht? Und daraus leitest du eine Handlungsempfehlung …« Wieder bremste sich der Präsident und erhob die Stimme: »Okay, alle raus jetzt, sofort! Das Kamerateam soll in fünf Minuten reinkommen!«
Eilig scheuchte er alle hinaus, die keine Uniform mit reichlich Lametta an der Brust trugen, und baute sich direkt vor seinem Verteidigungsminister auf.
»Du empfiehlst mir, mit Mjöllnir auf unsere eigene Stadt zu schießen, weil ein Agent sagt, dass es nötig ist?«
»Unser Agent weiß nichts von Mjöllnir, und es ist eine Agentin, um genau zu sein.«
Walker hob einen zitternden Zeigefinger, den er Cummings direkt unter die Nase hielt, als wolle er ihn damit aufspießen.
»Ich bin so kurz davor, dich zu feuern, Walter! Sei vorsichtig!«
»Sir«, erwiderte der Verteidigungsminister steif. »Ich habe meine Empfehlung entsprechend den mir vorliegenden Daten gegeben. Wir wissen nicht viel über die Substanz, die den Hafen und zwei weitere Hotspots infiziert hat, aber sie führt zum Tod und zur Umwandlung der Infizierten in eine unbekannte Substanz namens RS-66, wie unsere Geheimdienste herausgefunden haben. Man hat mir sogar versichert, dass es eben jene Agentin war, die vor der Gefahr gewarnt hat. Offenbar handelt es sich bei den Fragmenten um Aktivatoren für die Substanz, die sich bis zu ihrem Auftauchen inert verhält.«
Das soll doch ein Witz sein, wollte Walker erwidern und klappte doch den Mund wieder zu, als er an den Asteroiden dachte, der über ihren Köpfen schwebte wie ein Damoklesschwert. Er kannte die Berichte aus Area 51, wusste, dass sie es mit einer fremden Macht zu tun hatten, über die sie nichts wussten. Wie konnte er da ausschließen, dass die Gefahr tatsächlich so groß war, dass die CIA die entschlossensten Maßnahmen zur Eindämmung der Verseuchung empfahl?
»Sir?«, mischte sich Generalstabschef General Myers ein. »Wir wollen jetzt wirklich live gehen, wenn Sie einverstanden sind. Sosehr ich auch dagegen war, Mjöllnir einzusetzen, ist es jetzt ein Fakt, den wir der Bevölkerung erklären müssen.«
»Diese Unterhaltung ist noch nicht beendet«, knurrte Walker seinen Verteidigungsminister an und umrundete seinen Schreibtisch, vor dem ein Teleprompter und mehrere Studioleuchten aufgebaut waren. Er gab seinem Leibwächter an der Westtür einen Wink, der sie daraufhin öffnete und die beiden Kameramänner einließ. Verteidigungsminister und Generalstab bauten sich mit ernsten Mienen hinter ihm auf und verschränkten die Hände hinter ihren Rücken. Sobald er saß, zupfte er seinen Anzug und die USA-Brosche auf seinem Revers zurecht, ehe er ihnen zunickte und den Finger-Countdown abwartete.
Kapitel 2: Branson
»Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger«, sagte Präsident Walker. Seine Miene war ernst und niedergeschlagen, die Stimme gefasst, aber angegriffen. »Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, hat sich in Los Angeles eine Katastrophe unermesslichen Ausmaßes ereignet. Beim Abschuss eines auf den Stadtkern zufliegenden Meteoriten ist ein großes Trümmerstück im Hafen niedergegangen und hat große Teile der Küste verwüstet. Noch ist es zu früh, um etwas über die Opferzahlen sagen zu können. Ich habe soeben den nationalen Notstand ausrufen lassen und versichere Ihnen, dass wir an der Rettung und Versorgung unserer Männer, Frauen und Kinder in Kalifornien mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten. Bitte verstehen Sie, dass es noch keine gesicherten Informationen über irgendetwas gibt, wir Sie aber lückenlos in Kenntnis setzen, sobald sich das ändert. Ich habe die Nationalgarde mobilisiert, um Feuerwehr und Polizei vor Ort zu unterstützen. In diesem Moment wird ein Krisenstab gebildet, um effektiv auf alle Notwendigkeiten dieser schweren Lage für unsere Nation reagieren zu können. Wenn Sie zu den Überlebenden in Los Angeles gehören: Bleiben Sie ruhig. Helfen Sie Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Geraten Sie nicht in Panik. Hilfe ist unterwegs. Mein Generalstab und ich werden erst ruhen, wenn jedem von Ihnen geholfen wird!«
»Am Arsch!«, knurrte Branson und schleuderte einen in der Mitte durchgebrochenen Backstein in den Fernseher an der Wand. Es knisterte kurz, das Blitzen eines Kurzschlusses, dann erstarb der Bildschirm, und zurück blieb ein Spinnennetz aus zersplittertem Plastik auf schwarzem Grund. Marv und Johnny hockten hinter ihm, angelehnt an einen umgestürzten Tisch, der in der Mitte durchgebrochen war. Der Schankraum der Bar war vollkommen verwüstet, die Fenster samt Läden zerborsten, ganze Wandstücke waren auf Tische und Stühle gekracht und ließen alles ringsherum aussehen wie den Keller unter einem im Abriss befindlichen Haus. Durch ein großes Loch in der Decke konnte Branson den dichten Nebel aus Staub sehen, der jetzt den Himmel bildete, wo vorher noch zwei Stockwerke gewesen waren, wenn er sich richtig erinnerte. Die Flucht aus der panischen Menschenmenge in das einzige gemauerte Haus weit und breit war nicht gerade von Umsicht und Konzentration geprägt gewesen.
Er spürte, wie sich die Fingernägel in seine Handflächen bohrten und er entkrampfte seine Fäuste wieder. Er musste sich dazu zwingen. Als er sich mit Marv und Johnny hustend aus dem Keller nach oben gekämpft hatte – vorbei an einer zerstörten Tür und zentnerweise Schutt – war er überrascht gewesen, dass neben einem ganzen Regal mit Schnapsflaschen auch der Fernseher unberührt geblieben war. Doch dann hatte er den Bildschirm angestarrt und sich vorgestellt, dass er ihn einschaltete und jemand ihn direkt ansah und sagte: »Branson! Feyn ist nur zweihundert Meter entfernt von dir. Geh und schnapp ihn dir!«
Das war natürlich verrücktes Wunschdenken, angetrieben von seinem Schockzustand und der Fassungslosigkeit darüber, was gerade geschehen war.
»Boss?«, stöhnte Marv hinter ihm, und er drehte sich langsam um.
»Ja, Junge?« Seine Kiefermuskulatur war so verspannt, dass sie schmerzte. Ein Blick auf sein Crewmitglied genügte, um zu erkennen, dass es schlecht um ihn stand. Er war kreidebleich, und Branson glaubte nicht, dass es an dem allgegenwärtigen Staub lag, der sie alle bedeckte und zu wandelnden Geistern machte.
»Ich fühle mich nicht gut. Können wir vielleicht gehen?«
»Wohin denn, Marv?«, fragte Johnny, der schweratmend an der Schulter seines Freundes lehnte. »Wohin sollen wir denn gehen?«
Branson hustete eine Staubwolke aus seinen Lungen und starrte zu Boden. Die Maserung der schwarzen Holzdielen, die jetzt grau und fahl wirkten in dem wenigen Licht, das durch die zerstörten Wände und das Dach hereinfiel, schien sich in Schlangen zu verwandeln, die im Schmutz nach Beute gierten, unbeobachtet und zielstrebig.
Die ganze Zeit haben die uns benutzt. Von Anfang an, dachte er bitter. Erst Perkins, der uns erpresst und sogar Decker ins Spiel gebracht hat, um meinen wunden Punkt zu treffen. Er hat uns nichts gesagt und behandelt wie dummen Dreck. Dann seine Vorgesetzten, die uns mit dem Einhalten ihres Teils der Abmachungen in die Enge getrieben haben. Wie rechtfertigt man ein Nein, wenn die andere Seite sich nichts zu Schulden hat kommen lassen? Und dann diese Agenten, die uns nur als Teil ihrer Fahndung nach den Drahtziehern hinter allem benutzt haben. Sie hätten uns einfach weggeworfen, ein Hort von Verrätern wie dieses Schwein Feyn. Allein der Gedanke an das Dauergrinsen des Briten ließ Branson erneut vor Zorn erbeben. Dass es zugegebenermaßen charmant und sein ganzes Wesen eine sympathische Ausstrahlung gehabt hatte, ließ seine Wut nur noch greller werden, wie eine Glühbirne, die kurz vor dem Durchbrennen war.
Beruhige dich, ermahnte er sich, als sein Blick ein weiteres Mal auf Marv und Johnny fiel, die ihn hilfesuchend anstarrten wie zwei verängstigte Kinder ihren Vater. Reiß dich zusammen. Für sie. Du hast Fehler gemacht, aber sie brauchen deine Hilfe. Jetzt und hier. Deine Wut wird ihnen bestimmt nicht weiterhelfen.
»Wir gehen zurück zum Schiff«, entschied er mit rauer Stimme und räusperte sich. »Wir müssen zur alten Lady, und dann verschwinden wir von hier.«
»Aber Boss«, meinte Marv und drehte den Kopf in Richtung des zerstörten Türrahmens, durch den ein steter Strom neuen Staubs von der Straße hereinwehte. »Wie soll die Triton das da überlebt haben?«
»Die alte Lady wurde schon viel zu oft unterschätzt. Sie hat schon Schlimmeres überstanden.«
»Schlimmeres als … das?« Marv sah ungläubig zu Johnny, der müde den Kopf schüttelte.
»Über zwanzig Jahre haben alle auf Hawaii über mich und die alte Lady gelacht. Haben sie eine alte Rostlaube genannt, einen Flusskahn! Aber am Ende hat sie selbst die schlimmsten Stürme besser weggesteckt als die ganzen geleckten X-Fregatten von den reichen Säcken wie Decker und seinen Speichelleckern«, beharrte Branson und spürte, wie neue Kraft seine Glieder durchströmte und die Schockstarre aus ihnen vertrieb. Auch ein Großteil seiner lodernden Wut löste sich in neue Zuversicht auf, als er an sein schwimmendes Zuhause dachte. »Außerdem war die Hafenmauer ziemlich groß und stabil. Vielleicht wurde das Radar wegrasiert, aber einen alten Stahlkutter wie die Triton hat noch kein Meteor versenkt!«
Er lächelte über seinen Scherz, aber Marv und Johnny sahen ihn bloß mit gerunzelter Stirn an, als verstünden sie seine Sprache nicht.
»Kommt schon! Den Teufel an die Wand zu malen, hilft uns jetzt auch nicht weiter!« Er ging auf sie zu und streckte beide Hände aus, um ihnen aufzuhelfen. Das Bild einer zerstörten, in Einzelteilen im Hafenbecken schwimmenden Triton One geisterte für eine Sekunde in seinem Geist umher und sandte einen Stich des Entsetzens durch seine Eingeweide, als hätte ihm jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Doch er schob es beiseite und lächelte es mit jener Zuversicht weg, an die er sich jetzt klammerte wie ein Ertrinkender.
Die beiden schwankten, als er ihnen auf die Beine geholfen hatte, klopften sich aber standhaft den Staub aus der Kleidung und schienen selbstständig laufen zu können.
»Seid ihr okay?«, fragte er besorgt. Du musst sie nach Hause bringen, ermahnte er sich in Gedanken und spürte eine Welle der Sympathie für seine Jungs in sich aufsteigen. Zur alten Lady. Dann wird es ihnen besser gehen.
»Wird schon gehen. Habe nur ganz schön viel von dem Zeugs hier eingeatmet«, meinte Johnny, und auch Marv nickte. »Bisschen wackelig auf den Beinen, Boss, zurück auf der Triton ziehe ich mir aber erst mal mindestens drei Tüten rein, bevor ich wieder aus meiner Kabine komme.«
»So ist’s recht.« Branson grinste breit und schmeckte den knisternden Dreck in seinem Mund, sammelte ihn und spuckte aus. »Wenn der Präsident ausnahmsweise mal die Wahrheit sagt, und die wirklich Hilfe schicken, bleiben wir am besten noch im Hafen, bis die Krankenwagen kommen. Dann lassen wir euch durchchecken.«
»Was ist mit Joe?«, fragte Marv.
»Der alte Hund lacht uns wahrscheinlich aus, wenn wir zurück an Bord sind.« Davon war Branson überzeugt und lachte ein in ihm aufsteigendes Bild vom selbstgefällig grinsenden Feyn einfach weg. »Vielleicht kann er uns dann auch sagen, was zur Hölle hier passiert ist.«
»Ein Meteoritenfragment, hast du doch gehört.«
»Schon möglich. Kommt, wir verschwinden hier.«
Gemeinsam gingen sie zum Ausgang, stiegen auf die wie eine Gangway vor ihnen liegende Tür, auf der ein Mosaik aus Glasscherben lag, ehe er innehielt und sich noch einmal umdrehte. »Wartet mal kurz.«
Marv und Johnny blickten ihm verwirrt nach, als er über die Leiche einer der Gäste hinweg trat, die vor dem Einschlag in der Ecke am Fenster gesessen und sich über ihre Smartphones gebeugt hatten. Er musste von dort mindestens fünf Meter weit geschleudert worden sein und war so übel zugerichtet, dass er wie ein unregelmäßiger Haufen zwischen Überresten von Stühlen und Tischen lag. Branson versuchte, nicht darüber nachzudenken und vor allem nicht hinzusehen und kletterte über die mit Scherben gespickte Bar hinweg. Mit den Händen tastete er von der Rückseite unter der Theke entlang, bis seine Finger über die Umrisse einer Schrotflinte fuhren. Er riss sie aus ihrer Halterung und fand eine Box mit Patronen, die er sich in die Hosentaschen stopfte. Dann lud er das Gewehr durch und kletterte wieder in den Schankraum zurück zu seinen beiden wartenden Freunden.
»Erwartest du Ärger?«, fragte Johnny.
»Darauf kannst du Gift nehmen. Außerdem will ich vorbereitet sein.«
»Worauf?«
»Ratten wie dieser Feyn haben die Angewohnheit, jeden Scheiß zu überleben, glaubt mir. Aber einen kurzen Wink von dieser Bleispritze hier«, Branson klopfte auf den Kolben der Schrotflinte, »kann er nicht einfach weggrinsen, das kann ich euch versprechen.«
»Okay.«
»Los jetzt. Zum Schiff ist es nicht weit!« Als guter Kapitän ging er voran, stellte sich in den Türrahmen und spähte in den staubigen Dunst hinaus, der heiß und feucht über die Straße wehte. Er konnte nicht einmal zehn Meter weit sehen, sah eine Menge Leichen, die größtenteils so verbrannt waren, dass sich ihre Kleidung entweder aufgelöst hatte, oder mit der Haut verschmolzen war. Der Gestank war ekelerregend und ließ ihn mehrmals würgen, ehe er sich mit einem langen Atemzug zur Ruhe zwang und den Blick auf Horizonthöhe zwischen verwüstetem Asphalt und Wolke heftete. Es lag ein merkwürdiger Geruch in der Luft, in dem er Benzin, Blut, Schweiß und Fäkalien wiederfand. Es roch nach Untergang.
Noch ein Grund mehr, hier schleunigst zu verschwinden.
Sie hielten sich dicht an der Hauswand, damit sie eine Orientierung hatten. Er wusste, dass sie nach links mussten, der Hafen sich auf der rechten Seite befand, sie aber bis zum Ende gehen mussten, zum ersten Anlegebecken mit dem großen Parkplatz. Der Bürgersteig war voller verbrannter Leichen und zerschmetterten Gestalten, die zwischen den Trümmern lagen. Fernes Wehklagen und nicht allzu fernes Jammern schwoll an, als würde langsam ein Lautstärkeregler hochgedreht. Bereits nach wenigen Metern wurde klar, dass das gemauerte Haus, in dessen Keller sie sich versteckt hatten, eines der wenigen war, von dem überhaupt noch etwas stand. Als sie ein brennendes Autowrack passierten, das ihnen den Schweiß auf die Haut trieb, konnten sie etwas mehr um sich herum erkennen und hielten vor Erschütterung inne. Zwischen den weggefegten Häuserruinen und den komplett versengten ersten Abschnitten der Wiesen des Parks lagen Dutzende Leichen, die wie von einer Druckwelle gefällte Bäume nach Norden hin ausgerichtet auf dem Asphalt lagen. Einige Kleidungsreste brannten und sonderten einen widerlich-süßlichen Geruch an die Luft ab. Marvin übergab sich, und als Branson sich besorgt zu ihm drehte, sprang Johnny zwischen sie.
»Was ist los?«
»Nichts«, sagte Johnny. »Wir sollten weitergehen. Ich will hier nicht stehenbleiben.«
»Ja«, hauchte Branson mit belegter Stimme. »Los, gehen wir.«
Sie überquerten die Straße wie einen reißenden Fluss, die Köpfe nach oben gereckt, das Kinn nach vorne, um nicht nach unten sehen zu müssen, wann immer sie gegen etwas Weiches stießen. Sie stolperten dann immer schneller über die schwarzen Grasreste nach Süden in Richtung Parkplatz, der durch den dichten Dunst an ein Stück Ozean erinnerte, auf dem eine Schule Buckelwale dahintrieb.
»Wir haben es gleich geschafft, hört ihr?«, keuchte er. Die Luft roch hier nach Ozon und kratzte in seinem Hals. »Hört ihr?«
Als er keine Antwort bekam, drehte er sich um und sah, dass er alleine war. »Marv? Johnny?«
Sein Herz begann wie wild in seiner Brust zu trommeln, als er zurück stolperte und gehetzt nach links und rechts blickte.
»MARV! JOHNNY!«
»Wir sind hier!«, hörte er jemanden rufen. Johnny? Branson lief nach rechts, von wo er meinte, die Stimme gehört zu haben.
»Ich bin hier!«, sagte er laut.
Was, wenn er es ist, der mich in eine Falle lockt?, schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der ihn erstarren ließ. Wie automatisch hob er die Schrotflinte und zielte in den stinkenden Nebel hinein. Nochmal benutzt du mich nicht!
Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen, mit Bedacht, tastend und den Blick über die Kimme der Waffe nach vorne gerichtet. Lautlos stieg er über die Leiche einer Frau hinweg, der von der Druckwelle die Haut von den Knochen gefräst worden war, sog den Geruch verbrannten Fleisches auf und schluckte widerwillig die Übelkeit runter, die ihn überkam.
All diese Toten, dachte er traurig. Sie sind Opfer von Verrat geworden, genau wie wir. Wie ich. Ich habe mich schuldig gemacht, indem ich nicht ausgestiegen bin, als wir die Chance hatten. Aber hatten wir jemals eine Chance? Haben die uns nicht in die Enge getrieben wie scheues Vieh? »Es geht um mehr als Sie mit ihrem Redneck-Verstand begreifen könnten. Aber Sie sorgen sich um Anstand und Moral?«, hallten Daryas Worte in seinem Kopf nach. Auch ihr herablassender Tonfall und die Verachtung in ihrer Miene hatten sich in sein Gedächtnis eingeätzt wie Säure. Er hatte sich wie eine Marionette in den Händen dieses Feyn und der Ärztin bewegt, getanzt, wenn sie gezupft hatten, und dafür hatten sie ihm nicht einmal Respekt gezollt. Dabei interessierte der ihn nicht einmal. Er wollte nur, dass am Ende nicht alles umsonst gewesen war und er mit seiner Familie wieder zur See in die Freiheit fahren konnte, weg von all diesen verrückten Dingen, die seit ihrem Aufbruch von Hawaii vor sich gingen.
Es war nicht umsonst, sagte er sich in Gedanken immer wieder. Es war nicht umsonst! Auf dem Schiff liegen fünfzehn Millionen in Gold und noch einmal fünf in bar. Sammle deine Familie ein, bring sie in Sicherheit und hol Xenia zurück. Dann kannst du auf alles zurückblicken und sagen, dass es nicht umsonst gewesen ist.
»Boss! BOSS!«
Branson schüttelte den Kopf und damit die Gedanken aus seinem Geist. Als er Johnny direkt in die Mündung der Schrotflinte starren sah, riss er die Augen auf und dann die Waffe herunter.
»Johnny!«, keuchte er. »Ich habe dich nicht ...«
»Was ist los mit dir?«
Branson schaute zu Marv hinab, der an der Stoßstange eines Autos lehnte und schwer atmete.
»Was ist mit ihm?«
Johnny verzog den Mund und deutete in den Nebel, aus dem Branson gekommen war. »Setz einen Funkspruch ab, ja? Er kommt nicht weiter, und ich bin zu schwach, um ihn zu tragen. Ich fühle mich echt nicht gut.«
»Ich lasse euch nicht allein!«, widersprach er und schüttelte vehement den Kopf. »Nein, auf keinen Fall!«
»Sorry, Boss, aber ...«
»Ich lasse euch nicht zurück!« Branson bemerkte erst jetzt, dass er schrie und ihm Tränen über die Wangen liefen.
»Hey, Boss.« Johnny legte ihm eine Hand auf die Schulter und sah ihm mit treuem Blick in die Augen. »Du hast uns gerettet. Wir müssen nur noch einen Krankenwagen hierher bekommen, oder du holst uns mit Joe ab, ja? Aber Marv kann nicht mehr weiter, und ich bleibe hier und passe auf ihn auf.