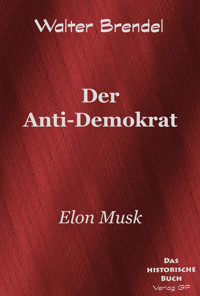4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am 15. Januar 1919 werden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Die Täter: Ein geheimes Freikorps-Mordkommando unter der Leitung von Waldemar Papst. Der Sozialdemokrat Gustav Noske gilt als Verbündeter. Die Morde markieren den finalen Bruch zwischen Linken und Sozialdemokraten. Ebert und seine Gefolgsleute haben die Entwicklung des russischen Bürgerkriegs vor Augen und Lenins Worte, dass die kommunistische Weltrevolution über Deutschland gehen müsse, im Ohr. Die Angst vor einem Umsturz, wie unrealistisch er zu dieser Zeit auch sein mag, wächst. Diese rechten sozialdemokratischen Führer, Otto Landsberg, Philipp Scheidemann, Gustav Noske, Friedrich Ebert, Rudolf Wissell, Otto Landsberg, zu denen sich der langjährige preußische Ministerpräsident Otto Braun gesellte, ignorierten in ihrem blinden Antikommunismus die Bedrohung der Weimarer Republik von rechts. Noske verstand sich mit der preußischen Offizierskamarilla aufs Beste. Noske hat die Morde an Liebknecht und Luxemburg gebilligt. Sie waren der Preis für ein politisches Bündnis, das Noske und die übrigen führenden Sozialdemokraten als nützlich erachtet haben. Diese Billigung kann als Sündenfall in der Beziehung zwischen Sozialdemokraten und Sozialisten gesehen werden. Bis heute zählt die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht zu dem schmerzlichen Mythos der politischen Linken. Gustav Noske wird nie in irgendeiner Form belangt. Der "Bluthund" Noske geht als erster sozialdemokratischer Militärminister in die deutsche Geschichte ein. Für die SPD ist er heute vor allem der Mann, der am Widerstand des 20. Juli 1944 gegen Hitler beteiligt war. Die SPD hat bis heute sich nicht zur Schuld ihrer Partei bekannt. Und so ist das hier vorliegende Buch nicht nur ein Bericht über Zeit, Umstände und Vorgehen zur Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sondern auch eine klein bisschen die Geschichte der SPD von 1914 bis 1933.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Walter Brendel
Der Mord bleibt ungesühnt
Impressum
Texte: © Copyright by Walter Brendel
Umschlag: © Copyright by Gunter Pirntke
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Inhalt
Impressum
Symbiose mit der Reaktion
Die göttliche Rosa
Liebknechts Nein
Gerichtssaal als Tribüne
Die Schriften der Rosa Luxemburg
Reform und Zweck
Die ganze Erdkugel
Grundsätze und Erfolg
Einzelner Schwertstreich
Die Ordnung herrscht in Berlin
„Götterdämmerung“ und Reichsrätekongress im Dezember 1918
Genossenmord
Der Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Tod im Landwehrkanal
Die Spur der Mörder führt in die SPD-Reichskanzlei
Doppelmord nach Plan
Waldemar Papst
"ICH LIES ROSA LUXEMBURG RICHTEN"
Vom Landwehrkanal zum Wiener Heldenplatz
Der Konterrevolutionär
Hermann Souchon
„Wer verschwand im Keller?“
Schuss auf Dingsda
Ungesühnt und verdrängt
Henkersknechte der Bourgeoisie
Mord an der deutschen Justiz
Zusammenfassung
Symbiose mit der Reaktion
Kaum eine Periode der deutschen politischen Sozialgeschichte ist so gut dokumentiert wie die revolutionäre Nachkriegskrise der Jahre 1918/19 bis 1923. Der Quellenfundus ist enorm und hat sich seit Beginn der 1990er Jahre nochmals derart vergrößert, dass auch Spezialisten ihn kaum noch zu überblicken vermögen. Deshalb sind die seit den 1960er Jahren erscheinenden Quelleneditionen wichtige Orientierungshilfen, auch wenn sie nur einen Teil des schriftlich Überlieferten vermitteln und hinter dem ständig weiter wachsenden archivalischen Fundus hoffnungslos herhinken.1 Die Voraussetzungen für die historische Forschung sind somit günstig. Trotzdem herrscht auf diesem Terrain der politischen Sozialgeschichte seit der Mitte der 1980er Jahre weitgehend Funkstille. Die revolutionäre Antwort der Unterklassen auf die Massenschlächtereien und Entbehrungen des Ersten Weltkriegs ist derzeit kein Forschungsthema, aber auch die Geschichte der Gegenrevolution stagniert trotz ihrer Bedeutung für die Genese des Faschismus und ist zudem – wie die wenigen Ausnahmen von der Regel zeigen – nach wie vor durch mächtige geschichtspolitische Tabus blockiert.2 Vor allem die Frage nach der Verantwortung der Arbeiterbürokratien – Mehrheitssozialdemokratie und Generalkommission der Gewerkschaften – für die Gewaltexzesse der Militärkaste und für die politischen Folgen ihres Triumphs darf auch heute nicht gestellt werden. Dabei drängt sie sich sofort allen denjenigen als Schlüsselproblem auf, die sich mit der Geschichte der Umbruchsjahre zwischen 1916/17 und 1923 auseinandersetzen. Rekapitulieren wir zunächst die wesentlichen Kontexte dieses Problemfelds.
Mordopfer Liebknecht: Die Aufnahme des toten Spartakus-Führers entstand im Berliner Leichenschauhaus kurz nach seiner Ermordung. Rosa Luxemburgs Leiche, die die Mörder in den Landwehrkanal geworfen hatten, wurde erst am 1. Juni 1919 gefunden; die Revolutionärin wurde am 13. Juni neben Liebknecht auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin beigesetzt
Seit Beginn des Ersten Weltkriegs hatte der völkisch-nationalistische Flügel der organisierten Arbeiterbewegung unter der Parole des „Burgfriedens“ die Schlüsselpositionen besetzt und ihren Partei- und Gewerkschaftsapparat bis 1916 in die spätwilhelminische Propaganda- und Rüstungsmaschinerie eingebaut. Dieser Integrationsprozess der Führungsgruppen und Funktionsschichten der Arbeiterbürokratien war zunächst reibungslos verlaufen, hatte dann aber 1916 zur Spaltung der Sozialdemokratie in einen mehrheitssozialdemokratischen (MSPD) und einen Unabhängigen Flügel (USPD) geführt. Parallel dazu waren die mehrheitssozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Führungskader rigoros gegen den sich an der Basis langsam herausbildenden Widerstand vorgegangen. In enger Kooperation mit den Stellvertretenden Generalkommandos und der Politischen Polizei hatten sie ihre Verbände, Zeitungsredaktionen und Parteigliederungen gesäubert, Tausende missliebiger Funktionsträger und Mitglieder zwangsmilitarisiert und die widerständigen Basisinitiativen in die Illegalität getrieben. Dabei war es den mehrheitssozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Führungskadern im Zusammenspiel mit dem Repressionsapparat immer wieder gelungen, die oppositionellen Netzwerke aufzudecken, zu denunzieren und die meisten Reorganisationsversuche im Keim zu ersticken.
Der Sozialdemokrat und Reichswehrminister Gustav Noske (Mitte) vor dem Münchener Hotel Continental (August 1919)
Aber für diesen Erfolg musste die MSPD- und Gewerkschaftsoligarchie um Gustav -Bauer, Heinrich Cunow, Eduard David, Friedrich Ebert, Konrad Haenisch, Wolfgang Heine, Otto Landsberg, Carl Legien, Gustav Noske, Philipp Scheidemann, Carl Severing, Albert Südekum und August Winnig einen hohen Preis zahlen. Sie hatte sich erbitterte Feinde geschaffen, und wenn sich das Kriegsglück wendete und das Regime ins Wanken geriet, dann konnten sie und ihre regionalen Repräsentanten auf keine Kompromissbereitschaft mehr hoffen. Ihre Kritiker hatten sich längst auf die Suche nach alternativen Modellen der Selbstorganisation und der Gegenmacht begeben, und dadurch war die arbeits- und sozialpolitische Einfriedungsfunktion der Arbeiterbürokratien gegenüber den Unterklassen brüchig geworden. Es musste ihnen schwerfallen, die gegen Kriegsende zu erwartende soziale Massenbewegung unter Kontrolle zu halten.
Trotzdem setzte sich die völkisch-nationalistische Führungsgruppe zunächst recht erfolgreich an die Spitze des revolutionären Aufbruchs, der zu Beginn des November 1918 durch die Matrosenrevolte in den Standorten der Kriegsmarine ausgelöst wurde.
Am 7. November übernahm Gustav Noske den Gouverneursposten in Kiel und verband ihn mit dem Vorsitz im dortigen Arbeiter- und Soldatenrat. Zwei Tage später proklamierte Philipp Scheidemann im Wettlauf mit der oppositionellen Spartakusgruppe den Übergang des Kaiserreichs zur Republik. Friedrich Ebert und er arrangierten sich mit der USPD- Führung und sicherten sich zusammen mit Otto Landsberg eine dominierende Rolle in einem improvisierten Übergangskabinett, dem „Rat der Volksbeauftragten“. Dabei ging es ihnen aber nicht um die Wiederherstellung der fraktionierten Arbeiterbewegung und die gemeinsame Einleitung eines entschiedenen Reformkurses, sondern nur um die Camouflage ihres strategischen Bündnisses mit den Herrschaftseliten des wankenden Regimes, das weiterhin oberste Priorität genoss. Am 10. November 1918 schloss Ebert einen gegenrevolutionären Pakt mit Wilhelm Groener, dem politischen Kopf der Obersten Heeresleitung (OHL)3, und eine knappe Woche später verschafften ihm Carl Legien und der Rüstungsindustrielle Hugo Stinnes in Gestalt einer „Zentral-Arbeitsgemeinschaft“ der Unternehmerverbände und der Gewerkschaften die erforderliche sozial- und wirtschaftspolitische Basis. 4 Unter diesen Voraussetzungen suchten sie dann dem Umsturzprozess die Spitze zu nehmen und „Ruhe und Ordnung“ wiederherzustellen. Dabei überrumpelten und desavouierten sie immer wieder die USPD-Vertreter des Rats der Volksbeauftragten und machten die ihnen missliebig erscheinenden Beschlüsse des inzwischen nach Berlin einberufenen Reichs-Rätekongresses zu Makulatur.
Mordaufruf: Nachdem rechte Gegner der Weimarer Republik zum Mord an Karl Liebknecht aufgerufen hatten, tauchten der KPD-Führer und seine Mitstreiterin Rosa Luxemburg unter. Es half nicht mehr - sie wurden verraten, verhaftet, misshandelt und von Angehörigen der Gardekavallerie-Schützen-Division ermordet
So wurde im Verlauf des Dezember 1918 offenkundig, dass die MSPD-Führung auch zu den reformorientierten Fraktionen der Massenbewegung ihre Brücken abgebrochen hatte. Sie setzte ausschließlich auf die Soldateska, bei der sie dank ihres langjährigen Militärexperten Gustav Noske und ihrer Kooperation mit den Propaganda und Nachrichtendiensten der Obersten Heeresleitung wohlgelitten war. Noske war es gelungen, Teile des Marine-Offizierskorps, nämlich die Nautiker (Decksoffiziere), auf
den MSPD-Kurs einzuschwören. Sie hatten schon bei der Unterdrückung der Matrosenrevolte von 1916/17 eine wichtige Rolle gespielt. Deshalb war Noske auch Ende September 1918 bei der Entscheidung zur Einleitung von Friedensverhandlungen mit den Entente-Mächten als Schlüsselfigur einer Regierungsumbildung in Vorschlag gekommen. Nun wurde er mit seinen Kieler Offizierskameraden in Berlin dringend benötigt, denn die dort einrückende und als Kristallisationskern der militärischen Gegenrevolution ausersehene Garde-Kavallerie-Schützendivision brauchte Verstärkung.
Bei ihrer Ankunft wurde sie von Ebert enthusiastisch begrüßt: „Kein Feind hat euch überwunden“, rief er. „Auf euch vor allem ruht die Hoffnung der deutschen Freiheit. Ihr seid die stärksten Träger der deutschen Zukunft.“ Damit war der Rubikon überschritten.
Die anhaltende und immer stärker auf eine „zweite Revolution“ drängende Massenbewegung der demobilisierten Soldaten, der Arbeiterinnen und Arbeiter und der pazifistischen Intelligenz sollte nicht durch die Einleitung eines großzügigen Reformprogramms kanalisiert, sondern mit Hilfe des militärischen Restkaders des Wilhelminismus niedergeschlagen und gedemütigt werden.
Diese endgültige strategische Festlegung blieb den Akteuren der sich zunehmend politisch formierenden Sozialrevolte nicht verborgen. Als sie sich seit dem Jahreswechsel 1918/19 entschieden gegen die Provokationen der gegenrevolutionären Soldateska zur Wehr setzten, gab der inzwischen nur noch aus Mehrheitssozialdemokraten bestehende Rat der Volksbeauftragten der Obersten Heeresleitung freie Hand zum Massenmord. Er unterstützte jetzt ein Konzept der bedingungslosen Gewaltanwendung gegen die eigene aufständische Bevölkerung, das der SPD-Militärexperte Noske 1911 noch scharf kritisiert hatte.5 Die sich politisch formierende Alternative sollte vernichtet werden, und zwar ihre Widerstand leistenden Basisaktivisten genauso wie ihre führenden Köpfe. Kurz vor der Verhaftung und Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts schrieb ein Generalmajor der Obersten Heeresleitung in sein Tagebuch: „Ebert und Scheidemann zittern (…) vor Liebknecht und Rosa und wünschen ihr Verschwinden (auf kriminelle Art), nur: Sie wollen nichts davon wissen, nichts damit zu tun haben.“6
Diese Notiz dokumentiert exakt die Taktik des arbeitsteiligen Vorgehens bei der Bekämpfung des Januaraufstands in Berlin, der Niederschlagung der daraufhin proklamierten Räterepubliken in Bremen und München sowie der Märzkämpfe 1919, die der Gegenrevolution den entscheidenden militärischen Durchbruch brachten. Seit dem 6. Januar amtierte Noske als Oberbefehlshaber der gegenrevolutionären Truppen in Berlin sowie nach der Ernennung der neuen Reichsregierung durch die Weimarer Nationalversammlung als Reichswehrminister. Als Repräsentant der regierenden Mehrheitssozialdemokratie und unter dem Applaus der MSPD-Reichstagsfraktion gab er den Militärstäben freie Hand. Am 9. März 1919 erließ er einen von Waldemar Pabst, dem Stabschef der Garde-Kavallerie-Schützendivision, vorformulierten Erschießungs-befehl, der von Pabst nochmals verschärft wurde, und sicherte den Mördern auf einer Offiziersbesprechung Straffreiheit zu, auch wenn sie noch über diesen Befehl hinausgingen. Dabei machten er und seine Mentoren Ebert und Heine sich die barbarische Tätersprache der Militärkaste zu Eigen: Je brutaler und härter das Vorgehen, desto kürzer der Kampf, wiederholten sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Soldateska der Regierungstruppen und der mit ihnen assoziierten Freikorps galten dieser politischen Troika der Gegenrevolution schließlich sogar als einzige Garanten der „deutschen Zukunft“ – und nicht mehr eine wie deformiert auch immer daherkommende Arbeiterbewegung.
Trotzdem wurde weiter auf Camouflage Wert gelegt. Die Ermordung der prominenten politischen Gegenspieler/-innen und ihres aktiven Anhangs wurde dringend gewünscht, aber nicht direkt befohlen. Dies war auch nicht nötig, denn die dafür geschaffenen institutionellen Rahmenbedingungen und Garantien genügten. Zusätzlich wurde alles vermieden, was als direkte Restauration der alten Machtverhältnisse hätte gedeutet werden können. Dieses Vorgehen verschaffte der deutschen Gegenrevolution eine besondere Legitimationsbasis, die bis heute fortwirkt: Die Massenmorde der Soldateska erschienen nicht als erste Symptome des heraufziehenden Faschismus, sondern geschahen unter dem Vorwand, eine sich formierende repräsentativparlamentarische Ordnung schützen zu müssen. Hinzu kam die außenpolitische Begründung, hart zuschlagen zu müssen, um nicht den Siegermächten einen Vorwand zur Blockade der Lebensmittelimporte oder gar zum Einmarsch und zum Aufbau einer Besatzungsherrschaft zu liefern. In diesen und anderen Maskeraden kam die Gegenrevolution daher, und die Symbiose zwischen den Militärs und der Mehrheitssozialdemokratie neigte sich erst in jenem Augenblick ihrem Ende zu, als die sozialdemokratisch geführte Reichsregierung nicht in der Lage war, die von den Entente-Mächten geforderte Auflösung der Freikorps zu verhindern. Im März 1920 wurde ihr dann in Gestalt des Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putschs die Rechnung präsentiert, wie Waldemar Pabst, einer der Organisatoren des Putsches, dies auf den Begriff brachte:
„Wir wollten und mussten zunächst einmal (…) ein Stück mit den Sozialdemokraten marschieren, um unseren gemeinsamen Feind, den ›Spartakismus‹ abzuwürgen. War dies geglückt, dann wollten wir unseren bisherigen Verbündeten die Rechnung vom November 1918 vorlegen und von ihnen begleichen lassen.“7
Mit der Bewilligung der Kriegskredite am 4. August 1914 wurde die deutsche Sozialdemokratie Teil der wilhelminischen Propaganda- und Rüstungsmaschinerie
Wie kann dieser Freibrief der Arbeiteroligarchie an die Adresse der Militärs zur physischen Vernichtung ehemaliger Parteigenoss/-innen und Organisationskader erklärt werden? Wir haben lange darüber nachgedacht, und wir glauben, dass der genaue Abgleich der im zweiten Teil dieses Artikels vorgelegten Text mit ihren Kontexten eine erste vorläufige Antwort ermöglicht.
Von Bedeutung ist erstens die Vorgeschichte des gegenrevolutionären Bündnisses. Die Arbeiteroligarchie war seit 1915/16 skrupellos gegen den sich formierenden innerorganisatorischen Widerstand vorgegangen und hatte Tausende von Mitgliedern und Kadern denunziert, in die Schützengräben geschickt und/oder dem Repressionsapparat ausgeliefert. Dadurch hatte sich ihre Hemmschwelle zur arbeitsteilig mit dem Militär- und Polizeiapparat organisierten Gewaltanwendung ständig verringert.
Ein zweiter wesentlicher Faktor war der Verlust der Massenloyalitäten und der Massenbasis, der 1916 mit der Abspaltung der USPD begann und nicht mehr kontrollierbare Radikalisierungsprozesse freisetzte. Gegen diese Entwicklung waren die völkisch-nationalistischen Arbeiterbürokratien insoweit machtlos, als ihre bislang so erprobten autoritären Disziplinierungsmethoden zunehmend ihre Wirkung verloren.
Den revoltierenden Matrosen, Betriebsausschüssen, Obleuten und parteiförmigen Absplitterungen konnte nicht mehr mit dem Parteiausschluss und dem Entzug der gewerkschaftlichen Unterstützung gedroht werden. Auch dadurch erschien der Zugriff auf die weitaus wirksameren staatlich-militärischen Repressionsmaßnahmen konsequent, da der innerorganisatorische Meinungsbildungsprozess als mögliche Voraussetzung einer politischen Kurskorrektur blockiert war. Die Preisgabe der bisherigen sozialen Verankerung der Arbeiterbürokratien war die unausweichliche Folge, und auch dies erleichterte den Übergang zur Symbiose mit dem wilhelminischen Machtapparat.
Von großer Bedeutung waren schließlich die materiellen und organisatorischen Vorteile, die sich für die Arbeiteroligarchie aus ihrer zunehmenden Kooptation in das imperiale Machtgefüge ergaben. Die entstehenden korporatistischen Strukturen beispielsweise des „Vaterländischen Hilfsdienstes“, der Lebensmittelversorgung und der Kriegssozialpolitik verschafften ihr nicht nur neue Aufgabenfelder, sondern konnten auch zur Kontinuitätssicherung des bis dahin erreichten Bürokratisierungsprozesses der Arbeiterbewegung genutzt werden. Die sich durch die Sachzwänge des Kriegs ergebende Integrationschance in das herrschende Machtgefüge wollten sich die Führungsschichten und Funktionsträger der Arbeiterorganisationen nicht entgehen lassen, und daraus entwickelte sich ein erhebliches kollektives Eigeninteresse, das offensiv gegen die Gegner des hypernationalistischen Kriegskurses gerichtet war.
Diese Gemengelage aus bürokratischer Verselbständigung, materiellen Eigeninteressen und systematischer Ausgrenzung aller politischen Alternativen wurde zunehmend auch ideologisch überbaut. Seit 1915/16 propagierten die Spitzenvertreter der Arbeiteroligarchie das Ende des Klassenkampfs und seine Überwindung durch eine ethnisch reine „Volksgemeinschaft“8. Die politischen Gegner wurden als „Judenjungen“, die „raus“ müssten (Gustav Bauer), bzw. als „Judenbande“, mit der „Schicht gemacht werden“ müsse (Carl Legien)9, oder „ostjüdische Marxisten“10 angeprangert.
Auch das hypernationalistische „Augusterlebnis“ des Kriegsbeginns 1914 wurde weiter ausgestaltet: Es weitete sich schließlich zu einer alldeutsch verfassten „Reichsidee“, die zuletzt nur noch durch die Freikorps bewahrt werden konnte. Daran wurde selbst nach dem Kapp-Putsch festgehalten. Als sich der dagegen gerichtete Arbeiterwiderstand im Ruhrgebiet zur Märzrevolution ausweitete, zögerte die sozialdemokratische Reichsregierung keinen Augenblick, die hochverräterischen Truppeneinheiten gegen sie loszuschicken, was eine weitere Welle der Massaker zur Folge hatte.
Alles in allem erfüllte das Verhalten des völkisch-nationalistischen Flügels der deutschen Arbeiterbewegung in seiner gegenrevolutionären Phase in wesentlichen Aspekten jene Voraussetzungen, die die historische Forschung dem faschistischen Habitus zuschreibt. Er war nicht nur extrem nationalistisch, gewaltbereit und antisemitisch, sondern er propagierte auch eine ethnisch reine Volksgemeinschaft. Erst im Gefolge der Rückkehr eines erheblichen Teils der USPD verlor er wieder seine prägende Stellung. Freilich wurde er auch nicht mehr zur Erhaltung des wilhelminischen Machtsystems benötigt, weil die herrschenden Eliten seit dem Fiasko der Hyperinflation vom Herbst 1923 bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise die Weimarer Republik als zeitweilige Zwischenlösung in Kauf nahmen. Sollte man aber trotz dieser Zäsur nicht lieber darauf verzichten, die heutige Parteistiftung der Sozialdemokratie nach Friedrich Ebert, dem Hauptexponenten ihrer rechtsextremistischen Phase, zu benennen, und sollten die sozialdemokratischen Historiker nicht endlich ihren Widerstand gegen die Wiedererrichtung des von den Nazis zerstörten Rosa-Luxemburg-Denkmals aufgeben?
Quellen zu diesem Kapitel:
1 Aus der seit den 1960er Jahren ständig wachsenden Quellenpublizistik seien nur die beiden wichtigsten Veröffentlichungen der letzten Jahre referiert: E. Könnemann/ G. Schulze (Hg.): Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorff-Putsch. Dokumente. München 2002; Gerhard Granier (Bearb.): Die deutsche Seekriegsleitung im Ersten Weltkrieg. Dokumentation. Vierter Band, Koblenz 2004
2 Vgl. als Beispiel die verdienstvolle biographische Studie Wolfram Wettes über Gustav Noske: Sie markiert in der Auseinandersetzung mit dieser Schlüsselfigur der Gegenrevolution die Grenzen des heute Zulässigen bei der Auslotung der historischen Verantwortung der Sozialdemokratie. Wolfram Wette, Gustav Noske: Eine politische Biographie. Düsseldorf 1987
3 Zeugenaussage Wilhelm Groeners im sogenannten Münchener Dolchstossprozess (1925) über die Vereinbarungen zwischen der OHL und Friedrich Ebert vom 10. November 1918. Zit. nach Wolfgang Ruge/Wolfgang Schumann (Hg.): Dokumente zur deutschen Geschichte 1917–1919. Frankfurt a.M. 1977, S. 62–64
4 Arbeitsgemeinschaftsabkommen zwischen den Unternehmerverbänden und den Gewerkschaften vom 15. November 1918, zit. nach Ruge/Schumann: Dokumente zur deutschen Politik 1917–1919. S. 71–72
5 Der Kampf in in surgenten Städten, bearbeitet in der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabes. 1907, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 1/2, Bd. 19. Noskes Rede im Reichstag vom 24.2.1911 in: Sten. Ber., Bd. 264, S. 4897–4907
6 Albrecht von Thaer: Generalstabsdienst an der Front und in der O.H.L.. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen 1915–1919. Göttingen 1958, S. 287, ähnlich S. 286
7 Waldemar Pabst, Das Kapp-Unternehmen, in: Revolutionen der Weltgeschichte. Hrsg. von Wulf Bley u.a., München 1933, S. 827. Zuerst erscheinen als Artikelserie in: Der Angriff Nr. 193,195-199, 1932
8 Eduard David benutzte diesen Begriff, genauso wie Gustav Bauer und Friedrich Ebert. Er fand sogar Eingang ins Görlitzer Parteiprogramm von 1921
9 Damit waren außer Hugo Haase aus der Minderheit der SPD-Kriegsgegner die Juden Oskar Cohn, Joseph Herzfeld, Arthur Stadthagen sowie Emanuel Wurm und Eduard Bernstein gemeint. Die antisemitischen Ausfälle von Bauer und Legien vom 24.3.1916 im Reichstag kamen in einer Verbandstagung der Büroangestellten 1918 zur Sprache: Karlludwig Rintelen: Ein undemokratischer Demokrat. Gustav Bauer. Frankfurt 1993, S. 116
10 Gustav Noske: Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang einer Demokratie. Offenbach 1947, S. 27
Die göttliche Rosa
Sie war eine Aufrührerin im Wilhelminischen Reich, ihre Ermordung 1919 machte sie zur Märtyrerin der deutschen Linken jenseits der SPD. Zu ihrem Todestag pilgern bis zu hunderttausend hinaus ans Grab von Rosa Luxemburg.
Rosa Luxemburg ist die Ikone der revolutionären Linken vieler Länder, deren Patronin, eine Art ungeschütztes Warenzeichen. Ihren berühmtesten Satz - "Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden" - zitieren FDP-Koryphäen ebenso selbstverständlich wie die der LINKEn.
Die Feministinnen berufen sich auf ihr Vorbild, Margarethe von Trotta drehte 1985 einen ihrer einfühlsamen Filme über sie, Barbara Sukowa spielte die Hauptrolle. Die Flut der Biografien reißt nicht ab, die Apologeten, die der DDR nachtrauern oder weiterhin einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus suchen, überwiegen naturgemäß. Aber auch der politisch völlig unverdächtige Franzose Max Gallo, der einst François Mitterrand als Präsidentensprecher diente, widmete der Frau ein Buch, deren Lebensbogen sich zwischen der deutschen Reichseinheit 1871 und den revolutionären Wirren nach dem Ersten Weltkrieg spannt.
100 Jahre nach ihrer Ermordung ist Rosa Luxemburg das Objekt übergroßer Verehrung, in Europa kommt ihr nur die spanische Bürgerkriegsheldin Dolores Ibarruri, genannt "La Pasionaria", gleich, die in Spanien Kultstatus genießt und mit 93 Jahren einen friedlichen Tod starb. Rosa Luxemburg aber ist durch die Ermordung zur Märtyrerin geworden, wie Ché Guevara dank seines gewaltsamen Todes in Bolivien zum Märtyrer wurde.
Sie war vieles, was man zu ihrer Zeit besser nicht war: eine Revolutionärin, als Frauen noch nicht das Wahlrecht besaßen; eine Polin, als Polen geteilt war; eine Jüdin zu Zeiten wiederkehrender Pogrome; zusätzlich hinkte sie, weil das eine Bein nach einem frühen Hüftleiden kürzer geriet als das andere.
Rozalia Luksenburg, so hieß sie ursprünglich, stammte aus einer jüdischen Familie, in der man Polnisch sprach und Jiddisch fluchte. Ihr erstes Pogrom erlebte sie 1881 in Warschau, da war sie zehn Jahre alt. Das Gymnasium durfte sie besuchen, weil sie den Numerus clausus erfüllte, der den Anteil jüdischer Schüler begrenzte.
Als sie 1888 studieren wollte, musste sie ihr Land verlassen. Frauen waren an den polnischen Universitäten nicht zugelassen, und überdies suchte die zaristische Geheimpolizei nach ihr. Polen war, eine stete Demütigung für den romantischen Nationalismus dieses Landes, zwischen Österreich, Preußen und Russland geteilt. Warschau gehörte zum Beutegut des Zarenreiches - und die berüchtigte Polizei Alexanders III. jagte die junge Sozialistin. Rozalia hatte sich einer Gruppe um den Dachdecker Marcin Kasprzak angeschlossen, die eine sozialdemokratische Partei nach deutschem Vorbild aufbauen wollte und vom friedlichen Zusammenleben der Völker träumte.
Kasprzak organisierte ihre Flucht. Einem katholischen Pfarrer erzählte er, die junge Frau sei vom tiefen Wunsch beseelt, zum Christentum überzutreten, gegen den Willen ihrer Eltern. Der Kirchenmann schmuggelte sie versteckt im Stroh seines Fuhrwerks
über die Grenze nach Westen.
Die 18jährige ging nach Zürich, dem Sammelplatz für sozialistische Emigranten vornehmlich aus Deutschland und Russland. Sie agitierte für den "Sturz des Zarentums".
Nebenbei studierte sie Staatswissenschaften an der Zürcher Universität. Sie war 22 Jahre alt, als sie mit ihrem Freund Leo Jogiches, einem introvertierten Unternehmersohn aus Wilna, und Adolf Warszawski, dem Ehemann einer Schulkameradin, die "Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen (SDKPiL)" aus der Taufe hob. Der jungen, schwungvollen Frau oblag es bald, die Parteizeitung herauszugeben.
Die SDKPiL gehörte in die Reihe linksdoktrinärer Politsekten, die in der Emigration aus dem Boden schossen. So ziemlich sämtliche Gründungsmitglieder fanden später Aufnahme ins Pantheon des Welt-Kommunismus: Felix Dserschinski rief die sowjetische Terrorpolizei Tscheka ins Leben, den Vorläufer des KGB, Warszawski war bis in die dreißiger Jahre Vorsitzender der polnischen KP, Luxemburg und Jogiches riefen in den Wirren der Nachkriegszeit 1918 die KPD aus.
Unter den Emigranten galt Rosa Luxemburg als brillante Theoretikerin. Die kleine, charismatische Frau mit dem großen Kopf und den leuchtend schönen Augen zog die Menschen wie ein Magnet an.
Über den ersten Auftritt der damals 22 Jahre alten Studentin auf einem internationalen Arbeiterkongress 1893 berichtete später Karl Kautsky, die theoretische Eminenz der SPD, dass die junge Frau "begeisterte Zustimmung, ja schwärmerische Bewunderung derjenigen gewann, deren Sache sie vertrat". Er berichtete aber auch vom "bittersten Hass derjenigen, gegen die sie den Kampf aufnahm". Zeit ihres Lebens löste sie diese extremen Gefühle aus.
Für eine leidenschaftliche Sozialistin, die um die Jahrhundertwende die Revolution vorantreiben wollte, war Deutschland der Mittelpunkt der Welt. Keine europäische Partei konnte sich mit der SPD messen.
Um einen deutschen Pass zu erhalten, ging sie eine Scheinehe mit dem Schriftsetzer Gustav Lübeck ein. Die beiden sahen sich nach der standesamtlichen Trauung in Basel erst fünf Jahre später wieder, bei der Scheidung.
Am 16. Mai 1898 traf Luxemburg um 6.30 Uhr morgens mit dem Schnellzug in Berlin ein. Sie mochte weder die Metropole Preußens, die vor Vitalität und Selbstbewusstsein förmlich explodierte, noch die Deutschen, die Kaiser Wilhelm II. zujubelten und dem Imperialismus anhingen. "Ich hasse sie aus ganzer Seele", schrieb sie an Jogiches, "es soll sie der Schlag treffen."
Luxemburg nahm sich ein Zimmer am Tiergarten, sie lernte das Wahlhandbuch der SPD auswendig und kreuzte in der Parteizentrale in der Katzbachstraße auf, wo Wahlkampfhektik herrschte, denn am 16. Juni 1898 standen Reichstagswahlen an.
Im Wilhelminischen Reich lebten am Ausgang des 19. Jahrhunderts 3,5 Millionen Polen; unter ihnen wollte Luxemburg für die SPD und die Weltrevolution werben. Ihre Wahlkampftournee durch Schlesien geriet zum Triumphzug.
Sie schrieb Artikel für den "Vorwärts", das Kampfblatt der frühen SPD, und für die "Neue Zeit", das Theorie-Organ der Partei. Mehr als Journalistin denn als Politikerin nahm sie teil an der großen theoretischen Debatte, ob der gesellschaftliche Fortschritt in Deutschland besser mit einer Reform oder einer Revolution herbeizuführen sei, die die SPD auf Jahrzehnte beseelte und zugleich lähmte.
Trauerzug für Luxemburg und Liebknecht: Diese Aufnahme von der Beisetzung des ermordetem KPD- Führers Karl Liebknecht und anderer Opfer des Spartakus-Aufstandes wurde auch als Postkarte verbreitet. Die sterblichen Überreste von Liebknechts Mitstreiterin Rosa Luxemburgs wurden erst am 1. Juni 1919, fast ein halbes Jahr nach der Tat, aus dem Landwehrkanal geborgen
Eduard Bernstein, ein ehemaliger Angestellter des Bankhauses Rothschild in Berlin,
hielt den Kapitalismus für reformfähig und die Weltrevolution für eine Chimäre. Sein
Widerpart war Karl Kautsky, der Lordsiegelbewahrer der reinen Lehre. Ihm zur Seite
trat Luxemburg, die Bernstein "vulgärökonomische Schnitzer" vorwarf und ihn am liebsten aus der Partei geworfen hätte.
Die Revisionismusdebatte machte Luxemburg berühmt und zu einer Wortführerin der Parteilinken. Autogrammjäger umlagerten sie auf den Parteitagen, sie werde, berichtete sie stolz ihrem Geliebten Jogiches, "die Göttliche" genannt. Die Pressekommission der SPD machte sie zur Chefredakteurin der "Sächsischen Arbeiterzeitung".
Keiner Frau vor ihr, keiner nach ihr wurde diese Ehre zuteil.
Als die bundesdeutsche Frauenbewegung 70 Jahre später nach Vorbildern in der Geschichte suchte, stieß sie zwangsläufig auf die Journalistin, Theoretikerin und Revolutionärin Luxemburg. Sie behauptete sich in der patriarchalischen SPD, sie war
emanzipiert, führte ein freies Liebesleben, einer ihrer Männer war 15 Jahre jünger als
sie. Von schieren Frauenthemen hielt sie jedoch wenig, sie lästerte im Gegenteil über
die Treffen "dieser Glucken", wie sie die Zusammenkünfte der Suffragetten nannte.
Ganz kleinbürgerlich träumte sie, die weitgehend vom Geld ihrer Männer lebte, von einem geordneten Leben ohne Politik in einer Wohnung mit "hübschen Möbeln", Ferien auf dem Lande und "dazu ein kleines, klitzekleines Würmchen", wie sie an Jogiches schrieb, dem die Revolution erheblich wichtiger war als das kleine private Glück.
Die Briefe Luxemburgs mit teils poetischen, teils kitschigen Passagen zählen zu den