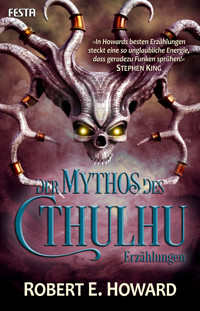
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kosmischer Schrecken aus der Welt von H. P. Lovecraft. Robert E. Howard gilt mit seinen Geschichten um Helden wie Conan der Barbar oder Solomon Kane als der Begründer der modernen »Schwert und Magie«-Fantasy. Er war ein Schriftsteller von gewaltiger visionärer und literarischer Kraft.Howard war ein Brieffreund von H. P. Lovecraft und wurde durch den Meister des Schreckens zu vielen Erzählungen inspiriert. H. P. Lovecraft: »Welcher Schriftsteller kann schon mit Howard mithalten, wenn es um pure, lebendige Angst geht?« Robert Bloch: »Hinter Howards Erzählungen lauert eine dunkle Poetik, und die zeitlose Wahrheit der Träume.« Stephen King: »In Howards besten Erzählungen steckt eine so unglaubliche Energie, dass geradezu Funken sprühen!« Inhalt: Arkham (Gedicht) Der Schwarze Stein Der Schwarze Bär schlägt zu Die Götter von Bal-Sagoth Würmer der Erde Volk der Finsternis Das Ding auf dem Dach Schaufelt mir kein Grab Das Königreich der Schatten Das Feuer von Asshurbanipal Das Kleine Volk Die Kinder der Nacht Die Kreatur mit den Hufen Das Schädelgesicht Nachwort von Bobby Derie: Von Cimmeria nach R'lyeh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Eine Festa Originalausgabe
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: www.bookcoversart.com
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-856-8
www.Festa-Verlag.de
Inhalt
Impressum
Arkham
Der Schwarze Stein
Der Schwarze Bär schlägt zu
Die Götter von Bal-Sagoth
Würmer der Erde
Volk der Finsternis
Das Ding auf dem Dach
Schaufelt mir kein Grab
Das Königreich der Schatten
Das Feuer von Asshurbanipal
Das Kleine Volk
Die Kinder der Nacht
Die Kreatur mit den Hufen
Das Schädelgesicht
Von Cimmeria nach R’lyeh
Quellen und Übersetzer
Entdecke die Festa-Community
Arkham
Die Häuser blinzeln schläfrig und vor Alter matt
In Straßen ohne Ziel, von keiner Zeit vermisst,
Doch was schleicht menschenfremd
und grinsend durch die Stadt,
Durch die alten Gassen, wenn der Mond versunken ist?
Der Schwarze Stein
Das erste Mal las ich davon in jenem befremdlichen Buch des exzentrischen Deutschen von Junzt, der ein so eigentümliches Leben führte und auf ebenso schreckliche wie mysteriöse Weise den Tod fand. Ich hatte das Glück, die Unaussprechlichen Kulte in ihrer Originalausgabe lesen zu können, dem sogenannten ›Schwarzen Buch‹, das 1839 in Düsseldorf erschien, kurz bevor den Autor sein grausiges Schicksal ereilte. Die meisten Sammler seltener Literatur dürften das Buch unter dem Titel Nameless Cults in der fehlerhaften englischen Übersetzung kennen, die 1845 von Bridewall in London verfertigt wurde, sowie durch die sorgfältig zensierte Ausgabe, die Golden Goblin Press 1909 in New York veröffentlichte. Doch das Buch, auf das ich stieß, war eines der unzensierten deutschen Exemplare, mit schwerem Ledereinband und rostigen Eisenschließen. Ich bezweifle, dass es heute auf der ganzen Welt noch mehr als ein halbes Dutzend dieser Bücher gibt, denn die gedruckte Auflage war nicht groß und als sich herumsprach, wie der Autor zu Tode kam, verbrannten viele Besitzer des Buches voller Panik ihre Exemplare.
Von Junzt widmete sein gesamtes Leben (1795–1840) der Erforschung verbotener Dinge; er reiste in alle Winkel der Welt, erlangte Zugang zu unzähligen Geheimbünden und las zahllose kaum bekannte esoterische Bücher und Manuskripte im Original. Die Kapitel des Schwarzen Buches, die in ihrer Formulierung von verblüffender Klarheit bis zu dunkler Mehrdeutigkeit reichen, enthalten Aussagen und Anspielungen, die einem denkenden Menschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und das, was von Junzt in den Druck zu geben wagte, wirft die bange Frage auf, was er sich wohl nicht zu verraten getraute. Welche dunklen Geheimnisse enthielten etwa die dicht beschriebenen Seiten des unveröffentlichten Manuskriptes, an dem er in den Monaten vor seinem Tod unausgesetzt arbeitete und die zerrissen auf dem Boden des verschlossenen und verriegelten Zimmers verstreut lagen, in welchem man von Junzt tot auffand, mit den Abdrücken krallenbewehrter Finger an seiner Kehle? Man wird es nie erfahren, denn nachdem sein engster Freund, der Franzose Alexis Ladeau, eine ganze Nacht damit zugebracht hatte, die Fragmente zusammenzusetzen und zu lesen, verbrannte er sie zu Asche, bevor er sich mit einem Rasiermesser die Kehle durchschnitt.
Aber der Inhalt des veröffentlichten Materials ist schon schaurig genug, selbst wenn man sich die allgemeine Ansicht zu eigen macht, dass es nur das irre Gestammel eines Wahnsinnigen sei. Dort entdeckte ich unter vielen Absonderlichkeiten eine Erwähnung des Schwarzen Steins, jenes seltsamen, unheilvollen Monolithen, der irgendwo in den Bergen Ungarns steht und um den sich so viele düstere Legenden ranken. Von Junzt widmet ihm nicht viel Raum; der Großteil seines grausigen Werkes befasst sich mit finsteren Kulten und den Objekten ihrer Anbetung, die – wie er behauptet – zu seiner Zeit noch existierten, und offenbar schien der Schwarze Stein einen Kult oder ein Wesen zu repräsentieren, der oder das schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten war. Aber er bezeichnet ihn als einen der Schlüssel – ein Ausdruck, den er häufig und in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet und der einen der dunkleren Aspekte seines Werkes ausmacht. Und er spielt kurz auf seltsame Erscheinungen an, die während der Mittsommernacht in der Nähe des Monolithen beobachtet wurden. Er erwähnt Otto Dostmanns Theorie, der Monolith sei ein Überbleibsel der hunnischen Invasion und zum Andenken an einen Sieg Attilas über die Goten errichtet worden. Von Junzt widerspricht dieser Behauptung, ohne stichhaltige Argumente dafür anzuführen, er bemerkt lediglich, den Ursprung des Schwarzen Steins den Hunnen zuzuschreiben sei etwa so logisch wie die Annahme, Wilhelm der Eroberer habe Stonehenge erbaut.
Diese implizite Andeutung eines unvorstellbar hohen Alters des Schwarzen Steins ließ mich sofort aufhorchen, und nach einigen Schwierigkeiten gelang es mir, eine verschimmelte und von Ratten zernagte Ausgabe von Dostmanns Relikte versunkener Reiche (Berlin 1809, Verlag ›Das Drachenhaus‹) ausfindig zu machen. Wie enttäuscht war ich, als ich feststellte, dass Dostmann dem Stein sogar noch weniger Worte widmet als von Junzt; mit ein paar knappen Zeilen tut er ihn als ein Artefakt ab, das relativ jung ist im Vergleich zu den griechisch-römischen Ruinen in Kleinasien, denen sein Hauptinteresse gilt. Er gesteht sein Unvermögen ein, die entstellten Schriftzeichen auf dem Monolithen zu entziffern, erklärt sie aber als eindeutig mongolischen Ursprungs. Doch sowenig ich auch von Dostmann erfuhr, so erwähnt er doch den Namen des Dorfes, das in der Nähe des Schwarzen Steins liegt: Stregoicavar – ein unheilvoller Name, der so etwas wie ›Hexendorf‹ bedeutet.
Eine gründliche Durchsicht von Reiseführern und -berichten erbrachte keine weiteren Informationen – Stregoicavar, das auf keiner Karte verzeichnet war, die ich ausfindig machen konnte, lag in einer wilden, wenig besuchten Region, in die sich niemals ein Reisender verirrte. In Dornlys Ungarische Folklore fand ich jedoch etwas, das mein Interesse weckte. In seinem Kapitel über Traummythen erwähnt er den Schwarzen Stein und berichtet von einigen seltsamen abergläubischen Vorstellungen rund um das Artefakt – vor allem dem Glauben, dass jeder, der in der Nähe des Monolithen schläft, für den Rest seines Lebens an entsetzlichen Albträumen leidet. Darüber hinaus zitiert er Geschichten der Landbevölkerung, die von Neugierigen erzählen, welche in der Mittsommernacht den Stein aufsuchten und in geistiger Umnachtung starben, weil sie dort etwas erblickten.
Das war alles, was Dornly dazu zu berichten hatte, doch mein Interesse war nun erst recht entflammt, denn ich spürte, dass der Stein eine ausgesprochen düstere Aura auszustrahlen schien. Der Gedanke an einen möglichen Ursprung in finsterer Vorzeit und die wiederholte Erwähnung übernatürlicher Geschehnisse während der Mittsommernacht berührten einen schlummernden Instinkt in meinem Inneren, genau wie man das Fließen eines dunklen unterirdischen Flusses in der Nacht mehr spürt als hört.
Und plötzlich erkannte ich eine Verbindung zwischen diesem Stein und einem bizarren und fantastischen Gedicht des wahnsinnigen Poeten Justin Geoffrey: Das Volk vom Monolithen. Nachforschungen ergaben, dass Geoffrey dieses Gedicht tatsächlich auf einer Ungarnreise schrieb, und ich hegte keinen Zweifel, dass der Schwarze Stein genau jener Monolith war, auf den er sich in seinen seltsamen Versen bezog. Als ich seine Strophen noch einmal las, verspürte ich erneut die vagen Regungen eines unterbewussten Drängens, das ich schon bemerkt hatte, als ich zum ersten Mal vom Schwarzen Stein las.
Schon seit einer Weile war ich auf der Suche nach einem geeigneten Ort für einen kurzen Urlaub, und so entschloss ich mich nun, nach Stregoicavar zu reisen. Ein Zug von altertümlicher Bauart brachte mich von Temeswar in die Nähe meines Zieles, und nach einer dreitägigen holprigen Kutschfahrt erreichte ich das kleine Dorf, das in einem fruchtbaren Tal hoch in den von Tannen bewachsenen Bergen lag. Die Reise selbst verlief ereignislos, doch am ersten Tag passierten wir das alte Schlachtfeld von Schomvaal, wo sich der tapfere polnisch-ungarische Ritter Graf Boris Wladinow ebenso furchtlos wie vergeblich den siegreichen Heerscharen Süleymans des Prächtigen entgegengestemmt hatte, als der große Türke 1526 über Osteuropa hinwegfegte.
Der Kutscher wies mich auf einen großen Haufen Steintrümmer auf einem nahe gelegenen Hügel hin, unter dem, wie er sagte, die Knochen des tapferen Grafen lagen. Ich erinnerte mich an eine Passage aus Larsons Die Türkenkriege: »Nach dem Gefecht …« (in welchem der Graf mit seiner kleinen Armee die türkische Vorhut zurückgeschlagen hatte) »… stand der Graf vor den halb eingestürzten Mauern der alten Burg auf dem Hügel und erteilte Befehle zur Neuordnung seiner Truppen, als einer seiner Berater ihm ein kleines lackiertes Kästchen brachte, das man bei der Leiche des berühmten türkischen Schreibers und Historikers Selim Bahadur gefunden hatte, welcher im Kampf gefallen war. Der Graf entnahm dem Behältnis eine Pergamentrolle und begann zu lesen, doch war er noch nicht sehr weit gekommen, als er fürchterlich erbleichte und, ohne ein Wort zu sagen, das Pergament in das Kästchen zurücksteckte und dieses unter seinem Umhang barg. Just in diesem Augenblick eröffnete eine versteckte türkische Geschützstellung plötzlich das Feuer, die Kanonenkugeln trafen die alte Burg und die Ungarn wurden entsetzt Zeuge, wie die Mauern allesamt einstürzten und den tapferen Grafen unter sich begruben. Ohne Anführer wurde die furchtlose kleine Armee schnell aufgerieben und in den langen kriegerischen Jahren, die folgten, suchte man nie nach den Gebeinen des Adligen. Heute verweisen die Einheimischen auf einen riesigen Trümmerhaufen zerfallener Ruinen, unter denen noch immer das ruhen soll, was die Jahrhunderte von Graf Boris Wladinow übrig ließen.«
Das Dorf Stregoicavar entpuppte sich als ein verschlafenes kleines Nest, das seinem düsteren Namen so gar nicht gerecht wurde – ein vergessener Winkel der Welt, an dem der Fortschritt unbemerkt vorübergezogen war. Die malerischen Häuser und die altertümliche Tracht der Einwohner gehörten in ein früheres Jahrhundert. Die Menschen waren freundlich und neugierig, aber nicht aufdringlich, obwohl sie nur selten Besuch von außerhalb erhielten.
»Vor zehn Jahren war schon einmal ein Amerikaner für ein paar Tage in unserem Dorf«, erzählte mir der Wirt des Gasthauses, in dem ich abstieg. »Ein junger Mann, verhielt sich seltsam … murmelte immer vor sich hin – ein Dichter, glaube ich.«
Ich wusste, er konnte nur Justin Geoffrey meinen.
»Ja, er war ein Poet«, antwortete ich, »und er schrieb ein Gedicht über eine Landschaft ganz in der Nähe dieses Dorfes hier.«
»Tatsächlich?« Das Interesse meines Wirtes war geweckt. »Dann muss er, da alle Poeten sich seltsam ausdrücken und verhalten, großen Ruhm erlangt haben, denn sein Benehmen und seine Äußerungen waren die seltsamsten, die ich je bei einem Menschen erlebt habe.«
»Wie es häufig bei Künstlern der Fall ist«, erwiderte ich, »fand er erst nach seinem Tod größere Beachtung.«
»Also ist er tot?«
»Er starb vor fünf Jahren in einem Irrenhaus.«
»Schlimm, schlimm«, seufzte der Wirt mitfühlend. »Armer Kerl – er hat zu lange den Schwarzen Stein angeschaut.«
Mein Herz machte einen Satz, aber ich verbarg mein brennendes Interesse und meinte beiläufig: »Von diesem Schwarzen Stein habe ich schon gehört; irgendwo in der Nähe dieses Dorfes, nicht wahr?«
»Näher als gute Christenmenschen sich wünschen können. Sehen Sie!« Er winkte mich zu einem vergitterten Fenster und zeigte auf die tannenbewachsenen Abhänge der dräuenden blauen Berge. »Da drüben, wo der nackte Fels der Klippe aufragt, steht der verwünschte Stein. Würde er doch zu Staub zermahlen und der Staub in die Donau geworfen und ins tiefste Meer geschwemmt! Einst versuchte man, das verdammte Ding zu zerstören, aber jeder, der seinen Hammer dagegen erhob, fand ein schlimmes Ende. Deshalb meiden die Menschen ihn heute.«
»Was hat es damit auf sich?«, fragte ich neugierig.
»Der Stein wird von Dämonen heimgesucht«, antwortete er unbehaglich und mit dem Anflug eines Schauderns. »In meiner Kindheit gab es einen jungen Mann, der zu uns in die Berge heraufkam und über unsere Traditionen lachte – in seiner Vermessenheit ging er während der Mittsommernacht zum Schwarzen Stein, und bei Morgengrauen kam er ins Dorf zurückgetaumelt, stumm und mit irrem Blick. Etwas hatte seinen Geist zerrüttet und seine Lippen versiegelt, denn bis zum Tag seines Todes, der nicht lange auf sich warten ließ, sprach er nur, um furchtbare Blasphemien oder unverständliches Kauderwelsch auszustoßen.
Mein eigener Neffe verlief sich als Kind in den Bergen und nächtigte in der Nähe des Steins, und jetzt, als Mann, suchen ihn grauenvolle Albträume heim – manchmal zerreißen seine entsetzlichen Schreie die Nacht und er erwacht in kaltem Schweiß gebadet.
Aber reden wir lieber von etwas anderem, mein Herr; es ist nicht gut, sich zu viel mit solchen Dingen zu befassen.«
Ich machte eine Bemerkung über das offensichtliche Alter des Gasthauses und er antwortete voller Stolz: »Die Fundamente sind über 400 Jahre alt; das ursprüngliche Haus war das einzige im Dorf, das nicht niedergebrannt wurde, als Süleymans Teufel durch die Berge stürmten. Hier, in dem Haus, das damals auf diesen Fundamenten ruhte, soll der Schreiber Selim Bahadur sein Hauptquartier aufgeschlagen haben, während seine Truppen das umliegende Land plünderten.«
Ich erfuhr, dass die heutigen Einwohner von Stregoicavar nicht die Nachkommen derjenigen sind, die dort vor dem türkischen Eroberungszug 1526 lebten. Die siegreichen Moslems ließen keine Menschenseele im Dorf und der umliegenden Gegend am Leben. In einem blutigen Mordrausch metzelten sie Männer, Frauen und Kinder nieder, ein ganzer Landstrich blieb stumm und verlassen hinter ihnen zurück. Die jetzigen Bewohner von Stregoicavar stammen von robusten Siedlern aus den unteren Tälern ab, die in die höheren Regionen zogen und das zerstörte Dorf wiederaufbauten, nachdem die Türken zurückgedrängt worden waren.
Mein Wirt sprach ohne größere Verbitterung von der Ausrottung der ursprünglichen Einwohner und ließ durchblicken, dass seine Vorfahren in den tiefer gelegenen Regionen die damaligen Bergbewohner sogar noch mehr gehasst und verabscheut hatten als die Türken. Er drückte sich nur sehr vage aus, was den Ursprung dieser Aversion anging, erzählte aber, die früheren Bewohner von Stregoicavar hätten des Öfteren nächtliche Raubzüge in das Flachland unternommen und Frauen und Kinder entführt. Überdies sagte er, sie seien nicht ganz vom selben Blut gewesen wie seine Vorfahren; die stämmige magyarisch-slawische Bevölkerung habe sich mit einem degenerierten Eingeborenenvolk vermengt, woraus ein abstoßendes Mischvolk hervorgegangen sei. Wer diese Eingeborenen waren, konnte er nicht sagen, aber er wusste zu berichten, dass sie ›Heiden‹ waren und seit Menschengedenken in den Bergen gelebt hatten, schon vor der Ankunft der erobernden Völker.
Ich widmete dieser Geschichte wenig Aufmerksamkeit; ich erkannte lediglich eine Parallele zu der Verschmelzung keltischer Stämme mit Eingeborenen mediterraner Herkunft im Hügelland von Galloway darin, aus der das Mischvolk der Pikten hervorging, das so eine prägnante Rolle in den schottischen Legenden spielt. Die Zeit übt einen seltsam verkürzenden Effekt auf die Legendenbildung aus, und genau wie sich die Geschichten über die Pikten mit Legenden von einer noch älteren mongolischstämmigen Rasse verflochten haben, sodass den Pikten schließlich das abstoßende Äußere der gedrungenen Primitiven zugeschrieben wurde, deren Eigenständigkeit in die piktischen Erzählungen einfloss und in Vergessenheit geriet – genauso, war ich mir sicher, konnten die angeblich unmenschlichen Eigenschaften der ersten Bewohner von Stregoicavar auf ältere, halb vergessene Mythen zurückgeführt werden, die sich um eindringende Hunnen und Mongolen gerankt hatten.
Am Morgen nach meiner Ankunft ließ ich mir von meinem Wirt den Weg beschreiben, was dieser nur widerstrebend tat, und brach auf, um den Schwarzen Stein zu suchen. Eine mehrstündige Wanderung die tannenbewachsenen Berghänge hinauf brachte mich an die massive, zerklüftete Steinklippe, die kühn aus der Flanke des Berges aufragte. Ein enger Pfad führte nach oben, und als ich ihn hinaufstieg, konnte ich auf das friedliche Tal von Stregoicavar hinabblicken, das dort unten zu schlummern schien, auf allen Seiten bewacht von den gewaltigen blauen Bergen. Keine Hütten oder andere Anzeichen menschlicher Ansiedlung waren zwischen der Klippe, auf der ich stand, und dem Dorf zu sehen. Ich konnte zahlreiche Bauernhöfe ausmachen, die verstreut im Tal lagen, aber alle befanden sich auf der anderen Seite von Stregoicavar, das seinerseits vor den dräuenden Abhängen zurückzuschrecken schien, die den Schwarzen Stein verbargen.
Der Gipfel der Klippe stellte sich als eine dicht bewaldete Hochebene heraus. Ich schlug mich ein kurzes Stück durch das dichte Unterholz und gelangte auf eine weite Lichtung. Und in der Mitte dieser Lichtung erhob sich die hagere Form eines schwarzen Steins.
Er war von achteckiger Form, an die fünf Meter hoch und einen halben im Durchmesser. Offenbar war er einst poliert gewesen, doch jetzt zeigte die Oberfläche starke Abnutzungsspuren, als wären große Anstrengungen unternommen worden, ihn zu zerstören; aber die Hämmer hatten kaum mehr angerichtet, als kleine Steinsplitter abplatzen zu lassen und die Schriftzeichen unkenntlich zu machen, die offensichtlich in einer endlosen Spirallinie vom Fuß des Steins nach oben geführt hatten. Bis in eine Höhe von drei Metern waren die Zeichen fast vollständig ausgetilgt, deshalb ließ sich nur schwer bestimmen, in welche Richtung sie verliefen. Weiter oben waren sie etwas deutlicher zu erkennen, und es gelang mir, mich ein Stück den Stein hinaufzuarbeiten und sie aus nächster Nähe zu betrachten. Die Zeichen waren alle mehr oder weniger beschädigt, aber ich war mir sicher, dass sie keine Sprache wiedergaben, an die sich noch jemand auf Erden erinnert. Ich bin recht gut vertraut mit allen Hieroglyphen, die Forschern und Philologen bekannt sind, und ich kann mit Überzeugung sagen, dass diese Schriftzeichen nichts gleichen, wovon ich jemals gelesen oder gehört habe. Am ähnlichsten kommen ihnen vielleicht ein paar Kratzer, die ich einmal auf einem riesigen und merkwürdig symmetrischen Felsblock in einem vergessenen Tal in Yucatán sah. Ich erinnere mich noch, wie ich diese Markierungen damals dem Archäologen zeigte, der mich begleitete, und er der Meinung war, es handle sich entweder um natürliche Verwitterungsspuren oder das müßige Gekritzel eines Indianers. Über meine Theorie, der Felsblock sei in Wirklichkeit die Basis einer längst verschwundenen Säule, lachte er nur und machte mich auf die Dimensionen des Blocks aufmerksam, aus dem man, wäre sie auch nur nach den einfachsten Regeln architektonischer Symmetrie gebaut gewesen, auf eine Säule von 300 Metern Höhe hätte schließen müssen. Doch trotz seiner Argumentation war ich nicht überzeugt.
Ich will nicht behaupten, dass die Schriftzeichen auf dem Schwarzen Stein denen auf dem riesigen Felsblock in Yucatán ähnelten – aber die einen erinnerten an die anderen. Doch auch das Material des Monolithen war mir ein Rätsel. Der Stein, aus dem er bestand, war von einem stumpf glänzenden Schwarz und die Oberfläche erweckte dort, wo sie nicht beschädigt und abgeplatzt war, den merkwürdigen Eindruck von Halbtransparenz.
Ich verbrachte den größten Teil des Vormittags dort und war nicht viel klüger als vorher. Keine Verbindung des Steins zu irgendeinem anderen Artefakt der Welt erschloss sich mir. Es schien fast, als wäre der Monolith von unvorstellbar fremdartigen Händen errichtet worden, in einem Zeitalter weit vor jeglicher menschlicher Historie.
Mit keineswegs zufriedengestellter Neugier kehrte ich ins Dorf zurück. Jetzt, da ich das seltsame Objekt gesehen hatte, war mein Wunsch eher noch gewachsen, die Angelegenheit genauer zu erforschen und herauszufinden, welche unbekannten Hände den Schwarzen Stein zu welchen mysteriösen Zwecken vor so langer Zeit errichtet hatten.
Ich suchte den Neffen des Gastwirtes auf und befragte ihn nach seinen Träumen, aber er konnte nur vage Angaben machen. Er erteilte bereitwillig Auskunft, war jedoch nicht in der Lage, die Bilder klar zu beschreiben; obwohl er wiederholt die gleichen Träume hatte und sie immer entsetzlich lebhaft waren, hinterließen sie keinen bleibenden Eindruck in seinem wachen Geist. Er erinnerte sich an sie nur als chaotische Albträume, in denen riesige, wirbelnde Feuer grelle Flammenzungen verschossen und unentwegt eine finstere Trommel dröhnte. Nur an eine Sache konnte er sich deutlich erinnern – in einem Traum hatte er den Schwarzen Stein gesehen, aber nicht an einem Berghang, sondern wie eine Turmspitze auf einer gewaltigen schwarzen Burg.
Was die anderen Dorfbewohner anging, so musste ich feststellen, dass sie nicht sehr geneigt waren, über den Schwarzen Stein zu reden – mit Ausnahme des Schulmeisters, eines Mannes von überraschender Bildung, der einen weit größeren Teil seines Lebens außerhalb des Dorfes verbracht hatte als jeder andere.
Er war sehr interessiert, als ich ihm von Junzts Bemerkungen über den Stein schilderte, und stimmte dem deutschen Autor bezüglich des vermuteten Alters des Monolithen von ganzem Herzen zu. Er glaubte, dass einst eine Art Hexenzirkel in der Nähe des Dorfes existiert habe und dass möglicherweise alle ursprünglichen Dorfbewohner Mitglieder dieses Fruchtbarkeitskultes gewesen seien, der einst die europäische Zivilisation zu unterwandern gedroht hatte und auf den die Geschichten über Hexerei zurückgingen. Als Beleg führte er den Namen des Dorfes an; ursprünglich habe es nicht Stregoicavar geheißen. Den Legenden zufolge hatten seine Erbauer es Xuthltan genannt, was der Eingeborenenname für den Ort war, an dem das Dorf vor vielen Jahrhunderten erbaut worden war.
Diese Tatsache erweckte bei mir erneut ein schwer beschreibbares Gefühl des Unbehagens. Dieser barbarische Name deutete auf keinerlei Verbindung zu irgendeinem skythischen, slawischen oder mongolischen Volk hin, dem die Ureinwohner dieser Berge unter natürlichen Umständen angehört haben müssten.
Dass die Magyaren und Slawen der unteren Täler glaubten, die ursprünglichen Bewohner des Dorfes hätten diesem Hexenkult angehört, sei – so der Schulmeister – schon aus dem Namen ersichtlich, den sie dem Dorf gegeben hatten und der auch beibehalten wurde, nachdem die älteren Siedler von den Türken massakriert und das Dorf von einem gesünderen und unverdorbeneren Menschenschlag wiederaufgebaut worden war.
Er glaubte nicht, dass die Anhänger des Kultes den Monolithen erbaut hatten, war aber überzeugt, dass er im Zentrum ihrer kultischen Handlungen gestanden hatte, und indem er vage Legenden zitierte, die aus der Zeit vor der türkischen Invasion überliefert waren, legte er mir seine Theorie dar, die degenerierten Dorfbewohner hätten ihn als eine Art Altar benutzt, auf dem sie Menschen opferten, insbesondere die Frauen und Kinder, die sie seinen Vorfahren im Tiefland geraubt hatten.
Die Erzählungen über absonderliche Geschehnisse während der Mittsommernacht tat er als reine Mythen ab, ebenso eine merkwürdige Legende von einer bizarren Gottheit, welche die Hexenmenschen von Xuthltan mit Gesängen und wilden Ritualen voller Geißelungen und Blutvergießen heraufbeschworen haben sollten.
Er selbst habe den Schwarzen Stein nie während der Mittsommernacht besucht, fürchte sich aber auch nicht davor; was immer dort existiert oder in der Vergangenheit stattgefunden habe, sei längst von den Nebeln der Zeit und des Vergessens verschlungen worden. Der Schwarze Stein habe jede Bedeutung verloren, außer als Verbindungsglied zu einer toten, staubigen Vergangenheit.
Eines Abends, etwa eine Woche nach meiner Ankunft in Stregoicavar, kehrte ich von einem meiner Besuche beim Schulmeister zurück, als mich eine plötzliche Erkenntnis durchzuckte – es war Mittsommernacht! Jene Nacht des Jahres, welche die Legenden auf so grausige Weise mit dem Schwarzen Stein in Verbindung brachten. Ich bog vom Weg zum Gasthaus ab und ging mit schnellen Schritten durch das Dorf. Es war totenstill in Stregoicavar; die Bewohner gingen früh zu Bett. Ich sah niemanden, als ich rasch das Dorf verließ und zwischen den Tannen hinaufschritt, welche die Berghänge in flüsternde Dunkelheit hüllten. Ein strahlender Silbermond hing über dem Tal und übergoss die Felsen und Abhänge mit einem unheimlichen Licht, das die Schatten schwarz hervortreten ließ. Kein Wind wehte durch die Tannen, aber ein mysteriöses, ungreifbares Rascheln und Flüstern war allgegenwärtig. In solchen Nächten, so raunte mir meine entflammte Vorstellungskraft zu, mussten in vergangenen Jahrhunderten nackte Hexen auf Besenstielen durch dieses Tal geflogen sein, verfolgt von johlenden Dämonengeistern.
Ich gelangte an die Klippen und verspürte eine gewisse Beunruhigung, als ich feststellte, dass das trügerische Mondlicht ihnen auf subtile Weise ein Aussehen verlieh, das ich vorher nicht bemerkt hatte – in dem gespenstischen Licht sahen sie weniger wie natürliche Klippen aus, sondern fast wie die Ruinen gigantischer, von Titanen errichteter Burgzinnen, die aus dem Berghang ragten.
Nur mühsam diese Halluzination abschüttelnd, gelangte ich auf die Hochebene, wo ich einen Augenblick zögerte, bevor ich in die unheilvolle Finsternis des Waldes vordrang. Eine gewisse atemlose Spannung hing über den Schatten, wie ein lauerndes Ungetüm, das seinen Atem anhält, um die Beute nicht zu verscheuchen.
Ich trat auf die Lichtung hinaus und erblickte den Monolithen, der groß und hager über der Grasnarbe aufragte. Am Rand des Waldes auf der den Klippen zugewandten Seite lag ein Felsbrocken, der eine Art natürlichen Sitz bildete. Dort nahm ich Platz und dachte daran, dass der wahnsinnige Poet Justin Geoffrey wahrscheinlich hier sein fantastisches Gedicht Das Volk vom Monolithen geschrieben hatte. Der Wirt des Gasthauses glaubte, es sei der Schwarze Stein gewesen, der Geoffrey in den Irrsinn getrieben hatte, aber die Saat des Wahnsinns war schon lange, bevor der Poet nach Stregoicavar kam, in seinem Geist eingepflanzt gewesen.
Ein Blick auf meine Uhr verriet mir, dass die Mitternachtsstunde nicht mehr fern war. Ich lehnte mich zurück und wartete ab, welche geisterhaften Erscheinungen mir hier bevorstehen mochten. Ein leichter Nachtwind flüsterte in den Zweigen der Tannen, auf unheimliche Weise an leise, unsichtbare Flöten erinnernd, die eine gespenstische, unheilvolle Melodie bliesen. Die Eintönigkeit dieses Geräusches und mein unentwegtes Starren auf den Monolithen versetzten mich in eine Art Selbsthypnose; ich wurde schläfrig. Ich kämpfte dagegen an, doch der Schlaf war stärker. Der Monolith schien zu schwanken und zu tanzen, seltsam verzerrt vor meinem Blick, und dann schlief ich ein.
Ich öffnete die Augen und wollte mich erheben, lag aber wie erstarrt, als hielte mich eine eisige Hand fest gepackt. Kaltes Entsetzen durchfuhr mich. Die Lichtung war nicht länger verwaist. Eine schweigende Menge seltsamer Menschen drängte sich darauf und meine weit aufgerissenen Augen nahmen barbarische Details ihrer Kleidung wahr, die – wie mir mein Verstand sagte – selbst in diesem rückständigen Landstrich archaisch und längst vergessen waren. Bestimmt, so dachte ich, sind dies Dorfbewohner, die hierhergekommen sind, um irgendeine bizarre Zusammenkunft abzuhalten – aber ein genauerer Blick verriet mir, dass diese Menschen nicht die Einwohner von Stregoicavar waren. Sie gehörten einem kleineren, gedrungeneren Volk an, dessen Brauen tiefer saßen, dessen Gesichter breiter und stumpfsinniger waren. Einige hatten slawische oder magyarische Gesichtszüge, aber diese Züge wirkten degeneriert, als hätten sie sich mit einer primitiveren, fremderen Linie vermischt, die ich nicht einordnen konnte. Viele trugen Tierfelle und ihre Gesamterscheinung verriet, bei Männern und Frauen gleichermaßen, eine Art sinnlicher Animalität. Sie erschreckten mich und stießen mich ab, aber sie schenkten mir keine Beachtung.
In einem großen Halbkreis standen sie vor dem Monolithen, und nun setzten sie zu einer Art Singsang an, wobei sie im Gleichtakt mit den Armen fuchtelten und ihren Oberkörper rhythmisch hin und her wiegten. Alle Augen waren auf die Spitze des Steines fixiert, den sie zu beschwören schienen. Aber das Befremdlichste war die Undeutlichkeit ihrer Stimmen; keine 50 Meter von mir entfernt erhoben Hunderte Männer und Frauen unverkennbar ihre Stimmen zu einem wilden Gesang, und dennoch drangen diese Stimmen zu mir nur wie ein schwaches, unverständliches Gemurmel, als käme es von jenseits gewaltiger Abgründe des Raumes – oder der Zeit.
Vor dem Monolithen stand eine Feuerschale, aus der ein beißender, ekelerregender gelber Rauch aufquoll und sich auf absonderliche Weise in einer wogenden Spirale um den Schwarzen Stein kräuselte, wie eine riesige, flüchtige Schlange.
Neben dieser Feuerschale lagen zwei Gestalten – eine junge Frau, splitternackt und an Händen und Füßen gefesselt, und ein Säugling, offenbar erst wenige Monate alt. Auf der anderen Seite der Schale hockte eine abscheuliche alte Vettel mit einer seltsam geformten schwarzen Trommel im Schoß; diese Trommel schlug sie mit langsamen, leichten Schlägen ihrer Handfläche, doch den Laut konnte ich nicht hören.
Der Rhythmus der sich wiegenden Körper wurde schneller und in den freien Raum zwischen den Kultisten und dem Monolithen sprang nun eine nackte junge Frau mit blitzenden Augen und flatterndem schwarzem Haar. Sie drehte sich schwindelerregend auf den Zehen, wirbelte über die offene Fläche und warf sich flach vor dem Stein auf die Erde, wo sie reglos liegen blieb. Im nächsten Moment folgte ihr eine fantastische Gestalt – ein Mann, um dessen Hüften ein Ziegenfell hing und dessen Gesicht vollständig unter einer Maske versteckt war, die aus einem riesigen Wolfskopf gemacht war, sodass er wie eine grässliche Albtraumkreatur aussah, gleichermaßen aus menschlichen und tierischen Komponenten zusammengesetzt. In seiner Hand hielt er ein Bündel Tannengerten, die an den dickeren Enden zusammengebunden waren, und das Mondlicht glitzerte auf einer schweren Goldkette, die um seinen Hals hing; eine kleinere Kette, die daran hing, deutete auf einen Anhänger hin, der jedoch offenbar fehlte.
Die Umstehenden warfen wild die Arme in die Luft und schienen ihre Rufe zu verdoppeln, als diese groteske Kreatur mit zahlreichen fantastischen Sprüngen und Kapriolen über die freie Fläche tanzte. Als der Mann die vor dem Monolithen liegende Frau erreichte, schlug er mit den Gerten, die er in der Hand hielt, auf sie ein, und sie sprang auf und schloss sich ihm mit wilden Verrenkungen zum unglaublichsten Tanz an, den ich je gesehen habe. Und ihr Peiniger tanzte mit ihr, im gleichen wilden Rhythmus passte er sich ihren Sprüngen und Drehungen an, während er unentwegt brutale Schläge auf ihren nackten Körper niederregnen ließ. Und bei jedem Schlag schrie er ein einzelnes Wort, immer und immer wieder, und die Menge schrie es zurück. Ich sah, wie ihre Lippen sich bewegten, und jetzt verschmolz das leise, undeutliche Gemurmel ihrer Stimmen zu einem fernen Ruf, der in sabbernder Ekstase unablässig wiederholt wurde. Aber wie dieses Wort lautete, konnte ich nicht verstehen.
In schwindelerregenden Drehungen wirbelten die Tänzer umher, während die Zuschauer, wie angewurzelt an ihrem Platz stehend, dem Rhythmus des Tanzes mit wiegendem Oberkörper und schwenkenden Armen folgten. Immer heftiger loderte der Wahnsinn in den Augen der besessenen Tänzerin und spiegelte sich in den Gesichtern der Zuschauer wider. Wilder und zügelloser wurde die furiose Raserei dieses irren Tanzes – er wurde zu etwas Bestialischem und Obszönem, während die Alte heulte und wie eine Wahnsinnige die Trommel schlug und die Gerten den Rhythmus dieses Teufelsgesangs peitschten.
Blut bedeckte die Gliedmaßen der Tänzerin, aber sie schien die Schläge gar nicht zu spüren, es sei denn als Ansporn für neuerliche Steigerungen ihrer besessenen Bewegungen. Sie sprang mitten hinein in den gelben Qualm, der jetzt zarte Tentakel ausstreckte, um die beiden wirbelnden Gestalten zu umarmen, und sie schien regelrecht mit dem fauligen Nebel zu verschmelzen und sich damit zu verhüllen. Dann tauchte sie wieder auf, dicht gefolgt von der bestialischen Kreatur, die sie immer weiter auspeitschte, in einem unbeschreiblichen, explosiven Ausbruch furioser, irrsinniger Bewegung, und auf dem Höhepunkt dieses Irrsinns ließ sie sich plötzlich zu Boden fallen, zitternd und keuchend, als hätten ihre frenetischen Anstrengungen sie vollständig erschöpft. Die Schläge hielten mit unverminderter Brutalität und Intensität an, und nun begann sie, sich auf dem Bauch in Richtung des Monolithen zu schlängeln. Der Priester – so will ich ihn nennen – folgte ihr und schlug mit aller Kraft auf ihren schutzlosen Körper ein, während sie weiterkroch und eine breite, blutige Spur auf der festgetrampelten Erde hinterließ. Sie erreichte den Monolithen, und keuchend und stöhnend warf sie beide Arme darum und bedeckte den kalten Stein mit heißen, innigen Küssen wie in wahnsinniger, unheiliger Anbetung.
Der groteske Priester sprang hoch in die Luft, warf das blutig rote Gertenbündel beiseite, und die Anbeter, heulend und mit Schaum vor dem Mund, stürzten sich mit Zähnen und Fingernägeln aufeinander und zerrissen sich gegenseitig Kleidung und Haut in einer wilden Raserei enthemmter Brutalität. Der Priester schnappte mit seinem langen Arm nach dem Säugling, und indem er erneut jenen Namen schrie, wirbelte er das heulende Kind hoch durch die Luft und zerschmetterte dessen Schädel an dem Monolithen, wo ein hässlicher, dunkler Fleck auf der schwarzen Oberfläche zurückblieb. Erfüllt von eiskaltem Entsetzen sah ich, wie er den winzigen Körper mit seinen bloßen bestialischen Fingern aufriss und den Stein mit Blut bespritzte, bevor er die zerfetzte Gestalt in die Feuerschale warf und mit einem blutroten Regen Flammen und Rauch löschte, während die besessenen Kultisten hinter ihm immer und immer wieder jenen Namen heulten. Und dann warfen sich plötzlich alle zu Boden, sich windend wie Schlangen, während der Priester seine blutüberströmten Arme wie im Triumph weit ausbreitete. Ich riss den Mund auf, um mein Entsetzen und meine Abscheu in die Welt zu schreien, aber nur ein trockenes Rasseln drang heraus – denn ein riesiges, monströses krötenartiges Ding hockte auf der Spitze des Monolithen!
Ich sah seine aufgedunsenen, abstoßenden, schwankenden Umrisse gegen das Mondlicht, und dort, wo sich bei einem natürlichen Lebewesen das Gesicht befunden hätte, blinzelten riesige Augen, in denen sich all die Lust, die unermessliche Gier, die obszöne Grausamkeit und das abgrundtiefe Böse widerspiegelten, die immer wieder die Söhne der Menschen heimsuchten, seit ihre Vorfahren blind und haarlos in den Bäumen umhergeklettert waren. In jenen grauenvollen Augen spiegelten sich all die unheiligen Dinge und widerwärtigen Geheimnisse, die in den Städten unter dem Meer schlummern und sich in der Finsternis urzeitlicher Höhlen vor dem Tageslicht verstecken. Und so blinzelte und grinste diese entsetzliche Kreatur, die durch jenes abscheuliche Ritual aus Grausamkeit, Sadismus und Blut aus der Stille der Hügel heraufbeschworen worden war, auf ihre bestialischen Anbeter hinab, die in abstoßender Erniedrigung vor ihr katzbuckelten.
Jetzt packte der Priester mit der Tiermaske die gefesselte und sich verzweifelt windende Gefangene mit seinen brutalen Händen und hob sie dem Grauen auf dem Monolithen entgegen. Und als diese Monstrosität tief einatmete, lustvoll und sabbernd, da rastete etwas in meinem Geist aus und ich fiel in eine gnädige Ohnmacht.
Ich öffnete die Augen in einer stillen weißen Morgendämmerung. Die Ereignisse der Nacht drangen in mein Gedächtnis, und ich sprang auf und sah mich erstaunt um. Der Monolith ragte hager und stumm über dem Gras auf, das grün und unzertreten in der Morgenbrise wogte. Ein paar schnelle Schritte brachten mich über die Lichtung; hier waren die Tänzer herumgesprungen und -getollt, hier hatten sie den Boden aufgewühlt und zertreten und hier war die Anbeterin ihren schmerzvollen Weg zum Stein gekrochen und hatte die Erde mit Blut getränkt. Aber kein roter Tropfen war auf der unversehrten Grasnarbe zu sehen. Ich betrachtete schaudernd die Seite des Monolithen, an welcher der bestialische Priester den Säugling zerschmettert hatte – aber dort war kein dunkler Fleck und kein grausiges Gerinnsel.
Ein Traum! Es war ein wilder Albtraum gewesen … aber andererseits – ich zuckte mit den Achseln. Welch eine lebhafte Klarheit für einen Traum!
Ich kehrte leise ins Dorf zurück und betrat den Gasthof, ohne gesehen zu werden. Und dort saß ich und dachte über die seltsamen Geschehnisse der Nacht nach. Mehr und mehr neigte ich dazu, die Traum-Theorie zu verwerfen. Dass das, was ich gesehen hatte, eine Illusion war und keine materielle Substanz besaß, war unbestreitbar. Aber ich war davon überzeugt, die Widerspiegelung einer Untat gesehen zu haben, die in grausiger Realität in fernen Zeiten begangen worden war. Aber wie konnte ich mir sicher sein? Welche Beweise konnte ich vorweisen, dass meine Vision ein Blick auf die Gräuel früher Vergangenheit war und kein bloßer Albtraum, der meinem eigenen Geist entsprang?
Wie als Antwort schoss mir ein Name in den Sinn – Selim Bahadur! Der Legende zufolge hatte dieser Mann, der ebenso Soldat gewesen war wie Schreiber, jenen Teil von Süleymans Armee befehligt, der Stregoicavar verwüstete – was mir durchaus möglich erschien. Und wenn es sich so verhielt, dann war er direkt von jenem entvölkerten Landstrich zum blutigen Schlachtfeld von Schomvaal und damit seinem Schicksal geeilt. Mit einem leisen Schrei sprang ich auf – das Manuskript, das man bei der Leiche des Türken fand und das Graf Boris so tief erschaudern ließ … Konnte es nicht eine Schilderung dessen enthalten, worauf die siegreichen Türken in Stregoicavar gestoßen waren? Was sonst hätte die stählernen Nerven des polnischen Abenteurers so erschüttern können? Und da die Gebeine des Grafen nie geborgen wurden, konnte es nicht sein, dass das lackierte Kästchen mit seinem mysteriösen Inhalt immer noch unter den Ruinen versteckt lag, die Boris Wladinows Grab bildeten? In fieberhafter Eile packte ich meine Tasche.
Drei Tage später hatte ich mich in einem Dorf wenige Meilen vom alten Schlachtfeld entfernt einquartiert, und als der Mond aufging, arbeitete ich mit wilder Entschlossenheit an dem großen Haufen aus zerfallenen Steinen, der den Hügel krönte. Es war eine zermürbende Plackerei – rückblickend ist es mir ein Rätsel, wie ich diese Arbeit bewältigen konnte, obwohl ich mich von Mondaufgang bis Morgengrauen abmühte. Gerade als die Sonne aufging, wuchtete ich den letzten Steinbrocken beiseite und erblickte die sterblichen Überreste von Graf Boris Wladinow – nur ein paar klägliche Bruchstücke zerschmetterter Knochen –, und dazwischen, so zerdrückt, dass die ursprüngliche Form kaum noch zu erkennen war, lag ein Kästchen, dessen lackierte Oberfläche es davor bewahrt hatte, im Laufe der Jahrhunderte gänzlich zu verrotten.
Mit brennender Ungeduld nahm ich es an mich, und nachdem ich die Knochen wieder mit einigen Steinen bedeckt hatte, eilte ich davon; denn ich wollte ungern von den argwöhnischen Bauern bei einem Akt augenscheinlicher Grabschändung ertappt werden.
Zurück in meinem Gastzimmer öffnete ich das Kästchen und fand das Pergament vergleichsweise unversehrt vor; doch da war noch etwas in dem Behälter – ein kleiner, plumper Gegenstand, eingehüllt in Seide. Ich brannte darauf, die Geheimnisse dieser vergilbten Seiten zu ergründen, aber die Müdigkeit hielt mich davon ab. Seit meinem Aufbruch aus Stregoicavar hatte ich kaum geschlafen und die entsetzlichen Anstrengungen der vergangenen Nacht forderten ihren Tribut. Gegen meinen Willen war ich gezwungen, mich auf dem Bett auszustrecken, und ich erwachte nicht vor Sonnenuntergang.
Nach einem hastigen Abendmahl machte ich mich im flackernden Licht einer Kerze daran, die säuberlichen Schriftzeichen in türkischer Sprache zu lesen, welche das Pergament bedeckten. Es war ein schweres Stück Arbeit, denn ich bin nicht sehr bewandert in dieser Sprache und der archaische Stil des Textes machte mir zu schaffen. Aber während ich mich hindurchmühte, fiel mir hier und da ein Wort oder ein Ausdruck ins Auge und ein vages, aber beständig zunehmendes Grauen erfasste mich. Ich widmete meine ganze Energie der Aufgabe, und als der Bericht klarer wurde und greifbarere Gestalt annahm, gefror mir das Blut in den Adern, das Haar stand mir zu Berge und die Zunge erstarrte in meinem Mund. Alles um mich herum wurde Teil des grausigen Wahnsinns jenes höllischen Manuskriptes, bis die Nachtgeräusche der Insekten und der Geschöpfe des Waldes zum schauderhaften Gemurmel und dem verstohlenen Schleichen grauenhafter Schrecken wurden und das Seufzen des Nachtwindes sich in die kichernde, obszöne Häme des Bösen angesichts der Seelen der Menschen verwandelte.
Als sich schließlich der graue Morgen durch das vergitterte Fenster stahl, legte ich das Manuskript nieder und wickelte den Gegenstand aus dem Seidentuch. Mit übernächtigten Augen starrte ich ihn an und wusste, dass damit die Wahrheit des Textes besiegelt war, wenn es denn überhaupt möglich gewesen wäre, die Glaubwürdigkeit dieses entsetzlichen Manuskriptes anzuzweifeln.
Und ich legte die beiden obszönen Objekte in das Kästchen zurück, und weder ruhte oder schlief noch aß ich, bis ich jenes Kästchen mit Steinen beschwert und in den tiefsten Lauf der Donau geworfen hatte, die es, gebe Gott, in die Hölle zurücktragen würde, aus der es gekommen war.
Denn es war kein Traum, den ich in der Mittsommernacht in den Hügeln über Stregoicavar geträumt hatte. Gut, dass Justin Geoffrey dort nur bei Sonnenlicht verweilt hatte und dann seines Weges gegangen war, denn wäre er Zeuge jener grausigen Zusammenkunft geworden, hätte sein angegriffener Geist ihn bereits dort im Stich gelassen. Wie ich selbst es schaffte, bei Vernunft zu bleiben, vermag ich nicht zu sagen.
Nein, es war kein Traum – ich wurde Zeuge eines unseligen Aufmarsches längst verstorbener Götzenanbeter, aus der Hölle heraufgekommen, um ihr Idol zu verehren wie in alter Zeit; Geister, die sich vor einem Geist verneigten. Denn schon vor Langem hat die Hölle ihren abscheulichen Gott verschlungen. Lange, lange Zeit lebte er in jenen Hügeln, ein grässliches Überbleibsel eines untergegangenen Zeitalters, doch nicht länger mehr bohren sich seine obszönen Klauen in die Seelen lebender Menschen, denn sein Reich ist ein totes Reich, nur von den Geistern derjenigen bevölkert, die ihm zu seinen und ihren Lebzeiten dienten.
Durch welche schändliche Alchemie oder ruchlose Zauberei die Pforten der Hölle in jener gespenstischen Nacht aufgetan wurden, weiß ich nicht, doch ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und ich weiß, dass ich in jener Nacht nichts Lebendes erblickte, denn das Manuskript, in der akribischen Handschrift von Selim Bahadur verfasst, berichtet ausführlich davon, was er und seine Mannen im Tal von Stregoicavar fanden. Und ich las, in aller Ausführlichkeit, von den blasphemischen Obszönitäten, welche die Folter den Lippen der Götzenanbeter entriss; ich las von der vergessenen, düster schwarzen Höhle hoch in den Bergen, wo die entsetzten Türken eine monströse, aufgeblähte, sich im Dreck suhlende krötenähnliche Kreatur in die Enge trieben und mit Feuer und uraltem Stahl, in alter Zeit von Mohammed gesegnet, und Beschwörungen, die schon alt waren, als Arabien noch jung war, niedermetzelten. Und selbst die Hand des unerschütterlichen alten Selim hatte gezittert, als er vom verheerenden, die Welt erschütternden Todesgeheul jener Monstrosität berichtete, die nicht allein starb; denn ein Dutzend ihrer Angreifer starb mit ihr, auf eine Weise, die Selim nicht beschreiben wollte oder konnte.
Und das gedrungene Götzenbild aus Gold war ein Abbild dieser Kreatur, und Selim riss es von der Goldkette, die den Hals des niedergemetzelten Hohepriesters mit der Maske zierte.
Welch ein Segen, dass die Türken jenes unselige Tal mit Fackel und reinigendem Stahl säuberten! Was diese düsteren Berge gesehen haben, gehört in die Finsternis und die Abgründe vergessener Zeitalter. Nein – es ist nicht die Angst vor dieser krötenartigen Kreatur, die mich des Nachts erschaudern lässt. Sie ist mitsamt ihrer ekelhaften Horde in der Hölle gefangen, nur während der unheimlichsten Nacht des Jahres für eine Stunde befreit, so wie ich es gesehen habe. Und von ihren Anbetern ist keiner verblieben.
Vielmehr ist es die Erkenntnis, dass solche Wesen einst wie Raubtiere auf die Seelen der Menschen lauerten, die mir den kalten Schweiß auf die Stirn treibt; und ich scheue davor zurück, einen erneuten Blick in die Blätter von von Junzts grausigem Werk zu werfen. Denn jetzt verstehe ich, weshalb er immer wieder das Wort Schlüssel wiederholt – ja, Schlüssel zu fernen Toren … Verbindungen zu einer abscheulichen Vergangenheit und – wer weiß? – zu abscheulichen Sphären der Gegenwart. Und ich begreife, weshalb die Klippen im Mondlicht wie Burgzinnen aussehen und weshalb der von Nachtmahren geplagte Neffe des Gastwirtes in seinen Träumen den Schwarzen Stein als Spitze einer gigantischen schwarzen Burg erblickt. Sollten Menschen jemals Ausgrabungen in jenen Bergen unternehmen, könnten sie unvorstellbare Dinge unter diesen trügerischen Abhängen finden. Denn die Höhle, in der die Türken jenes … Ding … in die Enge trieben, war nicht wirklich eine Höhle, und ich erschaudere beim Gedanken an den gewaltigen Abgrund der Äonen, der sich zwischen unserem Zeitalter und der Zeit erstreckt, als die Erde sich schüttelte und wie eine Welle jene blauen Berge aufwarf, die Undenkbares unter sich begruben. Hoffentlich wird der Mensch niemals versuchen, die grauenvolle Turmspitze freizulegen, die wir heute den Schwarzen Stein nennen!
Ein Schlüssel! Ja, es ist ein Schlüssel, ein Symbol eines vergessenen Grauens. Dieses Grauen ist wieder in die Vorhölle verschwunden, aus der es auf abscheuliche Weise in der schwarzen Morgendämmerung der Erde gekrochen kam. Aber was ist mit den anderen blasphemischen Teufeleien, die von Junzt andeutet – und mit der grauenvollen Krallenhand, die das Leben aus ihm herauswürgte? Seit ich gelesen habe, was Selim Bahadur schrieb, kann ich nichts mehr anzweifeln, was im Schwarzen Buch steht. Der Mensch war nicht immer der Herr der Erde – ist er es denn heute?
Und ein Gedanke lässt mich nicht los … Wenn eine solche grauenvolle Kreatur wie der Herr des Monolithen es irgendwie schaffte, ihr eigenes, unaussprechlich fernes Zeitalter so lange zu überleben – welche namenlosen Wesenheiten mögen noch jetzt an den finstersten Orten der Welt hausen?
Der Schwarze Bär schlägt zu
Die Nacht hing unheilschwanger wie eine dunkle Bedrohung über dem Fluss. Ich kauerte zwischen den spärlichen Büschen, und die klamme Kälte ließ mich erzittern. Irgendwo in dem großen dunklen Haus vor mir ertönte ein leiser Gongschlag – einmal. Seit ich in meinem Versteck saß, war der Gong bereits achtmal erklungen. Ich zählte die Töne mechanisch und beobachtete den schwarzen Klotz mit finsterem Blick. Dies war ein Haus der Geheimnisse – das Haus des geheimnisvollen Yotai Yun, eines chinesischen Handelsherrn – und welch zwielichtige Geschäfte in seinem Inneren abgeschlossen wurden, hatte kein Weißer je erfahren. Bill Lannon wollte es herausfinden – ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter des britischen Empire, der leicht in alte Gewohnheiten zurückfiel. Auf eigene Faust stellte er geheime Ermittlungen an – er machte mir gegenüber vage Andeutungen, dass in Yotai Yuns Haus finstere Geheimnisse verborgen lägen – und erzählte mir und Eric Brand von mysteriösen Versammlungen, unglaublichen Verschwörungen und einem schrecklichen Vermummten Mönch, der irgendeinen schwarzen Kult anführte, der ein neues Weltreich versprach.
Eric Brand, ein schlanker Abenteurer mit verwegenem Blick, lachte Lannon nur aus – ich jedoch nicht. Ich wusste, dass der alte Knabe wie ein Jagdhund etwas Finsterem, Geheimnisvollem auf der Spur war. Eines Abends, wir saßen im European Club-Room und tranken Whiskey Soda, erzählte er uns, er habe vor, sich noch in dieser Nacht in Yotai Yuns Haus zu schleichen, um herauszufinden, was dort vor sich ging. Man fand seine Leiche am nächsten Morgen – er trieb schlaff in den schmutzig gelben Wassern des Jangtse, und ein dünner Dolch steckte bis zum Griff zwischen seinen Schulterblättern.
Bill Lannon war mein Freund gewesen. Deshalb kauerte ich nun auch nach Mitternacht im dünnen Gestrüpp und beobachtete Yotai Yuns Haus, das etwas außerhalb der heruntergekommenen Vororte von Hankow in den Himmel ragte. Ich fragte mich, worauf Bill Lannon wohl gestoßen war, bevor sie ihn erstochen und den Fischen zum Fraß vorgeworfen hatten – wurde in diesem düsteren Haus Piraterie, Schmuggel oder ein Regierungsumsturz geplant? Yotai Yun trieb zwielichtigen Handel und schloss krumme Geschäfte auf dem Fluss ab, das war allgemein bekannt – aber niemand hatte ihm je etwas nachweisen können.
Plötzlich tauchte schlurfend eine große Gestalt aus dem Nebel auf – ein Asiat, augenscheinlich ein Einheimischer, der in formlose Gewänder gehüllt war. Er bewegte sich auf eine armselige Fischerhütte zu, die scheinbar verlassen am Flussufer stand, vielleicht 50 Meter von der Mauer entfernt, die das große Dragon House umgab. Ich wurde plötzlich stocksteif. Ein- oder zweimal hatte ich mir eingebildet, einen Lichtschein in der Hütte zu sehen, obwohl sie dem äußeren Anschein nach völlig leer stand. Aber jedes Mal, wenn ein Einheimischer in der Hütte verschwand, ertönte kurz darauf von irgendwo im Dragon House ein Gongschlag. Acht Männer waren bislang in die Hütte gegangen – achtmal war der Gong im Haus ertönt. Worin bestand die Verbindung zwischen dieser schäbigen, baufälligen Fischerhütte und dem palastartigen Anwesen von Yotai Yun?
Der Einheimische näherte sich der brüchigen Tür, und ich erhob mich aus meinem Versteck und folgte ihm wagemutig mit schnellen Schritten. Hätte er sich umgedreht, hätte er mich unmöglich übersehen können. Aber er betrat die Hütte, ohne sich ein einziges Mal umzusehen, und schloss die schief hängende Tür hinter sich. Bis auf den Asiaten war die Hütte leer! Er schob einige alte Teppiche zur Seite und klopfte mit der Faust auf den Boden – dreimal – hielt inne – klopfte weitere drei Mal – hielt wieder inne – und klopfte noch dreimal.
Sein Streichholz war erloschen, aber im Boden der Hütte war plötzlich ein schmaler Balken aus Licht zu erkennen, der sich vergrößerte, als die Klappe einer Falltür aufgestoßen wurde und das brutale Gesicht eines weiteren Asiaten in der Öffnung erschien. Keiner der beiden sagte etwas; der Türwächter nickte lediglich und verschwand wieder nach unten, woraufhin der andere ihm in die Luke nachkletterte. In diesem Augenblick waren seine Gesichtszüge deutlich zu sehen und ich erkannte ihn – er war ein berüchtigter Flusspirat, der seit Langem wegen Raub und Mord gesucht wurde. Er verschwand, und die Falltür fiel wieder zu. Ich begann die Verbindung zu verstehen. Ganz offensichtlich führte diese Geheimtür zu einem Tunnel, der die Hütte mit dem Dragon House verband. Der Gong diente dazu, die Ankunft jener Besucher anzukündigen, die das Haus auf diesem Weg betraten. Ich war fest entschlossen herauszufinden, weshalb.
Schnell und heimlich betrat ich die Hütte, suchte in der Dunkelheit mit den Händen nach der Falltür und klopfte genauso, wie der Chinese es getan hatte. Fast im selben Moment öffnete sich die Klappe und ich versteckte mich hastig dahinter. Wieder erschien die Verbrechervisage, und der Asiat blickte sich mit funkelnden Augen hektisch um, sah jedoch nicht, dass ich direkt hinter seinem Kopf kauerte. Er kletterte halb aus der Öffnung, und bevor er sich umdrehen und mich sehen konnte, packte ich seinen Hals mit so festem Griff, dass der Schrei in seiner Kehle erstarb, und dann schlug ich ihm mit der rechten Faust hinters Ohr. Er sackte sofort bewusstlos zusammen.
Ich zog ihn aus der Öffnung und fesselte und knebelte ihn mit Stoffstreifen, die ich aus seinen Gewändern riss. Dann zog ich ihn in eine dunkle Ecke der Hütte und versteckte ihn unter einigen dreckigen Teppichen, die auf dem Boden lagen. Die Hütte war durch den Schein aus der offenen Luke schwach erleuchtet. Ich zog meine Pistole, eine 45er Automatik, stieg vorsichtig in die Öffnung hinab und schloss die Geheimtür hinter mir. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen oder was ich dort tun sollte, aber ich wusste, dass der Weg der Vergeltung mich irgendwie zu Yotai Yun führen würde, und ich hatte geschworen, diesen Weg zu gehen – bis zum bitteren Ende.
Eine Steintreppe führte zu einem schmalen Tunnel mit steinernen Wänden, der, soweit ich sehen konnte, geradewegs zum Dragon House führte. Dank der Laternen, die in regelmäßigen Abständen an der Wand hingen, war er einigermaßen ausgeleuchtet und ich folgte ihm rasch, aber vorsichtig mit schussbereiter Waffe. Mir begegnete jedoch niemand, und nach einer Weile befand ich mich, wie ich annahm, direkt unter dem großen Haus. Bald darauf endete der Tunnel an einer stabilen Holztür. Vorsichtig drückte ich mit angespannten Nerven die Klinke, ohne zu wissen, was mich dahinter erwartete. Die Tür gab nach und öffnete sich in eine kleine Kammer, deren Fußboden, Wände und Decke aus nacktem Stein waren. In der Kammer standen ein einfacher Tisch und ein paar Stühle in europäischem Stil, aber das Zimmer war menschenleer.
Ich trat ein und schloss die Tür hinter mir. Am anderen Ende des Raumes sah ich eine Steintreppe, die nach oben führte. Am Fuß der Treppe befand sich eine kleine Tür. Ich hatte bereits einige Stufen hinter mir gelassen, als ich über mir das Gemurmel mehrerer Stimmen hörte und sich die Falltür über der Treppe öffnete. Ich sprang hastig von den Stufen und rüttelte an der kleinen Tür. Sie ließ sich öffnen und ich trat hinein, keine Sekunde zu früh. Jemand kam die Treppe herunter und ich hörte die abgehackt klingenden Laute einer asiatischen Unterhaltung.
Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand, denn in meinem Versteck war es so dunkel wie im Bauch einer Katze. Während ich das Dunkel abtastete und jeden Moment damit rechnete, in eine Grube zu fallen oder ein Messer in den Rücken zu bekommen, fragte ich mich, was Eric Brand wohl sagen würde, wenn man meine Leiche morgen im Jangtse treibend fände. Er hatte Bill Lannons Ende vorhergesehen und ihn auf seine typisch zynische Art gewarnt, sich nicht in asiatische Angelegenheiten einzumischen. Im Gegensatz zu Lannon habe ich Brand nie gemocht und ihn auch nie ins Vertrauen gezogen. Nach meinem Geschmack besaß dieser arrogante, raffinierte Lebemann eine zu gleichgültige Einstellung zum Leben. Er hatte andere Ansichten als ich, was menschliche Werte betraf, und behauptete, jede Art menschlicher Bemühungen, Gefühle und Ambitionen zu verabscheuen. Nun, ich bin nur ein einfacher Seemann, unkultiviert und ungebildet und ganz gewiss kein Feingeist. Ich lebe nach dem Leitspruch »Auge um Auge, Zahn um Zahn« – das war auch der Grund, weshalb ich in dieser stillen, nebligen Nacht allein auf der Suche nach Yotai Yun war.
Beim Abtasten stellte ich fest, dass ich mich in einem sehr engen Gang befand, und bald erreichte ich eine schmale Steintreppe, die nach oben führte. In völliger Dunkelheit krabbelte ich hinauf und fand mich plötzlich, wie es schien, in einer weiteren Kammer wieder. Ich konnte jedoch noch immer nichts sehen und wagte nicht, ein Streichholz anzuzünden. Ich knallte mit dem Knie gegen eine Art Kasten und stolperte über mehrere Gegenstände, die mit einem solch entsetzlichen Lärm übereinanderfielen, dass mir beinahe das Herz aus der Brust sprang. Es geschah jedoch nichts, und so tastete ich mich weiter. Bei Gott – dieser Raum war das reinste Waffenarsenal! Meine Finger glitten über haufenweise Gewehre und Kisten voller Pistolen samt Halfter, auseinandergebauter Maschinengewehre und Munition. All dies deutete klar und deutlich auf eine baldige Revolution oder einen Aufstand hin, und in der Dunkelheit brach mir der Schweiß aus, als ich an all die unschuldigen Europäer, Amerikaner und friedliebenden Chinesen dachte, die in diesen Stunden seelenruhig in Hankow schliefen und nichts von der Gefahr ahnten, die über ihnen schwebte.
Ich tastete mich weiter bis zu einer Tür, die sich, so schätzte ich, ungefähr gegenüber der Stelle befand, an der ich den Raum betreten hatte. Sie war mit einem Riegel verschlossen. Er war jedoch an der Innenseite angebracht, sodass ich ihn leicht öffnen konnte. Durch die Tür trat ich in einen weiteren schmalen Korridor. Von irgendwo drang ein schwacher Lichtschein herein und ich wusste, wo ich mich befand – in einem Geheimgang hinter der Wand. China ist, ebenso wie der gesamte Orient, von einem regelrechten Netz solcher Gänge durchzogen, mit deren Hilfe die Hausherren ununterbrochen ihren Dienern und anderen Personen ihres Haushalts nachspionieren. Ich schlich mich weiter, bis das Gemurmel einer Unterhaltung an mein Ohr drang. Es erklang hinter der Mauer. Ich hielt inne und suchte nach dem Guckloch, das ganz in der Nähe sein musste. Bald fand ich es und blickte hindurch.
Ich sah in einen großen, aufwendig ausgestatteten Raum, an dessen Wänden samtene Wandbehänge mit eingewirkten Drachen, Göttern und Dämonen hingen. Er war von Kerzen erleuchtet, die den Raum in ein eigenartig goldenes Licht tauchten. Auf seidenen Kissen und Diwanen saß rundum eine seltsame Gruppe bunt gemischter Gestalten – respektable Kaufleute, niedere Regierungsangestellte und wilde, böse dreinblickende Kerle, die allesamt nach Mördern oder Halsabschneidern aussahen. Ich erkannte den Flusspiraten, der vor mir in den Tunnel hinabgestiegen war, und mir wurde klar, weshalb es den geheimen Eingang gab. Den Tunnel nutzten Gauner und Kriminelle, die nur unnötig Verdacht auf das Dragon House gelenkt hätten, wären sie durch den Vordereingang eingetreten.
Insgesamt zählte ich im ganzen Zimmer etwa 40 Männer, alle Asiaten – die meisten stammten aus China, aber ich sah auch ein paar Eurasier und Malaien. Alle hatten Platz genommen und ihren Blick auf ein Podium am anderen Ende des Raumes gerichtet. Auf dem Podium saß Yotai Yun – schlank, boshaft, falkenartig – und neben ihm hockte eine große Gestalt mit schwarzem Umhang, deren Gesicht unter einer schwarzen Maske verborgen war – der Vermummte Lama! Er war also kein Mythos, sondern grausame Wirklichkeit. Ich betrachtete ihn genau; unter seiner Kapuze blitzten zwei stechende, magnetische Augen auf. Aus ihm schien das pure Böse herauszuströmen und ihn wie eine Aura zu umgeben. Ich erschauderte unwillkürlich. Dann erhob er sich zu seiner vollen, entsetzlichen Größe und begann zu sprechen, und sein Publikum klebte förmlich an seinen Lippen. Ich schüttelte mich vor Abscheu, als ich den blasphemischen Worten lauschte, die in vornehmem Chinesisch über seine unsichtbaren Lippen kamen. Er predigte von Revolution, Plünderungen und Krieg! Tod allen ausländischen Teufeln und allen Asiaten, die sich ihnen in den Weg stellten!
Er war der Prophet einer uralten Religion des Bösen oder eines schrecklichen Kultes, der den Teufel anbetet und dessen bloße Existenz sich die meisten Weißen nicht einmal in ihren Träumen vorzustellen vermögen. Dieser Kult war uralt, so alt wie das Böse selbst, und hatte eine sehr lange Zeit in den finsteren schwarzen Bergen des Ostens überdauert. Dschingis Khan kniete einst vor seinen Priestern, ebenso wie Tamerlan und, Jahrhunderte vor ihm, Attila. Nun erwachte der grauenhafte Kult, der für viele Tausend Jahre in der Ödnis der Mongolei geschlummert hatte, aus seinem Schlaf, schüttelte seine schreckliche Mähne und suchte nach Opfern – er streckte seine fürchterlichen Fangarme geradewegs nach dem Herzen Chinas aus.
Den Anhängern des Kultes fiel die Aufgabe zu, so der Vermummte Lama, den Weg für das neue Weltreich zu ebnen. Lasst sie die falschen Lehren von Konfuzius und Buddha vergessen und auch die Götter Tibets und Lhasas, die es zuließen, dass ihr Volk unter der Knechtschaft der weißen Teufel endete. Lasst sie unter der Führung des Propheten, den die Großen Alten zu ihnen sandten, wiederauferstehen, und der große Cthulhu wird sie allesamt zum Sieg führen. Wie Dschingis Khan die Welt mit Pferdehufen niedertrampelte, würden sie die weißen Teufel niedertrampeln und ein neues Weltreich in Asien errichten, das eine Million Jahre Bestand haben werde.
Seine Stimme erhob sich zu einem blutrünstigen Schreien – Mord, Plünderungen, Tod, Hass, Raub und Blutvergießen! Er riss seine Zuhörer im Strom seines eigenen Wahnsinns mit, und sie sprangen auf und heulten wie wild gewordene Hunde. Dann änderte sich seine Stimmung schlagartig und geschickt und gerissen wählte er seine Worte. Er erklärte, die Zeit sei noch nicht reif, es gebe noch viel zu tun; man müsse noch weitere Anhänger gewinnen, der Samen der Revolution müsse noch weiter gestreut werden, die geheime Arbeit fortgesetzt. Der rote Wahnsinn verschwand aus den Augen seiner Zuhörer, und die Ideen, die er eben ausgesprochen hatte, setzten sich in ihren Köpfen fest – sie mussten geschickt vorgehen, mit der Geduld eines jagenden Wolfes und mit grimmiger Arglist.
Ich folgte dem Geschehen mit Entsetzen und wurde mir bewusst, welches Ausmaß dieser Irrsinn annehmen konnte. China ist seit jeher ein Pulverfass, das nur auf ein brennendes Streichholz wartet. Dieser unbekannte Priester hatte Macht, Überzeugungskraft, Persönlichkeit. Manches asiatische Weltreich war auf weniger aufgebaut worden. Ein Gefühl der Schwäche überkam mich, als ich mir die blutroten Veränderungen vorstellte, die ein plötzlicher, entschlossener Aufstand für ein ruhiges, ahnungsloses, friedliches China bedeuten würde. In den Straßen würde Blut fließen – ein plötzlicher, unerwarteter, heftiger Angriff würde die Regierungstruppen vernichten. Horden von unzufriedenen Bürgern und Gaunern würden sich den Revolutionären anschließen. Sämtliche Ausländer würden abgeschlachtet werden.
Ihre Rebellion würde, natürlich, fehlschlagen. Die Nationen der Welt würden ihre Armeen entsenden, um ihre Bürger zu beschützen und ihre Interessen zu verteidigen. Man würde die Revolte auf einem blutigen Schlachtfeld niederschlagen, und Yotai Yun und der Schwarze Mönch würden ihre Köpfe auf dem Peking-Turm verlieren. Aber vorher würden unzählige Menschen sterben, Chinesen und Weiße. Beim Gedanken an so viel Tod und Zerstörung wurde mir übel.
Plötzlich stürzte ein weiterer Einheimischer ins Zimmer. Seine Augen funkelten – es war offensichtlich der Mann, den ich gehört hatte, als er vom Haus in den Tunnel hinabstieg. Hinter ihm folgte der Asiat, der die Falltür in der Hütte bewacht hatte – sein Gesicht war vor Wut und Angst verzerrt. Sie sprachen aufgeregt mit Yotai Yun, in dessen Augen ein unheimlicher Glanz aufflackerte, der den Türwächter erblassen ließ. Der Handelsherr zeigte jedoch keinerlei Anzeichen der Bestürzung. Er richtete ein paar kurze Worte an den Lama, der daraufhin nickte und sich setzte.
Dann erhob sich Yotai Yun und sagte ruhig: »Meine Herren und verehrten Freunde! Ein Spion ist ins Haus eingedrungen, wie mir diese Unwürdigen eben mitteilen. Wer er ist, wissen wir nicht, aber seine Zeit wird schon bald abgelaufen sein. Geht nun, ohne Hast, aber zügig, auf demselben Weg nach Hause, auf dem Ihr gekommen seid. Man wird später erneut nach Euch schicken.«
Mir wurde eiskalt, wusste ich doch nur zu gut, wer dieser Spion war!
Die Asiaten erhoben sich eilig und verließen ohne viel Aufhebens das Zimmer. Nach erstaunlich kurzer Zeit war der Raum bis auf Yotai Yun, den Lama, der auf seinem Stuhl wie ein schwarzes Gemälde wirkte, und die beiden Diener, die zitternd vor ihm standen, leer. Zu ihnen sprach nun Yotai Yun: »Du!«, wandte er sich an den ersten. »Trommle die Diener zusammen und durchsucht das Haus. Finde diesen Spion, wenn dir dein Leben lieb ist!« Der Diener verbeugte sich tief und verließ das Zimmer
Yotai Yun wandte sich dem Wächter der Falltür zu: »Du«, sagte er mit schrecklich giftiger Stimme, »hast mich tief enttäuscht. Dich habe ich für diese schwere Aufgabe ausgewählt, weil du in der Vergangenheit Mut und Intelligenz bewiesen hast. Hiermit verbanne ich dich!«
Der unglückliche Diener zitterte wie ein Blatt im Wind.
»Aber, Meister, ich habe Euch noch niemals zuvor enttäuscht …«
»Eine Enttäuschung ist eine zu viel, du Hund«, sagte Yotai Yun mit tonloser Stimme. »Ich entlasse dich aus meinen Diensten!«
Blitzschnell zog er einen Revolver unter seinem Gewand hervor und feuerte aus kürzester Entfernung. Der Diener fiel stumm zu Boden, Blut tropfte von seiner Schläfe. Yotai Yun klatschte in die Hände, und zwei große Kulis erschienen. Eine Geste ihres Meisters genügte, und sie hoben die Leiche vom Boden auf und trugen sie schwerfällig aus dem Raum.





























