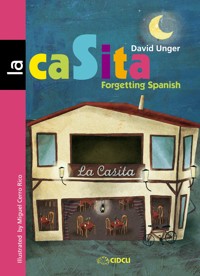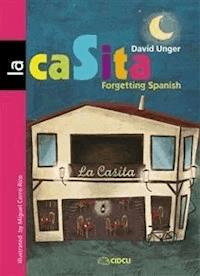10,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kommode Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn plötzlich alles aus den Fugen gerät? Der Jude Samuel Berkow muss 1938 vor den Nazis fliehen und seine Heimatstadt Hamburg verlassen. Mit dem Schiff geht es nach Puerto Barrios in Guatemala. Doch die Hoffnung, fernab der Heimat sicher vor den Nazis leben zu können, hält nicht lange, und die Schlinge um Samuels Hals scheint sich zusehends enger zu ziehen. An diesem Ort, das lernt er schnell, ist auf niemanden Verlass. Kann es einen Ausweg geben, wenn nichts mehr so ist, wie es einmal war? Und die Frage, die über dem Roman steht: Was ist der Preis der Flucht? Mit unnachahmlicher Virtuosität und leichter Hand zeichnet David Unger das Porträt eines jungen, orientierungslosen Mannes und zeigt, wie unsicher der scheinbare Schutz der Zivilisation ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1. Auflage
© 2024 Kommode Verlag, Zürich
Alle Rechte vorbehalten.
Original
David Unger
The Price Of Escape
© David Unger, 2011
c/o Indent Literary Agency
www.indentagency.com
Übersetzung: Lutz Kliche
Lektorat: Matthias Jügler
Korrektorat: Gertrud Germann, torat.ch
Illustration, Satz und Gestaltung: Anneka Beatty
eISBN 978-3-905574-30-2
Kommode Verlag GmbH, Zürich
www.kommode-verlag.ch
David UngerDer Preis der Rettung
Aus dem Englischen von Lutz Kliche
INHALT
PROLOG
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
NEUNZEHNTES KAPITEL
ZWANZIGSTES KAPITEL
EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL
ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL
DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL
VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL
FÜNFUNDZWANZIGSTES KAPITEL
PROLOG
Samuel Berkow hätte einen Angestellten losschicken können, um herauszufinden, warum die »Martin«-Gürtel noch nicht im Laden angeliefert worden waren, aber er hatte Lust, selbst loszugehen. Das Lager befand sich auf St. Pauli, im Hafengebiet in der Nähe der Elbe, nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Trotz der Bordelle und heruntergekommenen Kneipen mochte Samuel diese Gegend. Nur hier konnte man noch so etwas wie Widerstand gegen die Nazis finden; wenigstens die Arbeiter trauten sich, ab und zu den Mund aufzumachen.
Obwohl es Juni war, ließ sich die Sonne nicht blicken. Tatsächlich fühlte der Tag sich an wie ein Tag im Januar. Zwar regnete es nicht, doch Rauch und Nebel lagen über allem, und es schien, als liefe der von den Frachtern und Fabriken ausgespiene Ruß klebrig an den Hauswänden herunter. Samuel ging schnell an den Fischläden und Restaurants vorbei, den zahlreichen Bierhallen und billigen Hotels, die die düsteren Straßen zum Fluss hinunter säumten. Als er noch ein paar Querstraßen von den Landungsbrücken entfernt war, sah er, dass die Uhr am Turm dort vier Uhr nachmittags anzeigte. Um sieben sollte er seinen Onkel Jacob besuchen.
Nach Sonnenuntergang war die Hafengegend für jeden gefährlich, der nicht hierher gehörte, voller Seeleute, Spitzel und Gestapo-Agenten, nicht zu reden von den Dieben und Räubern, die es auf Emigranten abgesehen hatten, von denen viele aus Osteuropa stammten und die in den Hotels maßlose Preise zahlten. Oft trugen sie, in ihre Kleidung eingenäht, Gold- und Silberschmuck bei sich, den sie den dubiosen Schmugglern und Menschenhändlern gaben, die sie auf die Fähren nach London oder Rotterdam zu bringen versprachen.
Die Radionachrichten hatten berichtet, dass sich auf dem Platz vor der Überseebrücke direkt am Fluss etwas zusammenbraue. Es hieß, eine der Munitionsfabriken sei weit unter ihrem Produktionssoll geblieben und einige der Arbeiter – Kommunisten und Anarchisten, wie der Radiosprecher sagte – hätten dagegen protestiert, ohne Pause durcharbeiten zu müssen. Sie hätten sich beschwert, dass sie seit fünf Wochen keinen Lohn bekommen, keinen einzigen freien Tag gehabt hätten und sich ungerechtfertigt hätten aufopfern müssen.
Als Samuel am Platz ankam, sah er, was los war. Ein Trupp Arbeiter in grünen Overalls hatte sich vor dem Gebäude des Hafen- und Zollamts in der Nähe der Landungsbrücken versammelt und mit Paletten und Sperrholzplatten aus den umliegenden Lagerhäusern eine provisorische Bühne errichtet. Von dort aus wurden Reden geschwungen und die Arbeiter aufgewiegelt.
Bald schlossen sich den Fabrikarbeitern am anderen Ende des Platzes ein Dutzend Schauerleute aus dem Hafen in ihren Blaumännern an. In seinem Regenmantel, den er über dem Anzug trug, wirkte Samuel hier fehl am Platze, sodass er beschloss, sich unter ein Vordach an der Hafenmole zu stellen und von dort aus weiter zuzuschauen. Rechts von ihm beobachteten noch zwei Männer die Szene. Einer der beiden saß auf dem Trittbrett eines schwarzen Autos, rauchte entspannt eine Zigarette und schaute ab und zu durch ein Fernglas; der andere sprach lebhaft in ein Funkgerät und schien zu berichten, was er da sah. Abgesehen davon wirkte der Platz auf unheilvolle Weise leer.
Von seinem Standort aus konnte Samuel sehen, dass die Demonstranten Knüppel, Rohre und Latten in den Händen hielten. Einige von ihnen waren mutig genug, Schilder hochzuhalten, auf denen gegen die fehlenden Lohnzahlungen protestiert wurde oder eine geballte Faust zu sehen war.
Solche Massenansammlungen waren ja längst verboten, die Naziregierung tolerierte solche Provokationen nicht. Das hier konnte nichts Gutes geben.
Plötzlich frischte der Wind auf, und die Stimmen erstarben. Auf den Werften jenseits des Flusses schlugen und kreischten die Kabel der Kräne, und dann hörte Samuel noch ein oder zwei ferne Nebelhörner. An den Fahnenstangen der umliegenden Gebäude klirrten die Naziflaggen im Wind.
Samuel spürte sein Herz schneller schlagen, als er hinter sich ein Dröhnen hörte. Das Geräusch wurde immer lauter, bis seine Trommelfelle zu vibrieren begannen. Dann sah er die Stiefel, die im Gleichschritt wie die Hufe stampfender Stiere auf das Kopfsteinpflaster traten. Ein Trupp von Männern mit Hakenkreuzbinden am Arm rannte im Laufschritt an ihm vorbei, in den Händen Gummiknüppel und Gewehre. Wäre er ihnen in die Quere gekommen, sie hätten ihn niedergetrampelt.
Wie aus dem Nichts tauchte jetzt eine größere Truppe von Polizisten auf und trieb die Protestierenden über den Platz. Sie mussten sich wohl im Elbtunnel versteckt gehalten haben, der die Stadt mit dem Hafengebiet auf der anderen Seite des Flusses verband, wo sie auf das Zeichen zum Einsatz gewartet hatten.
Die Schauerleute zogen sich plötzlich zurück, holten ihre verborgenen Waffen hervor und begannen, auf die Arbeiter zu schießen. Sie waren jetzt von allen Seiten umzingelt, ohne irgendeine Fluchtmöglichkeit. Kugeln und Gummiknüppel flogen, und den Arbeitern blieb nichts anderes übrig, als sich mit ihren Stöcken und Schildern zu verteidigen, so gut sie konnten. Ein paar versuchten, über die Mauer des Zollamts zu klettern, wurden jedoch niedergeschossen. Sirenen begannen zu heulen, und fünf oder sechs Mannschaftswagen mit Soldaten kamen auf den Platz gefahren.
Doch ihr Einsatz war nicht mehr nötig, das Massaker war vorüber. Wegen des blauen Rauchs und des Nebels konnte Samuel alles nur schemenhaft erkennen, aber er schätzte, dass dreißig bis vierzig Männer niedergemäht worden waren.
Da kam plötzlich ein Mann mit einem Jungen an der Hand auf den Platz gelaufen. Beide trugen dunkle Anzüge, weiße Hemden und schwarze Hüte. Samuel wollte ihnen ein Zeichen geben, dass sie umkehren sollten, doch sie gingen schnell und unterhielten sich dabei. Samuel sah, wie der Nazi mit dem Funkgerät seinem Kollegen zuzwinkerte und dann einen Revolver aus der Manteltasche zog. Ohne zu zögern, feuerte er drei, vier Mal auf die beiden chassidischen Juden, die sofort tot zusammenbrachen.
Samuel fiel gegen die Wand hinter sich. Er hörte Gelächter und Klatschen. Seine Kehle und seine Zunge waren trocken, seine Brust schmerzte. Er konnte nicht fassen, was er da gerade gesehen hatte. Zwei Menschen getötet, einfach so, wie Asche, die von einer Zigarette geschnippt wird.
Als das schwarze Auto davonfuhr, schlug Samuel den Mantelkragen hoch und lief, so schnell er konnte, zum Laden zurück. In ein paar Stunden würde er seinen Onkel Jacob sehen. Was sollte er ihm erzählen? Dass er um ein Haar getötet worden war oder dass die »Martin«-Gürtel noch nicht aus England gekommen waren?
»Komm rein, komm rein«, bat Jacob seinen Neffen ein paar Stunden später in seine Wohnung. Die Lesebrille hatte er auf seine zerfurchte Stirn geschoben. Er half Samuel aus seinem Regenmantel, den er an die Metallgarderobe hinter der Eingangstür hängte. »Wie ist es draußen?«
Samuel war klar, dass sein Onkel nicht das Wetter meinte. »Du weißt ja, ich trage ihn eher gegen die Kälte als gegen den Regen …«
»Lass das. Du weißt, wovon ich spreche. Von dem, was ich im Radio gehört habe.«
Samuel holte tief Luft. »Es hat einen Zusammenstoß zwischen Fabrikarbeitern und der Polizei gegeben, unten am Hafen. Dabei sind mehrere Männer getötet worden. Das habe ich wenigstens so gehört.«
»Letzte Woche hat es eine Nazi-Kundgebung gegeben, da haben sie gesagt, kein Land der Welt wolle die polnischen Juden aufnehmen, die Hitler unbedingt loswerden will. Wenn du Bier mit Dummheit zusammenbringst, sind im Handumdrehen zehn Juden tot.«
Samuel schüttelte nur den Kopf, erzählte aber nichts von dem, was er gesehen hatte.
»Die einzige Option, die wir noch haben, ist wegzugehen – und auch die schwindet jetzt immer schneller«, fuhr sein Onkel fort. Er nahm Samuel bei der Hand und führte ihn in sein Studierzimmer, wo Samuel, seine Cousinen und sein Vetter als Kinder nie hatten spielen dürfen. Der Raum hatte sich seither nicht sehr verändert: das alte Pianola, das jetzt nie mehr spielte; die Vitrinen voller Bücher, mit Goldschnitt und in braunem Leder eingebunden; und die beiden Armsessel, in denen sein Vater und sein Onkel Platz zu nehmen pflegten, wenn sie Privates zu besprechen hatten. An der Wand hingen zwei Holzschnitte von Dürer, die eine Druckpresse aus verschiedenen Winkeln zeigten.
Als sie an der Küche vorbeikamen, rief sein Onkel durch die Tür: »Lottie, bring den Tee ins Arbeitszimmer. Zwei Tassen. Mein Neffe ist gerade gekommen. Und ein paar von den englischen Keksen, wenn noch welche da sind.«
»Ja, Herr Berkow«, kam es zurück.
Samuel setzte sich in den blauen Sessel, wo sein Vater früher immer gesessen hatte. Jacob ließ sich ihm gegenüber nieder. Er nahm die Brille ab und legte sie vor sich auf den Tisch. »Samuel, ich habe dich gebeten zu kommen, weil ich dich bitten möchte, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. Du kannst jeden Tag verhaftet werden.«
Die Vorhänge waren aufgezogen und an den Fensterseiten festgemacht worden. Die kühle Juniluft drang ins Zimmer; sein Onkel ließ das Fenster immer leicht geöffnet. Samuel konnte die Reihe der Kastanien sehen, welche die Lutterothstraße unter Onkel Jacobs Wohnung säumten. Auf der anderen Straßenseite lag ein kleiner Park voller Linden. Dort hatte Samuel mit seinem Vetter gespielt, hatte sich an den Eisenstangen festgehalten, gelacht und vor Freude gekreischt, während das rote Karussell sich drehte. Das waren andere Zeiten gewesen.
Er hätte seinem Onkel gern von dem erzählt, was er heute gesehen hatte, aber er konnte es nicht. »Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, wegzugehen«, sagte er stattdessen.
Jacob legte Samuel die Hand aufs Knie. »Ich habe Heinrich geschrieben und ihn informiert, dass du bald kommst. Guatemala City ist natürlich nicht Hamburg, doch Heinrich scheint überzeugt zu sein, dass die Stimmung dort gegenüber Juden allgemein freundlich ist. Eins ist sicher: Hier kannst du nicht bleiben. Ich habe dir schon ein Ticket für den Dampfer nach Panama gekauft.«
»Onkel Jacob, meinst du nicht, dass ich da auch ein Wörtchen mitzureden habe? Ich bin ein erwachsener Mann!«
»Ich habe deinem Vater versprochen, mich um dich zu kümmern. Eine andere Wahl gibt es nicht.«
»Ich könnte zu meiner Mutter und meiner Schwester nach Palma gehen. Mallorca ist ruhig, und Franco ignoriert Hitlers Befehle, Juden festnehmen zu lassen.«
Samuels Onkel schüttelte den Kopf. »Du musst Europa verlassen, Samuel. Sobald Franco seine Macht gefestigt hat, wird auch er beginnen, die Juden zu verfolgen.« Jacob rutschte in seinem Sessel hin und her, suchte nach einer bequemeren Sitzposition. »Außerdem kommt deine Mutter diese Woche nach Hamburg zurück. Ich habe versucht, es ihr auszureden, doch sie und deine Schwester, na ja, sie sind sich so ähnlich, dass sie nicht miteinander auskommen können. Zwei Jahre mit deiner Schwester sind genug. Du weißt sicher, was ich meine«, sagte er und lächelte dabei.
Samuel nickte. Er verstand seine Mutter nicht. Weshalb hatte sie sich geweigert, zur Beerdigung ihres Mannes zurückzukommen, nachdem sie fünfunddreißig Jahre verheiratet gewesen waren?
»Du hast hier einfach keine Zukunft«, sagte Jacob jetzt.
»Und was willst du tun, Onkel?«, fragte Samuel und versuchte, das Thema zu wechseln. »Gehst du zu Erna und Greta nach London?«
Jacob trug denselben dreiteiligen Anzug mit den Nadelstreifen, den er schon zwei Tage zuvor angehabt hatte. Nur hatte er jetzt schwarze Slipper statt Straßenschuhe an den Füßen.
»Nein, ich will hierbleiben und auf den Laden aufpassen. Sobald ich weggehe, werden die Nazis alles konfiszieren, so wie sie es auch in Berlin gemacht haben. Und eine Entschädigung kannst du vergessen – all die Zeit und alles Geld, das dein Vater, er ruhe in Frieden, investiert hat, wird für immer umsonst gewesen sein.«
»Wenn ich weggehen kann, Onkel, dann kannst du das doch auch.«
»Ich bin ein alter Mann. Was hab ich schon davon, wenn ich nach London gehe? Allein der Umzug würde mich umbringen. Nein, ich bleibe hier. Außerdem muss ich deine Mutter außer Landes bringen.«
»Darum werde ich mich schon kümmern.«
»Nein, nein, nein«, antwortete Jacob. »Du erinnerst sie zu sehr an deinen Vater. Ich habe schon begonnen, ihre Reise nach Kuba zu planen, zusammen mit ihrer Schwester. Ich werde sie auf der St. Louis rausbringen, das verspreche ich dir.«
Lottie kam mit einem Tablett, auf dem eine Teekanne mit einer Warmhaltehaube, zwei unterschiedliche Tassen und ein kleiner Teller mit Keksen standen. Sie war vor dreißig Jahren aus Leipzig gekommen, damals schon dünn und müde aussehend, und war über die Jahre noch dünner und müder geworden. Als Jacobs Frau Gertie Jahre zuvor starb, war Lottie zum Faktotum der Familie geworden, hatte sich um Jacob, seinen Sohn und die drei Töchter gekümmert. Jetzt, wo alle Kinder aus dem Haus waren, war nur noch Jacob übrig geblieben.
Der alte Mann stand auf, um ihr das Tablett abzunehmen. »Du kannst dich jetzt zur Ruhe begeben, Lottie. Es ist schon spät.«
Das Dienstmädchen sah auf Samuel hinunter und deutete ein Lächeln an, einen knappen Gruß. Er verstand nicht, wie sein Onkel sie all diese Jahre hatte ertragen können, war sie doch immer schlechter Laune. Sie sprach nur wenig, und wenn sie es tat, dann klang es immer unfreundlich.
»Ihr Abendessen steht auf dem Herd – Corned Beef und Kohl. Wenn Sie es bis acht Uhr nicht gegessen haben, wird es ganz matschig sein.«
»Vielen Dank«, antwortete Jacob nur, tätschelte ihre Hand und stellte das Tablett auf den Beistelltisch. »Wir sehen uns morgen früh um neun, wie immer.«
»Wie immer«, wiederholte sie, nahm die Warmhaltehaube von der Teekanne und goss ihnen ein – es war Pfefferminztee, eine Familientradition.
Der süßliche Duft tat Samuel gut.
Sobald das Dienstmädchen außer Hörweite war, sagte sein Onkel: »Ich habe für deine Visa für Panama und Guatemala eine Menge Geld bezahlt. Normalerweise würde man das Bestechung nennen. Es könnte einen Monat dauern, vielleicht mehr, bis sie da sind.«
Samuel wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte gerade gesehen, wie zwei Menschen ermordet wurden. Bis zur »Kristallnacht«, dem Pogrom vom 8. November 1938, hatte er die Bedrohung für die Juden in Deutschland nicht geahnt. Antisemitismus hatte es ja immer gegeben – seltsame Bemerkungen, merkwürdige Andeutungen, auch direktere Äußerungen –, doch dass der Hass und das Töten von Juden staatliche Politik werden könnte, das hatte er nicht für möglich gehalten, jedenfalls nicht in dem Deutschland, für das er im Weltkrieg gekämpft hatte und dabei beinahe umgekommen war.
»Himmler versucht nur, Hitler zu beeindrucken«, sagte er.
Jacob hob eine Augenbraue. »Samuel, du hast doch selbst gesehen, wie sie Steine und Kisten in das Schaufenster unseres Ladens in Berlin geworfen haben. Die Frauen unserer Kunden waren alle da mit ihren Pudeln, schauten zu und klatschten und johlten … Himmler ist der Chef der SS und der Gestapo, er steckt hinter dem Ganzen. Hör mir zu: Du musst langsam aufwachen, mein Sohn!«
»Ich bin längst wach, Onkel«, erwiderte Samuel ungehalten. Er war kurz davor zu erklären, was er gerade am Hafen gesehen hatte, um seine Reaktion verständlich zu machen und zu zeigen, dass er sehr wohl wusste, was los war.
»Mir ist klar, dass du es im Krieg nicht leicht gehabt hast, in der Gefangenschaft. Und auch deine Beziehung mit Lena muss sehr schmerzhaft für dich gewesen sein. Darf ich offen zu dir sprechen?«
Samuel zuckte die Achseln.
»Du bist jetzt Ende dreißig. Als ich so alt war die du, war ich längst verheiratet und hatte Kinder. Du läufst herum, als ob du auf etwas wartetest, das dein Leben verändert und das große Loch in dir füllt. Wir lieben dich alle, doch diese Liebe wird zu Mitleid werden, wenn du nicht etwas aus deinem Leben machst. Ich weiß, wovon ich spreche. Du denkst, deine Geschichte sei zu Ende geschrieben, aber das ist sie längst noch nicht. Du würdest überrascht darüber sein, zu was du fähig wärst, wenn du nur aufhören würdest, so zaghaft zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben die sechs Monate im Sanatorium nach dem Ende des Kriegs dich so werden lassen.«
Samuel stand auf, ging zum Fenster hinüber und schaute hinaus. Die Straßenlaternen waren eingeschaltet worden, und er konnte sehen, wie die Straßenbahn an der Haltestelle Ecke Lutterothstraße/Hagenbeckstraße hielt. Ein paar Leute stiegen ein, um Richtung Innenstadt zu fahren. Er hatte eine ganze Menge erlebt – als Soldat, als verwundeter Kriegsteilnehmer, als Einkäufer für das Geschäft seines Vaters. Was sein Onkel über ihn sagte, stimmte wohl. Er hatte zu viel unerwartetes Leid gesehen. Was würde es bedeuten, wenn er jetzt wieder fortginge? Sicher würde er dann nie wieder nach Deutschland zurückkehren.
»Ich weiß, dass deine Mutter böse auf mich ist, weil dein Vater mir das Geschäft hinterlassen hat«, hörte er jetzt seinen Onkel sagen. »Aber immerhin war ich ja sein Teilhaber. Dein Vater wusste, dass ich mich um dich kümmern würde. Berta hätte das ganze Geld deiner Schwester gegeben oder für irgendeine idiotische Sache wie das Retten von Dackeln oder Pudeln.«
»Ich habe meine Mutter nie verstanden.« Samuel wusste, dass es merkwürdig war, wenn ein Sohn so etwas sagte, doch seine Mutter zeigte nur Gefühle, wenn sie auf dem Klavier wieder und wieder Beethovens »Appassionata« spielte. Sie berührte menschliche Hände nie so zärtlich, wie sie die Klaviertasten berührte. Sie war unfähig, Zuneigung zu zeigen, viel weniger noch Liebe. Sein Vater verdiente hundert Orden dafür, dass er sie so viele Jahre lang ausgehalten hatte.
Samuel setzte sich wieder und sah, wie sein Onkel nach der Teekanne griff. Dabei verfehlte seine Hand den Henkel. Samuel hatte es schon im Laden bemerkt: Jacobs Augen waren schwach geworden.
»Kann ich dir einschenken?«
Jacob machte eine abwehrende Geste. »Ich kann das schon selbst.« Er nahm die Teekanne und schenkte sich ein, seine Hand zitterte, doch er traf die Tasse.
»Samuel, du hättest mit mehr Schläue auf die Welt kommen sollen.«
»Was meinst du damit, Onkel?«
Jacob lächelte. »Du bist zu vertrauensselig. Das bist du immer schon gewesen. Du hast ein gutes Herz, du bist jemand, der glaubt, dass man sich korrekt verhalten muss. Jemand, den manche Menschen fadengerade nennen.«
Samuel nippte am heißen Tee, nahm dann einen Keks und tauchte ihn in die Tasse. Seine Hand zitterte auch, seine Kopfhaut fühlte sich heiß an, aber er wollte seinem Onkel nicht widersprechen. »Ich nehme das als ein Kompliment«, sagte er.
Jacob lächelte wieder. »Natürlich ist es das. Nimm dagegen meinen Sohn Heinrich. Der ist überhaupt nicht wie du – der hat nur Schläue und kein Herz.«
»Das ist ungerecht, Onkel.«
»Nein, Samuel, das ist es überhaupt nicht. Ich denke, ich kenne meinen Sohn ziemlich gut.«
Obwohl Samuel seinen Vetter verteidigte, wusste er, dass Jacob recht hatte. Und er dachte jetzt, dass er vielleicht selbst zu Heinrichs argwöhnischem Charakter beigetragen hatte. Er hatte seinen Vetter einmal schlimm hängen lassen und hatte das nie wiedergutgemacht. Um ganz ehrlich zu sein, hatte er seinen Vetter verraten, und er wusste, dass Heinrich keinen Finger für ihn krumm machen würde, bevor er diesen Verrat nicht ausgebügelt hatte – und das wollte er auch tun, wenn sie sich in Guatemala wiedersähen.
ERSTES KAPITEL
Als das Motorboot neben dem kleinen Frachter längsseits gegangen war, tauchten zwei dunkelhäutige Seeleute in zerlumpten Kleidern an der Reling auf. Sie hielten Samuel Berkows Lederkoffer, seinen grauen Homburg und seinen Regenschirm, während er die Eisenleiter empor ans Oberdeck der Chicacao kletterte.
»Thank you, thank you very much«, sagte er nervös auf Englisch zu ihnen. Dabei streckte er seine rechte Hand aus, doch sie starrten nur verständnislos darauf und gingen davon. Als er ihnen hinterherrief, stiegen sie schon eine andere Leiter auf ein tiefer liegendes Deck hinunter.
Es war Abend, und Samuel war unsicher, was er als Nächstes tun sollte. Er legte seinen Regenschirm und seinen Hut auf den Koffer und wartete darauf, dass der Kapitän ihn begrüßen kam. Lose Taue, Ketten, Drahtrollen, rostende Zahnräder, Schraubenschlüssel und ein halbes Dutzend gelber Rettungswesten stapelten sich an Deck um den Schornstein des Schiffes herum. Der Dampfer war nicht alt, nur ziemlich ungepflegt. Er brauchte eine ordentliche Reinigung und einen neuen Anstrich, im Gegensatz zu dem Linienschiff, auf dem er den Ozean überquert hatte. Aber der Dampfer fuhr nach Puerto Barrios, Guatemala.
Die gut neuntausend Kilometer lange Reise nach Panama auf der Bremen mit ihren Kristalllüstern, Schubertwalzern, luxuriös ausgestatteten Speisesälen und eleganten Kabinen hatte zehn Tage gedauert, nicht lange genug, um Europa wirklich hinter sich zu lassen. Der Ocean Liner hatte es Samuel erlaubt, Hamburg in bester Erinnerung zu behalten: seine breiten Straßen, den Alsterpavillon mit seinem Teehaus, wo an den Nachmittagen Linzer Torte und Rote Grütze auf handbemaltem Porzellan gereicht wurden, eine Bootsfahrt auf der Elbe, Hagenbecks Tierpark.
Sein Wollanzug erstickte ihn fast. Er lockerte die Krawatte, knöpfte seine Jacke auf und legte sie gefaltet über den Arm. Mit dem Taschentuch aus seiner Jackentasche wischte er sich den Schweiß trocken, der ihm von der Stirn und über seine Wangen lief. Wo zum Teufel war er?
Plötzlich tauchte ein kleiner, schmieriger Mann vor ihm auf. »Ich hatte keine Begleitung auf dieser Fahrt erwartet«, begann er und grinste breit, »aber als mein erster Offizier über Funk mitbekam, dass einer der Passagiere auf dem Liner möglichst schnell nach Guatemala weiterreisen wollte, sagte ich mir, warum nicht? Ich fahre ja die Küste hinauf. Wir ankern ein Stück weiter nördlich für die Nacht. Sagen Sie, sprechen Sie Englisch?«
Dem Akzent nach zu urteilen musste der Mann aus den USA stammen. »Ich habe als Kriegsgefangener in England die Sprache gelernt, während des Weltkriegs«, antwortete Samuel und hob dabei den Zeigefinger. Er fragte sich, wie der Mann darauf reagieren würde, dass Samuel auf deutscher Seite gegen Amerika gekämpft hatte.
»Das war wohl vor meiner Zeit«, kicherte der Mann. Er hatte kleine, glasige Augen, und seine Wangen hingen an seinem Gesicht herunter wie kleine Euter. Die kurzen Ärmel seines Hemds spannten sich um seine Oberarme. Er sah aus wie einer der typischen SA-Männer, die in Hamburg auf der Suche nach Streit betrunken über die Piers torkelten.
»Ich heiße Alfred Lewis, aber meine Freunde nennen mich Alf. Sie sind ja ziemlich extravagant gekleidet, Mister – waren Sie gerade unterwegs in die Oper?« Er kicherte wieder und streckte die Hand aus.
»Samuel Berkow, sehr erfreut.« Samuel schüttelte die Hand. Normalerweise hätte er mit jemandem wie Lewis überhaupt nicht geredet – es war überdeutlich, dass sie nichts gemeinsam hatten. »Ich muss Ihnen danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Ich weiß nicht, was ich in Panama hätte tun sollen.«
Lewis grinste über das ganze Gesicht. »Das, was alle machen …«
»Und was wäre das?«
»Ordentlich vögeln und so schnell wie möglich verschwinden!«, lachte Lewis. »Was sonst kann man in einem Land machen, in dem es viel zu heiß ist und wo nur schwarze Vollidioten rumlaufen? Ja, wenn man einen Traumjob bei der Kanalgesellschaft hat …! Aber verdammt, sogar die Moskitos hauen da ab, so schnell sie können. Wo kommen Sie eigentlich her? Sie haben diesen komischen europäischen Akzent.«
»Ich komme aus Deutschland.«
»Nicht etwa ein Jude, oder?«
»Doch, genau«, gab Samuel zu. Seit Hitler an der Macht war, hatte er sich angewöhnt, die Wahrheit zu verheimlichen, bis es nicht mehr ging, doch hier in der Neuen Welt hatte er das Gefühl, dass dies nicht mehr notwendig war.
»Na, eure Leute verlassen ja alle Deutschland, Polen und Russland. Denen scheint die Party in Europa nicht zu gefallen.«
»Ich würde es kaum eine Party nennen«, antwortete Samuel.
»Ach, das wird schon nicht so schlimm werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganze Kommandieren und Herummarschieren im Stechschritt lange anhält. Warten Sie nur, bis wir in den Krieg eintreten!«
»Ich hoffe, Sie haben recht.«
Lewis nickte. »Na, willkommen an Bord, Sammy! Ich stamme aus Pittsburgh, jedenfalls ursprünglich, und bin inzwischen ein besserer Laufbursche, wenn Sie so wollen. Die letzten zehn Jahre über bin ich diese Küste rauf und runter gefahren und habe alle möglichen Jobs für die Fruit Company erledigt.« Er hielt inne und legte seinen linken Arm um Samuels Taille. »Na, wir können ja auch unten weiter quatschen. Ich wette, Sie haben einen Bärenhunger.«
»Nein, großen Hunger habe ich eigentlich nicht.«
»Auf jeden Fall ist jetzt Essenszeit. Kommen Sie mit runter in die Kombüse. Wenn Sie keinen Hunger haben, können Sie mir ja beim Essen zuschauen.«
»Was geschieht mit meiner Valise?«, fragte Samuel und wies auf seinen abgewetzten Lederkoffer.
»Wie nennen Sie das?«, fragte Lewis belustigt. »Valise? Lassen Sie sie einfach stehen. Einer meiner Jungs bringt sie runter.«
»Aber …«
»Entspannen Sie sich, Berkow«, sagte Lewis und gab ihm einen leichten Stupser. »Ich sage Ihnen doch, dass sich meine Jungs drum kümmern. Sie haben ihre Anweisungen.« Er ließ Berkow los, watschelte zur Deckmitte und hopste die Mittschiffstreppe hinab.
Acht Stufen tiefer kamen sie in einen mit Mahagoni getäfelten Speiseraum, an dessen frisch lackierten Wänden alle Arten von Navigationsinstrumenten, Messingapparaten und mehrere Reihen von Trophäen befestigt waren. Der Raum roch nach Jasminpolitur.
»Ein sehr schöner Raum«, sagte Samuel und fühlte sich etwas unsicher, wie ein nicht eingeladener Gast bei einer privaten Party.
»Ja, das ist mein ganzer Stolz. Manche dieser Stücke sind drei-, vierhundert Jahre alt. Wie dieses Fernglas und der Kompass hier, Zeug aus der Zeit von Blackbeard und Francis Drake. Auf die Trophäen bin ich besonders stolz. Wenn Sie meinen fetten Arsch sehen, denken Sie sicher nicht, dass ich ein großer Bowling-Spieler bin, doch zu Hause war ich der Abräumer, weil ich jeden letzten Kegel machte. Ich zeig’ Ihnen später meine Technik.«
Eine plötzliche Welle traf das Schiff und warf Samuel gegen die Wand.
Lewis schüttelte den Kopf. »Sie müssen sich ihnen anpassen, sie schon ahnen, bevor sie kommen.«
Gleich darauf kam ein zweiter Brecher; diesmal stolperte Samuel zwar ein bisschen, verlor aber nicht die Balance.
»Schon besser, Mr. Sammy. Nur zu, nehmen Sie Platz«, sagte Lewis, setzte sich auf die an die Wand geschraubte Bank und reckte den Kopf in Richtung einer Tür auf seiner rechten Seite. »Lincoln, wo ist der Fraß? Ich habe Hunger. Und bring noch Geschirr und Besteck für unseren Gast!« Zu Samuel gewandt fügte er kichernd hinzu: »Ist zwar kein Silber, aber was soll’s. Man kann damit essen.«
Ein barfüßiger Junge, nicht älter als vierzehn, kam mit einer Kasserolle aus der Küche, die er auf einen metallenen Untersetzer mitten auf dem Tisch absetzte. Der Duft von gekochtem Fisch und Zwiebeln breitete sich im Raum aus. Der Junge stellte noch eine silberne Glocke daneben und verschwand wieder.
»Also, was führt Sie nach Mittelamerika, Sammy-Boy?«, fragte Lewis, während er ein Stück Fisch aus der Kasserolle löffelte. »Liebe oder die Suche nach dem großen Glück?«
»Weder noch, eigentlich. Ich suche nur eine vernünftige Arbeit.«
»Ich hoffe, Sie haben nicht vor, in Puerto Barrios zu bleiben. Ich hätte ja nichts gegen die Gesellschaft von jemand wie Ihnen, aber wenn Sie den Ausdruck verzeihen wollen: Die Stadt ist ein Drecksloch.«
»Nein, ich reise nach Guatemala City weiter. Mein Vetter Heinrich lebt dort. Ich hoffe, er hilft mir dabei, dort Fuß zu fassen.«
»Tatsächlich«, sagte Lewis und schien wenig interessiert, während er weiter den Eintopf auf ihre Teller löffelte.
Samuel nahm seine Gabel in die Hand, stocherte in der Soße herum und spießte ein Stück Fisch auf. Während er die Gabel zum Mund führte, warf er einen Blick zu Lewis hinüber, der sich mit einem Stück Brot die weiße Soße vom Kinn wischte und beinahe an einem zu großen Bissen erstickte.
»Ist Ihr Vetter einer dieser Kaffeebarone? Ich habe gehört, dass den Krauts alle Plantagen in Guatemala gehören.«
»Nein, Heinrich hat ein Geschäft für Bekleidung.«
»Ah – jetzt verstehe ich! Diese eleganten Klamotten sind Familientradition! Ich hoffe, Sie nehmen’s mir nicht übel, Berkow, aber ihr Juden tragt wirklich gern einen feinen Zwirn …«
»Stimmt«, antwortete Samuel und wurde unvermittelt rot dabei.
»Ich freue mich, dass Sie mir das gesagt haben. Es macht mir gar nichts aus, dass Sie Jude sind. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gut darin, so was zu merken.« Er nahm sich erneut von dem Eintopf, obwohl sein Teller noch nicht leer war. »Ich sage immer, Juden sind auch nur Menschen, ist jedenfalls meine Meinung. Zemurray, der Firmenboss in Boston, ist ein Jude aus Rumänien! Sam, the Banana Man. Manche Leute sagen, dass er hochnäsig ist, aber da ist er ja nicht der Einzige … Verdammt nochmal, dieser Fisch ist wirklich köstlich. Roter Schnapper. Dieser Lincoln Douglas lernt ja endlich richtig gut kochen.«
Samuel sagte nichts.
Wenn die äußere Erscheinung den Charakter zeigte, dann schien es, als habe Alfred Lewis keinen. Die Kleiderfabrikanten in Deutschland lehrten ihre Verkäufer, dass man nach dem beurteilt wurde, was man trug. Doch was sollte er machen, Samuel musste diesen Mann jetzt erst mal ertragen, egal wie.
»Ich an Ihrer Stelle würde etwas essen.«
»Das haben sie auf der Bremen auch immer gesagt.«
»War das der Luxusdampfer, auf dem Sie nach Panama gekommen sind? Ich wette, da haben Sie richtig gut gegessen, viermal am Tag. Muss schon toll sein, so elegant zu reisen und die vielen Pinguine zu haben, die einen von vorne bis hinten bedienen … Aber so was ist eigentlich nichts für mich. Ich bin nicht gut darin, den großen Herrn zu spielen, bin nie gut darin gewesen.«
Da war nicht nur Lewis’ rüpelhafte Art, da waren auch die schwarzen Ringe um seinen Hals – Samuel vermutete, der Mann trage Schmutz, so wie er selbst eine Seidenkrawatte oder einen Kaschmirschal tragen würde. Vielleicht meinte Lewis, der Schmutz sei ein Symbol für seine Offenheit – er trug ihn so stolz zur Schau wie ein Diamantencollier.
Plötzlich legte Lewis seine Gabel zur Seite, streckte die Arme nach beiden Seiten aus und rülpste laut. »Ah, mehr als ordentlich was im Magen braucht ein Mann doch nicht, um glücklich zu sein«, sagte er und schaute Samuel an, als warte er darauf, dass der die Unterhaltung weiter führte.
»Was genau ist denn Ihr Job, Mr. Lewis?«
»Alf, bitte, Alf.«
»Ja, sicher, Alf.«
Lewis leckte sich die Lippen. »Sie haben sicher schon mal von der United Fruit Company gehört.«
»Nein, bislang nicht.«
»Das sind meine Bosse. Puerto Barrios ist Hauptsitz hier in der Region, aber ich bin die ganze Küste hinauf und hinunter in den Häfen von Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama unterwegs. Ich melde dem Zentralbüro, was an Maschinen und Ausrüstung und dem ganzen Zeug gebraucht wird – das erkläre ich Ihnen vielleicht ein andermal. Doch hauptsächlich überwache ich das Verladen der Bananen.«
»Wohin werden die denn verschifft?«
»Hauptsächlich nach New Orleans, wo sie gewogen, verpackt und weiter nach Norden verschickt werden. Aber ich schreibe nicht nur Zahlen in ein Notizbuch. Wissen Sie, die Company ist ein ziemlich kompliziertes Netzwerk – wir haben Eisenbahn- und Schifffahrtslinien, Plantagen, Vertretungen; das sind tatsächlich ganze Städte, Tausende von Menschen. Ich kümmere mich darum, dass in den Häfen alles rund läuft. Ich bin befugt, einzuschreiten, wenn’s irgendwo Ärger gibt. Ich habe hier auf dem Schiff meinen eigenen Telegrafen. Und ich will Ihnen was sagen, Sammy. Es gibt keine Mittel, die ich nicht einsetze – Streikbrecher, Bestechung, jemand dafür bezahlen, dass er einen Aufstand im Keim erstickt.« Lewis schnalzte mit der Zunge. »Ein Mann muss tun, was er tun muss, um den Laden am Laufen zu halten … Und solche Sachen passieren oft, wissen Sie.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Das sollten Sie auch! Und ich will Ihnen noch ein kleines Geheimnis erzählen: Erst letztes Jahr haben wir – also die Company – dem Präsidenten von Guatemala achtzigtausend Mäuse bezahlt, um die Stimmen für ein Gesetz zu kriegen, das uns exklusive Nutzungsrechte für achtzig Kilometer Land am Rio Motagua gibt. Achtzig Kilometer! Da kann man ’ne Menge Bananen anbauen, das kann ich Ihnen versprechen. Genug, um die ganzen USA damit zu füttern. Das war ein echter Coup. In der Zentrale reden sie jetzt noch darüber. Achtzigtausend Kröten!«
»Und Sie hatten damit zu tun?«
»Na ja, das war nicht allein mein Verdienst, aber ich habe meine Rolle dabei gespielt. Der alte Sam, der Banana-Mann, hat mir persönlich für meine Mitarbeit bei dem Deal gedankt und mir einen Bonus gezahlt.«
»Haben Sie denn keine Angst, dass jemand Sie deswegen später erpressen könnte?«
Lewis schob seinen Teller von sich und lehnte sich zurück, wobei sein schwarzes Halsband glänzte.
»Angst? Warum sollte ich Angst haben, Sammy?« Er brach in schallendes Gelächter aus.
»In Deutschland tut man so etwas nicht. Und wenn man so etwas tut, spricht man nicht darüber – bestimmt nicht mit jemand, den man gerade erst kennengelernt hat.«
»Nun mal langsam, Sammy-Boy. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass Sie nicht mehr in Deutschland sind. Und auch nicht in den USA. Dies hier ist eine andere Welt. Hier musst du ein paar Hände schmieren, und ich meine nicht mit Kokosöl! Ein paar Dollars hier und da, und plötzlich gehen Dinge, die vorher nicht gingen. Schwäche nehmen die Menschen hier als Rechtfertigung, dich über den Tisch zu ziehen, und das tun sie dann auch.« Lewis’ Augen wurden schmal. »Ich will Ihnen was sagen: Hier müssen Sie ein Fuchs sein, schnell und schlau! Die Eingeborenen sind fix und immer darauf aus, irgendetwas von einem zu bekommen. Man muss ihnen immer einen Schritt voraus sein. Und dann sind da noch diese großmäuligen Gewerkschaftsaktivisten – man nennt sie besser Kommunisten –, die überall herumschleichen und die Leute aufwiegeln. Wir müssen immer auf der Hut sein. Wenn sie eine Versammlung planen, laden wir die Pflücker zu einem Grillfest ein, solche Sachen. Na, Sie sind doch Deutscher! Ich bin sicher, Sie haben die gleichen Probleme auch zu Hause gehabt. Dieser Hitler, der weiß, wie man damit umgeht.«
»Verzeihung, Mr. Lewis, aber ich glaube nicht, dass man Hitler …«
Lewis unterbrach ihn. »Das ist kein einfach zu lösendes Problem. Die Eingeborenen haben nichts oder fast nichts, und die Roten versprechen ihnen das Blaue vom Himmel. Doch die Klugen unter ihnen wissen genau, dass sie entweder für unsere Löhne arbeiten oder hungern müssen – und wissen Sie was, Berkow? Sie haben recht! Sicher, wir können versuchen, ihnen ein wenig zu helfen – hier eine Schule, dort ein Hospital, aber was nützt ihnen das wirklich? Die meisten Menschen denken doch mit ihrem Magen oder ihrem Schwanz, und ein paar Schläge auf den Kopf helfen für gewöhnlich, dass sie zur Vernunft kommen.« Er hielt einen Moment inne und schaute Samuel an. »Ich habe Sie jetzt wohl geschockt, Sammy-Boy. Vielleicht haben Sie ja liberalere Vorstellungen.«
Bevor Samuel antworten konnte, warf Lewis einen Blick in die Runde und kam näher an ihn heran. »Als ich hierher kam, war ich genau wie Sie. Ich dachte, man muss einen Mann nur satt machen, ihm ein bisschen was zum Leben, eine Chance geben, dann wird er schon gut werden. Das hielt ungefähr einen Tag lang an. Hier unten liegen die Dinge anders, hier wird nach anderen Regeln gespielt. Ich hab’ mich damit beschäftigt, und ich weiß jetzt genau, wovon ich rede. Ich glaube inzwischen, dass ein Mann besser arbeitet, wenn er ein bisschen Hunger hat. Ein bisschen Magenknurren lässt ihn um seine nächste Mahlzeit betteln. Hier gibt es nichts umsonst. Du musst dafür sorgen, dass dein Feind keine Ahnung hat, was du als Nächstes planst.«
Lewis schnappte ein Stück kalten Fisch von Samuels Teller, hielt es ihm vor die Nase und ließ es hin- und herbaumeln wie einen Köder. »Nur dies«, flüsterte er, »nur dies hier, und ein Mann wird tatsächlich für dich töten.« Er hielt das Stück Fisch noch einen Moment in die Höhe, bevor er es sich selbst in den Mund stopfte.
Samuel rutschte auf seinem Stuhl herum. Die Welt, die dieser Mann hier beschrieb, schien ein Albtraum zu sein. Er hätte in Panama bleiben und sich dort an Land und Leute gewöhnen sollen, dachte er. Oder er wäre besser noch in Europa geblieben und hätte sich auf ein Schiff nach London oder Amsterdam geschmuggelt. »Das Leben scheint wirklich sehr anders hier zu sein, Mr. Lewis – Alf. Vielen Dank für Ihren Rat.«
»Aus mir spricht nur die Stimme der Erfahrung. Man braucht seine Zeit, um sich daran zu gewöhnen, wie das hier alles läuft. Aber ich kann Ihnen sagen, Berkow, je schneller Sie das tun, umso weniger Ärger haben Sie später. Sie müssen lernen zu ahnen, woher die Schläge kommen. Sie wissen ja, wenn Sie in Rom sind, machen Sie’s wie die Römer. Wenn Sie nichts dagegen haben, legen Sie erst mal diese eleganten Klamotten ab und ziehen Sie was Entspannteres an. So, wie Sie angezogen sind, bitten Sie ja geradezu darum, von irgendeinem Gauner übers Ohr gehauen zu werden.«
Lewis lehnte sich an die Wand und gähnte. »Ich bin verdammt müde. Wollen Sie was trinken?«
»Eine Tasse Kaffee, wenn Sie eine für mich haben.« Samuel nahm seine Krawatte ab und legte sie sich über die Knie.
Lewis zwinkerte ihm zu. »Das sieht schon viel besser aus, Sammy.« Er nahm die Glocke vom Tisch, läutete, und der Junge, der ihnen das Essen gebracht hatte, erschien wieder.
»Lincoln Douglas, eine Tasse Kaffee für den Herrn hier, hast du verstanden?«, sagte Lewis zu ihm auf Spanisch.
»Sí, Señor«, antwortete der Junge und wollte sich schon zum Gehen wenden.
»Hey, nicht so schnell!«
Der Junge zog den Kopf ein.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du den Fisch nicht so lange kochen lassen sollst?«
»Aber, Señor Lewis …«
»Halt’s Maul!«, fuhr in Lewis an. »Ich hasse dieses verdammte Rumgequengel. Wie lange hast du ihn gekocht?«
»Zwanzig Minuten. Wie Sie gesagt hatten.«
»Also, der Fisch war wie Gummi, und die Soße schmeckte nach gar nichts.«
Der Junge stotterte ein paar Entschuldigungen, aber Lewis hörte ihm gar nicht zu und schob stattdessen die Teller an den Rand des Tisches – der Junge schaffte es gerade noch, zu verhindern, dass sie zu Boden fielen. Dann wedelte Lewis mit der Hand, als verscheuche er Fliegen. »Bring das jetzt endlich raus.«
Der Junge türmte die Teller übereinander, ohne aufzuschauen. Sobald er außer Hörweite war, grinste Lewis triumphierend und sagte: »Ich werde langsam richtig gut darin.« Dann holte er eine dicke Zigarre und Streichhölzer aus einer Schublade im Tisch. »Lust auf einen Schluck Kentucky Bourbon? Hab’ letzte Woche erst eine Kiste bekommen.«
»Nein, danke.«
»Wie Sie wollen.« Lewis holte umständlich ein Streichholz aus der Schachtel, entzündete die Zigarre und nahm drei schnelle Züge. Dann drehte er sich um und holte eine Flasche Jack Daniel’s und ein Glas aus dem Wandschrank hinter ihm. Er füllte sein Glas und lächelte zufrieden.
Samuel fühlte sich krank, als bekäme er Malaria oder Cholera oder irgendeine ähnliche Krankheit. Ihm wurde abwechselnd heiß und kalt. Als er sich anschickte, aufzustehen, wurden ihm die Knie weich. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich mich jetzt gern zurückziehen.«
Lewis’ kräftiger Arm stoppte ihn. Der Mann begann »Camptown Races« zu summen, schwenkte dazu im Takt der Musik die Hand mit der Zigarre und sang »Doodah, doodah«. Nach jedem Zug aus der Zigarre schenkte er sich Whisky nach, doch nach dem vierten Glas wurde seine Zunge immer schwerer.
»Wissen Sie, Berkow, manchmal vermisse ich die Heimat. Pittsburgh. Sogar die stinkenden, Ruß auskotzenden Schornsteine. Und dann denke ich daran, zurückzugehen, mich dort niederzulassen. Das bequeme Leben – eine nette Ehefrau, die mich warm hält, Tag für Tag nur Kaffee und Pantoffeln. Es gibt Tage, da hätte ich gar nichts dagegen … Waren Sie mal verheiratet, Sammy?«
»Ja, vor vielen Jahren«, antwortete Samuel und sah Lena vor sich, wie sie ihren Chinchilla-Mantel über das paillettenbesetzte Kleid mit dem tiefen Rückendekolleté anzog. Es war ihr Lieblingskleid für Partys.
»Hat wohl nicht lange gehalten, was?«
»Nein«, gestand Samuel. Die Wunde war noch offen.
»Hab ich mir schon gedacht. Ich war auch mal verheiratet. Hat fast zehn Jahre gehalten. Keine Kinder, obwohl wir oft darüber geredet haben, Esther und ich. Ein Zug an einem Bahnübergang … hat sie einfach überfahren … bumm!«
»Das tut mir sehr leid«, sagte Samuel ehrlich betroffen. »Das muss ein schlimmer Schlag für Sie gewesen sein.«
Es vergingen einige lange Sekunden. Lewis hatte seine Augen geschlossen und nickte nur. Samuels Nase juckte, doch er vermied es, sich jetzt zu kratzen. In der Küche klapperte Geschirr. Er wünschte, er wäre überall, nur nicht hier.
Als Lewis seine Augen wieder öffnete, schwammen sie in ihren Höhlen, ohne Schwimmwesten. »Sie glauben aber auch alles, was ich Ihnen erzähle, stimmt’s, Berkow?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie hören«, tönte Lewis und hob sein Glas. »Diese Geschichte mit dem Bahnübergang ist eine verdammte Lüge, nichts weiter. Ich habe noch nie die Wahrheit darüber erzählt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann, Berkow.«
»Vielen Dank.« Samuel spürte, dass Lewis ein Spiel mit ihm spielte.
»Danke mir lieber nicht, Sammy. Ich weiß ja jetzt Dinge über dich – und habe dich ein bisschen in der Tasche.«
Samuel wusste nicht, was er sagen sollte. Was meinte Lewis? Etwa, dass er jüdisch war?
»Sehen Sie, mein Freund«, fuhr Lewis fort, »zu Hause in Pittsburgh habe ich in einer Gießerei gearbeitet und Eisenbahnschwellen gegossen. Harte, gefährliche Arbeit, und heißer als die Hölle, das kann ich Ihnen sagen. Na, und eines Tages fiel eine dieser Schwellen vom Kran herunter und landete quer über meiner Brust. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, sieben gebrochene Rippen und Verbrennungen zweiten Grades auf meinen Titten. Es war ein Wunder, dass ich nicht völlig platt war – sechs Wochen im Krankenhaus, aber ich habe überlebt. Esther und mein bester Freund Red besuchten mich fast jeden Abend. Ich könnte sagen, dass sie mich ins Leben zurückgeholt haben. Ich war ihnen sehr dankbar. Doch gegen Ende meiner Zeit im Krankenhaus hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas los war. Sie schauten sich immer so lange an und hatten dabei einen Blick, als wären sie gerade mit der Hand in der Keksdose erwischt worden …«
»Ich verstehe nicht.«
»Sie hatten hinter meinem Rücken die ganze Zeit miteinander gevögelt!«, brüllte Lewis und schüttelte sein Glas dicht vor Samuels Gesicht. »Verstehen Sie jetzt, mein kleiner Kraut?!«
Bevor Samuel auch nur ein Wort sagen konnte, redete Lewis schon weiter. »An dem Tag, als ich entlassen wurde, wollten sie kommen und mich nach Hause bringen. Ich brauchte noch einen Rollstuhl, und Red bot mir an, mich zum Auto zu tragen. Ich wartete in meinem Zimmer, frisch rasiert und angezogen, aber die Bastarde sind nie gekommen.«
»Die haben Sie einfach im Stich gelassen?«
»Sie können sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Manchmal muss ein Mann gewisse Dinge vergessen, aber ich konnte das nicht. Kann es immer noch nicht. Ich höre immer noch ihre Stimmen, wie sie mir Mut machen, mich ermuntern, mit den Krücken herumzulaufen, das nagt jetzt noch an mir. Man hat mich dann vom Hospital aus nach Hause gefahren, und ich musste mich all den mitleidig lächelnden Nachbarn stellen – sie wussten ja alle, was passiert war. Sie verbanden meine Wunden, kauften für mich ein, kochten für mich, als wären sie die Jünger Jesu persönlich … Langweilt Sie, was ich erzähle, Berkow? Dann halte ich die Schnauze!«
»Nein, bitte erzählen Sie weiter«, erwiderte Samuel. Vielleicht brauchte der Mann ja nur ein bisschen Zuwendung.