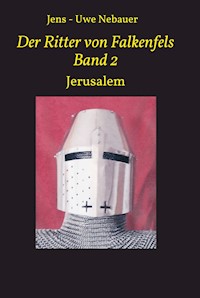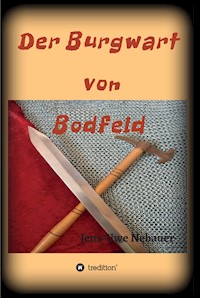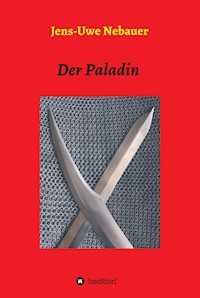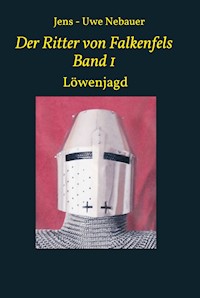
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In der Zeit der Herrschaft des Kaisers Friedrich Barbarossa gerät der junge Adlige Gerrit von Falkenfels in das Räderwerk der großen Politik, und verliert seine Ehre und seine erste große Liebe. Er wird in das Königreich Jerusalem verbannt, wo neue Kämpfe und Abenteuer auf ihn warten. Er erlebt erneut tiefe Enttäuschungen und abgrundtiefen Verrat, aber er findet auch wahre Freundschaft und eine neue große Liebe. Doch seine Feinde, die ihm wegen eines, große Macht versprechenden Geheimnisses seines Ahnen Gerold, nachstellen, ruhen nicht und so ist der Ritter gezwungen in die Heimat zurückzukehren, um seinen Besitz zu bewahren und um sich und seine neue Gefährtin gegen falsche Anschuldigungen zu verteidigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 840
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Jens - Uwe Nebauer wurde am 5. Juni, dem Pfingstsonntag des Jahres 1960, in Magdeburg geboren.
Nach erfolgreich bestandenem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg. Als Diplomingenieurökonom arbeitete er dann jahrelang im Anlagenbau und in anderen Berufen.
Der Autor interessiert sich seit seiner Kindheit für Geschichte. Der Besuch von Burgen, Schlössern und Museen mit seinen ebenfalls geschichtsinteressierten Eltern weckte in ihm schon früh diese Vorliebe. Später spezialisierte er sich auf das europäische Mittelalter und die Zeit der römischen Antike.
Seine Kreativität hat er bereits im Kindergarten entdeckt, denn da er während des verordneten Mittagsschlafes nur höchst selten einschlafen konnte, begann er damit sich die Langeweile durch das fantasievolle Erfinden und „Sichselbst-erzählen“ von kleinen oder größeren Geschichten zu vertreiben.
Später ging er dann dazu über seine Interessen beim Schreiben zu verarbeiten und verfasste u. a. die historischen Romane „Der Ritter von Falkenfels“, „Die Kreuzfahrer“, „Der Burgwart von Bodfeld“ und „Der Paladin“.
Der Ritter von Falkenfels
Band 1
Löwenjagd
Überarbeitete Auflage
von
Jens – Uwe Nebauer
© 2019 Jens-Uwe Nebauer
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-5812-8
Hardcover
978-3-7497-5813-5
e-Book
978-3-7497-5814-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
I. Der Tag den der Herr gemacht hat
II. Die Ehre des Ritters
cingulum militare
Die Schwester der Grafen
Hie Welf, hie Waibling
Der Prozess
Personenverzeichnis
Worterklärungen
I. DER TAG, DEN DER HERR GEMACHT HAT
Sie waren früh auf den Beinen an diesem Morgen, die Lombarden. Die Sonne hatte gerade erst begonnen sich über den Rand der Welt zu erheben, als sie ihre Nachtquartiere in Legnano verließen und sich eine halbe Wegstunde östlich der kleinen Stadt, an der Straße, die von Como nach Pavia führte, in Schlachtordnung formierten.
Friedrich, der rotbärtige Kaiser aus dem Geschlecht der Hohenstaufen, der sein Feldlager eine Meile weiter nördlich aufgeschlagen hatte, rückte erst vier Stunden später heran. Und er geruhte auch weiterhin keine Eile zu zeigen. Während die kaiserliche Vorhut die Straße besetzte, um das Heer gegen einen plötzlichen Überfall der Lombarden zu sichern, verhielten die in Viererreihen heran marschierenden, eisernen Scharen in Erwartung der Befehle ihres Kriegsherrn.
Gefolgt von seinem Bannerträger und umgeben von den Männern seines Kriegsrates und den Rittern seiner Leibwache ritt der Imperator, allen kenntlich durch seinen vergoldeten Helm und den purpurfarbenen Mantel, auf ein brachliegendes Ackerstück seitlich der Straße. Vor ihm breitete sich die unabsehbare Ebene aus wie ein großer grüner Teppich.
So weit das Auge reichte, reihten sich Wiesen und Weiden, lauschige Obstbaumhaine und Felder, auf denen die junge Saat schon kräftig spross, in unregelmäßiger Folge aneinander. Die Ränder der staubigen Straße, die sich schnurgerade nach Süden zog, waren mit Borten aus hohem Gras, Wiesenkräutern und Blumen gesäumt, von rechts grüßten die Türme und Dächer Legnanos herüber und über all dem spannte sich ein strahlendblauer Himmel.
Eine Idylle.
Doch mitten darin stand der Feind.
Der Kaiser seufzte leise. Zwar liebte er die kühn geschwungenen Berge und die endlosen, schattigen Wälder seiner schwäbischen Heimat über alles und sehnte sich nach ihnen, sobald er sie längere Zeit nicht gesehen hatte, doch war er auch für die Schönheiten der norditalienischen Landschaft nicht unempfänglich. Dass er diese aber dennoch nie so völlig rückhaltlos und uneingeschränkt hatte würdigen können, wie sie es zweifellos verdienten, lag wohl vor allem an ihren ihm so feindselig gesonnenen Bewohnern.
Nachdem Friedrich das lombardische Heer, das in einer Entfernung von fünf oder sechs Bogenschußweiten die Straße versperrte, eine Weile mit den geschulten Augen des erfahrenen Kriegsmannes gemustert hatte, fuhr er sich mit der behandschuhten Rechten durch den rötlich schimmernden Bart und schüttelte unwillig das Haupt.
Er musste seinen Feinden zugestehen, dass sie etwas vom Kriege verstanden. Die gegnerischen Befehlshaber hatten den Kampfplatz vortrefflich gewählt und ihre Truppen mit beachtlicher Geschicklichkeit aufgestellt.
Ihr erstes Treffen bildete die in fünf Kolonnen zu je siebenhundert Mann gegliederte, farbenfrohe Panzerreiterei, die sich vornehmlich aus den Patriziern der Städte Mailand, Lodi, Piacenza, Vercelli und Novara rekrutierte. Die Angehörigen des Kaufmannsadels ritten prächtige Pferde und waren mit dem Besten ausgerüstet, was in den italienischen Waffenschmieden hergestellt wurde. Die Sonne funkelte auf den Spitzen ihrer steil erhobenen Lanzen.
Knapp hinter den Reitern zog sich ein über zweitausend Schritt langer und schnurgerader Graben durch die grünenden Felder. Im Schutze dieses natürlichen Hindernisses standen die tiefgestaffelten Abteilungen der mailändischen Lanzenträger hufeisenförmig um den Carrocio, den sechsspännigen Fahnenwagen des lombardischen Bundes, geschart. Dreitausend Kämpfer hatten die Zünfte der Stadt aufgeboten. Ein jeder Mann trug ein eisenverstärktes, ledernes Koller, hatte eine stählerne Sturmhaube auf dem Kopf und war mit einem hohen Schild und einer über fünfzehn Fuß langen Lanze bewaffnet.
Die zweihundertfünfzig leichtbewaffneten Bogenschützen des Bundesheeres waren in das Innere des von den Lanzenträgern gebildeten Hufeisens gerückt, wo sie sich hinter dem Wall der schwer gerüsteten Infanterie in sicherer Deckung befanden.
Wie ein gut ausgebildeter Wachhund hockte das lombardische Heer auf der Straße und machte keinerlei Anstalten, sich fortzubewegen. Die an den weithin sichtbaren Masten des Carrocios lustig flatternden Fahnen und Wimpel schienen den Deutschen herausfordernd und höhnisch zugleich zuzuwinken.
Die Vorteile, die den Lombarden diese Stellung und ihre dreifache Übermacht boten, waren dem Kaiser nicht verborgen geblieben. Die kühl rechnenden Bürger, die sich ansonsten lieber hinter den mächtigen Mauern ihrer Städte versteckten, würden sich seinen gefürchteten Rittern nicht so bereitwillig in den Weg gestellt haben, wenn sie sich ihrer Stärke und ihres Vorteils nicht so bewusst gewesen wären.
Und dabei hatten sie hier noch nicht einmal ihr gesamtes Bundesheer versammelt!
Nicht ohne Mühe unterdrückte der Kaiser die plötzlich aufkommenden Zweifel. Nein, und nochmals nein, es gab kein Zurück! Ein Kaiser floh nicht vor einem Haufen von Krämern und Tuchwalkern. Nicht, wenn er des Reiches Ritterschaft hinter sich wusste!
Wütend über sich selbst, schnaubte der Staufer wie ein angriffslustiger Stier und schlug mit der geballten Faust auf den Sattelknopf. Dann stemmte er sich entschlossen in den Steigbügeln auf und rief mit kraftvoller Stimme Philipp von Heinsberg, den Erzbischof von Köln und Werner von Bolanden, seinen alten Paladin und Feldhauptmann, an seine Seite, um mit ihnen den Angriffsplan zu besprechen.
Schnell waren der untersetzte, breitschultrige Reichsministeriale und der Kirchenfürst mit den freundlich blickenden Augen, der unter seiner dunkelblauen Dalmatika ein Kettenhemd trug, zur Stelle, und schnell wurden sich die drei Kriegsherren einig.
Hier gab es nicht viel zu bedenken.
Da die Lombarden ihre Reiterei in fünf Kolonnen geteilt hatten, waren die Kaiserlichen gezwungen, es ihnen gleichzutun, denn einer jeden feindlichen Schar musste eine eigene Abteilung entgegengestellt werden, sonst lief man Gefahr, von einer freien gegnerischen Truppe in der Flanke oder im Rücken gefasst zu werden. Dass die deutschen Kolonnen nur etwa halb so stark sein würden wie die der Italiener, bereitete den Anführern keine übermäßigen Sorgen, vertrauten sie doch darauf, dass ihre Ritter die zahlenmäßige Unterlegenheit durch Mut und kriegerische Tüchtigkeit würden wettmachen können.
Da mit der Vorhut bereits eine Schar nahe am Feind stand, blieb den Heerführern nichts anderes zu tun übrig, als die restlichen Truppen, mit Ausnahme der kaiserlichen Leibwache, die als Reserve zurückbehalten werden sollte, in vier gleich große Kontingente zu teilen und diese den Lombardischen gegenüber in Stellung zu bringen. Sobald die Angriffstruppen auf ihren Plätzen standen, wollte man sich ohne langes Bedenken und mit der Wucht und dem Elan, der die deutschen Rittertruppen auszeichnete, auf die Feinde stürzen und sie aus dem Felde schlagen.
Der Kaiser nickte und rieb sich zufrieden die Hände. Das war ein Plan ganz nach seinem Geschmack. Einfach, schnörkellos, ehrlich.
Gut gelaunt forderte er seine Berater auf, die Einteilung der Mannschaften vorzunehmen. Sofort gaben die Getreuen ihren Pferden die Sporen und entfernten sich, um die Unterführer einzuweisen und sie mit den Einzelheiten des Aufmarsches vertraut zu machen.
Bald darauf kam Bewegung in die Reihen der wartenden Ritter, und wie ein Schwall Wasser aus einem umgestürzten Eimer, so ergossen sich die berittenen Scharen über die Felder und Wiesen zu beiden Seiten der Straße.
Der Mann aber, dessen Wort all diese Menschen und Tiere in Bewegung versetzte, hockte derweil still und regungslos auf seinem prächtigen Schimmelhengst und hing seinen Gedanken nach.
Der Krieg war ihm ein alter Bekannter. Die Hälfte seines Lebens hatte er auf Feldzügen, Schlachtfeldern und vor belagerten Städten verbracht und mit der Erfahrung eines altgedienten Kriegsherrn ahnte er, dass dieser Tag blutige Opfer fordern würde.
Oh, ja, er hatte sie hassen gelernt, diese stolzen, selbstbewussten, rebellischen Bürger der norditalienischen Städte, mit denen er sich nun schon seit zwanzig Jahren mit wechselndem Erfolg herumschlug. Wie viele Niederlagen er ihnen auch bereitete, wie viele Schläge er ihnen auch versetzte, stets erhoben sie wieder ihr Haupt, rissen ihm den sicher geglaubten Sieg aus den Händen und verwickelten ihn in neue verlustreiche Kämpfe. Wieder und wieder war er gezwungen gewesen, das Spiel um Macht und Einfluss von vorn zu beginnen. Und der Krieg war von Mal zu Mal härter geworden.
Doch dass die Lombarden es wagten, ihm so keck, so offen die Stirn zu bieten, das war auch für den Staufer eine neue, böse Erfahrung.
Anscheinend ist es mit der Macht und dem Ansehen des Kaisers nicht mehr weit her, dachte Friedrich bitter.
Und wem hatte er dies letztlich zu verdanken?!
Heinrich, seinem Vetter, dem Welfen, den sie den Löwen nannten!
Verweigerte der ihm doch rundweg die Gefolgschaft, wollte mit dem Kaiser schachern wie mit einem Krämer, stellte unverschämte Forderungen - so als ob er dem Herrscher gleichgestellt wäre!
Undankbar war Heinrich! Hatte er, Friedrich, ihn nicht immer und immer wieder, mit den Beweisen seiner Freundschaft und Gunst überschüttet, hatte er ihm nicht das Herzogtum Bayern verschafft und die selbstherrliche Willkürherrschaft des Welfen in dessen Ländereien geflissentlich übersehen!
Und nun das!
Die Gedanken des Rotbarts verstrickten sich immer tiefer in den Ereignissen der vergangenen Wochen und Monate. Als im Mai des letzten Jahres die Friedensverhandlungen von Montebello gescheitert waren, hatte er sich in einer üblen Lage befunden. Noch in dem Glauben, den Krieg endlich beenden zu können, hatte er zuvor große Teile seines von der vergeblichen Belagerung Allessandrias ohnehin schrecklich ermatteten Heeres nach Hause entlassen. Nun drohten neue Kämpfe auszubrechen und er stand mit völlig unzureichenden Kräften mitten in Feindesland.
Da kamen schon Gedanken auf an das verfluchte Jahr 1168, als er, verkleidet mit den stinkenden Lumpen eines Knechtes, vor den Italienern über die Alpen hatte fliehen müssen.
Eilends sandte Friedrich deshalb den Erzbischof von Köln, einen seiner getreuesten Männer, nach Deutschland, um dort neue Truppen auszuheben und sie nach Italien zu führen. Einige Bischöfe und Fürsten beschworen denn auch die Heerfahrt, doch schon bald musste Bischof Philipp erkennen, dass er trotz seines energischen und selbstlosen Einsatzes kaum mehr als ein kleines Heer von ein paar Hundert Rittern und Knechten zusammenbekommen würde. Die meisten der Großen des Reiches zeigten immer weniger Lust an den italienischen Abenteuern ihres Herrschers, und am allerwenigsten tat dies der Mächtigste unter ihnen, Heinrich, der Herzog von Sachsen und Bayern.
Der Kaiser, von seinen Beratern informiert, bestellte den Widerspenstigen zu einem Treffen auf die Felsenburg von Chiavenna. Doch auch hier verweigerte Heinrich, wie schon so oft in den Jahren zuvor, dem Staufer unter nichtigen Vorwänden die Heeresfolge.
Friedrich, der die kampferprobten sächsischen Ritter nur allzu gern unter den Kriegern seines Heeres gewusst hätte, versuchte alles, um den Löwen umzustimmen und war auch bereit, das eine oder andere größere Zugeständnis an die Unersättlichkeit des Welfen zu machen.
Bis dieser so weit ging, für seine Dienste die Herausgabe von Goslar zu verlangen und damit den Bogen überspannte. Fürchterlich ergrimmt brach der Rotbart die Gespräche ab und kehrte erfolglos in sein Hauptquartier nach Pavia zurück.
Drei Monate später erfuhr Friedrich, dass die Truppen aus dem regnum teutonicum die Alpen nach einem anstrengenden Marsch über den Lukmanierpass überschritten hatten.
Sofort begab sich der Kaiser mit kleinem Gefolge nach Como, dem mit Philipp von Köln vereinbarten Treffpunkt. Vor drei Tagen waren dann die deutschen Ritter und Fußknechte in die Stadt an dem großen See einmarschiert. Mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn erkannte der Monarch, dass sie viel zu Wenige waren, um seine Probleme nachhaltig lösen zu können.
Allerdings waren sie durchaus zahlreich genug, um andernorts Aufmerksamkeit zu erregen. Als die Kaiserlichen nach nur einem Ruhetag von Como nach Pavia aufbrachen, meldeten die Kundschafter den Anmarsch des lombardischen Bundesheeres.
Die Führer der verbündeten Städte, die von ihren Spähern über die Ankunft der staufischen Hilfstruppen in Italien unterrichtet worden waren, sahen mit Schrecken einer Vereinigung der staufischen Kräfte entgegen. Hatten sich die neu angekommenen Truppen aus Deutschland erst einmal mit der Armee, die der Barbarossa bei Pavia unter Waffen hielt, vereinigt, dann würden sie von der Übermacht des Feindes bald wieder hinter den Mauern ihrer Städte festgenagelt werden und jegliche Möglichkeit zu einer offensiven, selbst gewählten Führung des Krieges verlieren.
Die Drangsal und das Elend langjähriger, qualvoller Belagerungen vor Augen, riefen die Bundeshauptleute in großer Eile ihre Truppen zusammen. Und obwohl die einzelnen Kontingente der Bundesarmee noch nicht vollständig bei den Sammelplätzen vor Mailand eingetroffen waren, fassten sie noch am Tage der Ankunft der Kaiserlichen in Como den kühnen Entschluss, sich den deutschen Rittern in den Weg zu stellen. Sie bauten darauf, dass die staufischen Ritter und ihre Pferde von dem langen Marsch durch Deutschland und der strapazenreichen Überquerung der Alpen noch zu geschwächt und ermüdet wären um ihre volle Kampfkraft zu entfalten.
Durch einen schnellen Marsch gelang es den Lombarden, die günstige Stellung bei Legnano einzunehmen, noch ehe das kaiserliche Heer herannahte. Die Krieger aus Mailand und Lodi, Piacenza, Vercelli und Novara hofften, dass die Deutschen die Schlacht annehmen würden und waren auch ansonsten guten Mutes, denn sie erwarteten den Zuzug weiterer Verstärkungen aus Brescia.
Natürlich hatten der Kaiser und seine Heerführer die Absicht der Lombarden, sie mit einem überlegenen Heer, an einem selbst gewählten Ort und zu einer selbst gewählten Zeit zur Schlacht zu zwingen, sofort durchschaut. Friedrich hätte die Schlacht nicht annehmen brauchen. Eigentlich hätte er sie nicht annehmen dürfen! Und er wusste dies auch.
Klug und der Verantwortung eines Feldherren gegenüber dem Leben und der Gesundheit seiner Krieger angemessen wäre es gewesen, die Italiener an ihrer linken Flanke zu umgehen und - den Olona und den Ticinius nördlich von Legnano überschreitend - die freie Straße nach Pavia zu gewinnen. Dies hatten auch Gerhard von Falkenfels, der für die Sicherheit des Kaisers und für den Wach- und Patrouillendienst im Heer verantwortlich war, und der Magister Wortwin, ein Mann vieler geheimnisvoller Ämter, geraten. Aber dennoch stellte sich Friedrich zur Schlacht. Er konnte nicht anders. Denn hier ging es um mehr als um das Leben einiger Ritter und Fürsten. Hier ging es um die Ehre des Kaisers!
Spione hatten aus dem Lager der Lombarden berichtet, dass diese den Kaiser verhöhnten, weil dessen eigenes Land ihm nicht mehr als jene paar ärmlichen Ritter und Knechte für seinen Krieg zur Verfügung stellen konnte oder wollte. Man schwatzte törichtes Zeug von seinem Treffen mit Heinrich dem Löwen in Chiavenna und hielt den Sachsenherzog, der seinem Kaiser so einfach jede Hilfe verweigern konnte, bereits für den wirklichen Herrscher im neblig-kühlen Germanien.
Wollte Friedrich nicht selbst den Anschein erwecken, dass er ohne den Welfen unfähig sei, seine Ziele in Italien zu erreichen, so musste er diese Schlacht schlagen. Nur ein großer Sieg konnte seinen Ruf wieder herstellen.
Und trotz aller widrigen Umstände glaubte er daran, dass dies möglich war - vertraute er doch auf den göttlichen Beistand und die Stärke der deutschen Ritterschaft. Hatte diese nicht in all den vergangenen Kriegsjahren wahre Wunder vollbracht!
Hatte Otto von Wittelsbach etwa nicht die als uneinnehmbar geltende Veroneser Klause genommen und seine Feldherren Rainald von Dassel und Christian von Buch etwa nicht bei Tusculum einen Sieg errungen, der die Welt aufhorchen ließ! Und er selbst, hatte er nicht mit eben dieser Ritterschaft das stolze Mailand nach dreijähriger Belagerung in die Knie gezwungen!
Noch immer waren vor dem Ansturm der teutonischen Ritter die Welschländer ins Wanken geraten. Nur das den Nordländern so unfreundliche Klima, das Krankheiten und Seuchen ausbrütete so vielfältig wie Ungeziefer, hatte allzu oft die kaiserlichen Siege wieder zunichte gemacht.
Einen weniger starken Mann hätte dies schon längst zur Verzweiflung und vielleicht gar zum Aufgeben seiner Pläne gebracht, nicht aber ihn, Friedrich von Staufen, den Kaiser und König von Gottes Gnaden, den Herrscher über das Heilige Römische Reich, dessen Wille so hart und unbeugsam war wie ein Fels!
Während der Staufer noch solche schwerwiegende Gedanken wälzte, war sein Heer im Begriff, seine Vorbereitungen zu beenden. Die Unterführer hatten die Ritter in vier gleich große Kolonnen formiert und je zwei dieser Banner genannten Stoßtrupps zur Rechten und zur Linken der Straße aufmarschieren lassen. Der Vorhut, die unter dem Befehl des Herzogs von Zähringen, noch immer einige hundert Schritt vorgezogen auf der Straße verharrte, wurde somit die Rolle des Zentrums zuteil.
An der Spitze der vier keilförmigen, das Auge durch eine Vielzahl von Farben verwirrenden Heerhaufen hatten die Erzbischöfe von Köln und Magdeburg, die Bischöfe von Verden, Osnabrück, Brandenburg, Hildesheim und Münster, sowie der Landgraf von Thüringen und die Grafen von Holland und Saarbrücken ihre Fahnen entrollt. Gefolgt wurden sie von ihren Rittern, Knappen und berittenen Sergeanten, über deren Köpfen sich ein Wald von Lanzen erhob.
Die Ritter trugen unter ihren ein- oder mehrfarbigen, ärmellosen Waffenröcken schwere, aus kunstvoll verbundenen, stählernen Ringen gefertigte, bis zu den Knien reichende Kettenpanzer. Während ihre Hände in Handschuhen aus Leder und Kettengeflecht steckten, wurden die Beine durch eiserne Schienen oder durch eng um die Waden und Schenkel liegende Kettenstrümpfe geschützt. Auf den dreieckigen, blattförmigen Schilden aus festem, lederbezogenem Holz prangten in leuchtenden Farben die Wappen der adligen Kämpfer.
Die Helme der Ritter waren spitz oder kugelförmig und hatten eine breite, die Nase schützende Schiene, doch vereinzelt sah man auch schon die neuartigen topfförmigen Helme, die den gesamten Kopf bis zum Hals herab umschlossen. Am Gürtel eines jeden Kriegers hingen ein langes, scharf geschliffenes Schwert und ein kräftiger, spitzer Dolch, doch so manch einer der Kämpfer hatte sich dazu noch eine wuchtige Streitaxt oder eine stachelige Keule an den Sattel gehängt. Die stärkste und wichtigste Waffe für den Angriff aber war die zwölf Fuß lange Lanze mit der breiten eisernen Spitze.
Die kräftigen Ritterpferde stampften und schnaubten beunruhigt, von Zeit zu Zeit erklang ein helles Wiehern, das selbst den ohrenbetäubenden Lärm übertönte, der sich aus dem Klirren der Waffen, dem Knarren des Lederzeugs, den Hornrufen und Trompetenstößen und den Stimmen der Männer mischte.
Der Geruch des wartenden Heeres stieg dem Mann im Purpurmantel in die Nase. Es roch nach Leder und geöltem Eisen, nach Pferden und menschlichem Schweiß, nach Staub und nach zertrampelten Saaten.
Und nach Angst.
Nach der namenlosen Angst vor der Unendlichkeit, die an solchen Tagen wohl auch die Herzen der härtesten Krieger für einige Augenblicke in ihren Krallen hielt.
Viel mutete der Kaiser diesen Männern hier zu. Vielleicht zu viel. Doch was auch immer geschehen würde, sie würden ihn nicht enttäuschen. Dessen war er sich sicher.
„Eure Majestät!“ Die Stimme Gerhards von Falkenfels riss den Staufer endgültig aus seinen Gedanken. „Seht, dort kommt Herr Werner von Bolanden.“
Der große, kräftige Mann mit den dunklen Haaren wies mit ausgestrecktem Arm auf den eilends heran sprengenden Reiter. Kurz darauf passierte dieser die Front der aus achtzig Rittern bestehenden Leibgarde des Kaisers und brachte sein Pferd unter dem mächtigen, goldgelben Banner mit dem schwarzen, kaiserlichen Adler zum Stehen.
„Das Heer ist bereit zum Angriff, euer Gnaden!“, verkündete der Vasall grinsend. Offensichtlich freute er sich auf die bevorstehende Schlacht.
Friedrich lächelte seinem Getreuen wohlwollend zu.
„Dann schickt einen Mann zu Herzog Berthold und lasst ihm sagen, dass wir gleich zu ihm aufschließen und dann sofort angreifen werden.“
Der Paladin nickte und wendete seinen braunen Hengst, um dem Befehl des Herrschers Folge zu leisten. Doch in diesem Moment schmetterten bei den Lombarden die Hörner und Trompeten. Aus der Front ihrer Reiter löste sich das mittlere Treffen und stürmte, immer schneller werdend, auf die Ritter der kaiserlichen Vorhut zu. In Windeseile näherten sich die Italiener den Deutschen und nun ließ auch der Herzog Berthold, der erkannte, dass ein Rückzug unmöglich geworden war, sein Feldzeichen flattern, senkte die Lanze und gab den Befehl zum Angriff.
Die Schlacht hatte begonnen. Man schrieb den 29. Mai im Jahre des Herrn 1176. Es war die fünfte Stunde nach Sonnenaufgang.
Wie zwei gereizte Platzhirsche rannten die eisernen Scharen gegeneinander an und stießen mit einem dumpfen Knall zusammen. Durch eine mächtig aufgewirbelte Staubwolke verdeckt, entzogen sich die Einzelheiten des Kampfes schon wenige Sekunden später den Blicken der noch unbeteiligt zuschauenden Krieger. Nur hin und wieder öffnete sich der staubig graue Vorhang und gab die Sicht frei auf den Malstrom des Kampfes, auf wild dreinschlagende Ritter, auf blitzende Schwerter und auf stampfende, drängende, sich um sich selbst drehende Pferde.
Der Mann mit dem roten Bart reckte sich. „Herr Werner“, rief er dem gespannt wartenden Feldhauptmann zu, „Wir wollen Herzog Berthold nicht allzu lange mit den Feinden allein lassen. Blast zum Angriff.“ Dann fügte er etwas leiser hinzu: „Möge der Herr mit uns sein.“
Der Herr von Bolanden löste den Olifant von seinem Gürtel und hob ihn an die Lippen. Dumpf rollte der fordernde Ruf des Urhorns über das Schlachtfeld.
Ein Raunen ging durch die Reihen der wartenden Ritter. Sie zogen die Kinnriemen ihrer Helme fester, tasteten nach den Griffen der Schwerter, setzten sich in den Sätteln zurecht und schlugen ein letztes Kreuz. Dann setzte sich die eherne Lawine in Bewegung. Erst langsam, im Schritt, doch schon nach wenigen Metern an Geschwindigkeit gewinnend, fraß sie - einem gierigen Feuerbrand auf trockener Grassteppe gleich - unaufhörlich die Distanz, die sie von den bereits Kämpfenden trennte. Nur noch wenige Galoppsprünge von den Feinden, die nun auch ihre Pferde hatten antraben lassen, entfernt, senkten sich, wie an einer Schnur gezogen, die Lanzen der Deutschen und donnernd erklang ihr Schlachtruf.
„Christus qui natus!“
Fürchterlich erfolgte der Zusammenstoß. Lanzen zerbrachen, splitterten, glitten an Schilden und Rüstungen ab oder bohrten sich in die Körper und das Leben der Männer. Pferd krachte gegen Pferd, aus rauen Kehlen lösten sich tierische Schreie und jeder zehnte Reiter wurde aus dem Sattel gestoßen. Die festen Formationen lösten sich auf, gingen unter in dem irrsinnigen Strudel des Kampfes. Die Ritter wirbelten durcheinander, ließen ihre Lanze oder deren Stümpfe fallen und griffen zu den Schwertern und Beilen. Der wilde, tödliche Nahkampf hatte begonnen.
Den streitbaren Bischöfen, die an der Spitze der Deutschen kämpften, verbot es ihr Glauben und ihr kirchliches Amt, das Blut von Christen zu vergießen. Doch das hielt die kriegsgewandten
Männer nicht davon ab, sich wie die Racheengel auf die Lombarden zu stürzen. Nur, dass sie nicht mit den scharf schneidenden Schwertern sondern mit langstieligen, eisenbeschlagenen Keulen, verbissen auf die Köpfe und Schultern ihrer Feinde eindroschen.
Hageldicht prasselten die Schläge herab, wurden ausgeteilt und empfangen. Funken sprühend schlugen die Schwerter aneinander, klirrten auf Kettenhemden, hämmerten auf Helme und Schilde. Die Ritter rissen ihre Pferde nach links und nach rechts, deckten sich mit ihren Schilden und suchten ihre Gegner aus dem Sattel zu schlagen. Ein ohrenbetäubender Lärm aus dem Klirren der Waffen, dem Schreien der Getroffenen, dem Stöhnen der Gestürzten und den anfeuernden Rufen der Kämpfenden erhob sich zum Himmel.
Der Kampf wurde zum Blutbad. Schnell bedeckte sich das Feld mit Erschlagenen und Verwundeten, die hilflos dem Augenblick entgegensahen, in dem sie von den Hufen der Pferde zu Tode getrampelt würden.
Schritt für Schritt, unmerklich beinahe, drängten die Deutschen die Lombarden zurück. Ihr wilder Kampfesmut, ihr zäher Siegeswille und ihre an Verrücktheit grenzende Fähigkeit zur Selbstverleugnung hatten schon ihre Vorfahren berühmt, berüchtigt und erfolgreich gemacht, auch wenn sich diese Eigenschaften zu selten mit der kühlen, berechnenden Überlegung paarten. Doch so ganz allmählich begann in den Lombarden wieder das alte Grauen der Italiener vor den Germanen und dem furor teutonicus zu erwachen.
Die kaiserlichen Ritter kämpften erbittert. Kampf und Krieg, dreinschlagen und töten, das war ihr Leben, ihre vornehmste Aufgabe. Dafür waren sie ausgewählt und von Kindheit an ausgebildet worden.
Und sie erwiesen sich auch heute als gelehrige Schüler.
Die Sonne brannte unbarmherzig. Ihre glühenden Strahlen erhitzten die Helme und Rüstungen, verursachten quälenden Durst und raubten den Männern jegliche Besinnung.
Die Deutschen gewannen die Oberhand. Erste kleine Grüppchen lösten sich aus den Reihen der Lombarden und entfernten sich eilends vom Schlachtfeld, andere folgten ihnen und schließlich jagte die ganze Reiterei des Bundes, von wilder Panik ergriffen, in Richtung Legnano davon, ihr Fußvolk schmählich im Stich lassend.
Von seinem Standplatz aus hatte der Kaiser die Schlacht schweigend und mit unbewegtem Gesicht verfolgt. Jetzt aber ließ er ein triumphierendes Lachen ertönen.
„Ich wusste es“, schrie er, „ich wusste es!“
Und inbrünstig sandte er ein heißes Dankgebet gen Himmel.
Die siegreichen Ritter zügelten ihre Pferde und nahmen die Helme ab. Tief saugten sie die staubige Luft in ihre Lungen. Nach allen Regeln des Krieges hatten sie die Schlacht bereits gewonnen. Die Vertreibung des mailändischen Fußvolkes und die Gewinnung der städtischen Banner konnten nur noch das Werk einer kleinen Anstrengung sein.
Der Stern der Infanterie war mit den Legionen des römischen Kaisers Valens vor achthundert Jahren untergegangen. Seit jenem Tag, an dem die römischen Kohorten von den gotischen Panzerreitern vernichtet worden waren, hatte niemand mehr Fußvolk erfolgreich gegen Reiterei kämpfen sehen.
Und dies mussten auch die Mailänder wissen. Aber offensichtlich schienen sie die militärische Erfahrung aus hunderten von Jahren gering zu achten.
Halb belustigt und halb erstaunt beobachteten die Kaiserlichen, was bei den Mailändern vor sich ging. Anstatt die Waffen fortzuwerfen und gleich ihrer Reiterei das Weite zu suchen, zogen die Fußkrieger die Enden ihrer hufeisenförmigen Schlachtordnung zusammen, so dass rings um den Carrocio ein nach allen Seiten geschlossenes Karree entstand. Die Lombarden stießen die stumpfen Enden ihrer Lanzen fest in die Erde, hielten die Spitzen schräg auf die Feinde gerichtet und duckten sich hinter ihre Schilde.
Mann neben Mann, Schild an Schild, dazwischen und darüber die weit vorgestreckten Lanzen - der Mailänder Haufen glich einem zusammengerollten, abwehrbereiten Igel mit eisernen Stacheln.
Die Deutschen hatten einige Minuten lang abgewartet, was das gegnerische Fußvolk wohl tun würde. Als sie erkannten, dass dieses, wider alle Regeln, nicht die Flucht ergriff oder sich ergab, sondern sich zum Kampf vorbereitete, hielten sie nach den Feldzeichen ihrer Kriegsherren Ausschau und begannen sich, zwei Pfeilschussweiten vor der mailändischen Front, langsam wieder zu sammeln. So manch einer der Kaiserlichen mochte da wohl schon ahnen, dass es vielleicht doch nicht gar so leicht sein würde, die Feinde über den Haufen zu werfen.
Denn die Ritter hatten ein schwerwiegendes Problem - sie hatten keine Lanzen mehr!
Da niemand von den Heerführern damit gerechnet hatte, dass es zu mehr als einem Zusammenstoß kommen würde, hatte man die Reservelanzen mit den Pferdeknechten und dem Fußvolk im Lager zurückgelassen. Ein Angriff ohne Lanzen aber war, bei der Entschlossenheit des feindlichen Fußvolks, ein durchaus riskantes Unternehmen.
Allmählich formierten sich die Ritter wieder in ihren, schon deutlich kleiner gewordenen Bannern und sogleich erscholl, ungeduldig mahnend, das Angriffssignal. Die Mailänder sahen die Ritter antraben, sahen, wie sie von Meter zu Meter an Tempo gewannen, wie sie sich strafften, leicht nach vorn beugten und mit Schwertern, Keulen und Äxten fuchtelten. Und noch während die Lombarden in ihre vorgehaltenen Schilde ihre Schlachtrufe, ihre Angst und ihren Zorn hinein brüllten, war die stählerne Lawine schon heran.
Aber bereits die Überquerung des kleinen Grabens, der vor der mailändischen Kampflinie lag, bereitete den Angreifern Schwierigkeiten. Pferde stürzten oder gerieten ins Straucheln, Nachfolgende mussten ausweichen und brachten die Reihen durcheinander und ein lombardischer Pfeilhagel warf etliche Reiter zu Boden.
Und wenn auch die Mehrzahl der Ritter unbeschadet die andere Seite des Grabens gewann, so hatte dieser doch ihren Angriff verzögert und sie ihrer wichtigsten Waffe beraubt, ihres Schwungs!
Es zeigte sich, dass die Lanzen der Mailänder ein furchtbares Hindernis waren. Noch ehe die Kaiserlichen mit ihren Schwertern auch nur die Schilde der Fußkrieger erreichten, fanden die Waffen der Italiener ihre Ziele. Eine Anzahl von Rittern wurde aus dem Sattel gestoßen, Pferde brachen mit schweren Verletzungen zusammen und rissen ihre Reiter mit zu Boden. Viele der Angreifer verletzten sich bei den schweren Stürzen, verloren die Besinnung oder wurden von ihren getöteten Tieren hoffnungslos eingeklemmt.
Der Ansturm der Deutschen hatte die Schlachtordnung der Mailänder nicht zu erschüttern vermocht. Gelang es hier oder da doch einem der Ritter, sich in die Front der Verteidiger einzukeilen und eine Lücke zu reißen, so stießen ihm die Männer der hinteren Reihen ihre Lanzen in den Körper, rissen ihn vom Pferd, zerrten ihn zu Boden, erschlugen, zerhackten ihn. Und schlossen schnell und geschickt die entstandenen Lücken. Währenddessen jagten die lombardischen Bogenschützen eine Pfeilsalve nach der anderen unter die Deutschen und erhöhten deren Verluste.
Die Ritter des Kaisers wichen zurück, doch nur, um gleich darauf erneut anzugreifen. Und abgewehrt zu werden. Und wieder anzustürmen.
Von Attacke zu Attacke wurde ihre Aufgabe durch die bereits gefallenen Menschen und Tiere, die den freien Lauf der Schlachtrösser hemmten, zusätzlich erschwert. Die Deutschen galoppierten im Kreise um die Mailänder herum und versuchten mit Schwertern, Äxten und Schilden eine Schneise in den schier undurchdringlichen Lanzenwald zu schlagen. Doch dies erwies sich als ein schwieriges, nahezu aussichtsloses Unterfangen. Und die Angreifer bezahlten ihre Anstrengungen mit schweren Verlusten.
Ein magdeburgischer Ritter aus dem Gefolge des Erzbischofs Wichmann beugte sich tief über den Hals seines Pferdes, duckte sich hinter seinen Schild und trieb das Schlachtross mitten in die Spieße der Feinde. Es gelang ihm, diese auseinander zu drücken und mit tödlicher Wucht drang sein ledergepanzerter Hengst zwischen die Schilde der Italiener. Zwei Verteidiger wurden beiseite geschleudert, ein dritter, ein vierter niedergetrampelt. Eine Lücke entstand. Kaum in diesen Wall menschlicher Leiber eingedrungen, ließ der Waghalsige seine Streitaxt wirbeln. Ein, zwei weitere Feinde streckte er mit schnellen Schlägen nieder, dann traf ihn selbst eine Lanze am Hals und warf ihn vom Pferd. Nachrückende Lombarden erstachen sein auskeilendes Streitross, damit es nicht Unordnung in ihre Reihen bringen konnte, und sprangen über den Gefallenen nach vorn, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Ein Erschlagener mehr, was zählte das schon in dieser Schlacht.
Der Kampf der Ritter gegen das Fußvolk währte bereits über drei Stunden. Unerschütterlich behaupteten die Lombarden das Feld, und ein breiter Streifen von Leichen und Kadavern umkränzte ihre Stellung. Langsam, aber unerbittlich, schmolz das Heer des Kaisers zusammen.
Zur Zeit der Nona, als die Entscheidung über den Ausgang der Schlacht noch immer nicht gefallen war, entschloss sich Friedrich, genannt Barbarossa, zu einem letzten verzweifelten Schlag. Alles, was er jetzt noch in den Kampf werfen konnte, das waren die Männer seines persönlichen Gefolges – und sich selbst.
Mit metallischem Schurren fuhr das Schwert des Herrschers aus der Scheide, seine Stimme erhob sich über den Schlachtenlärm. „Bereitet Euch zum Kampf meine Herren. Wir greifen an!“
Die Ritter hinter dem Kaiser atmeten tief durch und nickten sich aufmunternd zu. Endlich durften sie in das Gefecht eingreifen. Schon seit Beginn der Schlacht hatten sie diesem Augenblick entgegen gefiebert und es als Schande empfunden, dass sie solange vom Feld der Ehre ferngehalten wurden. Nun aber kam auch ihre Stunde.
Gerhard von Falkenfels gab seinen Männern ein Handzeichen und sofort setzten diese ihre Pferde in Bewegung, nahmen den Kaiser und seinen Bannerträger in die Mitte und bildeten den Angriffskeil. Nachdem sich Gerhard mit einigen Rittern, die wie er aus dem östlichen Sachsen stammten, an die Spitze der kleinen Schar gesetzt hatte, hob er gemächlich seinen Helm vom Sattelknopf und stülpte ihn über den Kopf. Sobald er in das Halbdunkel des ringsum geschlossenen, eisernen Topfes eingetaucht war, drangen die Geräusche der Außenwelt nur noch gedämpft an seine Ohren. Ein paar Herzschläge lang spürte der Ritter ein mulmiges Ziehen in der Magengegend, doch mit der Erfahrung des altgedienten Kämpfers unterdrückte er dieses unwürdige und doch unvermeidliche Gefühl der Schwäche, das aus einem Mann einen Feigling machen wollte.
Es gab nichts zu befürchten. Er war Gerhard von Falkenfels, der Ritter. Ein hervorragender Kriegsmann, gut gerüstet, erfahren im Streit und umgeben von treuen Gefährten. Seite an Seite mit ihm ritten Markward von Arnstein, sein alter Freund und Waffenmeister; ein Mann von fast fünfzig Jahren, dessen Haar bereits ergraut war, dessen Körper aber nichts von seiner jugendlichen Kraft und Geschmeidigkeit eingebüßt hatte, und Hartmann von Trageburg, ein baumlanger, dunkelhaariger Recke, der stets einen schwarzen Waffenrock trug und der schon seit jungen Jahren einen beinahe legendären Ruf genoss.
Gerhard und Markward hatten den Trageburger bei Tusculum kennen gelernt. Seit damals ritten sie gern miteinander und so oft, wie die unergründlichen Ratschlüsse des Kaisers, die die Menschen bewegten wie Figuren auf dem Schachbrett, es zuließen. Denn ein Jeder hatte die feste Gewissheit, sich auf den Anderen bedingungslos verlassen zu können. Und darauf kam es an, im Krieg und in der Fremde. Und am allermeisten in einer Schlacht wie dieser.
Der Ritter von Falkenfels fasste die Lanze fester, hob sie mit ausgestrecktem Arm in die Höhe und senkte sie dann. Das war das Zeichen zum Angriff.
Die Ritter gaben ihren Pferden die Sporen. Der Falkenfelser führte das Banner so weit wie möglich nach links, denn er beabsichtigte, die Lombarden von der Flanke her anzugreifen. Schnell näherten sie sich dem Kampfplatz. Durch die viereckigen Helmschlitze sah Gerhard die Mauer der mailändischen Spießträger vor sich aufwachsen, sah ihre drohenden Lanzen und ihre blutbefleckten Schilde. Er wählte sich einen der Fußkrieger aus und konzentrierte sich ganz auf sein Ziel. Sein Körper, alle seine Muskeln spannten sich. Er stemmte die Füße fest in die Steigbügel und richtete sich im Sattel auf, den Oberkörper weit vorgebeugt, die Lanze fest eingelegt. Als er nur noch wenige Schritte von den Spießen der Mailänder entfernt war und schon die weit aufgerissenen Augen des Mannes, den er sich zum Opfer erwählt hatte, erkennen konnte, geschah das Unbegreifliche.
Er spürte keinen Schmerz und doch war ihm, als ob sein rechtes Bein abgeschlagen worden war. Ein eisiger Schreck durchzuckte den Ritter. Sein Fuß verlor den Halt, sein Körper das Gleichgewicht und vom Schwung des Angriffs mitgerissen, stürzte er über die rechte Seite nach vorn, die Kontrolle über Pferd und Waffen verlierend. Die Spitze einer Lanze drang durch sein Kettenhemd und bohrte sich ihm tief in die Brust. Er stürzte zu Boden.
Das Pferd Gerhards geriet in Panik. Mit angstvoll geweiteten Augen drehte es sich und raste, den Ritter, dessen linker Fuß noch im Steigbügel steckte, mit sich schleifend, in Richtung Norden davon.
Markward von Arnstein, der Gerhard wie ein Schatten gefolgt war, hatte alles gesehen. Entsetzen packte ihn, als er seinen Herrn und Freund vom Pferd fallen sah, doch Zeit für lange Überlegungen blieb ihm nicht, denn schon hatte er die Kampflinie erreicht. Mit Schild und Lanze lenkte der Ritter die nach ihm züngelnden Spieße beiseite und riss noch im Augenblick des Zusammentreffens mit dem Feind so heftig an den Zügeln, dass sein Schlachtross auf die Hinterhand stieg und zur Seite sprang. Kaum hatte er sich aus der Reichweite der lombardischen Spieße entfernt, da ließ er die Lanze fallen und trieb sein Pferd zum Galopp. Schon nach wenigen Sprüngen hatte er den Hengst des Falkenfelsers eingeholt, bekam dessen Zügel zu fassen und brachte das zitternde Tier zum Stehen. Eilig sprang er aus dem Sattel und löste hastig den Fuß des Gestürzten aus dem Steigbügel. Dann kniete er sich neben seinem Herrn nieder. Auf der linken Brustseite Gerhards entdeckte er eine heftig blutende Wunde. Derartige Verletzungen hatte der Arnsteiner schon öfter gesehen und mit aller Grausamkeit wurde ihm deutlich, dass der Getroffene nur noch wenige Augenblicke zu leben hatte.
Mühsam löste Markward die Bänder von Gerhards Helm und zog ihn vorsichtig vom Kopf des Verwundeten.
Der Falkenfelser war bei Bewusstsein. Seine Lippen bewegten sich. Schnell nahm Markward seinen spitzkegligen Helm ab, schob die Kapuze aus Kettengeflecht zurück, beugte sich tief hinab und legte sein Ohr nahe an Gerhards Mund.
„Der Steigbügel“, flüsterte der Liegende mühsam und blutige Bläschen traten auf seine Lippen, „… gerissen …“
Ein Blick genügte, und Markward erfasste die Situation. Der rechte Fuß des Ritters steckte noch immer in dem eisernen Steigbügel, dessen lederner Sattelriemen dem Gewicht des gerüsteten Mannes ganz offensichtlich nicht standgehalten hatte.
Der Ritter von Arnstein löste den Steigbügel vom Fuß des Falkenfelsers, hob ihn auf und starrte ihn ein, zwei Sekunden lang mit weit aufgerissenen Augen an. Dann schob er das Metall mit einer schnellen Bewegung in den Waffenrock.
Der Verwundete deutete mit einem leichten Heben des Kopfes an, dass er noch einmal sprechen wollte. Sofort neigte sich Markward wieder hinunter.
„Das Medaillon …“, röchelte der Sterbende, „ … bring es meinem Sohn … auch das Schwert … Sag ihm …“
Was Markward dem Sohn des Gefallenen hatte sagen sollen, blieb für immer ein Geheimnis. Der Kopf Gerhards sank zurück. Der Falkenfelser lebte nicht mehr.
Mit Tränen in den Augen griff Markward in das Kettenhemd seines getöteten Freundes und brachte mit einiger Mühe das silberne, kreisrunde Medaillon, das an einer schwergliedrigen, goldenen Kette hing, zum Vorschein. Die Oberfläche der flachen Scheibe, die die Größe eines Brakteaten hatte, war mit undeutbaren, fremdländischen Schriftzeichen und einer kunstvollen Gravur verziert, die einen über einem Berggipfel kreisenden Raubvogel zeigte.
Wie jedermann auf Burg Falkenfels kannte natürlich auch der Ritter von Arnstein die denkwürdige Geschichte dieses Medaillons und dessen Bedeutung für das Geschlecht seines Herrn und Freundes.
Vor über siebzig Jahren hatte Gerold von Falkenfels, der Kreuzfahrer, der mit Gottfried von Bouillon Jerusalem erobert hatte, dieses Schmuckstück mit nach Deutschland gebracht.
Verfolgt von grausamen Feinden, die seine Brüder erschlagen und ihre Burg ausgeraubt hatten, hatte sich Gerold der bewaffneten Pilgerfahrt zur Befreiung des Heiligen Grabes von den ungläubigen Sarazenen angeschlossen, von der er nach sieben Jahren voller Kämpfe und Entbehrungen ruhmbedeckt und mit beachtlicher Beute heimgekehrt war.
Er gewann ein neues Besitztum und gründete das schon fast erloschene Geschlecht der Falkenfelser neu. Auf allen seinen Unternehmungen ruhte der Segen des Herrn und irgendwann begannen die Menschen das sprichwörtliche Glück des Kreuzfahrers in einen untrennbaren Zusammenhang mit dem morgenländischen Medaillon zu bringen, welches der Ritter immer am Halse trug.
Und da gab es auch ein fortdauerndes, unausrottbares Gemunkel um ein großes, aber auch äußerst gefährliches Geheimnis, dessen Kenntnis Reichtum und Macht, aber auch Verderben bringen konnte, und zu dem dieses Medaillon der Schlüssel sein sollte. Irgendetwas Bedeutsames war von dem Kreuzfahrer gut versteckt im Morgenland zurückgelassen worden, vielleicht ein Schatz von unermesslicher Größe, vielleicht ein Buch mit magischen Zauberformeln, vielleicht ein Gegenstand, der gewaltige Kräfte verlieh.
Später ging das Medaillon von Gerold auf seinen ältesten Sohn über und von da an wurde es stets vom jeweiligen Burgherrn an seinen Nachfolger vererbt. So diente das Schmuckstück den Rittern von Falkenfels, ebenso als Talisman, wie als sichtbares Zeichen ihrer Herrschaft.
Ihm hat es kein Glück gebracht, dachte Markward bitter und hängte sich die Kette um den Hals. Dann band er Gerhards Wehrgehänge mit dessen Schwert los und schlang es sich zu dem Seinen um die Hüfte.
Nachdenklich kniete er noch einige Atemzüge lang bei dem Toten und seine Gedanken ließen die Tage wieder aufleben, an denen sie gemeinsam ihren Weg durch das Dickicht des Lebens gegangen waren.
In diesen Augenblicken aber wendete sich die Schlacht. Die lombardische Reiterei, die in voller Flucht die Walstatt verlassen hatte, war hinter Legnano auf eine eilig heranrückende Reiterschar getroffen. In panischer Angst fürchteten die Geflohenen zunächst, auf eine weitere Abteilung der Kaiserlichen gestoßen zu sein, doch nach einigen Sekunden erkannten die Lombarden, dass sie nicht den Deutschen, sondern der verspätet angekommenen Reiterei aus Brescia gegenüberstanden.
Die resoluten Hauptleute aus Brescia brachten schnell wieder Ordnung in den geschlagenen Haufen. Gemeinsam mit den brescianischen Gefährten und mit neuem Mut, kehrten die Ritter aus Mailand und den anderen Städten wieder auf das Schlachtfeld zurück. Ihre wilde Attacke traf die vom Kampf mit dem mailändischen Fußvolk bereits dezimierten und geschwächten deutschen Ritter umso vernichtender, da sie völlig überraschend kam.
Die Kaiserlichen gerieten in die Umklammerung. Während die lombardische Reiterei sie im Rücken und von der Flanke her packte, gaben die mailändischen Lanzenträger ihre Stellung auf und traten nun ihrerseits mit vorgestreckten Spießen zum Gegenangriff an.
Wenig später ballte sich das Unheil auch um das Gefolge des Kaisers zusammen.
Der wild und heftig aufbrausende Kampflärm riss Markward von Arnstein aus seinem Gedenken an den toten Freund. Entsetzt und verständnislos starrte er auf die ihn plötzlich von allen Seiten umdrängenden Pferde und Menschen. Er glaubte einen Alptraum zu erleben. Nur wenige Schritte von ihm entfernt sank das große kaiserliche Banner herab und breitete sich fallend über seinen erschlagenen Träger.
Der Ritter von Arnstein sah geschwungene lombardische Schwerter über den Köpfen der Deutschen und hörte jubelnde, triumphierende italienische Schreie. Und inmitten des Getümmels kämpfte, deutlich erkennbar an dem zackigen, goldenen Kronreif auf seinem Helm und dem purpurnen, goldgesäumten Mantel, der Kaiser um sein Leben.
Die Leibwächter Friedrichs wurden trotz ihres verzweifelten Widerstandes auseinander gedrängt und Mann für Mann niedergemacht. Nur Hartmann von Trageburg hielt sich unerschütterlich an der Seite des Herrschers und führte seine Schläge mit tödlicher Sicherheit.
Ein besonders mutiger mailändischer Lanzenträger drängte und zwängte sich zwischen den Pferden der kämpfenden Ritter hindurch und gelangte in die Nähe des Kaisers. Mit der Geschmeidigkeit einer Schlange glitt er unter den Bauch der weißen Stute des Staufers und stieß ihr sein Kurzschwert in die ungeschützte Brust. Noch ehe das tödlich getroffene Tier zusammenbrach, tauchte der Wagemutige wieder darunter hervor und sprang ein, zwei Schritte zur Seite.
Der Kaiser wurde von seinem sterbenden Pferd zu Boden gerissen und mit dem linken Bein hoffnungslos eingeklemmt. Der jähe Sturz raubte ihm die Sinne. Triumphierend hob der Lombarde sein Kurzschwert, um es auf den Hals des Monarchen niedersausen zu lassen, doch er kam nicht mehr dazu sein Vorhaben auszuführen. Das kreisende Schwert des Trageburgers erreichte ihn und trennte ihm den Kopf von den Schultern.
Angespornt durch das Beispiel Hartmanns und gleichermaßen ergrimmt und besorgt über das Unglück des Herrschers, fassten die kaiserlichen Gefolgsleute wieder Mut. Mit einer verzweifelten Kraftanstrengung warfen sie sich den Feinden entgegen und schlugen sie noch einmal zurück.
Für kurze Zeit entstand um den gestürzten Kaiser eine freie Zone. Markward von Arnstein lief in großen Sprüngen zu dem reglos daliegenden Staufer. Da sich der Riemen, mit dem der Helm an die Rüstung gebunden war, nicht ohne weiteres öffnen ließ, zerschnitt ihn der Ritter kurzerhand mit dem Dolch und riss dem Kaiser die eiserne Haube vom Kopf.
Friedrich hielt die Augen geschlossen, aber er atmete noch. Anscheinend war er bei seinem Sturz mit dem Kopf heftig auf die harte Erde geschlagen und ohnmächtig geworden. Eine offene, blutende Wunde vermochte Markward nicht zu entdecken.
Er sah auf. Neben ihm hielt Hartmann von Trageburg und schaute ihn fragend an.
„Er lebt“, antwortete Markward, „aber allein kann ich ihn nicht von seinem Pferd befreien. Du musst mir helfen.“
Sofort saß Hartmann ab und gemeinsam zogen und zerrten den Kaiser unter dem Kadaver hervor.
„Wie weiter?“ Der Ritter von Trageburg überließ Markward die Führung.
Dem alten Recken schossen die Gedanken wie Blitze durch den Kopf.
Die Schlacht war verloren. Länger als eine Stunde würden die Reste des kaiserlichen Heeres den Lombarden nicht mehr standhalten können. Ihre Niederlage war so vollständig, dass selbst an einen einigermaßen geordneten Rückzug nicht mehr zu denken war. Der Kaiser war in höchster Gefahr. Wollten sie ihm Leben und Freiheit retten, dann blieb ihnen nichts anderes als die Flucht. Und auch deren Gelingen war fraglich. Bald würde es im Umkreis von vielen Meilen für die Geschlagenen keine Sicherheit mehr geben.
Eine gewaltige Verantwortung hatte ihnen der allmächtige Gott auf die Schultern gebürdet.
Aber sie waren Ritter!
„Der Kaiser darf nicht in die Hände der Lombarden fallen“, sagte Markward entschlossen. „Wir bringen ihn aus der Schlacht.“
Er sah sich nach seinem Pferd um. „Ich nehme ihn vor mir in den Sattel. Du kämpfst uns den Weg frei. Mit Gottes Hilfe kommen wir davon.“
Sie packten den Staufer unter den Achseln, doch einer plötzlichen Eingebung folgend, hielt Markward inne. „Warte noch.“
Er nahm Friedrich den Purpurmantel von den Schultern, ergriff den vergoldeten Helm und brachte beides zu dem wenige Schritte entfernt liegenden Gerhard von Falkenfels. Dort setzte er dem Gefallenen den Helm des Monarchen auf den Kopf und deckte den kaiserlichen Mantel über den blutbefleckten Waffenrock des Falkenfelsers. Mit dem schmucklosen Topfhelm Gerhards in der Hand kehrte er zu Friedrich und Hartmann zurück und stülpte dem Kaiser die eiserne Haube über den Kopf.
Dann schwang er sich auf sein Pferd, beugte sich tief herab und fasste dem Ohnmächtigen, den der kräftige Hartmann aufrichtete, um den Leib. Zu zweit wuchteten sie den schweren Körper des gerüsteten Mannes vor Markward in den Sattel. Kurz darauf saß auch Hartmann wieder zu Pferde. Noch ein kurzer Wink zu Markward hinüber, noch eine schnelle Orientierung, dann drehte er sein Schlachtross nach Norden und schlug ihm die Fersen in die Flanken. Es ging los.
Wie ein Rammbock drang Hartmann von Trageburg in die Reihen der Feinde und hieb mit dem beidhändig geführten Schwert eine blutige Gasse. Markward hielt sich dicht hinter ihm und deckte den Kaiser mit hoch erhobenem Schild vor den wild auf sie niederprasselnden Schlägen. Auf und nieder fuhr die Klinge Hartmanns und jeder seiner kraftvoll geführten Hiebe fegte einen Gegner aus dem Sattel. Der Ring der Lombarden öffnete sich. Die Italiener wichen vor dem übermächtigen Kämpfer zur Seite und gaben den Weg frei. Sollten er und seine zwei Begleiter ruhig fliehen, es waren immer noch genug tedesci übrig, die man abschlachten konnte.
Die Pferde der Ritter fielen, kaum dass sie dem Getümmel entronnen waren, von allein in einen wilden Galopp. Mit wirbelnden Hufen preschten sie nach Norden, fort von diesem grausigen Acker des Todes, fort von den blitzenden Waffen, dem tosendem Lärm und dem entsetzlichen Blutgeruch. Fort, nur fort.
Nach einigen hundert Metern verlangsamte Hartmann den Schritt seines Rapphengstes etwas, um den zurückgefallenen Markward aufschließen zu lassen.
„Denen sind wir entwischt“, schrie der Arnsteiner und warf den zerhackten Schild, der jetzt nur noch eine Belastung darstellte, von sich.
„Bist du verletzt?“ Der lange Sachse deutete auf Markwards rechte Hüfte. Dort sickerte Blut aus dem zerschlitzten Waffenrock. Der Arnsteiner winkte ab. „Nicht der Rede wert. Nur ein Kratzer.“
Nachdem Hartmann sich versichert hatte, dass kein feindlicher Reiter ihnen folgte, schob er sein blutbeflecktes Schwert in die Scheide, was bei den Galoppsprüngen seines Pferdes keine so einfache Angelegenheit war. Dann wandte er sich wieder an Markward, der zunehmend Mühe hatte, den leblosen Körper des Kaisers im Sattel zu halten.
„Reiten wir zum Lager?“
„Ich denke, das können wir wagen“, antwortete der Gefragte, fügte aber gleich hinzu: „Allerdings werden wir dort nicht lange bleiben können. Ich fürchte, in spätestens einer Stunde werden die verfluchten lombardischen Hunde ihre Nasen in unsere Zelte stecken. Und bis dahin müssen wir uns wieder davon gemacht haben.“
Er überlegte einige Augenblicke, dann rief er: „Wir packen alles zusammen, was nötig und greifbar ist. Geld vor allem, Waffen, Mäntel, Decken. Die Pferde nehmen wir natürlich auch mit, und die Knechte. Dann ab nach Norden. In den Wald. Das sind nur ein oder zwei römische Meilen. Von dort nach Westen. Über den Olona und den Ticinius.“
Der Trageburger nickte kurz und schwieg. Ganz offensichtlich schien er an dem Plan des Arnsteiners nichts auszusetzen zu haben.
Einige Minuten später hatten sie sich dem kaiserlichen Feldlager bis auf eine Bogenschussweite genähert. Am Rand der ausgedehnten Zeltstadt standen dreißig oder vierzig Männer, die angespannt in Richtung des Schlachtfeldes schauten, von dem aber von hier aus nicht mehr als eine riesige Staubwolke auszumachen war.
Als die Wartenden der sich eilig nahenden Reiter gewahr wurden, löste sich ein Mann in einem schwarzen Talar aus der Gruppe und lief ihnen entgegen. Der kleine, dickleibige Herr war Markward und Hartmann nicht unbekannt, denn der Magister Wortwin, der Stellvertreter des Kanzlers und Vorsteher der kaiserlichen Kanzlei, gehörte zu den engsten Beratern seiner Majestät.
Hochrot im Gesicht und mit erhobenen Armen blieb der Protonotarius vor den Rittern stehen und stieß keuchend hervor: „Ihr Herren, was ist geschehen? Wie steht die Schlacht?“
„Schlecht, Herr Notarius, schlecht für uns“, gab ihm Markward Bescheid und setzte hinzu: „Ihr tätet gut daran, Euch eure Pergamente unter den Arm zu klemmen und schnellstens das Weite zu suchen!“ Dann beugte er sich zu dem Magister herab und flüsterte dem fassungslosen Mann ins Ohr: „Der Herr, den ich hier in meinen Armen halte, ist der Kaiser. Er ist verwundet und ohne Besinnung, aber wir werden versuchen ihn heil und sicher nach Pavia zu bringen.“
„Jesus Maria“, entfuhr es dem Protonotarius, er schwankte und musste sich an Markwards Sattel festhalten. Der aber richtete sich auf und rief mit lauter Stimme den am Lagerrand Versammelten zu: „Flieht, Leute, flieht! Flieht, solange noch Zeit ist! Bald werden die Lombarden hier sein und über euch herfallen wie der Wolf über die Schafe.“
Für einige Sekunden schienen die Männer, die zum größten Teil Zivilisten aus dem Hofstaat des Kaisers waren, wie gelähmt. Hälse wurden gereckt, ungläubige Blicke wanderten hin und her. Dann aber kam Leben in die Versammelten und mit beachtenswerter Geschwindigkeit zerstreuten sie sich zwischen den Zelten.
Während nun im ganzen Lager die Parole: „Rette sich wer kann!“ ausgegeben wurde, trieben auch Markward und Hartmann ihre Pferde wieder an. Ohne Rücksicht auf die aufgeregt durcheinander quirlenden Menschen zu nehmen, die die schlechten Nachrichten vom nicht mehr abwendbaren Ausgang der Schlacht aufgescheucht hatten, ritten sie im schnellen Schritt durch das Labyrinth der Lagergassen bis zu ihren Zelten.
„Volker, Brun, Nicolo“, brüllte der Arnsteiner, während er seinen schweißnassen Braunen zügelte, „verdammt, wo seid ihr?“
„Hier sind wir, Herr“, antwortete eine raue Stimme und gleich darauf kamen zwei der gerufenen Knechte, Volker und Brun, hinter den Zelten hervor. Wahrscheinlich hatten sie sich dort niedergelassen um ihrer Würfelleidenschaft zu frönen. Der Ritter wartete noch einige Augenblicke auf das Erscheinen Nicolos, doch als der Reitknecht Gerhards ausblieb, herrschte er die beiden anderen an: „Wo ist der verdammte Italiener?“
„Fort, Herr“, erwiderte Brun und kratzte sich verlegen am Kopf.
„Fort?“, donnerte Markward und der zornig-drohende Klang seiner Stimme ließ die Knechte zusammen zucken.
„Abgehauen ist er!“ Brun brachte es tatsächlich fertig, seinem Herrn bei dieser Nachricht in die Augen zu schauen. „Heut Morgen, gleich nachdem die Herren Ritter das Lager verlassen haben. Hat sich einfach den Fuchs genommen und ist weg geritten, ohne ein Wort zu sagen.“
„Warum habt ihr ihn nicht aufgehalten, ihr Esel!“, brüllte der Arnsteiner und schlug mit der Faust wütend auf das Sattelholz.
„Darüber können wir ein anderes Mal reden. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun“, mahnte der Ritter von Trageburg. „Volker, du holst die Pferde“, befahl er seinem Knecht, „und du, Brun, suchst im Zelt von Herrn Gerhard und Herrn Markward alles zusammen, was wir für einen mehrtägigen Ritt brauchen können.“
„Vor allem das Geld“, rief Markward, „es ist in der kleinen braunen Truhe. Und die Bögen … und die Decken.“
Während die Diener eilten, um ihre Befehle auszuführen, sprang Hartmann vom Pferd und verschwand im Eingang seines Zeltes. Markward, der den noch immer ohnmächtigen Staufer in den Armen hielt, musste unterdessen tatenlos auf seinem Hengst verharren. Er nutzte die Zeit, um nach der Wunde an seiner Hüfte zu sehen, die tiefer und schmerzhafter war, als er es seinem Gefährten gegenüber hatte zugeben wollen. Wenigstens hatte sie aufgehört zu bluten. Plötzlich verspürte der Ritter brennenden Durst.
„Brun“, rief er in das Halbdunkel des aufgeschlagenen Zelteingangs hinein, „vergiss die Wasserflaschen nicht!“
„Nein Herr“, antwortete der Gerufene und kam schwer beladen ins Freie.
„Dann gib mir zu trinken“, befahl Markward, riss die ihm eilfertig dargebotene Feldflasche mit der freien rechten Hand an sich und trank in hastigen Zügen. Als er, tief atmend, die Flasche wieder absetzte, führte Volker die gesattelten Pferde heran und schließlich erschien auch Hartmann mit einem großen Bündel auf der Schulter.
In aller Eile beluden der Ritter und die beiden Knechte die Gäule, dann schwangen sie sich in die Sättel. In einem schnellen Trab verließen die Männer das Lager in nördlicher Richtung.
*
Sie hatten den schnell fließenden, aber flachen Olona überquert und waren noch eine halbe Stunde lang durch den dichten, ausgedehnten Auwald, der sich zu beiden Seiten des Flusses erstreckte, geritten.
Der Marsch durch den dämmrigen, wegelosen Wald war äußerst beschwerlich und brachte vor allem die seit dem Morgen stark belasteten Pferde der beiden Ritter an den Rand des Zusammenbrechens. Es hatte keinen Zweck mehr, noch weiter zu reiten und es war auch nicht nötig. Seit ihrer Flucht aus dem Lager hatte sie niemand verfolgt. Vorläufig waren sie ihren Feinden entkommen.
Auf einer kleinen Lichtung brachten sie ihre Pferde zum Stehen. Der Platz erschien den beiden Rittern für ein Nachtlager bestens geeignet, gab es doch am Rande der Lichtung einen kleinen Bach, der sauberes Wasser führte. Hartmann und die Knechte saßen ab und eilten zu Markward. Mit vereinten Kräften hoben sie den Mann, der vor dem Arnsteiner im Sattel hing, vom Pferd und betteten ihn auf einem eilig ausgelegten Mantel.
„Hol Wasser, Brun“, ächzte Markward und ließ sich mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dem Sattel rutschen. „Und du Volker, kümmere dich um die Pferde.“
Während Volker sogleich die Zügel der Tiere ergriff, blieb Brun mit demütig gesenktem Blick bei dem Ritter stehen. „Herr“, sagte er leise, „darf ich zuvor noch etwas fragen?“
„Frag“, knurrte der Alte.
„Was ist mit dem Herrn Gerhard?“ Schon während des ganzen Rittes hatte sich der strohblonde Knecht mit den Sommersprossen dies gefragt. Der Mann mit dem geschlossenen Helm auf dem Kopf, der vor Ritter Markward gesessen hatte, konnte der Ritter von Falkenfes nicht sein, denn der trug keinen roten Waffenrock wie der Herr Gerhard, sondern einen gelben, der noch dazu aus wesentlich feinerem Stoff gearbeitet war.
„Der Herr ist tot“, gab Markward seinem Knecht kurz Bescheid und schickte sich an, sich zu dem Liegenden zu begeben. Der Knecht zuckte bei dieser ungeheuerlichen Nachricht zusammen, beherrschte sich aber und ließ sich nicht zu lauten Gefühlsausbrüchen hinreißen, da er wusste, dass sein Ritter dies nicht leiden konnte.
„Aber“, rief er und lief dem davon humpelnden Markward hinterher, „wer ist dann der Herr, der dort liegt?“
Auch diesmal fiel die Antwort des Arnsteiners knapp aus. „Der Kaiser.“
Der Kaiser!
Brun riss die Augen auf, öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Da der Ritter Markward nicht gerade in dem Ruf stand, ein Spaßvogel zu sein, musste das Gesagte wohl der Wahrheit entsprechen. Schwer zu glauben war es allemal.
Kopfschüttelnd blieb der Knecht stehen und brummte leise: „So, so, der Herr Kaiser also …“ Dann hob er die Schultern, schniefte vernehmlich und ging die Wasserflaschen füllen.
Kurz darauf stand er schon wieder bei seinem Herrn, der neben dem Kaiser hockte und ihm vorsichtig den Helm abnahm. Der Mann mit dem roten Bart hatte die Besinnung noch immer nicht wiedererlangt. Markward zog seinen Dolch und hielt ihn dem Staufer knapp über Mund und Nase. Als er sah, dass das kalte Metall von der warmen Atemluft beschlug, nickte er befriedigt und steckte die Waffe wieder in die Scheide. Aus seiner Gürteltasche holte er ein sauber gefaltetes Stück Leinen hervor, ließ sich von Brun die Wasserflasche reichen und goss etwas von der Flüssigkeit über den Stoff. Dann wischte er dem Ohnmächtigen, so sanft wie es ihm möglich war, mit dem feuchten Tuch über die Stirn, die Augen und die Schläfen.
Einen anderen, weniger bedeutenden Menschen hätte er einfach mit ein paar Ohrfeigen traktiert, um ihn ins Leben zurückzurufen, einem Kaiser aber durfte man eine solche Behandlung selbstverständlich nicht angedeihen lassen. Doch auch die sanftere Art verfehlte ihre Wirkung nicht. Der Staufer atmete einmal tief und öffnete dann langsam die Augen. Verständnislos irrten seine Blicke über die Gesichter der vier um ihn versammelten Männer.
„Wo bin ich?“
„In Sicherheit, Eure Majestät“, antwortete Markward.
„Die Schlacht …?“
„Haben wir leider verloren.“
„Verloren …“, flüsterte der Kaiser und versuchte sich aufzurichten. Da ihn aber sogleich ein heftiger Schwindel befiel, ließ er sich schnaufend wieder zurück sinken.
„Was ist geschehen?“, fragte er, nachdem das Drehen in seinem Kopf aufgehört hatte.
„Ihr seid gestürzt und habt die Besinnung verloren“, erklärte Markward. „Wir haben Euch aus der Schlacht fortgebracht und jetzt sind wir im Wald zwischen Olona und Ticinius. Hier werden uns die lombardischen Hunde ganz gewiss nicht aufspüren.“
„Ihr seid doch“, der Kaiser versuchte sich zu erinnern. „Markward von Arnstein und Ihr …“, er fasste den mit verschränkten Armen dastehenden Hartmann ins Auge, „ … Ihr seid der Ritter von Trageburg.“
Beide bestätigten die Worte ihres Herrschers mit einem Nicken und einem „Ja, Eure Hoheit.“
„Nun, meine Herren, da haben wir wohl kräftig Prügel bezogen“, stellte Friedrich mit gewollt spöttischen Unterton fest, doch eine plötzlich aufkommende Bitterkeit machte diesem Anflug von Selbstironie ein schnelles Ende. „Es ist gut, Ihr Herren Ritter. Wir werden nachher über alles reden. Jetzt will ich noch ein wenig ruhen.“
Erschöpft schloss Barbarossa die Augen und schon nach wenigen Sekunden verrieten seine ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge, dass er eingeschlafen war.
Die Männer bedeckten den Kaiser mit einer Lederplane und schoben ihm einen zusammengerollten Mantel unter den Kopf, dann gingen sie daran, sich für die Nacht einzurichten.
Sie entzündeten ein Feuer, aßen Brot und Trockenfleisch aus den mitgeführten Vorräten und tranken Wasser aus dem Bach. Aus ihren Sätteln, Mänteln und Decken bereiteten sie sich ihre einfachen Liegestätten, die Ritter zur Rechten und zur Linken des Kaisers, die Knechte ihnen gegenüber, auf der anderen Seite des Feuers.
„Ich hab schon besser geschlafen“, brummte Brun leise. Dem war nicht zu widersprechen. Aber es war ja auch nicht die erste Nacht, die sie unter freiem Himmel verbrachten und es würde, so Gott wollte, auch nicht die letzte sein. Das war das Los des Kriegers. Am Tage Prügel und Wunden und nächtens Kälte und Unbequemlichkeit. Und im Alter, falls man es erreichte, Rheuma und Gicht.
Unterdessen hatte die Dämmerung eingesetzt. Der Tag verabschiedete sich und räumte das Feld für seine Schwester, die Nacht. Er nahm das Blau des Himmels mit sich und hinterließ über den Wipfeln der Bäume eine fahle Blässe. Ein Teil des uralten Waldes begann einzuschlafen, ein anderer erwachte und erfüllte die Dämmerung mit vielerlei Stimmen.
Der Ritter von Trageburg aber hörte nicht viel von den Geräuschen des Waldes, denn mit sägender Gleichmäßigkeit drangen andere, unmelodiöse Töne in sein Ohr. Der wackere Volker besaß die beneidenswerte Gabe, in beinahe jeder Lage in Sekundenschnelle einschlafen zu können, doch leider teilte sich dies seiner Umwelt zumeist durch ein lautstarkes Schnarchen mit. Für gewöhnlich brachten die Nasengeräusche seines Dieners den Trageburger kaum aus der Ruhe, heute aber reizten sie seinen Ärger, denn sie hemmten den ungestörten Fluss seiner Gedanken.
„Brun“, fauchte er deshalb mit gedämpfter Stimme, „Schaff Ruhe!“
Sofort und bereitwillig trat der Gerufene dem Schlafenden erbarmungslos ins Kreuz und tatsächlich verstummte das Schnarchen für einige Zeit. Wenige Augenblicke später aber setzte es mit noch viel größerer Kraft und Lautstärke wieder ein. Schon hob Brun erneut seinen Fuß, um ihn nach Aufforderung Hartmanns ein weiteres Mal im Rücken des Kameraden zu platzieren, doch der Trageburger knurrte nur wie ein gereizter Wolf, winkte ab und widmete sich wieder seinen Überlegungen.
Da gab es eine kurze, bruchstückhafte Erinnerung an die heutige Schlacht, die ihn nicht ruhen ließ. Im Augenblick des Zusammenpralls der kaiserlichen Leibwache mit dem mailändischen Fußvolk, hatte er ganz am Rande seines Gesichtsfeldes den unvermittelten, scheinbar durch nichts gerechtfertigten Sturz Gerhards in die lombardischen Lanzen wahrgenommen. Während des Kampfes und der sich daran anschließenden rasenden Flucht hatte er keine Zeit gefunden, darüber nachzudenken, jetzt aber ließen ihn die merkwürdigen Umstände, die zum Tod seines Freundes geführt hatten, nicht mehr los. Irgendetwas war geschehen, was nicht geschehen hätte dürfen. Irgendetwas, das nicht mit rechten Dingen zugegangen war!
„Ist sein Steigbügelriemen gerissen?“ Die unerwartete Frage Hartmanns traf Markward so schmerzhaft wie ein Pfeil.
„Gerissen … ja“, erwiderte er nach eine Weile gedehnt. Langsam holte er aus seinem Waffenrock den Steigbügel, den er dem toten Gerhard vom Fuß gezogen hatte, hervor und warf ihn dem Trageburger mit einer schnellen Handbewegung zu.
„Sieh selbst!“
Hartmann fing den eisernen Bügel geschickt auf und betrachtete eingehend den zerrissenen Lederriemen. Dann fuhr er mit dem Daumen über die Rissstelle, grad so, als traue er seinen Augen nicht. Die eine Kante des zertrennten Leders war ungleichmäßig ausgefranst, das war in Ordnung. Die andere Kante aber war gerade und glatt, und dies durfte nicht sein! Es gab keinen Zweifel, da hatte jemand mit dem Messer nachgeholfen!
In dem hageren, kantigen Gesicht des langen Sachsen zuckte es. Er sah auf. Ein harter Blick aus Markwards wasserhellen Augen traf ihn.
„Hast du gesehen?!“ Die Stimme des alten Recken bebte.
„Hab ich“, gab Hartmann bedächtig zurück. „Eine saubere, meisterlich zu nennende Arbeit. Der Schnitt ist so angesetzt, dass der Gurt erst riss, als das ganze Gewicht des Reiters auf ihm lastete,