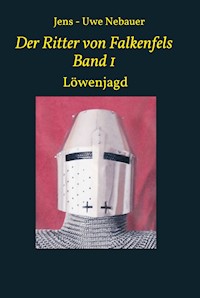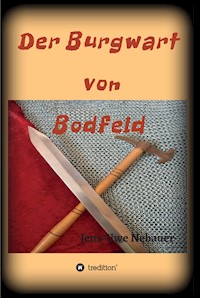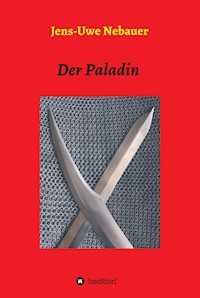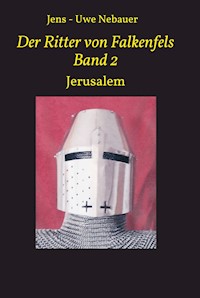
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In der Zeit der Herrschaft des Kaisers Friedrich Barbarossa gerät der junge Adlige Gerrit von Falkenfels in das Räderwerk der großen Politik, und verliert seine Ehre und seine erste große Liebe. Er wird in das Königreich Jerusalem verbannt, wo neue Kämpfe und Abenteuer auf ihn warten. Er erlebt erneut tiefe Enttäuschungen und abgrundtiefen Verrat, aber er findet auch wahre Freundschaft und eine neue große Liebe. Doch seine Feinde, die ihm wegen eines, große Macht versprechenden Geheimnisses seines Ahnen Gerold, nachstellen, ruhen nicht und so ist der Ritter gezwungen in die Heimat zurückzukehren, um seinen Besitz zu bewahren und um sich und seine neue Gefährtin gegen falsche Anschuldigungen zu verteidigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 851
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Jens - Uwe Nebauer wurde am 5. Juni, dem Pfingstsonntag des Jahres 1960, in Magdeburg geboren.
Nach erfolgreich bestandenem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg. Als Diplomingenieurökonom arbeitete er dann jahrelang im Anlagenbau und in anderen Berufen.
Der Autor interessiert sich seit seiner Kindheit für Geschichte. Der Besuch von Burgen, Schlössern und Museen mit seinen ebenfalls geschichtsinteressierten Eltern weckte in ihm schon früh diese Vorliebe. Später spezialisierte er sich auf das europäische Mittelalter und die Zeit der römischen Antike.
Seine Kreativität hat er bereits im Kindergarten entdeckt, denn da er während des verordneten Mittagsschlafes nur höchst selten einschlafen konnte, begann er damit sich die Langeweile durch das fantasievolle Erfinden und „Sichselbst-erzählen“ von kleinen oder größeren Geschichten zu vertreiben.
Später ging er dann dazu über seine Interessen beim Schreiben zu verarbeiten und verfasste u. a. die historische Romane „Der Ritter von Falkenfels“, „Die Kreuzfahrer“, „Der Burgwart von Bodfeld“ und „Der Paladin“.
Der Ritter von Falkenfels
Band 2
Jerusalem
Überarbeitete Auflage
von
Jens – Uwe Nebauer
© 2019 Jens-Uwe Nebauer
Verlag & Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7497-5815-9
Hardcover
978-3-7497-5816-6
e-Book
978-3-7497-5817-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
III. Das Heilige Kreuz
Pirata hostis humani generis
Der Mittelpunkt der Welt
Farah mit den dunklen Augen
Das Geheimnis des Ahnen
Der Alte vom Berge
Die Hörner von Hattin
IV. Farah
regnum teutonicum
Der Bastard
Kismet
Die Nacht des Falken
Personenverzeichnis
Worterklärungen
III. DAS HEILIGE KREUZ
Pirata hostis humani generis
Einer gigantischen, von eisbedeckten Spitzen gekrönten Mauer gleich, wuchs das Gebirge, das die deutschen Lande im Süden begrenzte, in die Höhe.
Mit einem kurzen Zug am Zügel lenkte Gerrit seinen schwarzen Hengst von der Heerstraße und ritt den leicht ansteigenden Hang eines mit Gras bewachsenen Hügels hinauf, auf dessen Kuppe eine einzelne, uralte Eiche ihre Äste ausbreitete. Ein sanfter, warmer Wind, der in trügerischer Weise an den Frühling erinnerte, fächelte über den Wiesenplan und verfing sich in den langen Haaren des Ritters. Am hohen, nur von einigen hauchzarten Wolkenschleiern bedeckten Himmel kreisten Habichte und der würzige Duft von frisch gepflügter Erde hing in der Luft.
Der Reiter hob die Hand vor die Augen, um sie gegen die Sonne, die ihm direkt ins Gesicht schien, zu schützen und schaute staunend zu den sich in langen zackigen Wellen hintereinander und übereinander türmenden Bergen hinüber.
Was für ein Gebirge!
Gegen ein solches Gebirge waren selbst die Berge des Harzes nur kleine Erhebungen.
Gefesselt von dem faszinierenden Anblick verhielt Gerrit minutenlang vor der einsamen Eiche und ließ das erhabene Bild der sich nach Osten und Westen unendlich weit ausdehnenden Gebirgskette auf sich wirken.
Auf der Straße unterhalb des Hügels zogen währenddessen die Männer der kaiserlichen Gesandtschaft vorüber. An der Spitze der Reisegesellschaft ritten Heinrich von Hohenberg und der in ein neues, eselsgraues Gewand gehüllte Sebald, der sich den anderen wegen seiner Kenntnis aller Wege, Stege, Unterkünfte und Gasthäuser als Führer angedient hatte.
Dem Anführer der kaiserlichen Abordnung folgten auf friedlichen Maultieren sitzend, zwei Mönche des Benediktiner-Ordens, die ihnen der rotbärtige Staufer als geistlichen Beistand mitgegeben hatte und die am Heiligen Grab für den Kaiser und den Sünder Friedrich beten sollten.
Der eine der Brüder war ein kleiner, magerer Mann mit biederem Gesicht, schütterem, hellbraunem Haar und einem nach innen gekehrten Wesen. Sein Name war Bartholomäus.
Der andere Mönch, der sich Bonifatius nannte, war lang und schlank und hatte ein Gesicht mit unverwechselbaren, markanten Zügen. Über einer, nach einem Bruch ein wenig krumm gewachsenen Nase schauten zwei ungewöhnlich hellblaue Augen so aufmerksam und wach in die Welt, als trachteten sie danach all die Geheimnisse der Schöpfung ergründen. Seine in Wellen herabfallenden Haare und seine buschigen Augenbrauen waren von einem Schwarz, das an das Gefieder eines Raben erinnerte. Der ein wenig gelbliche Teint und die bläuliche Farbe der schmalen Lippen deuteten auf eine angegriffene Gesundheit hin, doch dieser Eindruck wurde durch das lebhafte Wesen des Bruders Bonifatius wieder wettgemacht.
In der Mitte des Zuges fuhren zwei schwere Trosswagen, die von je zwei Gespannpaaren gezogen wurden und die mit Planen abgedeckt waren. Hinter den Wagen ritten zwölf gewappnete Knechte, zu denen auch Kuno und Immo gehörten.
Anselm von Wildenburg, der sich bisher am Ende der Kolonne gehalten hatte, kam quer über die Wiese zu Gerrit getrabt. Gemeinsam ließen sie ihre Blicke über die in den Himmel strebenden Berge schweifen, die auch der Franke zum ersten Mal sah.
„Gott und alle Heiligen seien mit uns …“, brummte Anselm, „und da sollen wir hinüber?“
Der Falkenfelser grinste. „Brauchst ja nicht selbst die Berge hinauf zu laufen. Du solltest lieber dein armes Pferd bedauern, das dich mit deinem gewaltigen Gewicht über die Alpen tragen muss.“
„Ich bin eben etwas kräftiger gebaut“, lachte der Franke. „Das muss die Thusnelda abkönnen.“
Vergnügt klopfte er seiner kräftigen, braunen Stute auf den Hals. Das brave Tier antwortete mit einem unwirsch klingenden Schnauben und schüttelte den Kopf, dass das Zaumzeug klirrte.
„Begeistert scheint sie von der Aussicht aber nicht zu sein“, stichelte Gerrit.
„Ich werde ihr schon zeigen, wer der Herr ist“, trumpfte Anselm auf, wobei er seine Augen von den Bergen löste und sich der Straße zuwandte. „Du kennst ja meine feinfühlige Art den Frauen gegenüber!“
Die beiden Ritter warteten, bis die Knechte des Geleits an ihnen vorbeigezogen waren, dann setzten sie ihre Pferde in Trab und schlossen sich dem Zug wieder an.
Gut drei Wochen war es jetzt her, dass Gerrit von Burg Falkenfels aus nach Wildenburg aufgebrochen und von dort gemeinsam mit seinem Freund und dessen beiden Knechten Hans und Jörg nach Nürnberg weiter gezogen war.
Nach einer Reise von sechs Tagen waren sie in der im ganzen Reich bekannten Stadt eingetroffen und hatten sich sogleich auf die kaiserliche Burg begeben, wo sie von Heinrich von Hohenberg, der schon ungeduldig auf sie gewartet hatte, freudig in Empfang genommen worden waren. Schon am nächsten Morgen hatte sich die kaiserliche Gesandtschaft dann auf den Weg nach Süden gemacht.
Bei dem flotten Tempo, das Heinrich anschlagen ließ, hatten sie die Schwäbische Alb bald hinter sich gelassen. Die Donau wurde bei Ingolstadt, die Isar bei der aufstrebenden Siedlung Munichen, bei der Heinrich der Löwe, als er noch der Herzog von Bayern war, einen Flussübergang errichtet hatte, überquert.
Nun lag der anstrengendste Teil ihrer Reise, die sie zunächst bis nach Venedig führen sollte, unmittelbar vor den Männern der kaiserlichen Gesandtschaft: der Zug über die Alpen.
Die Heerstraße, die seit geraumer Zeit in südöstliche Richtung führte, bahnte sich ihren Weg zwischen Hügeln, kleinen Waldstücken und von Menschenhand urbar gemachten Flächen. Eine Zeit lang wurde sie von einem glucksenden, schäumenden Bach begleitet. Das Laub der Bäume, die ihren Schatten auf die staubige Fahrbahn warfen, leuchtete in den Strahlen der Sonne in einem satten Grün.
Wie seit hunderten von Jahren zogen Scharen von Pilgern dem hochragenden Gebirgswall der Alpen zu; Männer oder Frauen, die die heiligen Stätten in Rom besuchen oder sich in einem der italienischen Häfen eine Überfahrt ins Heilige Land sichern wollten. Doch nicht nur die Menschen, die auf ihr Seelenheil bedacht waren, nahmen das Wagnis der strapaziösen Reise auf sich. Neben dem einen oder anderen adligen Herrn mit seinem Gefolge waren es vor allem die von vier oder gar sechs grobknochigen, schweren Gäulen gezogenen Fuhrwerke der Fernhandelsleute, die die Straßen belebten.
Beladen mit Leinwand, Wolle, Leder und Pelzwerk strebten die Wagenzüge gen Süden; mit Gewürzen aller Art, mit feurigem italienischem Wein, mit Seide, Brokat und Samt aus den Handelskontoren der Venezianer und mit den berühmten, sündhaft teuren Glaswaren von Murano kehrten sie wieder von dort zurück.
War das Glück ihnen hold und blieben sie von Überfällen und Unfällen verschont, dann zogen die wagemutigen Kaufherren aus dem Handel mit den Ländern des Mittelmeeres einen erklecklichen Gewinn.
Um weit weniger großen Gewinn war da schon so mancherlei fahrendes Volk unterwegs, Gaukler und lose Weibsbilder, Scholaren, Beutelschneider und kleine Diebe, streunende Soldknechte auf der Suche nach neuen Herren, Krämer und Quacksalber. Doch auch sie, die niemals lange an einem Ort verweilten konnten, und die es jetzt, den Zugvögeln gleich, in den warmen Süden zog, wurden getrieben von der Hoffnung, einen Zipfel vom Mantel des Glücks zu erhaschen.
Am Abend dieses Tages erreichten die Männer der kaiserlichen Gesandtschaft den Fuß des Gebirges. Unweit der Talöffnung, aus der sich die wilden Wasser des Inn in das flachere Land ergossen, nahmen sie Quartier in einer Pilgerherberge. Nach einer ruhig verbrachten Nacht und einem kräftigen Frühstück setzten sie sich wieder in Marsch und drangen in die sowohl beklemmendes Gruseln als auch fasziniertes Staunen erregende Welt der eisbedeckten Berge ein.
Dem Bett des Flusses Inn folgend gelangten die Gesandten am späten Nachmittag zu dem von grauen Mauern und einem Graben umgebenen Marktort Innsbruck, der in den letzten Jahren unter der kräftigen Förderung der Grafen von Andechs aufgeblüht war. Die Siedlung, die ihren Namen und ihre Bedeutung der weit und breit einzigen Brücke über den Inn verdankte, lag in einem ausgedehnten, ringsum von Bergen umgebenen Tal.
Von dem Abt des nahe Innsbruck gelegenen Stiftes Wilten, in dem die Männer der Gesandtschaft Unterkunft fanden, erfuhren die Reisenden, dass der Brennerpass noch schneefrei und leicht zu überqueren war.
Als am darauf folgenden Morgen die Sonne die Eisspitzen der Berge rot färbte, stiegen Heinrich und seine Begleiter wieder in die Sättel und zogen das enge, schluchtartige Wipptal, durch das die Sill, ein grünlich schäumendes, wildes Wasser rauschte, hinauf. Die beiden Planwagen hatten sie bereits am Tag zuvor bei einem Kaufherrn in Innsbruck gegen ein halbes Dutzend Packpferde umgetauscht.
Der Anstieg zum Pass war weniger steil als Gerrit, Anselm und die anderen Männer, die noch nie auf Italienfahrt gegangen waren, befürchtet hatten.
Die Straße, die sich zwischen Felsen und Fluss dahin zog, war zwar schmal, aber von einigen kurzen, holprigen Abschnitten abgesehen, gut begehbar. An der einen oder anderen Stelle waren sogar Geleise für die schweren Kaufmannswagen in den felsigen Boden geschlagen worden.
„Diese Straßen haben vor tausend und mehr Jahren die heidnischen Römer unter ihren mächtigen Kaisern erbaut“, erklärte Sebald. „Von der Südspitze Siziliens bis hin zur rauen Nordsee und von Kastilien bis nach Jerusalem legten sie solche Straßen gleich einem Fischernetz über die Länder und verbanden auf diese Weise alle Provinzen ihres Reiches miteinander.“
„Und wir zuckeln heutzutage auf staubigen oder schlammigen Wegen dahin“, sagte Anselm, der aufmerksam zugehört hatte. „Und unsere Pferde brechen sich die Beine auf dem holprigen Boden.“
„Die alten Römer waren uns in vielem weit voraus“, bekräftigte Sebald.
„Aber auch ihr Reich ist letztlich untergegangen“, mischte sich der Mönch Bonifatius in das Gespräch, „gefallen unter dem Ansturm unserer Vorväter.“
„Der Herr gibt, der Herr nimmt“, sagte Bartholomäus fromm und schlug ein Kreuz.
Wohl wahr, dachte Gerrit und der Gedanke an Friedgund zog ihm schmerzhaft die Brust zusammen. Bis auf den heutigen Tag vermochte er nicht anders als mit Trauer und Wehmut an den Verlust seiner großen Liebe zu denken. Daran hatte auch die seitdem vergangene Zeit nichts ändern können.
Gewaltsam schob Gerrit die trüben und peinigenden Gedanken zur Seite und zwang sich zu einer aufmerksamen Betrachtung der Umgebung. Das langsam ansteigende Tal wurde von einigen Burgen und einer Reihe kleiner Dörfer gesäumt. Inmitten von Feldern, Wiesen und Hecken standen einsame Berghöfe, Schafe mit zottigen Fellen und Ziegen weideten auf den Hängen. Die mit Eiskappen bedeckten Bergketten, deren zackige Gipfel in den Himmel stachen, erinnerten den Ritter von Falkenfels an ein gewaltiges Gebiss, wobei die unteren, von Wald und Almen bedeckten Teile der Berge, das Zahnfleisch, und die kahlen, von blendendweißem Schnee umhüllten Bergspitzen die Zähne waren.
Je weiter die Deutschen vorankamen, desto mehr verengte sich das Tal. Der Weg wurde so schmal, dass die Männer oftmals gezwungen wurden, einer hinter dem anderen zu reiten. Zweimal mussten sie Sturzbächen ausweichen, die in freiem Fall von schroffen Felswänden hernieder stürzten.
Immer seltener wurden auch die menschlichen Ansiedlungen. Mit Ausnahme der Marktorte Matrei und Steinach trafen die Reisenden auf keine größeren Dörfer mehr. Über lange Strecken des Weges zeugten nur noch die Behausungen der Bergbauern und Hirten, die sich in den Schutz der steil aufragenden Bergwände duckten, von der Anwesenheit der Menschen in dieser unwirtlichen Region. Die Schindeldächer dieser ärmlichen, aus knorrigen Stämmen gefügten Hütten waren mit großen Steinbrocken beschwert, damit der Sturm sie nicht fortreißen konnte.
Vor Steinach überholten die Abgesandten des Kaisers eine Gruppe von wenigstens zwei Dutzend Rompilgern, ein glücklicher Umstand, denn so konnten sie die letzten noch freien Unterkünfte in dem Marktort für sich in Beschlag nehmen. Zwar waren auch diese nicht wahrhaft fürstlich zu nennen, doch selbst in der zugigsten Scheune schlief es sich immer noch besser als unter freiem Himmel.
Tags darauf, noch vor dem Mittag, erreichten die Deutschen die Passhöhe. Das Wipptal verbreiterte sich dort zu einer größeren Ausbuchtung, die von nicht allzu hohen, oftmals bewaldeten Bergen umgeben war. Auf der rechten Seite blinkte zwischen Grasmatten und kleinen, wie gerupft wirkenden Gehölzen, die aus Föhren, Lärchen und Rottannen bestanden, das Wasser eines kleinen Sees.
„Der Brenner ist der wohl niedrigste aller Alpenpässe“, dozierte Sebald, „auf jedem Fall aber der am leichtesten zu übersteigende. Darum wird er auch am meisten benutzt. Von unseren Königen und Kaisern ebenso, wie von den Kaufleuten, die ihren Handel mit Venedig treiben.“ Er wartete, bis auch die am Ende des Zuges reitenden Knechte aufgeschlossen hatten, dann fuhr er mit lauter Stimme fort: „Übrigens werden auch auf der südlichen Seite des Gebirges zwei Flüsse unseren Weg bis hinunter nach Verona begleiten. So wie es auf der Nordseite die Inn und die Sill waren, deren Tälern wir gefolgt sind, so werden es nun zunächst die Eisack und dann der Etsch sein.“
Obwohl der Aufstieg zum Brenner die Männer und ihre Reittiere nicht sonderlich erschöpft hatte, so waren sie doch insgeheim froh darüber, dass es von nun an die meiste Zeit bergab gehen sollte. Doch ihre gute Stimmung verflog schon nach kaum einer Stunde Weges wieder, denn kurz hinter Sterzing änderte sich plötzlich das Wetter. Graue Wolken hingen tief in das Eisacktal und Nieselregen, gemischt mit matschigen Schneeflocken machte die Kleidung der Reisenden klamm.
Anselm von Wildenburg, der Regen und kalte Feuchte verabscheute, schüttelte sich mehrmals wie ein Hund und fluchte wie ein Fuhrknecht, während Gerrit die Unbilden der Natur schweigend und mit ausdruckslosem Gesicht über sich ergehen ließ.
Der vor ihnen reitende Sebald hatte sein Haupt mit einem enorm breitkrempigen, nach oben spitz zulaufenden Hut vor dem Regen geschützt. Er hockte so zusammengesunken auf seiner braunen Stute und hatte seinen Kopf soweit eingezogen, dass es von hinten so aussah, als ob der Hut direkt auf seinen Schultern saß.
Meile für Meile legten die Männer zurück, ohne dass der Himmel ein Einsehen mit ihnen hatte, und so waren sie alle erleichtert, als sie am Abend hinter den Regenschleiern die Bischofsstadt Brixen vor sich auftauchen sahen.
Als kaiserliche Gesandte fanden sie Quartier in der bischöflichen Burg auf dem Säbener Berg und Heinrich, Gerrit und Anselm wurden gemeinsam mit den beiden Benediktinern an die Tafel des Bischofs geladen.
Am kommenden Morgen stellten die Reisenden befriedigt fest, dass es aufgehört hatte zu regnen. Ein kräftiger, von Süden wehender Wind trieb die Wolken davon wie eine Herde grauwolliger Schafe.
Unter einem blank geputzten Himmel brachen die Männer um Heinrich von Hohenberg frohen Mutes auf; die schweren Mäntel, die sie seit Innsbruck getragen hatten, lagen nun wieder zusammengerollt auf den Rücken der Pferde.
Schon kurz hinter Brixen endete die Straße vor einer wilden, von den reißenden Wassern der Eisack überschwemmten Schlucht. Auf Saumpfaden, die steil und oft so schmal waren, dass keine zwei Männer, geschweige denn zwei Pferde nebeneinander gehen konnten, erstiegen sie den Westhang des Ritten, eines großen Bergmassivs, das sich zwischen Brixen und Bozen ausdehnte.
Die Pferde stolperten und rutschten auf schmieriger Erde und weichem Moos aus, Bergschutt knirschte unter ihren Hufeisen, frei liegende Wurzeln knackten. Bisweilen neigte sich dichtes Gezweig so tief über die hohlwegartig ausgeschnittenen Pfade, dass die Reiter aus den Sätteln steigen und die Rosse hinter sich her ziehen mussten.
Nachdem sie endlich und unter vielen Mühen die Höhe erstiegen hatten, hielten sie an, um sich auszuruhen und auch den Tieren eine Rast zu gönnen.
Das Plateau des Ritten war von grünen Matten und ausgedehnten Wäldern bedeckt in denen ein nie erlahmender Wind rauschte. Die spitzen Türme kleiner Kapellen überragten die eng zusammengedrängten Hüttendächer der Bergbewohner und die windzerzausten Wipfel des Waldes. Adler und Geier kreisten und ließen ihre pfeifenden Schreie ertönen.
Die Wege, die Jahr für Jahr von vielen tausend Reisenden benutzt wurden, waren im Großen und Ganzen in einem annehmbaren Zustand. Über sanft geschwungene Berge und an windgeschützten Hängen entlang schlängelten sie sich nach Süden, vorbei an Dörfern und Weilern, in denen hilfsbereite, zupackende Leute wohnten. Kleine Stiege überspannten tief ausgespülte Bachläufe, in unregelmäßigen Abständen boten robust gezimmerte Hütten dem Wanderer Schutz und Unterschlupf vor den Unbilden des schnell wechselnden Wetters. Sogar ein Hospiz, das extra für die Pilger angelegt worden war, gab es dort.
An einigen Stellen des Weges eröffneten sich den Reisenden herrliche Blicke in die Eisackschlucht und auf die dahinter empor wachsenden, gewaltigen Bergriesen.
Am Mittag des dritten Tages nach ihrem Aufbruch von Brixen erblickten die kaiserlichen Abgesandten in einem vor ihnen liegenden Talkessel eine große, von Mauern und Türmen umgebene Stadt.
„Das ist Bozen“, beantwortete Sebald die unausgesprochene Frage seiner Gefährten.
Über abschüssige, sich serpentinenartig krümmende Pfade stiegen die Deutschen zur Stadt hinab und fanden in einem Wirtshaus, das den Namen „Zum Güldenen Kelch“ trug, eine gastfreundliche Aufnahme für die Nacht.
Hinter Bozen öffnete sich vor den Reisenden das von hohen, hell schimmernden Kalkbergen umrahmte Tal der Etsch. Es war wesentlich breiter als das Tal der Eisack, doch sein zumeist brettflacher Grund bestand zum weitaus größten Teil aus sumpfigem, unwegsamen Gelände. Dafür sorgten die in jedem Frühjahr reichlich von den Bergen herabstürzenden Wassermassen, die durch die Schneeschmelze freisetzt wurden und die das Tal vollkommen überschwemmten.
Nachdem sich der morgendliche Nebel, der von den feuchten Talauen und den Sumpfwiesen aufstieg, gehoben hatte, zogen die Gefährten auf der Straße, die sich hart am Rand der Berge entlang schlängelte, den mit Sonne und Wärme lockenden italienischen Landen entgegen.
Die Siedlungen, auf die sie von Zeit zu Zeit trafen, waren zumeist schon von den alten Römern angelegt worden. Sie standen auf festem Grund oberhalb des Überschwemmungsgebietes und trotzten mit der einfachen, aber robusten Bauweise ihrer Häuser, Ställe und Scheunen, unerschütterlich den wechselhaften Herausforderungen der Natur.
Die Menschen, die hier lebten, fristeten ihr Dasein seit jeher vor allem mit der Aufzucht von Rindern, Ziegen und Schafen und der Herstellung von wohlschmeckendem Käse, den sie zu guten Preisen an die Durchziehenden verkauften.
Auf beiden Seiten des Tales wurden zahlreiche Bergspitzen von Burgen und Wachtürmen gekrönt. Deren Besatzungen schauten von der Höhe hernieder und überwachten die Straße und den Reiseverkehr mit Argusaugen.
„Denen dort oben sagen nur die Vögel ein „Gott zum Gruß“, staunte Anselm mit Blick auf eine dieser, in schwindelerregender Höhe erbauten Burgen. „Eine solche Burg möchte ich, bei allen Heiligen, nicht erstürmen müssen. Schon allein der Weg da hinauf …“ Er schüttelte sich, als hätte er von einem außerordentlich sauren Wein getrunken.
„Nun, leicht ist es nicht, mein junger Freund, da mag ich dir Recht geben“, ließ sich der vor ihm reitende Heinrich von Hohenberg vernehmen, „aber auch nicht unmöglich. Vor beinahe dreißig Jahren, so berichten uns die Alten, ist unseren Männern unter der Führung Ottos von Wittelsbach ein solch tolles Stücklein gelungen. Unter den Augen unseres Herrn Kaisers haben diese Tapferen damals die als uneinnehmbar erscheinende Burg über der Veroneser Klause erstiegen und erstürmt und sich damit unsterblichen Ruhm erworben.“
„Ruhm …“, murmelte Gerrit gedehnt, und in seiner Stimme schwang ein seltsam wehmütiger Ton mit. Seine Augen wurden schmal und seine Lippen zuckten. „Ruhm …“, wiederholte er dann beinahe verächtlich und schüttelte den Kopf. „Was für ein Wahnwitz …“
Der Benediktiner Bartholomäus, der die Worte Gerrits gehört hatte, betrachtete den Ritter mit erstauntem Blick, dann schaute er fragend zu seinem Mitbruder Bonifatius hinüber. Doch der zuckte nur mit den Schultern.
Der Ritt durch das Etschtal verlief ohne größere Zwischenfälle und Aufregungen, nur einmal, beim Durchqueren des Engpasses von Salerno, wo sich die Bergwände weit in das Tal und bis an den Lauf des Flusses heran schoben, verlor eines der Packpferde ein Hufeisen. Doch schon im nächsten Ort fanden die Deutschen einen Schmied, der das Pferd neu beschlug, sodass sie ihren Weg unbehindert fortsetzen konnten. Am Abend desselben Tages zogen sie noch vor dem Sonnenuntergang in Trient ein und übernachteten dort als Gäste des hiesigen Bischofs.
Hinter der prächtig ausgebauten Bischofsstadt wurde das Tal zusehends freundlicher und fruchtbarer. Milde Lüfte und eine üppigere Vegetation kündeten den Reisenden den sich nahenden Süden an. Auf den Hügeln am Ufer des Flusses gediehen Weinstöcke und Obstbäume und die Bergwiesen leuchteten nun in einem viel üppigeren Grün, als in den höher gelegenen Bergregionen. Nur wenige Wolken hingen über den Bergen, fast unbeweglich, so als zögerten sie, weiter zu ziehen. Nach Sonnenuntergang erfüllte das Gezirpe der Grillen und Zikaden die Nacht. Auch die Etsch floss nun sanfter und an vielen Stellen hoben sich aus ihrem Bett die rauschuppigen Rücken breiter Kiesbänke.
In diesem Teil des Tales trugen die Bewohner auch jetzt, im angehenden Herbst, noch eine leichte, luftige Kleidung. Die Männer zeigten unter ihren halb geöffneten Hemden und leichten Jacken ihre behaarte Brust, die Frauen und Mädchen gingen barfuß und mit geschürzten Röcken einher.
Am fünfundzwanzigsten Tag des Gilbmonds schauten die Männer der kaiserlichen Gesandtschaft voller Staunen zu der berühmten Feste über der Veroneser Klause hinauf und wurden im Gedenken an die Leistung der Männer um Otto von Wittelsbach von Ehrfurcht und Stolz erfüllt.
Am darauffolgenden Tag verließen sie die bizarre Bergwelt und sahen das zwischen der weiten, dunstigen Ebene und den hochragenden Kalksteinbergen der Venezianer Alpen erbaute Verona vor sich liegen.
In der großen, alten Stadt, die von mächtigen grauen Mauern und Bastionen umgeben war, gönnten sich die Gefährten einen Tag der Ruhe, der den Menschen und Tieren gleichermaßen gut tat. Mit neuen Kräften und bei strahlendem Sonnenschein brachen sie am darauf folgenden Morgen auf und zogen auf einer breiten und viel benutzten Straße, die durch fruchtbare Felder führte, nach Osten.
Diejenigen von den Deutschen, die zum ersten Mal in Italien weilten, verwunderten sich darüber, wie warm und freundlich es hier zum Ende des Oktobers noch war. In ihrer Heimat, von der sie inzwischen viele hundert Meilen und ein gewaltiges Gebirge trennten, mochten jetzt wohl schon die stürmischen Herbstwinde und die dicken, grauschwarzen Regenwolken die Herrschaft am Himmel übernommen haben.
Vielleicht lag es an dem Sonnenschein und der lichterfüllten Weite der norditalienischen Ebene, vielleicht tat aber einfach auch nur die Zeit ihre Wirkung, dass sich Gerrits verfinstertes Gemüt allmählich aufhellte. Hatte er sonst während der Pausen und der Mahlzeiten zumeist nur schweigend im Kreis der Gefährten gesessen, so begann er sich nun wieder öfter an deren Gesprächen, die sich vor allem um die Eigenheiten und Schönheiten der italienischen Lande und ihrer Bewohnerinnen drehten, zu beteiligen.
Anselm, Heinrich und Sebald, sowie Gerrits Knechte Kuno und Immo, die alle den Grund für die Verschlossenheit des jungen Ritters kannten, nahmen dies mit Erleichterung und Freude zur Kenntnis und bemühten sich nach Kräften, den Stimmungswandel des Falkenfelsers noch weiter zu befördern.
So war Heinrich denn auch sichtlich erfreut, als sich Gerrit während einer Mittagsrast, zu der sie sich im Schatten eines Olivenbaumhaines niedergelassen hatten, zu ihm setzte und ihn zum ersten Mal, seit sie von Nürnberg aufgebrochen waren, nach dem eigentlichen Zweck dieser Gesandtschaft befragte. Der Schwabe bedeutete Gerrit etwas näher heranzurücken, goss ihm Wein in einen Holzbecher und begann in leisem Tonfall zu berichten: „Also, nach außen hin besteht unser Auftrag nur darin, ein wertvolles Kleinod, ein ellengroßes Kruzifix aus purem Gold und verziert mit vielen wertvollen Steinen, der Kirche des Heiligen Grabes zum Geschenk zu machen als Dank für den Beistand, den Gott, der Herr, unserem Kaiser bei seinem Kampf gegen den unbotmäßigen Welfen geleistet hat. Darüber hinaus aber“, der Hohenberger beugte sich noch ein wenig mehr zu Gerrit hinüber und dämpfte seine Stimme, „geht es um die Regelung der Thronfolge im Königreich von Jerusalem.
Dazu musst du wissen, dass der derzeitige König Balduin am Aussatz leidet und wohl, wenn Gott kein Wunder geschehen lässt, nicht mehr lange zu leben haben wird. Da er, verständlicherweise, nie verheiratet war, hat er auch keinen leiblichen, männlichen Erben und leider auch keine Brüder, denen die Krone übertragen werden könnte. So bleiben nur seine zwei Schwestern, von denen die ältere, die Sibylle geheißen wird, seit zwei Jahren verheiratet ist. Ihr Gemahl, ein gewisser Guido von Lusignan, käme somit als erster Prätendent für die Thronfolge in Frage, allerdings wird seine Eignung zum Herrscher, zumal über ein von so vielfältigen Gefahren bedrohtes Königreich, von Kennern der dortigen Gegebenheiten als äußerst gering eingeschätzt.
Bliebe da also nur noch Isabella, die zweite und jüngere Schwester König Balduins. Sie ist jetzt zehn Jahre alt und bereits seit zwei Jahren mit einem Jüngling namens Humfried von Toron verlobt. Die Torons gehören zu den alteingesessenen Adelsfamilien des Königreiches.
König Balduin hoffte, die alten Barone damit wieder fester an sein Königshaus binden zu können, doch ob jener Humfried tatsächlich ein geeigneter Thronanwärter ist, darf getrost bezweifelt werden, aus verschiedenen Gründen, über die ich den Mantel des Schweigens breiten will.
Da nun aber die Sorgen und Nöte des Königreiches Jerusalem unseren Kaiser als Herrscher des Abendlandes und größten christlichen Fürsten nicht kalt lassen können, hat er beschlossen, bei König Balduin seinen Sohn Friedrich, den Herzog von Schwaben, als möglichen Freier für die noch nicht verheiratete Isabella ins Spiel zu bringen. Und genau zu diesem Behuf hat mich seine Majestät nach Jerusalem entsandt.“
„Natürlich“, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu, „ist dies alles streng vertraulich und niemand außer uns darf davon erfahren. Aber ich weiß ja, dass du kein Schwätzer bist.“
Er goss den Rest seines Weines zwischen die knorrigen Wurzeln des Olivenbaumes, gegen den er sich gelehnt hatte, und barg seinen und Gerrits Becher in seinem Mantelsack. Dann erhob er sich und gab dadurch auch den anderen das Zeichen zu Aufbruch.
Die Männer schwangen sich wieder in die Sättel und setzten ihre Reise auf der staubigen Straße fort.
„Ein König, der vom Aussatz geschlagen ist“, murmelte Gerrit nachdenklich und schüttelte den Kopf, „und das in Gottes eigenem Land …“
Hinter Vicenza, der nächsten größeren Stadt auf dem Weg nach Venedig, bogen Heinrich und Sebald plötzlich von der Straße ab und führten die Männer nach Süden, auf eine sich unvermittelt aus dem flachen Umland erhebende Berglandschaft zu.
„Diese Berge werden die Euganäischen Hügel geheißen“, erklärte der Hohenberger seinen Leuten. „In einem der Dörfer dort werden wir überwintern, denn vor März fahren jetzt keine Schiffe mehr von Venedig nach Akkon oder zu einem der anderen Häfen in Outremer.“
Die schöne Landschaft mit ihren Rebhängen, ihren lieblichen Tälern und Wäldern gefiel den Männern der Gesandtschaft und sie waren zufrieden, dass ihre Führer für die Tage des Wartens auf die Einschiffung in Venedig dieses freie Land und nicht die Enge und den Lärm einer der großen Städte ausgewählt hatten.
Gleich in dem ersten Dorf, auf das sie trafen, verhandelten Heinrich und Sebald mit dem Podesta über die Aufnahme der Gesandtschaft und schon nach gut einer halben Stunde wurde man sich einig.
Die Ritter erhielten Unterkunft in den Häusern der Bauern, die Mönche nahm der örtliche Pfarrer in seine Obhut und die Knechte wurden in Scheunen untergebracht. Für die Unterkunft und die Verpflegung, die die Dorfbewohner bereitstellten, bezahlten die Deutschen in guter Münze und einige der Knechte, die auf dem Land groß geworden waren, boten den Bauern ihre Hilfe bei den anfallenden Arbeiten an.
Schon am Tag nach ihrer Ankunft in dem italienischen Dorf machten sich Heinrich und Sebald auf den Weg nach Venedig. Dort hofften sie, einen Kaufherrn anzutreffen der Sebald, von einer früheren Begegnung her, noch einen Dienst für die Heilung von einer Krankheit schuldig war und der ihnen mit seinen Kenntnissen und Verbindungen bei der Suche nach einem passenden Schiff für die Überfahrt in das Heilige Land behilflich sein sollte.
Als sie nach zwei Wochen zurückkehrten, konnten sie ihren Leuten berichten, dass sie auf einem Handelssegler namens „Bella Chiara“, der in dem großen Frühjahrskonvoi von Venedig nach Akkon fahren würde, ausreichenden Schiffsraum für die Männer und die Pferde gemietet hatten. Da das Schiff aber erst Mitte März in See stechen würde, verblieb den Deutschen noch reichlich Zeit, die sie sich mit Waffenübungen, Würfelspielen und gelegentlichen Ausritten nach Padua und in die nähere Umgebung, vertrieben.
Die Einheimischen zeigten sich ihren Gästen gegenüber zwar zurückhaltend, aber freundlich und friedfertig, und da Heinrich und Gerrit, der den Hohenberger bei dessen Abwesenheit als Anführer vertrat, auch bei ihren Knechten auf strenge Disziplin hielten, kam es zu keinerlei unliebsamen Zwischenfällen. Und als die Dörfler merkten, dass die fremden Kriegsleute weder streitsüchtig noch gewalttätig waren und auch nur den Frauen nachstellten, die dies auch wollten, gaben sie ein Stück ihrer Zurückhaltung auf und luden die Deutschen sogar zu ihren gar nicht so seltenen dörflichen Festen ein.
So verging die Zeit, und das Jahr neigte sich seinem Ende zu. Auf Vorschlag von Bartholomäus und Bonifatius feierten die Männer der kaiserlichen Gesandtschaft die Weihnachtsmesse in der nahe gelegenen Benediktiner-Abtei von Praglia, wo sie den Leib Christi und den Segen des Abtes für ihre Reise empfingen.
Nach einigen weiteren Wochen, es war nun Anfang März, war die Zeit des Aufbruchs gekommen.
Die Kaiserlichen verabschiedeten sich von ihren Gastgebern - was bei so mancher jüngeren oder auch etwas weniger jüngeren Dorfbewohnerin die eine oder andere Träne zum Fließen brachte - und brachen bei kühlem, aber sonnigem Wetter zu ihrem Ritt nach Venedig auf.
Von Padua, das die Männer um Heinrich noch vor dem Mittag erreichten, führte sie die Straße immer südostwärts durch eine grüne, fruchtbare Ebene. Dichte Hecken, Baumreihen und ausgedehnte Haine säumten den Weg und gestatteten nur an einigen Stellen eine weite Aussicht in die Umgebung. An solchen Orten sahen die Reisenden im Norden die verschneiten, halb in den Wolken versteckten Berge aufragen, während sich nach Süden und Osten das weite, flache Land erstreckte.
Am Nachmittag aber tauchten am östlichen Horizont zuerst ein größerer und danach noch einige andere, etwas kleinere Türme auf.
„Was ist das für ein Ort?“, fragten die Knechte und Heinrich wandte sich im Sattel herum, lachte zufrieden und sagte: „Das, Männer, ist Venedig.“
Als die Sonne in einer Dunstschicht am westlichen Himmelsrand zerfloss, kamen die Reisegefährten zu einem Ort namens Mestre.
Die aufstrebende Siedlung lag nahe am Ufer des flachen, vom eigentlichen Meer durch einige lang gestreckte Inseln abgetrennten Gewässers, das die Einheimischen Laguna nannten. Hier gab es eine Anlegestelle für die Barken, Schuten und Prahme, mit denen die vielfältigen Handelswaren der venezianischen und der fremdländischen Kaufleute über das flache Wasser der Lagune hin und her transportiert wurden.
In Ermangelung eines unbelegten Quartiers schlugen die Ankömmlinge ihre Zelte in der Nachbarschaft einiger mecklenburgischer Handelsmänner auf, die mit echter norddeutscher Gelassenheit darauf warteten, dass sie ihre Pelze, ihren Honig und ihr Bienenwachs in die Inselstadt bringen durften.
Sobald der Aufbau ihres Lagers abgeschlossen war, liefen Gerrit und Anselm, Sebald, die beiden Mönche und die meisten der Knechte, zu dem nahe gelegenen sandigen Strand der Lagune.
Ein salziger, frischer Wind wehte ihnen entgegen und der für flache Gewässer so typische Geruch von Tang und Muscheln stieg ihnen in die Nasen. Während ihre Füße im feuchten Ufersand einsanken und ihnen das Meerwasser um die Stiefel spielte, schauten sie mit großen Augen zu der weithin berühmten Stadt hinüber, die mitten in der ausgedehnten, blinkenden Wasserfläche lag.
Leise klang von dort das Abendläuten herüber.
*
Venedig, was für eine seltsame Stadt!
Vom Deck der beiden breitbordigen, flach auf den sanft rollenden Wogen der Lagune liegenden Wasserfahrzeuge aus, mit denen Heinrich und seine Mannen nach Venedig übersetzten, erschien den Deutschen die meerumschlungene Stadt, als eine dicht gedrängte Ansammlung von Kirchen, Palästen, Häusern, Hütten und Hallen, die übergangslos aus der grünlichblauen Wasserfläche in die Höhe wuchsen.
Eine Vielzahl von kleinen und größeren Schiffen, Booten und Gondeln glitten über das spiegelblanke Wasser, von kräftigen Ruderschlägen oder von geschwellten grauen, braunen und gelben Segeln getrieben. Am hellblauen Himmel flogen Möwen und Seeadler, die begierig nach einer Beute Ausschau hielten. Ein frischer Wind kräuselte das Wasser der Lagune.
Mit angezogenen Beinen, den Oberkörper seitlich der Stadt zugewendet, hockten Gerrit, Anselm und Heinrich auf der schmalen, die niedrigen Bordwände umlaufenden Planke, die als Sitzgelegenheit diente, und ließen das Bild der einzigartigen Stadt auf sich wirken. Außer ihnen befanden sich noch Sebald, Immo und Kuno, Anselms Knechte Hans und Jörg sowie die beiden Benediktiner auf dem Boot.
Ebenfalls mit an Bord der Schute waren die Pferde der drei Ritter, die als Einzige auf die Reise in das Heilige Land mitgenommen werden sollten. Die Packpferde und die Reittiere der Knechte und der frommen Brüder hatten Heinrich und Sebald an einen der in Mestre ansässigen Pferdehändler verkauft.
Schneller als sie gedacht hatten, näherten sich die Deutschen dem Stadtrand Venedigs. Schon eine gute Stunde nach dem Ablegen in Mestre liefen ihre Boote in eine Wasserstraße ein, die rechts von einer lang gezogenen, zum großen Teil auch schon bebauten Insel, auf der linken Seite aber von der eigentlichen Stadt begrenzt wurde.
„Wenn man sich wie ein Vogel in die Lüfte erheben könnte und von oben herab auf Venedig schauen würde“, ließ sich Sebald vernehmen, „dann würde die Stadt so ähnlich aussehen wie ein gegen einen großen, aufrecht stehenden Stiefel springendes Pferd; wobei das Pferd und der Stiefel durch einen langen, sich gleich einem Wurm krümmenden Wasserlauf, dem sogenannten canale grande, getrennt werden.“
„Und woher willst du das wissen?“, fragte Anselm erstaunt, „du kannst doch gar nicht fliegen!“
Der Alte holte tief Luft. „Weil ich“, erklärte er dann mit leichtem Kopfschütteln, „schon einmal den Grundriss der Stadt auf einem Lageplan gesehen habe.“
„Ach, so“, brummte Anselm ein wenig enttäuscht und wandte sich wieder den auf der Backbordseite vorüber gleitenden Häusern und Palästen zu, die den Stadtrand Venedigs bildeten.
Die meisten der eng aneinander gebauten und mit farbenfrohen Anstrichen versehenen Gebäude hatten mehrere Stockwerke und flache, mit Ziegeln gedeckte Dächer. Die vielen, in kurzen Abständen aufeinander folgenden Fenster waren mit zweiflügligen, in eisernen Angeln hängenden Holzläden versehen. Vor den Palästen und Häusern ragten dicke runde und bunt angestrichene Pfosten mit hutähnlichen, metallisch blinkenden Aufsätzen aus dem Wasser. An diesen Pfählen wurden die Boote und Gondeln angebunden, mit denen sich die Venezianer auf den Canales bewegten.
Die Bootsführer, die die Schuten der Deutschen steuerten, hielten sich beim Durchfahren der breiten Wasserstraße stets auf deren rechter, der Insel La Giudecca zugewandten Seite, während die entgegenkommenden Boote die andere Hälfte des Kanals benutzten.
Nach reichlich einer halben Stunde beschrieb der Kanal einen leichten Bogen nach links. Kurz darauf eröffnete sich den Ankömmlingen ein herrlicher Blick auf den hell schimmernden Dogenpalast, den schlanken, hoch aufragenden Campanile, den halb hinter den näher zum Wasser stehenden Bauwerken verborgenen, an seinen runden Dachkuppeln erkennbaren Dom von San Marco und den mit zwei Säulen geschmückten Eingang des Markusplatzes.
Hier, dass wussten auch Heinrich, Gerrit und Anselm, befand sich das Zentrum Venedigs, hier schlug das Herz der mächtigen Seerepublik!
Langsam glitten die Schuten an den Prachtbauten des Markusplatzes vorüber. Auf der Höhe der Insel San Giorgio nahmen die Bootsführer einen geraden Kurs auf den östlich gelegenen Uferrand zu, der von düster drohenden, kastellartigen Gebäuden mit schmutzig grauen Fassaden gesäumt wurde.
An einer lang gezogenen Kaimauer schaukelte dort eine Reihe von Schiffen. Vorwiegend handelte es sich dabei um kleinere Barken und Fischerkähne, doch auch zwei der flachen, dreimastigen Galeeren und einige dickbäuchige Kauffahrerschiffe waren darunter.
Als sich die Boote mit den Kaiserlichen dem Ufer bis auf vierzig, fünfzig Schritte genährt hatten, wendeten sie und hielten auf eine freie Stelle inmitten der Schiffsreihe zu. Mit knappen Kommandos dirigierte der Bootsführer seine Leute am Segel und an den nun ausgebrachten Riemen, und kurz darauf legten sie gekonnt an der Kaimauer an.
Einer der Matrosen sprang von der Bordwand an Land und schlang die ihm von einem anderen Bootsmann zugeworfenen Schiffstaue um zwei der zu diesem Zweck auf der Kaimauer liegenden, großen Steine.
Die Passagiere erhoben sich von ihren Sitzen, die Ritter nahmen ihre Pferde beim Zügel und führten sie über den Landesteg auf den Kai, wo sie bereits von einem bärtigen, lederhäutigen Mann in der einfachen Kluft eines Matrosen in Empfang genommen worden.
Mittels Handzeichen bedeutete der Mann den Kaiserlichen, ihm zu folgen und führte sie dann zu einem nur wenige Dutzend Meter entfernt ankernden, hochbordigen Segler.
Das Schiff, das nur einen Mast hatte und dessen mittlerer Teil um Schulterhöhe über den Kai ragte, war wenigsten fünfundzwanzig Schritte lang und in der Mitte zehn Schritte breit. Der Bug und das Heck wurden von hölzernen Plattformen gekrönt, die von einer zinnenartig gestalteten und bunt bemalten Reling umlaufen wurden. Die Aufbauten am Heck waren direkt auf den hoch gezogenen Schiffskörper aufgesetzt worden, die im vorderen Teil des Schiffes fußten auf einem Gerüst aus kräftigen Balken. Im Seekampf boten diese Plattformen, die auch Kastelle genannt wurden, den Bogen- oder Armbrustschützen der Schiffsbesatzung einen günstigen, weil erhöhten Platz, von dem aus sie den Feind beschießen konnten.
Die Schiffsplanken des Seglers waren glatt gescheuert und mit einem neuen Anstrich versehen worden. Während der Winterruhe hatte man sie in einem der Docks des geheimnisumwitterten, für alle Fremden verbotenen Arsenals von Muscheln und anderem Bewuchs gründlich befreit.
An der Spitze des einzigen Mastes flatterte ein langer, dreieckiger Wimpel, auf dem der goldene Löwe von San Marco zu erkennen war. Das Segel hing noch zusammengerefft an der Rah.
„Bella Chiara“, sagte der Matrose und deutete auf das Schiff. „Capitano Pisani.“
Er gab den Fremdlingen zu verstehen, dass sie hier vor dem Schiff auf ihn warten sollten, dann ging er mit leicht schaukelnden Schritten an Bord und entschwand den Blicken der Deutschen.
Es dauerte einige Augenblicke, dann erschien auf dem Deck des Schiffes ein mittelgroßer, schwarzhaariger Mann von etwa dreißig Jahren.
„Ich bin Aldo Pisani“, stellte sich der Mann vor, nachdem er zu den Wartenden an Land gekommen war, „der Kapitän dieses Schiffes.“
„Und ich bin Heinrich von Hohenberg, Gesandter seiner kaiserlichen Majestät Friedrich I.“, erwiderte der Schwabe, „und dies sind meine Begleiter.“ Er stellte die anderen der Reihe nach vor.
„Seid willkommen an Bord meines Schiffes“, erwiderte der Venezianer freundlich, „wir beginnen sofort mit der Verladung des Gepäckes und der Pferde. Doch zuvor möchte ich ihnen die Unterkünfte zeigen. Bitte kommen sie mit mir.“
Über den breiten, aus stabilen Bohlen und Rundhölzern gefertigten Landesteg, der mittschiffs auf der Bordwand lag, betraten die Deutschen den Segler.
Der Kapitän führte sie zum Achterkastell und öffnete eine niedrige Tür, hinter der eine kurze Treppe nach unten in einen winzigen und dunklen Vorraum führte. Die Deutschen brauchten einige Sekunden, bis sich ihre Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, dann sahen sie, dass sich an der hinteren Wand des Raumes zwei weitere Türen befanden.
Der Venezianer wies zuerst auf die linke Tür und sagte: „Der Herr kaiserliche Gesandte und die ehrwürdigen Brüder werden in meiner Kajüte schlafen, die Herren Ritter und der Übersetzer in der Kajüte meines Steuermannes.“ Bei seinen letzten Worten zeigte der Capitano Pisani auf die zweite Tür. „Die Knechte schlafen im Laderaum bei den Pferden und dem Gepäck.“
Die Kaiserlichen warfen einen kurzen Blick in die schmalen, recht kärglich ausgestatteten Kajüten, dann kehrten sie gemeinsam mit dem Kapitän an Deck zurück. Dort waren bereits die ersten Verladearbeiten im Gange. Begleitet von lautem Geschrei und heftigem Schimpfen schleppten die Lastträger, die sich schon bei der Ankunft der Tedesci sofort an der Anlegestelle der „Bella Chiara“ eingefunden hatten, die Kisten und Packen des Reisegepäcks der Gesandtschaft in den Laderaum des Schiffes. Die Pferde wurden mit Hilfe der deutschen Knechte an Bord geführt und dann gleich unter Deck in mit Stroh ausgelegte Verschläge gebracht.
„Nun, mio … meine Herren“, sagte der Kapitän zu seinen Passagieren, „morgen früh mit der Flut laufen wir aus. Also seien sie bitte noch vor dem Sonnenaufgang auf dem Schiff, falls sie diese Nacht noch in Venezia verbringen wollen. Ein …“ er suchte nach einem passenden Wort, „Aufenthalt in La Serenissima lohnt sich ganz gewiss, denn außer unseren vielen schönen Kirchen und Palazzos gibt es auch viele gute Schenken und …“ er grinste verschwörerisch, „auch viele schöne und heißblutige Frauen, sie verstehen?“
Die Deutschen verstanden, und nachdem ihr persönliches Gepäck in der kleinen Kajüte verstaut worden war, machten sich Gerrit, Anselm und Sebald zu Fuß auf den Weg zum Zentrum der Seestadt. Zuvor hatten sie ihre ledernen Reisekleider mit den eng anliegenden Tuchhosen und den ärmellosen Wämsern vertauscht. Ihre Schwerter ließen sie auf der „Bella Chiara“ zurück, nur die Dolche hingen an ihren Gürteln.
Heinrich, der Venedig schon kannte, hatte es weniger eilig, er folgte den Dreien erst, nachdem er mit Capitano Pisani, der gleichzeitig der Eigner des Schiffes war, alle geldlichen Angelegenheiten geregelt hatte. Begleitet wurde er von Bonifatius und Bartholomäus, die im Dom von San Marco ihre Gebete sprechen und den dort aufbewahrten, in der ganzen Christenheit berühmten Reliquien ihre Verehrung erweisen wollten.
Von den Knechten sahen die meisten von einer Erkundung der Stadt ab, denn nur wenige hundert Schritte von der Kaimauer entfernt fanden sie eine herrlich heruntergekommene Hafenspelunke, in der sie billigen Wein und nicht allzu streng riechenden Fisch von schlampigen, freigiebig ihre Reize zur Schau stellenden Schankmägden serviert bekamen.
Vom Anlegesteg der „Chiara“ führte eine ziemlich gerade Uferstraße zu dem in westlicher Richtung gelegenen Markusplatz. Auf ihrem Weg dorthin mussten Gerrit, Anselm und Sebald etliche Brücken überqueren, die die zumeist nicht sehr breiten Kanäle überspannten, die von der Lagune zwischen die Häuserblöcke führten. Alle diese Brücken waren aus Stein gemauert und auf jeder Seite mit Treppenstufen versehen.
Nach bestenfalls einer Viertelstunde gemütlichen Spazierens hatten sie den Markusplatz erreicht und standen vor dem imposanten Gebäude des Dogenpalastes, der mit seinem, von feinen Säulen gebildeten Arkadengang, den hohen, rundbogigen Fenstern und der im Sonnenlicht leuchtenden Fassade überaus prächtig anzusehen war.
Vor allem die Wandverkleidung erregte die Begeisterung von Gerrit und Anselm, die Ähnliches noch nie gesehen hatten. Sie bestand aus Tausenden von weißen und hellgelben Ziegeln, die von den Erschaffern dieses riesigen Mosaiks zu kunstvollen Mustern zusammengestellt worden waren.
„Hier, in diesem Palast oder Palazzo, wie man hierzulande sagt, lebt und regiert der Doge, der gemeinsam mit dem Großen Rat, welcher aus fünfundvierzig Ratsherren besteht, über die Geschicke der Republik bestimmt“, erklärte Sebald den beiden Rittern.
„Was ist eine Republik?“, erkundigte sich Anselm bei dem Alten.
Die Gelegenheit, mit seinem Wissen glänzen zu können, ließ der Weitgereiste natürlich nicht ungenutzt verstreichen. „Der Begriff Republik stammt schon von den heidnischen Römern und ist von den lateinischen Wörtern res publica abgeleitet worden. Ins Deutsche übersetzt bedeuten diese so viel wie: öffentliche Angelegenheit oder Angelegenheit der Allgemeinheit. Das soll heißen, dass an dem Gedeihen des Reiches alle Menschen nicht nur durch die Leistung von Abgaben, Steuern und Diensten beteiligt sind, sondern auch über die Geschicke des Gemeinwesens mitbestimmen.
Dementsprechend regiert in einer Republik, wie der von San Marco, kein erblicher Herrscher als Souverän, sondern ein von der Gemeinschaft, beziehungsweise den bedeutendsten Männern des Landes gewähltes Oberhaupt, dessen Handlungen zumeist auch noch von einem Rat, wie dem Großen Rat der Fünfundvierzig, überwacht werden. Hier in Venedig heißt dieses Oberhaupt, also wenn ihr so wollt, der Bürgermeister, Doge und deswegen wird dieser Palast eben Dogenpalast genannt.“
„Ah“, Anselm schüttelte den Kopf, „kaum zu glauben, dass so etwas gut geht.“
„Von der Sache her ist es nicht anders als in unseren freien Reichsstädten, auch dort regieren ein gewählter Rat und ein gewählter Bürgermeister. Und außerdem, mein verehrter Herr Anselm, müsst Ihr bedenken, dass auch unser deutscher König von der Versammlung der Fürsten gewählt wird und dass diese auf den Reichstagen gemeinsam mit unserem Herrn Kaiser über die Geschicke des Heiligen Römischen Reiches bestimmen.“
Durch eine quirlige Menge, über der sich ein babylonisches Sprachengewirr erhob, schoben sich Gerrit, Anselm und Sebald über die Piazetta, den kleineren, und vom Lagunenbecken aus gesehen, vorderen Teil des Platzes, der ebenso wie der Dom und die gesamte venezianische Republik den Namen des Evangelisten Markus trug. Alles an diesem Platz war prachtvoll, großartig, beeindruckend.
Während Gerrit die beiden nahe am Wasser stehenden Säulen bestaunte, von denen die eine den geflügelten Markuslöwen und die andere eine Statue des heiligen Theodor trug, bewunderte Sebald vor allem die Ebenheit und Glätte der den gesamten Platz bedeckenden Pflasterung. Diese war erst kürzlich verlegt worden und bestand aus gebrannten Backsteinen, deren rötlichgelbe Färbung an welkes Herbstlaub erinnerte. Die Aufmerksamkeit des Ritter von Wildenburg aber galt neben der Schönheit und der Großartigkeit der Gebäude, die den Platz auf seinen nicht an das Wasser grenzenden Seiten umgaben, vor allem den Menschen, die ihn in so reichem Maße bevölkerten.
Zwischen Seeleuten, Handwerkern und Tagelöhnern wandelten die Vertreter der Geistlichkeit Seite an Seite mit Pilgern, welche die Reise zu den Heiligen Stätten in Outremer auf sich nehmen wollten, Ratsboten kamen und gingen und kleine Händler priesen ihre auf Ständen ausgebreiteten Waren an.
Gehüllt in ihre prächtigen Roben schritten die venezianischen Patrizier, die die Stadt und den Handel beherrschten, einher, die Gesichter in hochmütiger Starre eingefroren, die Augen lauernd und kalt. In bunte Livreen gekleidete Leibwächter geleiteten sie auf Schritt und Tritt.
„Pfeffersäcke“, brummte Anselm missmutig, der wie beinahe ein jeder wackere Ritter, den Kaufherrn ihren immer größer werdenden Reichtum nicht gönnte.
Juden mit langen, schön gepflegten Bärten und den spitzen Hüten, die zu tragen sie überall im Abendland gezwungen wurden, hasteten vorüber. Einmal kreuzten schnurrbärtige, braungebrannte Männer in weiten Gewändern und eigenartigen, aus Tuchstreifen gewickelten Kopfbedeckungen den Weg der Deutschen.
„Das sind Muselmänner, Sarazenen“, erklärte Sebald, „und was sie da auf ihren Köpfen haben, das nennt man Turbane. An den Anblick könnt Ihr Euch gleich gewöhnen, denn in Outremer werdet Ihr viele davon zu sehen bekommen.“
Der Franke schüttelte den Kopf. „Aber ich verstehe nicht, wieso diese Ungläubigen, die Feinde der Christenheit, hier frei und unbehindert herumlaufen dürfen?“
„Sie sind entweder Handelsleute oder Gesandte orientalischer Herrscher“, erwiderte Sebald, „aber auf alle Fälle sind sie Gäste des Dogen und niemand darf ihnen ein Haar krümmen.“
„Hm“, machte Anselm, doch bevor er sein Unverständnis über dieses seltsame, unchristliche Gebaren ausdrücken konnte, wurde seine Aufmerksamkeit von einer neuen Unglaublichkeit gefesselt.
Geradewegs auf ihn zu kam ein hoch gewachsener, kraftvoller Mann, der mit einem langen, silberverzierten Stab die ihm im Weg stehende Menge teilte, um einer ihm folgenden Sänfte Platz zu schaffen. Der Mann trug Sandalen, locker um seine Beine schwingende Pluderhosen und eine ärmellose, mit goldenen Knöpfen verzierte Weste aus grünem Samt, doch das wirklich Verwunderliche an ihm war seine Haut. Denn diese war weder weiß, wie die der Deutschen, noch sonnengebräunt, wie die der Italiener oder der Sarazenen, sondern sie war schwarz, so schwarz wie eine mondlose Nacht.
„Das ist ein Mohr aus den Ländern südlich des großen Meeres“, flüsterte Sebald dem Franken ins Ohr, „bei den venezianischen Edelleuten sind diese Schwarzen derzeit als Diener sehr beliebt; sie bezahlen, so hört man, den sarazenischen Sklavenhändlern horrende Summen für sie.“
Der Wildenburger war so konsterniert, dass er sich von dem Mohren widerstandslos beiseiteschieben ließ.
„Bei allen Heiligen“ murmelte er, während die aus edelsten Hölzern gefertigte Sänfte, für die der dunkelhäutige Mann den Weg bahnte, von zwei schwitzenden Dienern an ihm vorbei getragen wurde, „wenn ich das meiner Trixi erzähle!“
Die seidenen Vorhänge des türkisfarbenen, kastenförmigen Tragstuhls waren zugezogen, was der Franke bedauerte, denn nicht zu Unrecht vermutete er eine Angehörige des weiblichen Geschlechts hinter ihnen. Sollten ihm dabei aber unfromme Gedanken in den Sinn gekommen sein, so bekam er sogleich Gelegenheit diese zu unterdrücken, denn nun betraten die Drei den Dom des Heiligen Markus.
Eine geraume Weile ergötzten sie sich an der Pracht der von Gold strotzenden, mit herrlichen Mosaiken ausgestatteten Innenräume, dann sanken sie vor dem Schrein mit den Gebeinen des Heiligen Markus auf die Knie und verrichteten ihre Gebete.
Nachdem sie die von fünf großen Kuppeln überdachte Kirche wieder verlassen hatten, schlenderten sie von der Piazza, dem hinteren Teil des Markusplatzes, über die Straße La Mercerie zum nördlich gelegenen Stadtteil Rialto hinüber, wo sich die großen Handelskontore der venezianischen Kaufherren befanden.
Die von vielen kleinen Läden, Werkstätten und Schenken gesäumte Gasse endete vor dem Canale Grande, der längsten und breitesten Wasserstraße im Inneren Venedigs. Unweit ihres Ausgangs auf einen schmalen Uferweg überspannte eine große, auf dicken Pfählen ruhende Holzbrücke den großen Kanal.
Gerrit, Anselm und Sebald gingen bis zur Mitte der Brücke und schauten hinunter auf das Wasser. Der Kanal unter ihnen war voll von Schiffen. Die meisten dieser Wasserfahrzeuge waren mit vom Festland herüber geholten Lebensmitteln und mit Rohstoffen für die handwerkliche Produktion Venedigs beladen. An den Anlegestellen herrschte, wie Anselm befand, ein Gedränge wie bei einer Wildenburger Kirmes vor einem Stand mit Freibier. Selbst die schlanken, schnittigen Gondeln, von denen es zwischen den Lastkähnen und Barken nur so wimmelte, hatten Mühe, sich ihren Weg zu bahnen.
Als die drei Gefährten nach einer Viertelstunde die Brücke wieder verließen, fiel Gerrit ein gleich neben der Brücke stehendes, großes und schmuckloses Gebäude auf, dessen untere Fenster allesamt vergittert waren.
„Ist dies der Kerker der Stadt?“, erkundigte er sich beim Anblick dieses abweisend wirkenden Hauses.
„Beileibe nicht“, erwiderte Sebald und lächelte. „Das Stadtgefängnis befindet sich gleich rechts neben dem Palast des Dogen, wir sind vorhin daran vorbeigegangen.
Dieses Gebäude hier ist das Fontico de’Allemani, das Handelskontor der deutschen Kaufleute. Für diese, wie für alle anderen ausländischen Handelsmänner, gelten hier ziemlich strenge Regeln. So werden sie von den Barken, mit denen sie sich in die Stadt übersetzen lassen, sofort in dieses Haus gebracht, wo sie während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes wohnen müssen. Verlassen dürfen sie das Fontico nur in Begleitung eines venezianischen Aufpassers, der zugleich auch alle Geschäfte, die sie tätigen, vermittelt und überwacht und der verhindert, dass sie mit anderen nichtvenezianischen Handelsleuten Verbindung aufnehmen. Außerdem dürfen sie ihre eigene, übrig gebliebene Ware nicht wieder mitnehmen und sind gezwungen, ihre gesamten Erlöse an Bargeld für den Kauf von venezianischen Waren aufzuwenden. Tun sie dies nicht, dann wird ihnen ihr Geld ersatzlos entzogen.“
„Da schlag doch das Heilige Donnerwetter drein!“, ereiferte sich Anselm. „Also, ich hätte diese erbärmlichen Schnüffler und Federfuchser schon Mores gelehrt, wenn sie mir ans Bare wollten! Warum lassen sich unsere Leute das gefallen?“
„Weil sie trotzdem noch hervorragende Geschäfte machen“, grinste der Alte, „und weil die stinkreichen Lagunenkrebse hier nun mal am längeren Hebel sitzen.“
Den Vergleich mit dem längeren Hebel verstand der Wildenburger nicht recht, aber die Titulierung der Venezianer als Lagunenkrebse gefiel ihm ausnehmend gut und entlockte ihm ein fröhliches Lachen, in das die anderen mit einfielen.
In aufgeräumter Stimmung nahmen die drei Gefährten ihren Rückweg in Richtung Markusplatz mitten durch das von größeren und kleineren Kanälen zerschnittene Labyrinth der Innenstadt. In den Gassen, durch die sie dabei kamen, herrschte eine erdrückende Enge, die den an Weite und freie Bewegung gewöhnten Rittern zu schaffen machte. Oftmals konnten sie die Breite einer solchen Gasse, in denen ein entsetzlicher Geruch aus Fäulnis, Urin und brackigem Wasser stand, mit ausgestreckten Armen entweder ganz oder doch beinahe ermessen.
Erschöpft von den vielfältigen, neuen und ungewohnten Eindrücken suchten Gerrit und Anselm schließlich ein Refugium in einer Taverne, die am Rande eines lang gestreckten, freien Platzes stand, der sich um eine kleine Kirche herum gebildet hatte. Sie ließen sich frisch gebackenes Fladenbrot und ein stark gewürztes Fischgericht bringen und tranken feurigen Rotwein dazu.
In diesem Teil der Stadt trieb sich ein loses Völkchen herum, das sich aus Gauklern, Scholaren, Hals- und Beutelabschneidern, Bettlern, Schmugglern und betrunkenen Seeleuten mischte. Als es dunkelte, wurden der Platz und die Gassen ringsum zusehends auch noch von leicht bekleideten, barbusigen Frauen bevölkert, die den Gästen der Schenken und den Vorbeigehenden ohne jegliche Scham ihre Liebesdienste anboten.
Im Angesicht der prallen, offenherzigen Weiblichkeit, die hier dargeboten wurde, nahm Anselm Gerrit beiseite.
„Gerrit, mein bester Freund und zukünftiger Schwager, ich möchte dich etwas fragen. Würdest du es als Verrat an meiner unzerstörbaren Liebe zu Beatrix betrachten, wenn ich einem dieser, nicht ganz reizlosen Weibsbilder ein Stündchen meiner Zeit und ein wenig meiner Barschaft opfern würde?“
„Opfern ist gut“, schmunzelte Gerrit, „aber sei beruhigt, das eine, also das, was dich mit Bea verbindet, ist Liebe, das andere hier ist Fleischeslust. Und da weder ich noch meine Schwester annehmen, dass ein Mann von so geringer Heiligkeit wie du es bist, drei lange Jahre überstehen kann, ohne bei einem Weibe zu liegen, so tue, was dir dein sündiges Fleisch abfordert, und tue es ohne Gewissensbisse. Ich werde dich deshalb nicht geringer achten, und von mir soll Bea auch nichts darüber erfahren.“
„Das beruhigt mich“, bekannte der Franke sichtlich erleichtert, und schon kurz darauf wurde Sebald, der den Übersetzer und Vermittler machte, in seinem Auftrag mit einer der Huren handelseinig. Auch Gerrit und Sebald, für den Anselm die Bezahlung der Liebesdienste übernahm, folgten den Frauen, die sie sich auserwählt hatten, in die winzigen Dachkammern, in denen diese ihrem Geschäft nachgingen.
Eine gute Stunde später trafen sie sich wieder auf der Straße und machten sich auf den Rückweg zur „Bella Chiara“. Anselm, der so erlöst und beschwingt wirkte wie der von seinen Qualen befreite Tantalus, erstand schnell noch einen großen Krug Wein, den sie auf dem Rückweg in Eintracht gemeinsam leerten.
Da der kurz vor seiner vollen Rundung stehende Mond die Nacht mit sanftem Licht erhellte, fanden die Männer ihr Schiff ohne große Mühe, stiegen über eine von der Nachtwache herab geworfene Strickleiter an Bord und verschwanden in der ihnen als Unterkunft zugewiesenen Kajüte. So wie sie waren, in vollständiger Bekleidung, warfen sie sich auf ihre, auf den schmalen Wandbänken hergerichteten Schlafstätten.
Kurz darauf erfüllte ein nicht übermäßig melodisches Schnarchen den kleinen, stockfinsteren Raum.
*
Am kommenden Morgen wurden Sebald und die beiden Ritter von lauten Rufen, von dumpfem Poltern und dem Geräusch von schnellen, stampfenden Schritten geweckt. Es dauerte einige Augenblicke bis sie sich zurechtgefunden hatten, denn in der fensterlosen Kajüte herrschte eine tiefe Dunkelheit. Erst als Sebald sich zur Tür getastet und diese geöffnet hatte fiel ein wenig Tageslicht in die Kajüte. Mit leicht verquollenen Augen schauten sich die Drei grinsend an, dann standen sie auf, strichen sich ihre Kleidung und ihre Haare glatt und gingen an Deck.
Der Tag, obwohl noch jung, wurde bereits von gleißendem Sonnenlicht erfüllt. Geblendet kniffen die gerade Erwachten ihre Augenlider zusammen.
„Und ich dachte schon, ihr kommt heute überhaupt nicht mehr aus den Decken“, rief Heinrich, der mit den beiden Benediktinern auf dem Achterkastell stand, vergnügt, „wärt ihr nur ein halbes Stündchen später erwacht, dann hättet ihr die Abfahrt verpasst!“
Die „Chiara“ stand kurz davor abzulegen. Die dicken Taue, die den stolzen Segler an das Land gefesselt hatten, waren bereits gelöst worden. Mit langen Stangen schoben die Matrosen das Schiff Handbreit um Handbreit von der Kaimauer weg, auf der sich wenigstens zwei Dutzend Weiber und Kinder eingefunden hatten, die den Männern auf dem Segler zuwinkten und ihnen alle guten Wünsche mit auf den Weg gaben.
Der Kapitän stand auf dem Achterkastell und gab mit lauter, weittragender Stimme seine Anweisungen. Als er die drei Spätaufsteher bemerkte, ersuchte er sie, zu ihm und den dort bereits versammelten Angehörigen der kaiserlichen Gesandtschaft auf das Kastell zu kommen. Auch die deutschen Knechte, die ein wenig verloren auf dem Mitteldeck herumstanden, wurden von einem der Seeleute, auf das Bugkastell geschickt. Von den beiden erhöhten Plätzen aus konnten die Passagiere alles beobachten, ohne den Matrosen allzu sehr im Wege zu stehen.
Nachdem Anselm, Gerrit und Sebald die Treppe zum Heckkastell hinauf gestiegen waren, stellten sie sich an die zur Kaimauer zeigende Reling.
Mit Gefühlen, die zwischen der Freude auf das sie nun erwartende Abenteuer einer Seefahrt und einer leichten Besorgnis über deren Unwägbarkeiten schwankten, schauten die beiden jungen Ritter auf den sich ständig verbreiternden Streifen schwappenden, schmatzenden Wassers zwischen der Ufermauer und der Bordwand. Langsam und mit sanftem Schaukeln löste sich das Schiff vom Kai und drehte sich mit dem Vordersteven gegen das Lagunenbecken.
Jetzt steckten die Matrosen die Ruder in die Riemenlöcher, die in der zweitobersten Planke der Bordwände ausgespart worden waren. Auf jeder Seite des Mittelschiffes gab es vier dieser kreisrunden Löcher. Je zwei der Matrosen nahmen eine der langen Ruderstangen in ihre schwieligen Hände, stellten sich bereit und begannen nach dem Takt, der ihnen von einem grauhaarigen Bootsmann vorgegeben wurde, mit dem Rudern.
Nachdem sich die „Chiara“ mehrere Schiffslängen vom Ufer entfernt hatte, ließ Kapitän Pisani das Segel setzen. Eine leichte Brise verfing sich in der weißgelben, mit einem großen roten Kreuz geschmückten Leinwand, ließ sie anschwellen und trieb den Segler gemächlich über die glatte, glitzernde Wasserfläche.
Messer Pisani brachte das Schiff auf einen südlichen Kurs und hielt auf den mehrere Meilen langen, von Gebüsch und Bäumen bewachsenen Landstreifen, der Lido geheißen wurde, zu.
Zur selben Zeit wie die „Bella Chiara“ hatten noch zehn oder zwölf weitere Schiffe vom Ufer abgelegt. Nach einer kurzen Fahrt von kaum mehr als einer halben Stunde vereinigte sich die kleine Flottille mit den Galeeren und Frachtseglern, die in großer Zahl aus dem neu angelegten Hafen von Malamocco ausliefen.
Vor der Ausfahrt in das offene Meer aber hieß es für die Besatzung der „Chiara“ zunächst einmal, den Anker zu werfen und sich in Geduld zu üben, denn da die nicht sehr breite, von Kastellen geschützte Fahrrinne immer nur von zwei Schiffen gleichzeitig durchfahren werden konnte, brauchte es eine geraume Zeit, bis die Reihe an den Segler von Signore Pisani kam.
Als das Schiff, von kräftigen Ruderschlägen getrieben, in den Kanal einfuhr, warfen die Mitglieder der kaiserlichen Gesandtschaft noch einmal einen Blick auf die Lagunenstadt, von der sie nur noch die sich über den morgendlichen Dunst erhebenden Türme erkennen konnten.
Vielen von ihnen wurde in diesem Augenblick bewusst, dass das Abenteuer der Orientfahrt für sie erst jetzt, richtig begonnen hatte. Und während mit der Stadt des heiligen Markus die letzte Brücke zum Festland und zu der weit entfernten Heimat entschwand, stellte sich mancher insgeheim die Frage, wann und ob er sie jemals wieder sehen würde.
Auf dem offenen Meer wölbte eine kräftige Brise das Segel der „Chiara“. Die Matrosen holten die Ruder ein und verstauten sie an ihrem Platz am Fuße des Mastes. Einer der Seeleute enterte zum Mastkorb hinauf, die anderen liefen geschäftig über das Deck, um die Anweisungen ihres Kapitäns auszuführen. Der Schiffsführer stand neben dem graubärtigen Steuermann auf dem Achterkastell und prüfte unablässig den Wind und den Kurs seines Schiffes.
In den folgenden zwei Stunden formierten sich die aus der Lagune strömenden Schiffe zu einem langen, wohlgeordneten Konvoi. Für die Kapitäne und die Besatzungen bedeutete es eine harte und anstrengende Arbeit, bis auch der letzte Segler seinen, schon Tage zuvor vom Admiral des Geleitzuges festgelegten Platz eingenommen hatte.
Die schwer beladenen Frachtschiffe fuhren in einer langen Doppelreihe in der Mitte des Geleitzuges, die Galeeren mit ihren funkelnden Rammspornspitzen deckten die leicht verwundbaren Flanken der dickbäuchigen, für den Seekampf wenig geeigneten Segler vor möglichen Angriffen von Piraten und anderem raubgierigem Gelichter. An der Spitze des Konvois fuhr die Galeere des Admirals, die am Tage an einem großen, roten Wimpel und nachts durch eine am Heck aufgehängte Laterne zu erkennen war.
Für die Kapitäne hieß es von nun an, ständig dafür zu sorgen, dass ihre Schiffe ihren Platz im Konvoi und die Abstände zu den anderen Schiffen so genau als möglich einhielten. Das war keine einfache Aufgabe, denn der Wind, die Wellen und die Strömungen spielten ihr eigenes, nicht immer vorhersehbares Spiel und stellten die Schiffsführer und ihre Besatzungen vor so manche Herausforderung. Doch Aldo Pisani und sein Steuermann Matteo Brizzo waren erfahrene Seeleute und die Mannschaft setzte ihre Befehle und Anweisungen folgsam und schnell um. So machte die „Chiara“ eine ruhige, sichere Fahrt.
Die Angehörigen der kaiserlichen Gesandtschaft hatten das bisherige Geschehen aufmerksam verfolgt. Nun, nachdem es an Bord etwas ruhiger zuging, verließen einige der Männer die Kastelle und suchten sich irgendwo an Deck einen Platz. Mancher aber verschwand auch in der Luke, die zu den Schlafstätten führte, und streckte sich, von heftigem Unwohlsein befallen, auf sein Lager aus.
Neben dem ständigen Schaukeln und Schwanken des Schiffes, dem sie ausgesetzt waren, mochte ihnen wohl vor allem der Gedanke schwer auf den Magen schlagen, dass sie ringsum von glucksendem, trügerischem, grundlosem Wasser umgeben waren und dass ihr Leben ganz und gar einer knarrenden und ächzenden und im Vergleich zu der Weite des Meeres winzigen Nussschale anvertraut war.