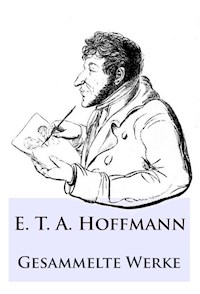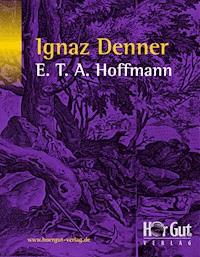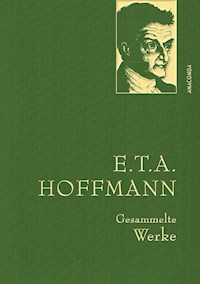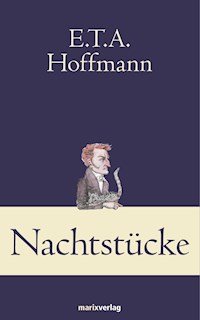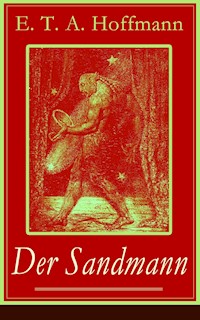3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Nathanael zehn Jahre alt ist, erhält sein Vater Besuch vom Sandmann – einem Mann, der den Kindern Sand in die Augen wirft, sodass sie ihnen blutig aus den Köpfen fallen. Jahre später, als Student, trifft er plötzlich auf eben dieses Monster …
Coverbild: © Ron and Joe / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Sandmann. Erzählung
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + Der Sandmann
Zum Buch
Der Sandmann
E. T. A. Hoffmann
Coverbild: © Ron and Joe / Shutterstock.com
Der Sandmann
Nathanael an Lothar:
Gewiss seid Ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange – lange nicht geschrieben. Mutter zürnt wohl und Clara mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar.
Dem ist aber nicht so; täglich und stündlich gedenke ich Eurer aller und in süßen Träumen geht meines holden Clärchens freundliche Gestalt vorüber und lächelt mich mit ihren hellen Augen so anmutig an, wie sie wohl pflegte, wenn ich zu Euch hineintrat.
Ach, wie vermochte ich denn Euch zu schreiben in der zerrissenen Stimmung des Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte!
Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten! Dunkle Ahnungen eines grässlichen mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl.
Nun soll ich Dir sagen, was mir widerfuhr. Ich muss es, das sehe ich ein, aber nur es denkend, lacht es wie toll aus mir heraus.
Ach, mein herzlieber Lothar, wie fange ich es denn an, Dich nur einigermaßen empfinden zu lassen, dass das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstören konnte!
Wärst Du nur hier, so könntest Du selbst schauen; aber jetzt hältst Du mich gewiss für einen närrischen Geisterseher.
Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu vermeiden ich mich vergebens bemühe, besteht in nichts anderem, als dass vor einigen Tagen, nämlich am 30. Oktober, mittags um 12 Uhr, ein Wetterglashändler in meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nicht und drohte, ihn die Treppe hinabzuwerfen, worauf er aber von selbst fort ging.
Du ahnst, dass nur ganz eigene, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben können, ja dass wohl die Person jenes unglückseligen Krämers gar feindlich auf mich wirken muss.
So ist es in der Tat. Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig Dir aus meiner früheren Jugendzeit so viel zu erzählen, dass Deinem regen Sinn alles klar und deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird.
Indem ich anfangen will, höre ich Dich lachen und Clara sagen: „Das sind ja rechte Kindereien!“
Lacht, ich bitte Euch, lacht mich recht herzlich aus! Ich bitt’ Euch sehr!
Aber Gott im Himmel! Die Haare sträuben sich mir, und es ist, als flehe ich Euch an, mich auszulachen, in wahnsinniger Verzweiflung, wie Franz Moor den Daniel.
Nun fort zur Sache!
Außer dem Mittagessen sahen wir, ich und meine Geschwister, tagsüber den Vater wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch.
Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennendes Papier hinhaltend, wieder anzünden musste, was mir ein Hauptspaß war.
Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, dass wir alle wie im Nebel schwammen.
An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig, und kaum schlug die Uhr neun, so sprach sie:
„Nun Kinder! Zu Bett! Zu Bett! Der Sandmann kommt, ich merk’ es schon.“
Wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas schweren langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern; das musste der Sandmann sein.
Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich; ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte:
„Ei, Mama, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?“
„Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind“, erwiderte die Mutter. ,,Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut.“
Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht, ja in meinem kindlichen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dass die Mutter den Sandmann verleugne, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten, ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen.
Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann?
„Ei, Thanelchen“, erwiderte diese, „weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bette gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Fütterung für seine Kinderchen; die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie die Augen der unartigen Menschenkindlein auf.“
Grässlich malte sich mir nun im Innern das Bild des grausamen Sandmanns aus; sowie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hervor gestotterten Ruf: „Der Sandmann! Der Sandmann!“ konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer, und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns.
Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl nicht ganz seine Richtigkeit haben könnte; indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst, und Grauen – Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte.
Manchmal blieb er lange weg, dann kam er öfter hintereinander. Jahrelang dauerte das, und nicht gewöhnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk, nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Sandmanns.
Sein Umgang mit dem Vater fing an, meine Fantasie immer mehr und mehr zu beschäftigen. Den Vater darum zu befragen, hielt mich eine unüberwindliche Scheu zurück, aber selbst – selbst das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen, dazu keimte mit den Jahren immer mehr die Lust in mir empor.
Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen gebracht, das sich so schon leicht im kindlichen Gemüt einnistet. Nichts war mir lieber, als schauerliche Geschichten von Kobolden, Hexen, Däumlingen und so weiter zu hören oder zu lesen; aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide, Kohle, hinzeichnete.
Als ich zehn Jahre alt geworden, wies mich die Mutter aus der Kinderstube in ein Kämmerchen, das auf dem Korridor unfern von meines Vaters Zimmer lag. Noch immer mussten wir uns, wenn auf den Schlag neun Uhr sich jener Unbekannte im Hause hören ließ, schnell entfernen. In meinem Kämmerchen vernahm ich, wie er bei dem Vater eintrat, und bald darauf war es mir dann, als verbreite sich im Hause ein feiner, seltsam riechender Dampf.
Immer höher mit der Neugierde wuchs der Mut, auf irgendeine Weise des Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich schnell aus dem Kämmerchen auf den Korridor, wenn die Mutter vorübergegangen, aber nichts konnte ich erlauschen, denn immer war der Sandmann schon zur Türe hinein, wenn ich den Platz erreicht hatte, wo er mir sichtbar werden musste.
Endlich, von unwiderstehlichem Drange getrieben, beschloss ich, mich im Zimmer des Vaters selbst zu verbergen und den Sandmann zu erwarten.
An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit merkte ich eines Abends, dass der Sandmann kommen werde; ich schützte daher große Müdigkeit vor, verließ schon vor neun Uhr das Zimmer und verbarg mich dicht neben der Türe in einem Schlupfwinkel. Die Haustüre knarrte, durch den Flur ging es langsamen, schweren, dröhnenden Schrittes nach der Treppe. Die Mutter eilte mit den Geschwistern an mir vorüber.
Leise – leise öffnete ich des Vaters Stubentür. Er saß wie gewöhnlich stumm und starr, den Rücken der Türe zugekehrt, er bemerkte mich nicht, schnell war ich hinein und hinter der Gardine, die vor einen gleich neben der Türe stehenden offenen Schrank, worin meines Vaters Kleider hingen, gezogen war.
Näher – immer näher dröhnten die Tritte – es hustete und scharrte und brummte seltsam draußen. Das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung. Dicht, dicht vor der Türe ein scharfer Tritt – ein heftiger Schlag auf die Klinke, die Tür springt rasselnd auf!