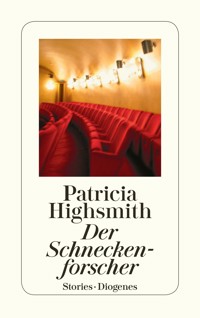
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Der Schneckenforscher‹ versammelt elf Erzählungen der Vereinsamung und seelischen Aberration, des subtilen bis drastischen Schreckens, der uns aus einem harmlos erscheinenden Alltag entgegentritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Patricia Highsmith
Der Schneckenforscher
Stories
Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren
Mit einem Vorwort von Graham Greene und einem Nachwort von Paul Ingendaay
Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta
Diogenes
Der Schneckenforscher
Für Alex Szogyi
Vorwort
Miss Highsmith ist eine Krimiautorin, deren Werke man immer wieder lesen kann. Es gibt nur sehr wenige, von denen sich das sagen läßt. Sie ist eine Schriftstellerin, die sich eine eigene Welt erschaffen hat – eine klaustrophobische, irrationale Welt, die wir jedesmal mit einem Gefühl persönlicher Bedrohung und fast widerstrebend betreten. Immer wieder werfen wir einen Blick über die Schulter, ja wir verspüren ein gewisses Widerstreben, denn wir gehen grausamen Freuden entgegen – bis wir etwa im dritten Kapitel feststellen, daß die Grenze hinter uns geschlossen und der Rückweg abgeschnitten ist und wir dazu verurteilt sind, eine ihrer vielen gehetzten Gestalten bis zum Ende der Geschichte zu begleiten.
Es vergrößert die Spannung, daß wir nie sicher sein können, ob die schlimmsten von ihnen – wie beispielsweise der talentierte Mr. Ripley – ungestraft davonkommen werden, ob ein relativ Unschuldiger wie der Stümper Walter büßen muß oder ein relativ Schuldiger wie Sydney Bartleby in Der Geschichtenerzähler vollkommen unbehelligt bleibt. Highsmiths Welt hat nichts gemein mit der heroischen Welt ihrer Kollegen Hammett und Chandler, sowenig wie ihre Detektive (die manchmal von monströser Grausamkeit sind wie der amerikanische Lieutenant Corby in Der Stümper oder langweilige, sympathische, vernunftgesteuerte Menschen wie der britische Inspector Brockway) etwas gemein haben mit den romantischen, desillusionierten Privatdetektiven, die bekanntlich am Ende über das Böse triumphieren und der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen, auch wenn deswegen ihre Liebste auf dem elektrischen Stuhl landet.
Jenseits dieser Grenze gibt es keine Gewißheit mehr. Die Welt, die wir dort vorfinden, ist nicht die, welche wir zu kennen glaubten, und doch erscheint sie uns auf beängstigende Weise wirklicher als das Haus unseres Nachbarn. Die Menschen handeln unvermittelt und spontan, und die Motive sind zuweilen so unerklärlich, daß wir sie einfach auf Treu und Glauben akzeptieren müssen: Credo quia absurdum. Highsmiths Protagonisten sind irrational und gerade durch ihren Mangel an Vernunft so lebensecht; plötzlich wird uns bewußt, wie unglaublich rational die meisten Personen in anderen Büchern sind: Sie leben ihr Leben so zielstrebig und folgerichtig wie Pendler, die täglich mit demselben Zug fahren. Deren Motive sind nie unerklärlich, weil sie so ermüdend offensichtlich sind und so zweidimensional wie mathematische Symbole. Wir haben sie mit der Zeit als ›wirklich‹ akzeptiert, doch wenn wir von Patricia Highsmiths Seite der Grenze auf sie zurückblicken, wird uns bewußt, daß unsere Welt keineswegs so rational bestimmt ist wie die dieser Personen. Mit einemmal beschleicht uns ein Gefühl der Angst, und wir denken: »Vielleicht gehöre ich eigentlich hierhin«, und auf dem Weg durch vertraute Straßen überläuft es uns plötzlich kalt, wenn wir am American-Express-Büro vorbeikommen, der Anlaufstelle so vieler zwielichtiger Highsmith-Gestalten in ihrem europäischen Exil, die hier ihre Briefe abholen und Travellerschecks einlösen (obgleich der Name auf dem Umschlag wahrscheinlich falsch und die Unterschrift auf dem Scheck gefälscht ist).
Patricia Highsmiths Stories enttäuschen uns nicht, auch wenn wir uns wegen ihrer Kürze manchmal leichter von ihnen lösen können. Wir leben nicht lange genug in ihnen, um ganz von ihnen aufgesogen zu werden. Patricia Highsmith ist nicht eine Dichterin der Angst, sondern der Beklemmung. Wie wir im Blitzkrieg erfahren haben, wirkt Angst narkotisierend: Sie erschöpft die Menschen und lullt sie in Schlaf, wogegen die Beklemmung sanft und stetig an den Nerven zerrt. Wir müssen lernen, damit zu leben. Patricia Highsmiths bester Roman ist meines Erachtens Das Zittern des Fälschers, und wenn man mich fragt, wovon er handelt, würde ich sagen: Beklemmung.
In ihren Kurzgeschichten muß sie natürlich eine andere Methode anwenden. Hier umschleicht sie den Leser nicht, sondern schlägt blitzschnell zu, und es ist bewundernswert, mit welcher Finesse sie uns zur Strecke bringt. Einige dieser Geschichten wurden vor zwanzig Jahren, vor ihrem ersten Roman Zwei Fremde im Zug, geschrieben, und dennoch hat man nicht das Gefühl, daß sie dabei ist, ihr Handwerk mittels tastender Versuche zu erlernen. ›Die Heldin‹ ist vor mehr als fünfundzwanzig Jahren erschienen und nicht weniger beklemmend als ihr jüngster Roman. Schon beim Einstellungsgespräch spüren wir, wie gefährlich (und gestört) das junge Kindermädchen ist, und würden den Eltern am liebsten zurufen: »Schicken Sie sie weg, bevor es zu spät ist!«
Wegen des aufwühlenden, entsetzlichen Endes ist ›Als die Flotte im Hafen lag‹ meine Lieblingsgeschichte in dieser Sammlung. Hier zeigt sich Patricia Highsmith als Meisterin der Beklemmung. ›Die Schildkröte‹, eine der späteren Geschichten, ist eine grausame Momentaufnahme einer Kindheit und Sakis Meisterstück ›Sredni Vashtar‹ durchaus ebenbürtig, und was das rein körperliche Grauen angeht – ein Gefühl, das bei Highsmith nur selten vorkommt –, dürfte ›Der Schneckenforscher‹ nur schwer zu überbieten sein. Mr. Knoppert nimmt seinen Schnecken gegenüber dieselbe Haltung ein wie Patricia Highsmith gegenüber Menschen. Er beobachtet sie mit derselben emotionslosen Neugier wie Highsmith den talentierten Mr. Ripley:
Eines Abends war Mr. Knoppert in die Küche geschlendert, um vor dem Abendessen noch eine Kleinigkeit zu essen, und hatte bemerkt, daß sich zwei der Weinbergschnecken in der Porzellanschüssel, die auf der Spüle stand, sehr eigenartig verhielten. Sie standen einander gegenüber, aufgerichtet und mehr oder weniger auf ihren Schwänzen, sie wiegten sich hin und her und sahen aus wie Schlangen, die von einem Flötenspieler hypnotisiert wurden. Im nächsten Augenblick legten sie ihre Gesichter zu einem Kuß von wollüstiger Intensität aneinander. Mr. Knoppert beugte sich hinunter und betrachtete sie von allen Seiten. Noch etwas geschah: An der rechten Seite der Köpfe erschienen Auswüchse, die wie Ohren wirkten. Sein Instinkt sagte ihm, daß es sich hier um eine Art sexueller Aktivität handelte.
G.G.
Der Schneckenforscher
Als Peter Knoppert begann, die Beobachtung von Schnecken zu seinem Hobby zu machen, ahnte er nicht, daß aus seiner ersten Handvoll von Exemplaren in kürzester Zeit Hunderte werden würden. Nur zwei Monate nachdem die ersten Schnecken in Knopperts Arbeitszimmer gebracht worden waren, standen etwa dreißig von Schnecken wimmelnde Glasgefäße entlang der Wände, auf dem Schreibtisch und den Fensterbänken, ja sie nahmen sogar einen Teil des Bodens ein. Mrs. Knoppert mißbilligte das sehr und weigerte sich, den Raum zu betreten. Sie sagte, es stinke dort, und außerdem war sie einmal auf eine Schnecke getreten – ein gräßliches Gefühl, das sie nie vergessen würde. Doch je mehr seine Frau und seine Freunde diesen ungewöhnlichen und irgendwie unappetitlichen Zeitvertreib kritisierten, desto mehr Vergnügen schien Mr. Knoppert daran zu finden.
»Ich hab mich mein Leben lang nicht für die Natur interessiert«, bemerkte er oft – er war Teilhaber in einer Brokerfirma und hatte sich immer nur den Vorgängen in der Finanzwelt gewidmet –, »aber diese Schnecken haben mir die Augen für die Schönheit der Tierwelt geöffnet.«
Wenn seine Freunde dann sagten, Schnecken seien eigentlich gar keine Tiere und ihre schleimige Lebensweise sei wohl kaum ein geeignetes Beispiel für die Schönheit der Natur, erwiderte Mr. Knoppert mit überlegenem Lächeln, sie wüßten eben nicht, was er über Schnecken wisse.
Und das stimmte. Mr. Knoppert war Zeuge eines Vorgangs geworden, der in keiner Enzyklopädie, in keinem ihm bekannten zoologischen Werk beschrieben worden war, jedenfalls nicht annähernd adäquat. Eines Abends war Mr. Knoppert in die Küche geschlendert, um vor dem Abendessen noch eine Kleinigkeit zu essen, und hatte bemerkt, daß sich zwei der Weinbergschnecken in der Porzellanschüssel, die auf der Spüle stand, sehr eigenartig verhielten. Sie standen einander gegenüber, aufgerichtet und mehr oder weniger auf ihren Schwänzen, sie wiegten sich hin und her und sahen aus wie Schlangen, die von einem Flötenspieler hypnotisiert wurden. Im nächsten Augenblick legten sie ihre Gesichter zu einem Kuß von wollüstiger Intensität aneinander. Mr. Knoppert beugte sich hinunter und betrachtete sie von allen Seiten. Noch etwas geschah: An der rechten Seite der Köpfe erschienen Auswüchse, die wie Ohren wirkten. Sein Instinkt sagte ihm, daß es sich hier um eine Art sexueller Aktivität handelte.
Die Köchin kam herein und sagte irgend etwas zu ihm, doch Mr. Knoppert gebot ihr mit einer ungeduldigen Handbewegung zu schweigen. Er konnte den Blick nicht von den faszinierenden kleinen Wesen in der Schüssel abwenden.
Als die Ränder der ohrenartigen Auswüchse sich berührten, reckte sich ein weißlicher Stengel, der wie ein zusätzlicher Fühler aussah, vom Ohr der einen Schnecke im Bogen zu dem der anderen. Mr. Knopperts erste Vermutung wurde widerlegt, als auch aus dem Ohr der zweiten Schnecke ein solcher Fühler wuchs. Sehr eigenartig, dachte er. Die beiden Fühler wurden zurückgezogen und wieder ausgefahren und saugten sich schließlich an der jeweils anderen Schnecke fest, als hätten sie ein unsichtbares Ziel gefunden. Mr. Knoppert betrachtete das Schauspiel aufmerksam. Die Köchin tat dasselbe.
»Haben Sie so was schon mal gesehen?« fragte Mr. Knoppert.
»Nein. Wahrscheinlich kämpfen sie miteinander«, sagte die Köchin gleichgültig und wandte sich ab. Das war ein Beispiel für jene Ignoranz in Hinblick auf Schnecken, der er später überall begegnen würde.
Über eine Stunde lang beobachtete Mr. Knoppert immer wieder die beiden Schnecken, bis sie zuerst die Ohren und dann die Fühler zurückzogen, sich schließlich entspannten und einander nicht mehr beachteten. Inzwischen zeigten jedoch zwei andere Tiere Interesse füreinander und richteten sich langsam in die Kußposition auf. Mr. Knoppert sagte der Köchin, er wünsche keine Schnecken zum Essen, und brachte die Schüssel hinauf in sein Arbeitszimmer. Im Haus der Knopperts wurden nie wieder Schnecken serviert.
Später am Abend schlug er in Enzyklopädien und ein paar allgemeinen Büchern über Biologie nach, die er besaß, fand jedoch absolut nichts über das Paarungsverhalten von Schnecken, wogegen der langweilige Fortpflanzungszyklus der Austern in allen Einzelheiten beschrieben war. Nach ein, zwei Tagen kam Mr. Knoppert zu dem Schluß, daß das, was er gesehen hatte, möglicherweise gar keine Paarung gewesen war. Edna, seine Frau, sagte ihm, er solle die Schnecken entweder essen oder loswerden – das war, nachdem sie auf eine Schnecke getreten war, die aus der Schüssel heraus- und auf dem Boden herumgekrochen war –, und Mr. Knoppert hätte das vielleicht auch getan, wenn er nicht in einem Abschnitt über Gastropoden in Darwins Ursprung der Arten auf einen bestimmten Satz gestoßen wäre. Der Satz war auf französisch, eine Sprache, die Mr. Knoppert nicht beherrschte, doch bei dem Wort sensualité durchfuhr es ihn wie einen Bluthund, der plötzlich Witterung aufgenommen hat. Er befand sich gerade in der öffentlichen Bibliothek und machte sich sogleich daran, den Abschnitt mit Hilfe eines französisch-englischen Wörterbuches mühsam zu übersetzen. Er umfaßte weniger als hundert Wörter und sagte aus, daß die Paarung von Schnecken mit einer Sinnlichkeit vonstatten gehe, wie sie anderswo im Tierreich nicht zu finden sei. Das war alles. Die Bemerkung stammte aus dem Notizbuch von Henri Fabre. Offenbar hatte Darwin beschlossen, ihn für den Durchschnittsleser nicht zu übersetzen, sondern für die wenigen gelehrten Geister, die sich für dieses Thema wirklich interessierten, in der Originalsprache zu belassen. Mr. Knoppert rechnete sich mittlerweile zu diesen wenigen gelehrten Geistern, und sein rundes, rosiges Gesicht strahlte vor Stolz.
Er hatte herausgefunden, daß seine Schnecken Süßwasser bevorzugten und ihre Eier in Sand oder Erde ablegten, und so stellte er Schalen mit Wasser und feuchter Erde in eine große Waschschüssel und setzte die Tiere hinein. Dann wartete er darauf, daß etwas geschehen würde. Es kam aber zu keiner weiteren Paarung. Er hob die Schnecken eine nach der anderen auf und untersuchte sie, ohne irgendwelche Anzeichen einer Trächtigkeit erkennen zu können. Eine der Schnecken konnte er jedoch nicht hochheben – es war, als wäre das Gehäuse an der Erde festgeklebt. Mr. Knoppert nahm an, daß das Tier den Kopf in der Erde vergraben hatte, um zu sterben. Es vergingen zwei Tage, und am Morgen des dritten fand Mr. Knoppert an der Stelle, wo die Schnecke gewesen war, ein Häufchen lockerer Erde. Neugierig stocherte er mit einem Streichholz darin und entdeckte zu seiner großen Freude eine flache Grube voller schimmernder, frisch gelegter Eier. Schneckeneier! Er hatte sich also nicht geirrt. Mr. Knoppert rief seine Frau und die Köchin, um ihnen die Eier zu zeigen, die stark an große Kaviarkörner erinnerten, nur daß sie nicht schwarz oder rot, sondern weiß waren.
»Tja, irgendwie müssen sie sich ja fortpflanzen« war alles, was seine Frau dazu zu sagen hatte. Mr. Knoppert konnte ihr mangelndes Interesse nicht begreifen. Wenn er zu Hause war, mußte er die Eier immer wieder betrachten. Er untersuchte sie jeden Morgen, um zu sehen, ob es irgendeine Veränderung gab, und abends, bevor er zu Bett ging, galt sein letzter Gedanke ihnen. Außerdem war eine zweite Schnecke dabei, eine Grube zu graben. Und zwei weitere Schnecken paarten sich! Das erste Gelege verfärbte sich gräulich, und an der Seite eines jeden Eis war die winzige Spirale eines Schneckenhauses zu erkennen. Mr. Knopperts freudige Erwartung wuchs. Endlich kam ein Morgen – nach Mr. Knopperts sorgfältiger Berechnung war es der achtzehnte nach der Eiablage –, an dem er in die Grube sah und den ersten winzigen Kopf erblickte, die ersten stumpfen kleinen Fühler, die unsicher das Nest erkundeten. Mr. Knoppert war so glücklich wie der Vater eines neugeborenen Kindes. Jedes der mehr als siebzig Eier in dem Nest erwachte wie durch ein Wunder zum Leben. Er war Zeuge, wie der ganze Fortpflanzungszyklus zu einem erfolgreichen Abschluß kam. Und die Tatsache, daß niemand – zumindest niemand, den er kannte – auch nur einen Bruchteil von dem wußte, was er gesehen hatte, verlieh seinem Wissen den besonderen Reiz einer Entdeckung, die Faszination des Exotischen. Mr. Knoppert machte sich Notizen über die weiteren Paarungen und Eiablagen. Seinen interessierten, häufiger jedoch schockierten Freunden und Gästen schilderte er die Biologie der Schnecken, bis seine Frau sich vor Peinlichkeit wand.
»Aber wo soll das alles enden, Peter? Wenn sie sich weiter in diesem Tempo vermehren, übernehmen sie bald das ganze Haus!« sagte sie, nachdem fünfzehn bis zwanzig Gelege geschlüpft waren.
»Die Natur kennt kein Ende«, antwortete er gut gelaunt. »Und sie haben nur das Arbeitszimmer übernommen. Da oben ist jede Menge Platz.«
Es wurden also immer mehr Glasbehälter angeschafft. Mr. Knoppert ging auf den Markt und suchte einige der lebhafter wirkenden Exemplare aus, außerdem zwei Schnecken, die sich, unbemerkt vom Rest der Welt, gerade paarten. Im Erdboden der Glasbehälter erschienen immer mehr Gruben mit Gelegen, und aus jeder davon kamen schließlich zwischen siebzig und neunzig winzige Schnecken zum Vorschein, so durchsichtig wie Tautropfen, die an den Streifen aus frischen Salatblättern, welche Mr. Knoppert eilends als eßbare Leitern in die Vertiefungen legte, nicht herabrannen, sondern hinaufkrochen. Paarungen waren inzwischen so häufig, daß er gar nicht mehr darauf achtete – immerhin konnte dieser Vorgang vierundzwanzig Stunden dauern. Doch die Verwandlung des weißen Kaviars in Schneckenhäuser, die sich schließlich bewegten, faszinierte ihn jedesmal aufs neue, ganz gleich, wie oft er sie sah.
Seine Kollegen in der Brokerfirma stellten fest, daß Peter Knoppert von einer neuen Lebenslust beseelt war. Er war wagemutiger als früher, seine Kalkulationen waren brillanter, seine Pläne fast schon gerissen, aber er brachte der Firma Geld ein. Es wurde einstimmig beschlossen, sein Grundgehalt von vierzigtausend auf sechzigtausend Dollar im Jahr zu erhöhen. Als man ihm gratulierte, führte Mr. Knopper seinen Erfolg auf die Schnecken und die wohltuende Entspannung zurück, die er empfand, wenn er sie beobachtete.
Die Abende verbrachte er ausnahmslos bei seinen Schnecken in dem Raum, der nun kein Arbeitszimmer, sondern eher eine Art Aquarium war. Es erfüllte ihn mit Freude, frische Salatblätter und zerkleinerte gekochte Kartoffeln und rote Bete in die Behälter zu geben und anschließend das Beregnungssystem einzuschalten, das er installiert hatte, um natürlichen Niederschlag zu simulieren. Dann kam Leben in die Schnecken, und sie begannen zu fressen, sich zu paaren und mit offensichtlichem Vergnügen durch die Pfützen zu gleiten. Oft ließ Mr. Knoppert eine Schnecke auf seinen Zeigefinger kriechen – er hatte den Eindruck, daß seine Tiere an diesem Kontakt zu einem Menschen Gefallen fanden –, fütterte sie mit einem Stückchen Salatblatt und betrachtete sie von allen Seiten. Dies bereitete ihm einen ästhetischen Genuß, wie ihn ein anderer beim Anblick eines japanischen Farbholzschnittes empfinden mochte.
Inzwischen hatte Mr. Knoppert allen anderen das Betreten seines Arbeitszimmers untersagt. Zu viele Schnecken hatten die Angewohnheit, auf dem Boden herumzukriechen und auf der Unterseite von Stuhlsitzen oder auf den Rücken der Bücher im Regal zu schlafen. Schnecken, besonders die älteren Exemplare, verbrachten einen großen Teil des Tages mit Schlafen. Es gab jedoch genügend Tiere, die weniger faul waren und sich gern dem Liebesspiel hingaben. Mr. Knoppert schätzte, daß stets etwa ein Dutzend Paare dabei waren, einander zu küssen. Auf jeden Fall gab es eine Unmenge kleiner Schnecken. Es war unmöglich, sie zu zählen. Mr. Knoppert zählte jedoch die Schnecken, die über die Zimmerdecke krochen oder dort schliefen, und kam auf eine Zahl, die zwischen elf- und zwölfhundert lag. In den Glasgefäßen, an der Unterseite des Schreibtisches und in den Bücherregalen waren vermutlich fünzigmal so viele. Mr. Knoppert nahm sich vor, demnächst die Schnecken von der Decke zu entfernen. Einige von ihnen waren schon seit Wochen dort oben, und er fürchtete, sie könnten verhungern. In letzter Zeit war er jedoch ein bißchen zu sehr beschäftigt gewesen, und sein Bedürfnis nach der Ruhe, die er empfand, wenn er einfach nur im Arbeitszimmer in seinem Lieblingssessel saß, war zu groß.
Im Juni gab es so viel zu tun, daß er oft bis zum späten Abend im Büro arbeiten mußte. Das Steuerjahr ging zu Ende, und auf seinem Schreibtisch türmten sich die verschiedensten Bilanzen. Er stellte Berechnungen an, entdeckte ein halbes Dutzend Möglichkeiten, höhere Gewinne zu erzielen, und reservierte die wagemutigsten, am wenigsten augenfälligen Transaktionen für seine eigenen Spekulationen. Er war zuversichtlich, daß sein Vermögen innerhalb eines Jahres auf das Drei- bis Vierfache wachsen würde. Das Geld würde sich so schnell und mühelos vermehren wie die Schnecken. Als er dies seiner Frau erzählte, war sie überglücklich. Sie verzieh ihm sogar, daß er das Arbeitszimmer ruiniert hatte und sich in der ganzen oberen Etage ein muffiger, fischiger Geruch ausbreitete.
»Trotzdem wäre es mir lieber, wenn du dort mal nach dem Rechten sehen würdest, Peter«, sagte sie eines Morgens recht besorgt. »Vielleicht ist einer der Behälter umgefallen, und ich möchte nicht, daß der Teppich Schaden nimmt. Du bist jetzt schon beinahe eine Woche nicht mehr im Arbeitszimmer gewesen, oder?«
Mr. Knoppert war seit beinahe zwei Wochen nicht mehr dort gewesen. Er verschwieg seiner Frau, daß von dem Teppich nicht mehr viel übrig war. »Ich werde heute abend mal nachsehen«, sagte er.
Es dauerte jedoch noch drei Tage, bis er die Zeit dazu fand. Eines Abends trat er, bevor er zu Bett ging, in das Zimmer und stellte zu seiner Überraschung fest, daß der Boden ganz und gar mit Schnecken bedeckt war, die in drei bis vier Schichten übereinanderlagen. Er hatte Schwierigkeiten, die Tür zu schließen, ohne welche zu zerquetschen. In den Ecken waren die Tiere zu Haufen übereinandergetürmt, so daß das Zimmer rund wirkte – es war, als stünde er in einem riesigen, aus unzähligen Kieseln zusammengefügten Stein. Mr. Knoppert ließ seine Fingerknöchel knacken und sah sich verwundert um. Die Schnecken saßen nicht nur auf allen Oberflächen – auch auf dem Kronleuchter hatten sich Tausende von ihnen zu einem grotesken Klumpen zusammengeballt, der in den Raum hing. Nach Halt suchend, streckte Mr. Knoppert den Arm nach der Sessellehne aus. Seine Hand berührte nur zahlreiche Schneckenhäuser. Unwillkürlich lächelte er: Auf dem Sitz krochen Schnecken übereinander – sie sahen aus wie ein klumpiges Kissen. Wegen der Zimmerdecke mußte er etwas unternehmen, und zwar sofort. Er nahm den Schirm, der in der Ecke lehnte, streifte einige der Schnecken darauf ab und räumte einen Teil des Schreibtisches frei, so daß er darauf stehen konnte. Die Schirmspitze kratzte über die Decke, und im nächsten Augenblick löste sich unter dem Gewicht der Schnecken eine Tapetenbahn und hing beinahe bis zum Boden herab. Mr. Knoppert war mit einemmal wütend. Die Beregnungsanlage würde sie in Bewegung bringen. Er legte den Hebel um.
In allen Behältern begann das Wasser zu rieseln, und sogleich beschleunigte sich das langsame Kriechen im Raum. Mr. Knoppert schob die Füße über den Boden, und die Schnecken, die er dabei beiseite fegte, klangen wie Kieselsteine in der Brandung. Er richtete einige Düsen der Beregnungsanlage auf die Zimmerdecke. Das war ein Fehler, wie er sogleich merkte, denn das aufgeweichte Papier riß. Er konnte einer langsam fallenden Masse von Schnecken gerade noch ausweichen, nur um von einer anderen schwingenden Girlande mit einem überraschend harten Schlag seitlich am Kopf getroffen zu werden. Benommen sank er in die Knie. Er sollte wohl ein Fenster öffnen, dachte er, denn es war sehr stickig im Raum. Schnecken krochen über seine Schuhe und die Hosenbeine hinauf. Ärgerlich schüttelte er die Beine. Gerade wollte er zur Tür gehen und eine der Hausangestellten rufen, damit sie ihm half, als der Kronleuchter auf ihn fiel. Mr. Knoppert sank schwer zu Boden. Er bemerkte jetzt, daß er keines der Fenster würde öffnen können, denn eine Unmenge von Schnecken hatte sich an den Fensterbrettern festgesaugt. Einen Augenblick lang hatte er das Gefühl, als könnte er sich nicht erheben, als würde er ersticken. Das lag nicht nur an dem modrigen Geruch, sondern auch daran, daß lange Tapetenstreifen voller Schnecken ihm die Sicht nahmen, so daß er sich vorkam wie in einem Gefängnis.
»Edna!« rief er und war verblüfft, wie gedämpft seine Stimme klang. Er hätte ebensogut in einem schalldichten Raum sein können.
Er kroch zur Tür und achtete nicht auf die zahllosen Schnecken, die er mit Händen und Knien zerquetschte. Es gelang ihm nicht, sie zu öffnen. Auf dem Spalt zwischen Tür und Rahmen saßen so viele Schnecken, daß ihre Saugkraft größer war als die Kraft seiner Arme.
»Edna!« Eine Schnecke kroch in seinen Mund. Voller Ekel spuckte er sie aus. Er versuchte, die Schnecken auf seinen Armen abzustreifen, doch wenn er hundert entfernt hatte, schienen vierhundert andere an ihm hochzukriechen und sich an ihm festzusaugen, als arbeiteten sie sich bewußt zu der einzigen vergleichsweise schneckenfreien Oberfläche im Raum vor. Schnecken krochen über seine Augen. Gerade als er sich taumelnd erhob, traf ihn erneut etwas – er konnte nicht einmal sehen, was es war. Er fiel in Ohnmacht! Jedenfalls lag er auf dem Boden. Seine Arme fühlten sich bleischwer an, als er versuchte, Nasenlöcher und Augen von den alles versiegelnden, mörderischen Schnecken zu befreien.
»Hilfe!« Er verschluckte eine Schnecke. Keuchend riß er den Mund auf und spürte, daß eine Schnecke über die Lippen auf seine Zunge kroch. Er war in der Hölle! Er fühlte, wie sie gleich einem klebrigen Fluß über seine Beine glitten und diese an den Boden hefteten. »Aah!« Mr. Knoppert schnappte kraftlos nach Luft. Ihm wurde schwarz vor Augen – es war ein schreckliches, wogendes Schwarz. Er bekam keine Luft mehr und konnte seine Nase nicht befreien, seine Hände nicht bewegen. Durch den Schlitz seines einen Auges sah er direkt vor sich, nur Zentimeter entfernt, die Überreste des Gummibaums, der in einem Topf neben der Tür stand. Auf der Erde paarten sich lautlos zwei Schnecken. Und gleich neben ihnen krochen, so durchsichtig wie Tautropfen, winzige Schnecken aus einer Grube – eine Armee von unzähligen Soldaten, die hinaustraten in ihre große, weite Welt.
Vor dem Flug
Jeden Morgen sah Don in seinem Briefkasten nach, aber nie war ein Brief von ihr da.
Sie hatte keine Zeit gehabt, sagte er sich dann. Er ging in Gedanken all die Dinge durch, die sie zu tun hatte: Sie mußte ihre Sachen von Rom nach Paris bringen lassen, eine Wohnung einrichten, die sie vermutlich schon vor dem Umzug gefunden hatte, und wahrscheinlich erst einmal ein paar Tage in ihrem neuen Job arbeiten, bevor sie Zeit und Inspiration fand, auf seinen Brief zu antworten. Doch schließlich war selbst die großzügigste Zeitspanne, die sich für diese Hindernisse veranschlagen ließ, überschritten. Und dann vergingen drei weitere Tage, und noch immer kam kein Brief von ihr.
Sie will in Ruhe darüber nachdenken, dachte er. Natürlich will sie sich über ihre Gefühle im klaren sein, bevor sie irgend etwas zu Papier bringt.
Er hatte Rosalind vor dreizehn Tagen geschrieben, daß er sie liebe und sie heiraten wolle. Angesichts dessen, daß er noch nicht lange um sie warb, war das vielleicht ein wenig übereilt, aber Don fand, daß er einen guten Brief geschrieben und keinerlei Druck ausgeübt, sondern nur seine Gefühle dargelegt hatte. Immerhin kannte er Rosalind schon seit zwei Jahren, oder vielmehr: Er hatte sie vor zwei Jahren in New York kennengelernt. Dann hatte er sie letzten Monat in Europa wiedergesehen, und nun liebte er sie und wollte sie heiraten.
Seit seiner Rückkehr aus Europa vor drei Wochen hatte er nur ein, zwei Freunde gesehen. Pläne für das gemeinsame Leben mit Rosalind zu machen war ihm Beschäftigung genug. Rosalind war Industriedesignerin und liebte Europa. Wenn sie dort bleiben wollte, konnte Don es arrangieren, ebenfalls in Europa zu leben. Sein Französisch war inzwischen recht gut. Dirksen & Hall, die Firma, für die er als technischer Berater arbeitete, hatte sogar eine Filiale in Paris. Es könnte alles ganz einfach sein. Er brauchte nur ein Visum, das es ihm erlaubte, ein paar Sachen – Bücher, Teppiche, den Plattenspieler, einige Werkzeuge und Zeichengeräte – mitzunehmen, und schon konnte er übersiedeln. Don hatte das Gefühl, sein Glück noch gar nicht ganz ermessen zu können. Jeder Tag war, als würde ein Vorhang, hinter dem sich eine herrliche Landschaft entfaltete, ein Stück weiter gehoben. Er wollte, daß Rosalind bei ihm war, wenn er endlich das ganze Panorama sehen konnte. Es gab eigentlich nur eines, was ihn davon abhielt, beglückt und selig hinauszulaufen in diese schöne Landschaft: Er hatte noch immer keinen Brief von ihr, den er hätte mitnehmen können. Er schickte noch einen Brief nach Rom und schrieb auf italienisch »Bitte nachsenden« auf den Umschlag. Wahrscheinlich war sie inzwischen in Paris, doch zweifellos hatte sie in Rom einen Nachsendeantrag gestellt.
Es vergingen zwei weitere Tage, und noch immer kein Brief. Er bekam einen Brief von seiner Mutter, die in Kalifornien lebte, eine Reklame von einem Schnapsladen und eine Wahlwerbung. Er lächelte in sich hinein, klappte den Briefkasten zu, schloß ihn ab und ging zur Arbeit. Der Moment, in dem er feststellte, daß kein Brief gekommen war, machte ihn nie traurig. Es war eher ein lustvolles Erschrecken, als wolle sie ihn foppen und halte deshalb den Brief noch einen Tag länger zurück. Dann senkte sich die Erkenntnis, daß er neun Stunden warten mußte, bis er nach Hause gehen und nachsehen konnte, ob vielleicht ein Eilbrief eingetroffen war, wie eine schwere Last auf ihn, und ganz unvermittelt fühlte er sich erschöpft, unglücklich und lustlos. Rosalind würde ihm keinen Eilbrief schicken, nicht nach so langer Zeit. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als auf den nächsten Morgen zu warten.
Am nächsten Morgen sah er einen Brief im Briefkasten. Es war nur die Einladung zu einer Vernissage. Er riß sie in kleine Fetzen und knüllte sie zusammen.
Im Briefkasten daneben steckten drei Briefe. Die waren doch schon seit gestern morgen dort. Was für ein Bursche war dieser Dusenberry, daß er es nicht für nötig befand, seinen Briefkasten zu leeren?
An diesem Vormittag kam ihm im Büro die Erleuchtung, die sofort seine Lebensgeister weckte: Vielleicht war ihr Brief versehentlich im benachbarten Kasten gelandet. Der Postbote öffnete die ganze Reihe der Kästen gleichzeitig, und hin und wieder hatte Don einen Brief in seinem Briefkasten gefunden, der nicht für ihn bestimmt gewesen war. Er wurde wieder optimistisch: In ihrem Brief würde stehen, daß sie ihn auch liebte. Wie sollte es anders sein, da sie in Juan-les-Pins doch so glücklich gewesen waren? Er würde »Ich liebe Dich, ich liebe Dich« zurücktelegrafieren. Nein, er würde sie anrufen, denn auf ihrem Brief würde ihre Pariser Adresse stehen, vielleicht sogar ihre Büroanschrift, so daß er wüßte, wo er sie erreichen könnte.
Als er Rosalind vor zwei Jahren in New York kennengelernt hatte, waren sie zwei- oder dreimal essen und ins Theater gegangen. Seine nächsten Einladungen hatte sie abgelehnt, und Don hatte daraus geschlossen, daß es jemand anders auf der Bildfläche gab, den sie lieber mochte. Damals hatte ihm das nicht sehr viel ausgemacht. Doch als sie ihm in Juan-les-Pins über den Weg gelaufen war, hatte die Sache anders ausgesehen. Es war Liebe auf den zweiten Blick gewesen. Der Beweis dafür war, daß Rosalind sich von den drei anderen, mit denen sie gekommen war – einem Mädchen und zwei Männern –, abgesetzt hatte, sie allein nach Cannes hatte fahren lassen und mit ihm in Juan-les-Pins geblieben war. Es waren fünf paradiesische Tage gewesen, und Don hatte gesagt: »Ich liebe dich«, und Rosalind hatte es auch einmal gesagt. Aber Zukunftspläne hatten sie nicht geschmiedet, nicht einmal darüber gesprochen, wann sie einander wiedersehen würden. Warum war er nur so dumm gewesen! Er wünschte sich auch, er hätte sie gefragt, ob sie mit ihm schlafen wolle. Doch andererseits waren seine Gefühle für sie so viel tiefer gewesen. Jeder konnte im Urlaub eine Affäre haben. Aber jemanden zu lieben und heiraten zu wollen – das war doch etwas ganz anderes. Aus ihrem Verhalten hatte er geschlossen, daß es ihr ebenso ging. Rosalind war kühl und brünett, sie lächelte viel. Sie war nicht groß, wirkte aber so. Sie war intelligent, und Don hatte das Gefühl, daß sie nie etwas Dummes oder Unüberlegtes tun würde. Und er war ebenfalls kein Mensch, der aus einem Impuls heraus einen Heiratsantrag machte. Das Heiraten war etwas, worüber man eine Zeitlang nachdachte – Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr lang. Er hatte das Gefühl, daß er über seinen Heiratsantrag länger nachgedacht hatte als die fünf Tage in Juan-les-Pins. Er glaubte, daß Rosalind Farnes ein Mädchen oder vielmehr eine Frau war (sie war sechsundzwanzig, er neunundzwanzig), die über Substanz verfügte, er glaubte, daß ihre Arbeit viel mit seiner gemeinsam hatte und daß sich ihnen die Chance bot, glücklich zu sein.
Am Abend waren die drei Briefe noch immer in Dusenberrys Briefkasten, und Don suchte seine Klingel auf der Liste gegenüber an der Wand und drückte sie entschlossen. Vielleicht war er da und hatte bloß vergessen, nach seiner Post zu sehen.
Keine Reaktion.
Dusenberry – oder Familie Dusenberry – war offenbar verreist.
Würde der Hausmeister ihm den Briefkasten öffnen? Ganz gewiß nicht. Außerdem hatte der Hausmeister auch gar nicht den oder die Schlüssel für die Briefkästen.
Einer der Briefe sah aus wie ein Luftpostbrief aus Europa. Es war zum Verrücktwerden. Don steckte einen Finger durch einen der Schlitze der glatten Metalltür und versuchte, den Kasten zu öffnen, doch er blieb verschlossen. Er zwängte seinen eigenen Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte ihn herum. Das Schloß klickte, der Riegel bewegte sich, und das Türchen ließ sich um zwei Zentimeter öffnen. Don hielt seinen Wohnungsschlüssel in der Hand, und jetzt steckte er diesen zwischen die Briefkastentür und den Messingrahmen und benutzte ihn als Hebel. Es gelang ihm, das Metall so weit zu verbiegen, daß er die Briefe erreichen konnte. Er zog sie heraus und bog die Messingtür wieder zurück, so gut es ging. Keiner der Briefe war an ihn. Zitternd wie ein Dieb starrte er sie an. Dann stopfte er einen in die Manteltasche, steckte die anderen wieder in den verbogenen Briefkasten und trat aus der Eingangshalle in das Gebäude. Die Aufzüge befanden sich um die Ecke. Don nahm eine leere wartende Kabine und fuhr allein hinauf in die dritte Etage.
Sein Herz klopfte, als er seine Wohnungstür hinter sich schloß. Warum hatte er bloß den Brief genommen? Selbstverständlich würde er ihn zurücklegen. Anfangs hatte er gedacht, es sei ein persönlicher Brief, doch er kam aus Amerika. Er betrachtete die Anschrift in zarter blauer Handschrift: R.L. Dusenberry usw. Dann den Absender auf der Rückseite des Umschlags: Edith W. Whitcomb, 717 Garfield Drive, Scranton, Pa. Dusenberrys Liebste, dachte er sofort. Ein dicker Brief in einem quadratischen Umschlag. Er sollte ihn sofort zurückbringen. Und der beschädigte Briefkasten? Nun, es war immerhin nichts gestohlen worden. Es war ein ernstes Vergehen, einen Briefkasten aufzubrechen, doch die Tür ließ sich ja wieder zurechtbiegen. Und solange nichts gestohlen worden war, konnte es ja wohl nicht so schlimm sein.
Don holte einen Anzug aus dem Schrank, den er sowieso in die Reinigung bringen wollte, und griff nach Dusenberrys Brief. Mit einemmal war er neugierig auf den Inhalt. Bevor er sich dafür schämen konnte, ging er in die Küche und setzte den Wasserkessel auf. Die Umschlaglasche rollte sich im Dampf sauber zurück. Don war geduldig. Es war ein handschriftlicher Brief, drei beidseitig beschriebene Seiten lang.
Liebster, begann er,
Du fehlst mir so sehr, daß ich Dir schreiben muß. Bist Du Dir jetzt über Deine Gefühle im klaren? Du hast gesagt, für beide von uns würde sich alles in Luft auflösen. Weißt Du, wie mir zumute ist? Genauso wie in der Nacht, als wir auf der Brücke standen und sahen, wie in Bennington die Lichter angingen …
Gebannt und ungläubig las er weiter. Das Mädchen war bis über beide Ohren in Dusenberry verliebt. Sie wartete nur auf eine Antwort, nur auf ein Zeichen von ihm. Sie schrieb von der Kleinstadt in Vermont, wo sie gewesen waren, und er fragte sich, ob sie sich dort kennengelernt hatten oder gemeinsam hingefahren waren. Mein Gott!, dachte er, wenn nur Rosalind ihm so einen Brief schreiben würde! Dusenberry würde ihr vermutlich nicht antworten, denn dem Brief nach zu schließen, hatte er ihr kein einziges Mal geschrieben. Don klebte den Umschlag sorgfältig zu und steckte ihn in die Tasche.
Der letzte Absatz ging ihm nicht aus dem Sinn.
Ich hätte nicht gedacht, daß ich Dir noch einmal schreiben würde. Jetzt habe ich es doch getan. Ich muß ehrlich sein. Ich kann nicht anders.
Don fand, daß er selbst ebenfalls ehrlich war. Weiter hieß es:
Erinnerst Du Dich, oder hast Du’s vergessen? Willst Du mich wiedersehen oder nicht? Wenn ich in den nächsten Tagen nichts von Dir höre, weiß ich Bescheid.
In ewiger Liebe
Edith
Er sah nach dem Datum des Poststempels. Der Brief war vor sechs Tagen aufgegeben worden. Und er malte sich aus, wie Edith Whitcomb sich vor Sehnsucht verzehrte, wie ihre Tage sich dahinschleppten, wie sie sich irgendwie einzureden versuchte, daß es einen Grund für diese Verzögerung gab. Sechs Tage. Doch natürlich hoffte sie immer noch. Hoffte in diesem Augenblick in Scranton, Pennsylvania. Was war dieser Dusenberry für ein Mensch? Ein Casanova? Ein verheirateter Mann, der einen Flirt beenden wollte? Welcher der sechs oder acht Männer, die ihm in diesem Haus aufgefallen waren, mochte Dusenberry sein? War er einer von denen, die morgens um halb neun ohne Hut zur Arbeit eilten? Oder ein ruhigerer Mann mit Homburg? Don achtete nicht besonders auf seine Nachbarn.
Ihm stockte der Atem. Einen Augenblick spürte er die Einsamkeit des Mädchens wie am eigenen Leib, den Hoffnungsschimmer, wie er ein letztes Mal aufflackerte. Mit einem einzigen Wort konnte er sie so glücklich machen. Oder vielmehr, Dusenberry konnte es.
»So ein Schwein«, flüsterte er.
Er legte den Anzug beiseite, trat zum Schreibtisch und schrieb auf einen Zettel: »Edith, ich liebe dich.« Es gefiel ihm, die Worte geschrieben zu sehen, lesbar. Er hatte das Gefühl, damit eine wichtige Angelegenheit entschieden zu haben, die zuvor gefährlich in der Schwebe gewesen war. Don knüllte den Zettel zusammen und warf ihn in den Papierkorb.
Dann ging er hinunter, schob den Brief wieder in den Briefkasten und gab den Anzug in der Reinigung ab. Er wanderte lange die Second Avenue hinauf, wurde müde, ging aber weiter, bis er beinahe in Harlem war, und nahm dann einen Bus zurück. Er war hungrig, doch ihm fiel nichts ein, was er essen wollte. Er bemühte sich, an nichts zu denken. Eigentlich wartete er darauf, daß die Nacht verging und der Morgen die nächste Postsendung brachte. Er dachte flüchtig an Rosalind. Und an das Mädchen in Scranton. Zu traurig, daß die Leute so unter ihren Gefühlen zu leiden hatten. Wie er selbst. Denn obwohl Rosalind ihn so glücklich gemacht hatte, konnte er nicht leugnen, daß die vergangenen drei Wochen eine wahre Folter gewesen waren. Ja, zweiundzwanzig Tage, wahrhaftig! Er fühlte sich eigenartig beschämt, zugeben zu müssen, daß es nun schon zweiundzwanzig Tage waren. Merkwürdig beschämt? Genau besehen, war daran doch nichts Merkwürdiges. Er schämte sich bei der Vorstellung, Rosalind möglicherweise verloren zu haben. Er hätte ihr in Juan-les-Pins ohne Umschweife sagen sollen, daß er sie nicht nur liebte, sondern heiraten wollte. Vielleicht hatte er sie jetzt verloren, weil er das nicht getan hatte.
Bei diesem Gedanken hielt es ihn nicht mehr im Bus. Die schreckliche, tödliche Vorstellung verbannte er aus seinen Gedanken und hielt sie sich vom Leibe, indem er zu Fuß weiterging.
Plötzlich hatte er eine Eingebung. Unausgegoren zuerst und vage, aber immerhin etwas, womit er sich heute abend beschäftigen konnte. Er begann damit, daß er sich auf dem Nachhauseweg so genau wie möglich vorzustellen versuchte, was Dusenberry Miss Whitcomb schreiben würde, wenn er ihren letzten Brief gelesen hätte, und ob er ihr schreiben würde, daß er sie zwar nicht unbedingt liebe, sie ihm aber so viel bedeute, daß er sie wiedersehen wolle.
Er brauchte etwa fünfzehn Minuten, um den Brief aufzusetzen. Er schrieb, er habe die ganze Zeit nichts von sich hören lassen, weil er sich weder seiner noch ihrer Gefühle sicher gewesen sei. Er wolle sie wiedersehen, bevor er mehr sagen könne, und fragte, wann sie ihn treffen könne. Er konnte sich nicht an Dusenberrys Vornamen erinnern oder daran, ob die Frau ihn in ihrem Brief überhaupt verwendet hatte, erinnerte sich aber an die Initialen R.L. auf dem Umschlag und unterschrieb einfach mit »R.«.
Während er den Brief schrieb, hatte er nicht ernsthaft beabsichtigt, ihn abzuschicken. Doch als er die anonymen, maschinengeschriebenen Worte las, begann er es zu erwägen. Es war so wenig und kam ihm so harmlos vor: Wann können wir uns sehen? Andererseits war es nicht nur sinnlos, sondern auch falsch. Dusenberry machte sich offenkundig nichts aus ihr, sonst hätte er nicht sechs Tage verstreichen lassen. Wenn Dusenberry das Verhältnis nicht dort fortsetzen wollte, wo es unterbrochen worden war, würde Don lediglich eine Klärung hinauszögern. Er starrte auf das »R.« und spürte, daß er eine Antwort von Edith wollte, eine einzige bejahende, glückliche Antwort. Darum schrieb er, wieder mit der Maschine, unter den Brief:
PS: Bitte schreib mir c/o Dirksen & Hall, Chanin Building, N.Y.C.
So würde der Brief schon irgendwie zu ihm gelangen – falls Edith antwortete. Und wenn sie nicht innerhalb der nächsten Tage antwortete, hieß das, daß Dusenberry selbst ihr geschrieben hatte. Wenn aber tatsächlich ein Brief von Edith kam, konnte – und mußte – Don die Sache von sich aus so schmerzlos wie möglich beenden.
Nachdem er den Brief abgeschickt hatte, fühlte er sich völlig befreit und in gewisser Weise auch erleichtert. Er schlief gut, und als er erwachte, glaubte er felsenfest, daß ihn im Briefkasten unten ein Brief erwartete. Als er sah, daß keiner da war (jedenfalls war kein Brief von Rosalind gekommen, nur eine Telefonrechnung), befiel ihn jähe, schlichte Enttäuschung oder Erbitterung, wie er sie noch nie erlebt hatte. Jetzt gab es einfach keinen Grund mehr, warum er keinen Brief bekommen sollte.
Am nächsten Morgen erwartete ihn im Büro ein Brief aus Scranton. Don entdeckte ihn auf dem Tisch der Empfangsdame und nahm ihn an sich, als sie gerade telefonierte. Sie stellte keine Fragen und blickte nicht einmal auf.





























