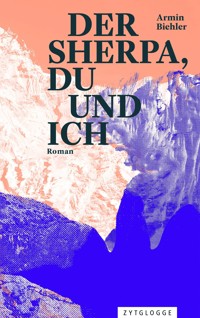
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Sherpa ihn das erste Mal sieht, wirkt der Bergsteiger wie ein Held aus einem Hindi-Film: ein Krieger, groß, stark und unverletzlich, in dessen Augen sich der Himmel spiegelt. Als der Autor das erste Mal vom Bergsteiger hört, ist dies dessen letztes Interview: Drei Wochen später ist «The Swiss Machine» tot, abgestürzt am Nuptse in Nepal. Er wird in einem buddhistischen Ritual im Himalaya eingeäschert. Einige Monate später – während einer eigenen Grenzerfahrung – tritt der Bergsteiger erneut in das Leben des Autors. Nun will er ihn kennenlernen und folgt dessen Spuren. Er ahnt nicht, dass er sich damit auf eine jahrelange Reise begibt. Hier, wo der Extremsportler als Alleingänger am Berg begeisterte, stößt er auf Ablehnung. Aber dort, wo dessen Alleinsein nicht verstanden wurde, trifft er auf den Sherpa Tenji. Dieser war dem Bergsteiger in dessen letzten zehn Jahren ein steter Begleiter und Freund geworden. Auch dem Autor wird Tenji zum Vertrauten und eröffnet ihm die Welt, in der er das Ziel seiner Reise findet. Doch was kommt danach? Der Sherpa, der Bergsteiger und der Autor: drei Menschen, deren Wege sich jenseits des Vorstellbaren kreuzen – in einem Roman, der die Grenzen des Machbaren auslotet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Vorstieg
Tritt fassen
In den Anfang gestürzt
Ankommen, um wegzugehen
Pizza in der Nordwand
Meine Reise zu dir
Der Schnee des Todes
Getanztes Leben
Der Bergtiger
Die Witwe verwirft
Tenji fährt Fahrrad
Seelenflug
Versprechen auf dünnem Boden
Allein für mich
Lawine der Gewalt
Flucht in den Körper
Gewürfelt um alles
Die Göttin geliebt
Meine Annapurna
Allein im Selbst
Aus dem Scheinwerferlicht getreten
In die Schwäche gefallen
Auf gutem Boden
Der Hund
Die Yakreise
Ein schwarzer Blitz
Leichte Asche
Nachgang
Über den Autor
Über das Buch
Armin Biehler
Der Sherpa, du und ich
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlKorrektorat: Tobias WeskampUmschlagfoto: Armin Biehler
Armin Biehler
Der Sherpa, du und ich
Roman
meinem Vater
Vorstieg
Wolkenfetzen tanzen im Wind. Die Luft streicht hart über die Bergkante. Im Auf- und Abschwellen der Winde ist weder Halt noch Orientierung möglich. Sie singen laut, schmettern ihre Fanfaren, und ihre Lust und Freude am Fabulieren flößt Respekt ein. Ihre Geschichte rennt dem Höhepunkt entgegen, weckt Neugierde und verdrängt die Angst. So bleibt das Staunen. Hinter den grünschwarzen Grasnarben nehmen die grauen, dunkel durchfurchten Felsgebilde Kontur an.
Immer mehr öffnet sich der Blick. Noch ist das Weiß der waagerechten Schneebänder mit den Wolken verwachsen. Doch langsam setzen sich Eis und Fels gegen das unstete, flüchtige Wesen der Luftbilder durch. Nicht, dass dies ein Kampf wäre, nein, die Wand scheint sich bewusst nun Stück für Stück zu entblößen. Augenblicke, in denen ihre sonderbare Verletzlichkeit berührt, um schließlich immer klarere Form zu gewinnen. So offenbart der Berg sein inneres Wesen. Gefestigt im unmissverständlichen Blau des Himmels spendet er in aller Schönheit einen Segen. Hier lebt die Göttin. Stille bemächtigt sich der Situation. Alles Zaudern ist verworfen. In der gebotenen Ehrfurcht lässt sie sich in ihrem Namen fassen: Annapurna.
Ihre Erhabenheit ist von einer Selbstverständlichkeit durchdrungen, mit der sie ein Lächeln schenkt. Ein Lächeln, das durchaus als Aufforderung zu verstehen ist, ihr näher zu kommen. An der höchsten Linie, der durchgehend weißen Kante entlang, wo darüber das Himmlische anfängt, zeigt sie ihren Körper. Hier entlangzugehen würde bedeuten, Unsterblichkeit zu erlangen. Und im Anblick dieses majestätischen Seins spiegelt sich das Wissen der Göttin, dass sie der unnahbarste Berg aller Berge ist. In diesem gigantischen Halbrund, ebenmäßig von der Wand der Wände begrenzt, bezeugt sie ihr Dasein in grenzenloser Weltabgeschiedenheit. Und die Gnade ihrer Hinwendung nimmt Gestalt an in den senkrecht abfallenden, endlos scheinenden Scharten vom Gipfelgrat hinunter, in den Seiten von massigen Sporen gefasst, um zum weltlichen Bergfuß hin die Landschaft zu ernähren. Sie, die Göttin der Ernte.
Plötzlich gibt sie krachend ihre Zuwendung auf. Mit ihrer Lust, sich selbst genug zu sein, wechselt sie hemmungslos ihr Kleid. Ihr elegantes Nachtgewand aus gefrorener Nässe schmilzt in der aufsteigenden Wärme des Tages und versetzt das Felsgefüge in rasende Bewegung. Im Fallen schlagen Steine ihren unheimlichen Rhythmus in die Bergflanke und brechen Eisskulpturen von gigantischer Größe aus den Vergletscherungen. Sie zerbersten beim Aufprall und reißen in unzählige Fetzen zerfallende Schneefelder mit in die Tiefe. Eine Staublawine nach der anderen reibt mit zischenden Rufen über die Haut des Berges. Dem sich auszusetzen ist der Preis, der von denjenigen verlangt wird, die es wagen, hier einzusteigen.
Diese scheinen abgeschlossen zu haben mit dem, was bisher war. Auch was kommen wird, kann sie nicht mehr berühren. Sie gehen in der Suche nach ihrem Weg in der Unsterblichkeit auf.
Davon war ich weit entfernt, als ich mein Zelt am Bergschrund der Annapurna aufstellte, mich hineinlegte und in die Nacht hörte. Ich döste in der Vorahnung, was noch alles kommen könnte, vor mich hin.
Tritt fassen
Er ist noch ein Junge, als er ihn das erste Mal sieht. Als kleiner roter Punkt bewegt sich der Bergsteiger in den Felsmassen. Die Situation hat etwas Unwirkliches. Der Onkel des Jungen begleitet als Koch diesen Versuch einer Erstbesteigung und hat seinen Neffen als Gehilfen mitgenommen.
Obwohl der Bergsteiger in seiner grellen Farbe in den Felsen wie ein Fremdkörper wirkt, strahlt er Sicherheit aus, als wisse er genau, wo ihn seine Route entlangführt. Doch der Küchengehilfe fragt sich, was der Bergsteiger hier macht, allein. Er ist ihm fremd, und er denkt sich, dass dieser wohl im Auftrag der Menschen in seinem Land hierhergekommen ist. Weil sie dort solche Berge nicht haben, besteigt er sie hier. So will der Fremde ihnen ein Stück davon mitbringen. Er hat gehört, dass dieser bei sich zu Hause dafür sehr bewundert wird.
Der Bergsteiger greift nach einer Felskante und zieht sich daran hoch. Sein Gesichtsausdruck spiegelt äußerste Konzentration wider, und sein offener Blick sucht nach Halt im Labyrinth der Felsen. Über ihm öffnet sich ein weites Schneefeld, das steil in einen Trichter mündet. Er hält auf einem Vorsprung an und schlägt mit großer Kraft die Eispickel in den Schnee, um zu prüfen, ob ihn das dunkelblaue Eis halten wird. Zufrieden nimmt er Fahrt auf und sprintet mit einer erstaunlichen Leichtigkeit diesen steilen Hang hinauf. Einem Mantra gleich wiederholt er den Ablauf der Pickelschläge mit den abwechselnd nachrückenden Beinen. Die harten kurzen Schläge ins aufspringende Eis im Wechsel mit dem langgezogenen Knirschen der haltfindenden Steigeisen an seinen Füßen geben den Rhythmus. Er fühlt sich offensichtlich wohl.
Dem Jungen aber kommt diese Landschaft bösartig vor. In der Nacht ist es bitterkalt. Aber am Tag scheint die Sonne grell. Ihre Wärme verbrennt alles. An diesem Ort ist keine Ruhe. Von Tag zu Tag vermisst er die Klostermauern mehr und mehr. Diese haben ihm bis vor Kurzem noch Geborgenheit gegeben. Er war schon als Kind in ein Kloster eingetreten, sechs Tage zu Fuß entfernt vom Haus seiner Eltern. Ihm war dieser Weg vorgegeben, als jüngster von sechs Geschwistern. Früh schon hat ihn das Leben Buddhas angezogen. Immer wieder erzählte ihm seine Großmutter die Geschichten des Prinzen Siddhartha. Deshalb gab es für ihn nur einen Wunsch: Mönch zu werden. Aber heute findet er sich widerwillig an dieser Stelle, wo so viele aus seiner Familie stehen. Sie bringen Touristen auf die Gipfel. Allein wären diese verloren. Und er kennt die endlosen Witze darüber, die sich seine Leute erzählen, wenn sie unter sich sind.
Der Bergsteiger kommt hoch oben an einem Felsband an. Er klettert in den weiterführenden Kamin. Mal für Mal verschwindet er in den Gesteinsblöcken, um an einer anderen Stelle wieder aufzutauchen. Schließlich ist der rote Punkt nicht mehr zu sehen, und als ob es ihn nie gegeben hätte, steht die Wand in ihrer Unzugänglichkeit da. Im letzten Licht des Tages zeichnen sich die Konturen der Felsformationen aufs Schärfste ab.
Doch für den Jungen sieht der Fremde nicht aus wie einer dieser hilflosen Touristen. Er ist wie ein Schauspieler aus diesen Hindi-Filmen. Groß, stark, unverletzlich. Ein Krieger, in dessen blauen Augen sich der Himmel spiegelt.
So berichtete es mir Tenzing Sherpa, der Junge von damals. Gerufen wird er Tenji wie so viele andere Tenzing Sherpa. Wie die zu unterscheiden seien, wollte ich wissen. Ich erinnere mich, dass ich ihn unsicher fragte, ob er denn noch einen anderen Namen habe. Er schien mich nicht zu verstehen, er sei doch der Tenji. Bei denen, die sich für Berge interessieren, der Tenji mit dem Everest ohne Sauerstoff. Und auch der Tenji aus dem Dorf Sanam Gudel im Kreis Mahahulung, dem Bezirk Solo Khumbu, der Provinz Nummer 1 in Nepal. Alle, die ihn kennen, wüssten schon, welcher Tenji gemeint sei, da solle ich mir keine Sorgen machen. Und er lächelte. Ich lächelte ebenfalls, aber mehr aus Verlegenheit, diese Selbstverständlichkeit nicht zu begreifen.
Später erfuhr ich, dass die Sherpa ihren Kindern oft den Namen des Wochentages geben, an dem sie geboren wurden. Das war bei Tenji jedoch nicht der Fall. Tenzing heißt in seiner Sprache «Beschützer Buddhas». Als ich Tenji stolz mein Wissen mitteilte, lachte er und meinte, es sei gut, dass es so viele Tenzing gebe. Buddha könne nie genug Schutz haben. Sein Name sei ihm Verpflichtung, und wie viele andere Tenzing komme auch er dieser nach. Dazu gebe es viele Möglichkeiten auf ganz unterschiedlichen Wegen.
In dieser Gleichheit entsteht die Vielfältigkeit der Menschen, die sich im selben Namen verbunden bleiben. Es ist nicht eine einzelne Person, die herausragt, sondern sie sind in ihrer Gesamtheit eingebunden und somit unverwechselbar. Die Verschiedenheit unter Gleichen zählt. So legte ich mir die Situation zurecht.
Mit dem allgemein gehaltenen Nachnamen Sherpa unterstreiche er seine generelle Zugehörigkeit zur weitverzweigten Volksgruppe der Sherpa. Früher seien keine Nachnamen nötig gewesen. Seine Großeltern hätten das so gemacht, als sie sich in ein Namensregister eintragen mussten. Er sei ein Sherpa, aber nicht alle Sherpa seien auch wirklich Sherpas, gibt er mir noch mit auf den Weg.
Ich begriff: In dieser Umgebung bist du allein nicht zu begreifen. Das macht einen großen Unterschied zu meinem Selbstverständnis und der Art, wie wir zueinanderstehen, dort wo ich herkomme. Als ich das verstanden hatte, war es möglich, diese Geschichte zu finden. Eine Geschichte der Freundschaft zwischen dem Bergsteiger, der sich als «The Swiss Machine» einen Namen gemacht hatte, und einem Nepali Tenzing Sherpa, den viele im zu kurzgegriffenen Verständnis seines Nachnamens als Träger sehen. Aber ohne Tenji könnte ich diese Geschichte nicht erzählen, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Als ich ihn kennenlernte, öffnete sich der Blick zu den Menschen, in die Landschaft und Orte, wo sich alles abspielte. So wuchsen vielfältige Tenjis zu diesem einen zusammen. Sie bedingten einander und waren wiederum nicht ohne den westlichen Bergsteiger zu denken, und dieser nicht, ohne Tenzing Sherpa zu fühlen.
Das ist meine Geschichte, sie begann vor fünf Jahren.
An einem Mittag im April hatte ich zum ersten Mal die Stimme des Bergsteigers gehört. Im Radio war er eingeladen, von seinem kommenden Vorhaben im Himalaya zu berichten, einer großen Überschreitung am Everest-Massiv. Es sprach ein Mann, dessen konzentrierte Art mir gefiel. Die Entschiedenheit, mit der er sein Ziel anging, war in einen Realismus eingebettet, der mich beeindruckte. Hier redete kein Abenteurer, sondern ein fokussierter Leistungssportler. Aber es blieb mir auch nicht verborgen, dass er im Unterton meinte, sich für seine Tätigkeit rechtfertigen zu müssen. Oder anders betrachtet: Es war ihm hörbar daran gelegen, sich zu erklären. Er beschrieb, wie er mit seiner Geschwindigkeit das Risiko minimiere, seine Erfahrung ihn schütze, seine körperliche und mentale Stärke Resultat eines harten Trainings sei und er sich als Teil der Geschichte des Alpinismus begreife.
Er wollte verstanden werden, und als ihn der Reporter fragte: «Sie haben Achttausender in Rekordzeit auf schwierigsten Routen bestiegen und vielfach erlebt, wie die Berge ihre Opfer forderten. Gibt es etwas, was Sie sich nicht trauen?», zögerte er keine Sekunde, und ohne Umschweife hörte ich seine klare Antwort: «Eine Familie zu gründen.»
Ich dachte: Du, das kann doch nicht wahr sein, was macht dir an der Aussicht, Verantwortung in einer Familie zu übernehmen, mehr Angst als auf Achttausender zu steigen? Ich schaltete das Radio aus und mich streifte abschließend der Gedanke, er werde wohl noch einige Klettereien vollbringen müssen, bis er diese Frage beantworten könne.
Dazu kam es nicht. Zwanzig Tage später war der Bergsteiger tot. Ausgerutscht an der Südwestflanke des Nuptse, einem Nachbargipfel des Everest, und tausend Meter tief ins Tal des Schweigens gefallen. Es war ein Sonntag. Die Sonne ging mitten in unserer Stadt hinter dem spitzen Kirchturm auf, und der Morgen präsentierte sich vielversprechend in klarem Blau. Ich lag noch im Zelt auf unserer Dachterrasse – und jetzt ertappe ich mich dabei, mich rechtfertigen zu müssen. Nein, bin eigentlich kein Asket, schlafe auf einer großen, bequemen Matratze unter einer Anzahl Bettdecken, die der Jahreszeit angepasst ist, und habe eine Nachttischlampe im Zelt. Aber ich mag es einfach, wenn frische Luft meine Nase kitzelt. Gut, im Winter, bei richtig kalter Temperatur, brauche ich manchmal etwas Überwindung, um die Bettdecken zurückzuschlagen und aufzustehen.
Das war an diesem Morgen nicht der Fall, als sich mein Mitbewohner bemerkbar machte und fragte, ob ich es schon mitbekommen hätte, «The Swiss Machine» sei abgestürzt. Wie sollte ich? Er hingegen ist Sportkletterer. Seine einarmigen Klimmzüge bei uns im Türrahmen machen nicht nur mir erheblichen Eindruck, sein tägliches Training ist eisern. Er hatte den Bergsteiger an einem Vortrag gesehen, und sogar in seiner Szene hatte dieser durchaus Geltung. Respekt war ihm sicher, obwohl er deutlich älter war und in Bedingungen kletterte, an denen jene, die stundenlang über einen bestimmten Bewegungsablauf am Fels fachsimpeln können, kein Interesse haben. Deren Routen heißen «Ravage», auf Deutsch «Verwüstung», oder «Anarchia» und sind im Mittelgebirge des Jura zu finden, nicht in der Annapurna-Südwand im Himalaya. Dennoch war mein Mitbewohner ergriffen, mitgenommen, aufgewühlt, und auch mir ging die Nachricht nahe. Ich schaute mir umgehend nepalesische Medien an, und mich schockierte die detaillierte Schilderung, wie ein Körper, der tausend Meter auf einem Eisfeld nach unten rutscht, Stück für Stück wie auf einer Küchenraspel zerlegt wird. Trotzdem werde in diesem Fall der Leichnam geborgen und nach Kathmandu geflogen, las ich. Danach nahm mein Tag seinen Lauf, und am Abend war mir dieser tödliche Absturz zum Ereignis geworden und weit in den Hintergrund gerückt. Ich schien ihn vergessen zu haben.
Im gleichen Frühjahr, einen Monat später, kam ich von einer atemberaubenden Fahrradfahrt in Teheran in mein kleines Hotel im Süden der Stadt zurück. Hier war ich abgestiegen, im Stadtteil der Ärmeren gleich beim Bahnhof, wo von riesengroßen Plakaten Ruholla Chomeini links vom Haupteingang in die Ferne blickte. Rechts davon suchte sein Nachfolger als geistiges Oberhaupt und Revolutionsführer Ali Chamenei den Blickkontakt zu den Reisenden auf dem Platz.
Der Portier nahm mir, als sei das ganz selbstverständlich, mein Velo ab, und ich ging die Treppe hoch der Dusche entgegen. Mein langärmliges dunkelblaues Hemd und die langen schwarzen Hosen zeigten mit weißen Salzringen und großflächig verteiltem frischen Schweiß die Spuren meiner Verausgabung: die Valisar-Straße, das Objekt meiner Begierde, und der alltägliche Weg Tausender auf Motorrädern, Autos, in Bussen und Lastwagen. Diese Transversale führt auf achtzehn Kilometern vom Süden schnurstracks, zeitweise sechsspurig, in den Norden der Stadt, wo sie sich in einer episch langgezogenen Kurve in Form einer Allee sanft nach Osten zum Tajrish-Platz neigt. Bei einem Höhenunterschied von sechshundert Metern. Oben, wo die Reichen wohnen, hatte ich mir zur Belohnung ein sündhaft teures Eis geleistet.
Ich fuhr einen Starrlauf: ein Gang, und nie aufhören zu pedalieren, hoch wie runter. Fahrräder waren bis vor hundertdreißig Jahren so, sind es heute auf der Bahn noch. Und seit einiger Zeit wieder auferstanden als Fixis im Fahrradkurierwesen. Ich trat einen unlackierten, rohen Stahlrahmen und hielt einen steilabfallenden, verchromten Keirin-Rennlenker. So genannt nach einer japanischen Bahnraddisziplin, dem Kampfsprint. Dieser Lenker erwies sich als Segen, erlaubte er mir doch, mich beim Hinunterfahren in schmalste Lücken zu stürzen. Manche auf ihren Mopeds und Motorrädern blieben so zurück. Ich drückte mich zwischen Bussen und Autos millimetergenau vorbei an die Spitze vor zur roten Ampel. Wenn die Ampel auf Grün schaltete, stürmte erst der Pulk von Motorrädern los. Jetzt galt es, blitzschnell zu beschleunigen und die Geschwindigkeit zu halten, um nicht von der sich hinter mir aufbauenden Autowelle überrollt zu werden. Der Sprint führte manchmal über ein, zwei Kilometer, bis ich in der Aufstauung an der nächsten Ampel wieder sicher verschwinden konnte. Ich gebe zu, dass es mir nicht möglich war, die Valisar in einem Zug durchzufahren, zu hoch war das verlangte Maß an Konzentration im massiven Verkehrsaufkommen und der Kraftaufwand bei oft über fünfzig Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit. Aber ich hatte es sehr genossen, mich ganz allein unter den Motorisierten zu bewegen, ein Fremdkörper zu sein, der trotzdem seinen Platz beanspruchte. Ein rasender Tanz im Verkehr.
Nun waren die Satteltaschen gepackt, und am nächsten Tag wollte ich los nach Norden ans Kaspische Meer.
Seit elf Stunden war ich unterwegs, erst im Nordwesten der Stadt auf einem Pass mit dem Blick zurück hinunter nach Teheran. Von hier aus war sogar der Moloch mit seinen rund neun Millionen Menschen fassbar. Das Licht der Morgensonne und die zahllosen Schattenwürfe ließen das Häusermeer ungewöhnlich ausgeglichen und ruhig erscheinen. Nach einigen Kehren hinunter, wobei meine Trittfrequenz einer Nähmaschine in höchster Auslastung glich, fand ich am Anfang eines Sees meine Straße in Richtung Nordwesten. Ich hatte geahnt, dass es so kommen würde: Stunden steter Steigung. Ich war bereit.
Im Wiegetritt schraubte ich mich Stück für Stück hoch, der Belag war bestens, schwarz und aufgeheizt von der gleißenden Sonne. Autos waren schon lange nicht mehr unterwegs, spätestens ab dort, wo ein massiver Erdrutsch die Fahrbahn weggedrückt hatte und ich mein Rad über die weitflächigen Steinhaufen getragen habe. Ich sah meinem Schatten auf dem Asphalt bei der Bewegung zu und meinte, den Beginn eines Sonnenstiches zu spüren.
Auf der gegenüberliegenden Seite des langgezogenen breiten Tals waren die Bergrücken schneebedeckt. Sie waren fast viertausend Meter hoch. Ich stieg vom Rad, suchte nach Orientierung und fand in einiger Entfernung die Passhöhe im direkten Gegenlicht. Wunderte mich, dass ich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte war, aber das Velo zu schieben wäre mir ungewohnt vorgekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass der Dizim-Pass – wo mich die beiden Herren vom Bahnhof erneut begrüßen sollten, diesmal auf Blech gemalt, festgeschraubt an einem starken Gerüst mit dem Hinweis auf das internationale Skigebiet – dreitausendzweihundertsechzig Meter über dem Meeresspiegel liegt.
Dort oben würde ich in etwas mehr als zwei Stunden ankommen. Die Winde würden stark blasen und sich an den Felskanten brechen. In Ostwestrichtung würde sich eine nächste Bergkette zeigen. Allerdings nicht mehr in der Höhe, von der meine Aussicht über sie hinweg in die dahinterliegenden Täler ging. Diese wiesen nach Norden, fielen in den Dunst, in dem das Kaspische Meer zu vermuten war. Erschöpft würde ich einen einigermaßen geschützten Platz für mein Zelt finden. Ohne Probleme in einen tiefen Schlaf fallen und am nächsten Tag jauchzend die steilsten Serpentinen halb fallend, halb fahrend hinuntertaumeln. Die Sonne würde mit unmissverständlicher Klarheit Schnee und Eis auf der Straße schmelzen, und ich würde glücklich sein.
Doch vorerst stand ich hier am späten Nachmittag mit dem suchenden Blick zur Passhöhe neben meinem Fahrrad: dem Monstre, und sammelte meine Kräfte. Da fiel mir der Bergsteiger ein, ganz beiläufig einfach so. Ich war keinesfalls überrascht oder verwundert. Ich nahm es einfach zur Kenntnis. Die Eingebung hatte ihren Platz beansprucht und gleich gefunden. Sie formte Gedanken, die von einer Gewissheit unterlegt waren, dass sie sich nicht mehr verflüchtigen würden. Was war das für ein Mensch, was bewegte ihn, was verknüpft mich mit ihm? Fragen, die mir eine eigene Antwort abverlangten. Ich stieg auf, ohne Druck zu verspüren, sie gleich finden zu müssen. Im Gegenteil. Beruhigt fuhr ich los, fand meinen Tritt.
Das war die Einladung für ein Zwiegespräch, das ich ohne Zweifel in aller Selbstverständlichkeit annahm. Der Beginn der Beziehung mit dem tödlich verunglückten Bergsteiger. Sie sollte die nächsten Jahre andauern.
Wieder zu Hause wusste ich nicht, was ich machen sollte. Wer war dieser Mensch, und was habe ich mit ihm zu tun? Einzig war mir klar, dass ich diese Gedanken, die Eingebung auf der Passstraße Rd 425, die ich aus dem iranischen Elbrozgebirge mitgenommen hatte, ernst nahm.
Eine erste Rundsicht schreckte mich ab. Zweihunderteinundneunzigtausend Links brachte die Suchmaschine ans Licht. Verlautbarungen unzähliger Medien in allen audiovisuellen oder getexteten Arten lagen vor mir. Auch wenn ich die Suchergebnisse auf die deutsche Sprache eingrenzte, blieb die Überforderung. Sollte ich mich für gewisse Leitmedien entscheiden und von diesen aus in die Tiefe gehen? Nein, die Abneigung blieb bestehen. Ich gestand mir ein, dass mich das mediale Bild, eine Mischung aus Profisportler und bodenständigem Bergler, eigentlich nicht interessierte. Ich war zögerlich und spürte einen inneren Widerstand, diesen Menschen in aller medialen Breite ausgewalzt vor mir zu sehen, so dass kein anderer Blickwinkel auf ihn Bestand haben konnte. Aber es war seine Angst davor, «eine Familie zu gründen», die bei mir hängengeblieben ist, und im Kontrast dazu sprach das mediale Bild wenig von Angst, höchstens von Strategien zur Risikominimierung am Berg. Folgerichtig wollte ich mich bei seiner Familie melden. Nur wie? Und wie damit umgehen, dass erst ein halbes Jahr vergangen war, seit der Tod den Eltern, den Geschwistern und der Ehefrau Sohn, Bruder und Ehemann entrissen hatte?
Meine Unsicherheit war unbegründet, und ich staunte, denn eine mögliche Kontaktaufnahme war auf einer digitalen Kondolenzseite in aller Klarheit geregelt. Die Familie bat, von direkten Anfragen abzusehen, sie werde von einer Medienagentur vertreten, die zu kontaktieren sei. Froh darüber, mich auf vorgespurtem Weg bewegen zu können, schilderte ich mein Anliegen und beschrieb, wie ich dazu gekommen war. Außerdem erwähnte ich, mir sei das Ungewöhnliche meiner Absicht, den verstorbenen Alpinisten nach dessen Tod kennenlernen zu wollen, durchaus bewusst. Und ich betonte, den Trauernden keinesfalls zu nahe treten zu wollen. Nach einigen Wochen kam eine höfliche Nachricht des Mediensprechers, mein Anliegen sei an die Familie weitergeleitet worden und man bitte mich um Geduld, bis die Antwort eintreffe.
In diesem Zusammenhang fiel mir auf: Der Bergsteiger wurde von einer Agentur vertreten, die sich die «persönliche Begleitung von führenden Wirtschaftspersönlichkeiten der Schweiz» auf die Fahne geschrieben hat. Der Inhaber war Diplomingenieur und hatte jahrelang als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Nun ging es um «Communication & Reputation Management». Eine Welt, in der das äußere Bild der Klienten gerade auch in Krisensituationen gesichert und gesteuert werden soll. Wieder war ich in die mediale Sphäre geraten und begriff, dass «The Swiss Machine» eine Marke war. Ein Produkt, das sich am Markt zu behaupten hatte. Und wahrscheinlich würde in der Agentur von «Brand» gesprochen. Das kam mir fremd vor.
Nur wenig später nach dem Kontakt mit dem Mediensprecher traf eine Antwort der Witwe ein. Sie freue sich darüber, dass ihr Mann mich inspiriert habe. Leider sehe sich die Familie in ihrer unmittelbaren Trauer nicht imstande, sich mit mir zu treffen. Sie bitte um Verständnis, und ich könne mich in einem Jahr wieder melden.
Ich war fast ein wenig erleichtert, was mich erstaunte. Aber unbewusst genoss ich es, so genug Raum zu haben, mich erstmal allein mit diesem Menschen auseinanderzusetzen. Mir Zeit zu geben, klar zu werden: Was für ein Verhältnis entsteht zwischen uns? Warum ließ er mich nicht los, und wieso ließ ich das zu? Wovon würde ich ausgehen, wenn ich dereinst seine Angehörigen treffen sollte?
Natürlich meldete ich mich ein Jahr später wieder bei der Frau des Bergsteigers, nicht ohne zu schildern, was ich in der Zwischenzeit unternommen hatte. Sie reagierte freundlich und beschrieb ihre Trauer. Ihr sei das wichtigste Gegenüber abhandengekommen, der Mensch, der ihr am nächsten gewesen sei und mit dem sie immer wieder neue Abenteuer erlebt habe, ihr Sparringspartner in den kleinen und großen Fragen des Lebens. Aber sie fühle sich heute noch nicht in der Lage, mich zu treffen. Sie bat um Verständnis, und ich könne gerne in einem Jahr wieder bei ihr anklopfen. Das nahm ich mir vor und fing an zu schreiben.
In den Anfang gestürzt
Als sich Tenji und der westliche Bergsteiger das erste Mal begegnen, ist dieser dreißig und Tenji fünfzehn. Vor einigen Tagen hat die Gruppe auf dem Weg zum Annapurna-Basislager an einer heißen Quelle eine Pause eingelegt. Im Tal ist es grün von all diesen Bananenstauden, und der Bambus wuchert. Der Bergsteiger legt sich, ohne zu zögern, in das Becken mit heißem Wasser, und Kaji, Tenjis Onkel, ebenfalls. Das Wasser ergießt sich aus einem gebogenen Rohr direkt über die Köpfe der beiden. Tenji hingegen ist vorsichtig, ihm ist dieser dampfende Wasserstrahl nicht ganz geheuer. Er lässt erst einmal etwas abseits die Beine ins Becken baumeln und beobachtet die fallenden Wassertropfen, die in den Sonnenstrahlen glitzern. Eine Frau hält eine Kamera und lächelt in Richtung des Bergsteigers, der gut gelaunt erzählt.
«Ja die Annapurna, der schwierigste Achttausender. Die Südwand, die schwierigste Route, eine Erstbesteigung. Ja, das ist richtig, bisher sind alle gescheitert.»
Die Reporterin nimmt seine Ausführungen wohlwollend zur Kenntnis und spricht dann selbst ins Mikrofon: «Du warst bis jetzt noch nie auf einem Achttausender in Nepal?»
«Irgendwo muss man ja anfangen.»
«Und wenn du scheiterst?»
«Gescheitert bin ich, wenn ich tot bin.»
Unvermittelt taucht er mit dem Kopf unter. Tenji hatte nichts von dem Gespräch verstanden, bemerkt aber, dass das Blubbern des Bergsteigers unter Wasser die Frau verlegen macht. Sie wendet sich hilflos an seinen Onkel Kaji: «Und Sie, was machen Sie hier?»
Kaji reckt sich zur Kamera, holt Luft und redet plötzlich aufgeregt los: «Ich backe Apfelkuchen, meinen Apfelkuchen mag er sehr gerne. Und das ist Tenji, mein Gehilfe.» Dieser nickt in Richtung der Journalistin und lächelt. Nun ist Kaji in seinem Element und erklärt: «Ich bin eigentlich kein Sherpa, aber mein Bruder hat eine Sherpa geheiratet, obwohl er ein Magar ist ...» Sie gibt ihm ein Zeichen, dass jetzt genug geredet sei, aber Kaji ist nicht mehr zu stoppen: «... deshalb ist Tenji jetzt bei mir, weil sein Onkel Mingma, der Sohn der Schwester des Großvaters, nicht verstanden hat ...»
Entnervt lässt die Frau die Kamera sinken und unterbricht Kaji: «Gut, danke, danke, und wir probieren gerne ein Stück Ihres Apfelkuchens.»
Kaji nickt stolz zu Tenji. Dieser fühlt sich wohl bei seinem Onkel.
Im Basislager schneit es seit Tagen ohne Unterbrechung. Tenji hat den Bergsteiger nach dessen Namen gefragt, dieser buchstabierte langsam, vielleicht merkte er sogar, dass Tenji diesen Doppellaut, der erst dunkel tief daherkommt und plötzlich in einen hellen offenen Ton übergeht, schwer aussprechen konnte. Tenji erinnert der Klang eher an den Ruf eines Vogels, einer Eule.
Aber das ist egal, denn der Bergsteiger redet sowieso nicht viel, mit ihm nicht und auch sonst nicht. Nur wenn die Journalistin mit der Kamera vor ihm steht, scheint ihm etwas einzufallen. Ansonsten ist er draußen und schippt stundenlang mit der Schaufel Schnee weg, während Tenji und sein Onkel Kaji im Küchenzelt das Essen vorbereiten und viel schlafen. Kaji sagt, das kenne er schon. Der Bergsteiger müsse erst auf einen Gipfel, wenn er dann zurückkomme mit seiner wiedergefundenen Sprache, hätten sie sogar schon zusammen gesungen. Er könne sehr lustig sein, was Tenji zu diesem Zeitpunkt nicht glauben mag. Aber dann lehnt sich Kaji zu seinem Neffen und setzt eine bedeutsame Miene auf. Tenji ist sich nicht sicher, wie ernst es sein Onkel in seinem Flüsterton wirklich meint. Er habe ihm etwas sehr Wichtiges anzuvertrauen: Der Westler sei krank. Er begebe sich immer wieder in Gefahr, in der seine Seele geraubt werden könnte. Ihm, Kaji, komme es so vor, dass die neun Hexenschwestern nur darauf warten würden, seine Seele verstecken zu können, und er mache sich Sorgen um ihn und werde helfen, egal was passiere. Er rollt ausgiebig mit den Augen, um seine Worte zu unterstreichen.
Er weiß, wovon er redet, er ist schon seit Jahren Koch bei den verschiedensten Projekten des Bergsteigers im Himalaya. Doch für Tenji ist alles neu, und er findet sich im Ganzen noch nicht zurecht. Er bleibt vorsichtig und schaut zu.
Das Wetter ändert sich. Nun scheint Tag für Tag die Sonne verlässlich bis zum Mittag. Dann ziehen jeweils Wolken auf, die sich auflösen, wenn es am Abend wieder frisch wird. Die Nächte sind sternenklar und sehr kalt.
So steht der Bergsteiger im ersten Licht des aufziehenden Tages am Bergfuß, nimmt die Steigeisen in die Hand und prüft mit der Fingerspitze die Schärfe der Zacken. Offensichtlich zufrieden schnallt er sich die Kletterhilfen an die Füße. Er richtet sich auf und blickt in die Wand. Sein Gesicht strahlt gespannte Vorfreude aus. Sein erster Zug am Fels eröffnet ihm die Möglichkeit, in dieser als unkletterbar geltenden Wand seinen Weg zu finden. Er hat sich entschieden, und die festen Stöße seines Atems formen den Rhythmus, der keinen Zweifel mehr aufkommen lässt.
Stunden später ist dieser kleine rote Punkt in den Felsmassen verschwunden.
Anfangs unbemerkt hebt irgendwo am Berg ein rauschendes Schlagen an. Das Geräusch schwillt an und wird immer lauter. Es steht in seltsamem Kontrast zum erhabenen, ruhigen, von der Sonne durchfluteten, ebenmäßigen Bild, das die Göttin Annapurna aus sicherer Entfernung von sich zeichnet. Plötzlich ein dumpfer Aufprall. Danach herrscht Ruhe.
Er liegt ausgestreckt und mit dem Kopf nach unten im Schnee und zittert am ganzen Leib. Sein Atem geht schnell und hechelnd. Trotzdem versucht er, sich aufzurichten, sackt aber immer wieder zusammen. In seinem erstarrten Gesicht steht ungläubiges Entsetzen. Schließlich gelingt es ihm, einigermaßen aufrecht im Schnee sitzen zu bleiben. Das Licht blendet ihn dermaßen, dass er die Augen mit aller Kraft zusammenkneift. Stotternd brabbelt er unverständliche Worte. Er schluchzt, zieht die schneidende Luft stoßweise durch die Nase ein, während er mit beiden Händen seinen Kopf abtastet und den verbeulten Helm abnimmt. Der zerfällt in zwei Hälften. Der Bergsteiger schluckt angestrengt, stiert vor sich hin. Um ihn herum liegen Felsbrocken in allen Größen und Formen. Seine Angst löst sich, als der Gedanke ihn ergreift, welcher dieser Steine ihn getroffen haben mag. Er muss wohl mehrere Hundert Meter abgestürzt sein und wird sich nicht daran erinnern können, was genau passiert ist. Dieses Unwissen bleibt bestehen.
Er tut Tenji leid, der sich fragt, wie es sein könne, dass dieser Krieger so geschlagen wurde. Der Westler kommt ihm sehr traurig und einsam vor. Wie er so dasitzt, sieht sich Tenji selbst, als er sein Kloster verlassen musste. In diesem Augenblick spürt er eine Nähe zum Bergsteiger. Von da an wird er bei jedem seiner Projekte in Nepal mit dabei sein. Die nächsten zehn Jahre bis zu dessen Tod.
Sie stützen den Verunfallten auf dem Weg ins Gemeinschaftszelt im Basislager. Die Frau mit der Kamera will sich gleich mit ihm unterhalten, muss dann aber einsehen, dass er nicht dazu fähig ist, ihr Auskunft zu geben. Er kriecht in seinen Schlafsack und schläft sofort ein.
Als er aufwacht, sitzt Tenji neben ihm und fragt, wie es ihm gehe. Der Bergsteiger fährt sich mit den Händen übers Gesicht. «Auf alle Fälle sehe ich nicht mehr alles doppelt und auf dem Kopf.»
«Du hast eine Nacht und einen ganzen Tag geschlafen.» Tenji reicht ihm Wasser.
Er reckt und streckt sich auf seiner Matte. Dann fasst er sich an den Kopf und nimmt die schwarze Strickmütze ab. Sie ist mit einem seltsamen weißen Zeichen bestickt, das Tenji sofort ins Auge springt, ohne dass er sich trauen würde, nach dessen Bedeutung zu fragen. In großen Schlücken trinkt der Bergsteiger das Wasser. Er spürt wohl Tenjis Interesse und mustert die Kappe. «Hat er mich beschützt, kaum zu glauben.»
«Wer?», will Tenji wissen und stellt sich vor, dass das einer der Götter des Westlers sein müsse.
«Die Mütze hat mir ein Freund geschenkt. Alle vierzehn Achttausender, geknackt wie Erdnüsschen.»
Tenji merkt, dass er einen Menschen meint, dass es um Berge geht und er nicht über einen Gott redet. Der Bergsteiger erzählt, wie er das erste Mal an einer richtigen Expedition im Himalaya am Jannu teilgenommen hat. Der Mann mit den vierzehn Achttausendern und den Erdnüsschen hatte ihn gefragt, ob er mitkomme. Er habe sich damals riesig gefreut und tue das jetzt noch, obwohl das schon fünf Jahre her sei.
Langsam taucht vor Tenjis Augen ein Bild dieses Manns auf. Er stellt sich ihn aufrecht und groß vor, er muss wohl älter als der Bergsteiger gewesen sein. Wie die weisen Asketen, denen Siddhartha auf seinem Werdegang zu Buddha begegnete. Dieser Mann scheint ein Vater für den Bergsteiger gewesen zu sein, ob ein guter oder ein böser, weiß Tenji nicht.
Doch er hat wohl von ihm gelernt, auf die Gipfel zu klettern, und als Tenji hört, dass dieser Mann auch ein Bergsteiger und fast zwanzig Jahre älter sei, bestätigt das seinen Eindruck. Auch weiß Tenji von Kaji, dass der Westler, der vor ihm sitzt und dem er dabei beobachten kann, wie dessen Lebensgeister wieder zurückkommen, fünfzehn Jahre älter ist als er selbst. Für ihn ist es selbstverständlich, dem Älteren mit großem Respekt zu begegnen. Allerdings ist sich Tenji nicht sicher, ob der Bergsteiger das überhaupt bemerkt. Vielleicht deutet er seine Zurückhaltung als Unsicherheit. Oder er nimmt schlicht keine Notiz vom Altersunterschied. Auf alle Fälle ist der Bergsteiger zu diesem Zeitpunkt doppelt so alt wie Tenji.
Nun gerät jener regelrecht ins Schwärmen über diese Nordwand am Jannu. Tenji hat keine Ahnung, wo sich dieser Berg befindet. Später erzählt ihm Kaji, der Kumbhakarna, wie sie den Jannu nennen, sei den Sherpa heilig, keiner würde ihn besteigen wollen. Der Bergsteiger ist indessen eingetaucht in seine Erinnerungen und eigentlich redet er immer mehr mit sich selbst, als er mit Begeisterung erzählt, dass der Jannu der Eisschrank sei und dessen Nordwand das Gefrierfach. Tenji versteht nicht, wie er das meint, und warum soll es besonders sein, sich an einem Ort aufzuhalten, an den die Sonne ihre Strahlen nicht hinschicken kann. Andauernd würden dort eisige Winde wehen und es schneie eigentlich immer, hört er ihn erzählen. So wundert es Tenji nicht, dass die beiden Männer es damals nicht geschafft haben, durch die Wand zu klettern. Es gab wohl einfach keinen Weg. Schließlich nennt der Bergsteiger erstaunlich lebhaft, dafür dass es keine zwei Tage her ist, dass ihn ein Stein aus der Wand geschlagen hat, den Namen seines Lehrers. Als solchen begreift Tenji den zweiten Bergsteiger und hat in diesem Moment den Eindruck, es rede ein Junge zu ihm, der den Namen seines Vorbildes ausspricht und dann vor lauter Ehrfurcht verstummt.
Aber sein Blick hat kein Ziel, und Tenji kann diesen Augen nicht standhalten. Der Bergsteiger verkrampft seine Hände in der Wollmütze und berichtet, dass dieser Mann etwas sehr Schweres mit sich herumtrage. Jener habe seinen Sohn, ein Baby, umgebracht. Es war an einem Feiertag, dem Heiligen Abend. Tenji hat schon von diesem großen Fest gehört. Er weiß, dass die Geburt des Sohnes ihres Gottes mit vielen Kerzen gefeiert wird. Das vergleicht er mit dem Lichterfest der Hindus. Es ist also an diesem Tag gewesen, als der Säugling des Lehrers geschrien und der Mann seinen Sohn geschüttelt hat, bis er verstummt war, tot. Neun Monate später waren sie dann zu dritt, der Mann, die Mutter des toten Kindes und der Bergsteiger, auf diese Expedition gegangen. Die Mutter kochte, was gut schmeckte und er regelrecht verschlang. Im Gegensatz dazu weigerte sich der Mann, irgendwas zu essen. Dieser habe eigentlich immer draußen im Sturm gestanden und sei nur zum Schlafen ins Zelt gekommen. Die Erinnerungen bedrängen den Bergsteiger immer mehr. Er fragt sich, warum es ihn nicht berührt hat, als die Mutter ihm gestand, sie höre Nacht für Nacht ihren Sohn im Schneesturm draußen schreien. Irgendetwas stimmte nicht. Das Elternpaar redete eigentlich kein Wort miteinander. Der Mann wusste nicht, was er zu seiner Frau sagen sollte, und es schien, er habe auch schlichtweg nichts zu sagen gehabt. Das erklärt der Bergsteiger damit, dass der Mann und er nur Gedanken für diese Wand gehabt hätten. Diese aber habe sich ihnen immer weiter entzogen. Und das mit dem Kind muss wohl ein Unfall gewesen sein, sagt er, so, wie er hier an der Annapurna verunglückt sei. Mit dem Unterschied, dass das Kind tot ist und er noch lebt, denkt Tenji und spürt: Auch der Bergsteiger ist sich dessen bewusst. Nun sieht Tenji sogar wieder den Krieger in seinem Gegenüber aufblitzen. Dieser stößt zurückhaltend lächelnd einen Seufzer aus und meint, auf alle Fälle gehe er dort nicht mehr hin, an diesen Jannu.
Nach einer Weile fragt ihn Tenji doch, was das in der Wollmütze eingestickte Zeichen bedeute. Der Bergsteiger schüttelt leicht den Kopf, als ob er etwas verneinen wollte, und hält ihm die Mütze hin. «Der Tod, ein Totenkopf, das ist das Zeichen für den letzten Atemzug, danach ist es vorbei.»
Der plötzliche Hinweis auf den Tod überrascht Tenji, und führt ihn in Gedanken in seine Klosterschule. Eigentlich hat er etwas sagen wollen, aber er zögert. Er will nicht den Eindruck erwecken, dem Älteren gegenüber belehrend zu sein, bis es doch aus ihm heraussprudelt: «Buddha sagt, es ist der Weg, der Wiedergeburt zu entkommen. Jeder Tag ist ein wenig Sterben.»
«Woher weißt du das?», fragt der Bergsteiger sichtlich überrascht.
«Ich war, bis ich hierherkam, Klosterschüler.»
«Du willst Mönch werden?»
«Ich war auf dem Weg. Aber jetzt ist er mir versperrt.»
«Warum?»
Tenji kann nicht antworten. Wahrscheinlich ist es ihm selbst zu groß, sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Kloster. So findet er keine Worte dafür, was ihn nicht stört. Aber er erklärt, wie er hierhergekommen ist: «Mein Onkel Kaji hat mich mitgenommen. Er ist der Bruder meines Vaters. Das ist besser, als wenn mich mein Mutteronkel Mingma zu den Touristen an den Everest geschleppt hätte. Er ist ein böser Mensch.»
Der Bergsteiger interessiert sich für die Familienverhältnisse, obwohl er sie nicht ganz nachvollziehen kann. Er legt die Mütze zur Seite und reicht Tenji die Hand. Der erwidert seinen Gruß im Wissen darum, dass die Menschen aus dem Westen so freundliche Verbindung zeigen.
«Da hast du Glück gehabt und ich auch. Freut mich, dich kennenzulernen.»
«Darf ich dich etwas fragen?», ergreift Tenji die Gelegenheit.
«Sicher, was denn?»
«Warum bist du allein hier?»
Er überlegt. Und Tenji fällt ein, dass die Frau mit der Kamera schon vor zwei Tagen abgereist ist. Ob sie zu seiner Familie gehört, fragt er sich.
«Ehrlich, ich weiß das nicht genau. Es hat sich so ergeben. Und allein zu klettern ist für mich am sichersten. So bin ich nur für mich verantwortlich. Verstehst du das?»
Tenji antwortet nicht.
Sie haben ihre Sachen zusammengepackt, und vorne treibt Kaji die mit der Ausrüstung beladenen Yaks auf den Weg nach unten. Gleich hinter dem letzten Tier gehen Tenji und der Bergsteiger. Als sie auf dem schmalen Pfad, der zu beiden Seiten steil ins Tal abfällt, auf einer kleinen Ebene ankommen, machen sie eine Pause. Die Tiere grasen und schnauben in ihrem wohligen Grunzton. Kaji ist in die Knie gegangen, kauert so neben den Yaks und denkt vor sich hin. Der Bergsteiger dreht sich um und schaut ins Tal zurück.
Der Blick zum Annapurna-Massiv ist atemberaubend. Auf halber Höhe haben sich Wolken an den Felsen festgesetzt, darüber thronen die Gipfel. Nebelfetzen tanzen hin und her. Die grauen Wolkengebilde reißen immer wieder auf und lassen dahinter, vom satten Blau des Himmels unterlegt, die festen, leuchtenden Schneefelder und ewig schwarzen Felswände auftauchen. Die beharrlich in gleicher Richtung durchbrechenden Sonnenstrahlen nähren die Vermutung, hinter dem Schleier liege eine freudige Leichtigkeit. Diese aber bleibt unzugänglich. Es besteht keine sichtbare Verbindung zwischen der grünbraunen Grasnarbe des Pfades, der sich auf seinem Weg talaufwärts verliert, und der nur zu erahnenden Bergarena am Horizont. Nichts weist darauf hin, dort hingelangen zu können. In der Distanz verblasst diese Möglichkeit und das Eigene der Elemente füllt den Raum.
«Dort ganz hinten hat er Momente der Unsterblichkeit erlebt», wendet sich plötzlich der Bergsteiger an Tenji.
«Wer?», will dieser wissen, und der andere tippt sich an seinen Kopf, an die Totenkopfmütze.
«Er.» Das ist der Mann, von dem der Bergsteiger vor zwei Tagen erzählt hat, und Tenji fragt sich, wo jener wohl heute ist. Aber er will nicht aufdringlich sein.
«Er war es, der mich auf die Idee gebracht hat, hierher zu kommen, weil er meinte, nichts sei mit der Annapurna zu vergleichen.» So war dieser wohl ein guter und böser Vater zugleich.
Tenji hingegen ist im Moment froh, dass sie die Steinwüste hinter sich gelassen haben, und freut sich auf die Unterkunft unten im Tal beim Wasserfall. Das frische Grün, das sanft rauschende Flüsschen haben ihm gefehlt, und vor allem macht die Bäuerin einen sehr guten Dal Bhat. Nichts gegen den seines Onkels, aber ihrer ist besser gewürzt, was er nie im Leben Kaji sagen würde.
Der Bergsteiger reißt ihn aus seinen Gedanken: «Wenn du sie überlebst, dann nur im Absoluten. Du musst deine eigenen Grenzen sprengen. Dich selbst aufgeben. Dich ganz deiner Kraft überlassen, ohne Zweifel sein. Genau so hat er über die Annapurna geredet.»
Worauf es Tenji herausrutscht: «Kaji meint, du bist krank.»
Der Bergsteiger lacht herzlich, nimmt einen Apfel aus seiner Hosentasche und bietet Tenji die Hälfte an. Kauend sitzen sie nebeneinander und schauen nach vorne, wo sich weit vor den Yaks eine Hügelkette nach der anderen auftut.
Nach beiden Seiten hin fällt der Bergrücken ab und liegt so vor dem nächsten Tal. Wolken zeichnen eine ausgeprägte Waagrechte, die ganz hinten am Horizont ihren Abschluss findet. Dort, wo sich das sanfte Orange der Sonne aufs helle Blau des Himmels setzt, wird das Oben von wolkiger Wattierung eingenommen. Dazwischen eilen abreißende dunkle Nebelschwaden in alle Richtungen. Ein unentschiedener Wind lässt sie tanzen.
«Was möchtest du jetzt machen?», fragt er Tenji.
«Meine Cousins sind Climbing Sherpas, mein Mutteronkel Mingma ist Ice Doctor. Sie arbeiten alle am Everest, für die Touristen.»
«Willst du das auch machen?»
«Nein, ich habe Angst vor Mingma.»
«Warum?»
«Er hätte eigentlich meine Mutter, die Tochter der Schwester seines Großonkels, heiraten sollen, aber sie wollte ihn nicht. Sie hat meinen Vater, einen Magar und keinen Sherpa, geheiratet. Seither will sich Mingma an ihr rächen.»
«Aber was geht dich das an?»
«Er wollte mich als Helfer am Everest, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin. Aber meine Mutter traute ihm nicht.»
Der Bergsteiger scheint zu überlegen. Etwas bereitet ihm Unbehagen. «Es gibt aber auch eine ganz andere Art zu klettern, als es die Touristen tun.»
«Wie du es machst?»
«Ja, und es gibt einige andere, die so unterwegs sind.» Sie schweigen eine Weile. Bis er den Faden wieder aufnimmt: «Als ich so alt war wie du, da wusste ich schon ganz genau: Ich werde Bergsteiger.»
«Warum?»
«Mein Vater lachte mich aus, als er mich bei einer ersten heimlichen Klettertour erwischte: ‹Wenn du was machst, dann mach es richtig oder gar nicht.› So ist das in unserer Familie.»
«Ist dein Vater Brahmane?»
Mit dieser Frage hat der Bergsteiger nicht gerechnet und lacht. Er findet Gefallen daran, dass Tenji ihn immer wieder überrascht. «Nein, Kupferschmied. Ich hätte werden sollen wie meine beiden Brüder. Das wollte ich nicht.»
Das bringt Tenji dazu, an seine Geschwister zu denken. Von seinen drei Brüdern warten zwei auf ein Visum ins Ausland, einer möchte nach Japan studieren gehen. Der andere ist schon Climbing Sherpa gewesen, will aber in Malaysia Arbeit suchen. Die beiden Schwestern gehen noch zur Schule, eine will später einen Laden in Kathmandu eröffnen, die andere jüngste wird wohl bei den Eltern im Dorf bleiben und sich um sie kümmern.
«Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber du, hast du alles richtig gemacht?»
«Ich glaube schon. Obwohl dieser Absturz hier nicht auf dem Programm stand.» Er schweigt und isst seinen Apfel auf. Dann dreht er sich um und zeigt auf einen Berg.
Mit einer breit ausgefächerten Spitze markiert dieser den Eingang des Tales. Die festen Linien seiner Kanten laufen von allen vier Himmelsrichtungen in einer Spirale im Gipfel zusammen. Die Verbindung seiner zwei gleich hohen Spitzen fällt in der Mitte behutsam ab, um in diesem ebenmäßigen Bogen am tiefsten Punkt wieder anzusteigen. Die gewölbten Flanken sind mit stark verwechteten Eisfeldern belegt, die im nachmittäglichen Licht der waagerecht einfallenden Sonnenstrahlen eine geschuppte Kontur bekommen. So betont der Berg seine Eigenständigkeit als herausragender Wegweiser in die Welt der Annapurna. Der Machhapuchahare.
«Das ist der Fischschwanz», stellt der Bergsteiger den Berg vor. Und Tenji stellt sich vor, wie der Fisch die ganze Zeit wohl auf dem Kopf steht. Ihm wird schwindlig.
«Wie würdest du dort hochklettern?», will der Bergsteiger von ihm wissen und lächelt gespannt.
Tenji ist erstaunt über die Frage und braucht einen Moment, um zu antworten: «Dort, wo du mir den Weg zeigst?»
Der Bergsteiger steht auf und klopft ihm auf die Schulter. Er geht hinüber zu einem der Yaks und fährt dem schnaubenden Tier mit der Hand durch das Fell.
Kaji mahnt zum Aufbruch.
Sie sind guter Dinge auf dem kleinen Hof Himal Pani angekommen. Ihr Glück, hier zu sein, liegt schon im Namen des Ortes begründet. «Himal Pani», glückliches Wasser, wobei «Himal» gleichzeitig auch «heilig» heißen kann. An dem kleinen Wasserfall hat sich eine Bauernfamilie niedergelassen, und mit dem Namen «Himal Pani» wollten sie den Vorbeiwandernden nicht Hochachtung abverlangen, sondern einfach zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Mit den sorgsam gepflegten Blumenhecken, den Schatten spendenden Bananenstauden und dem reichhaltigen Gemüsegarten ist für alle sichtbar, wie viel Liebe an diesem Ort ist. Das Wasser plätschert gemütlich über einen bemoosten Felsen. Die vielköpfige Familie lebt seit einigen Generationen hier auf knapp zweitausend Meter Höhe.
Alle drei, Tenji, Kaji und der Bergsteiger sitzen auf der steinernen Veranda und essen ihren Dal Bhat. Tenji staunt immer wieder, wie selbstverständlich der Westler den Reis mit den Fingern in die Linsensauce schiebt und das Gemüse mischt. Er weiß, dass in dessen Land mit Messer und Gabel oder an anderen Orten mit Stäbchen gegessen wird. Wie gewöhnlich reden sie beim Essen nicht. Und wenn er sieht, wie auch sein Onkel Kaji sich eine Portion nach der anderen einverleibt, dann bestätigt das seine Ansicht über den vorzüglichen Dal Bhat hier.





























