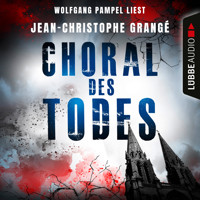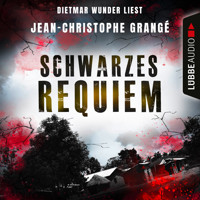7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Ein Kind, vom anderen Ende der Welt, das ein Geheimnis in sich trägt. Gnadenlose Mörder, die seinen Tod wollen. Und eine Frau, die alles tun wird, um das Kind zu retten.
Als die Tierforscherin Diane Thiberge einen kleinen Jungen aus Indonesien adoptiert, ahnt sie nicht, dass ihr Leben zu einem tödlichen Abenteuer wird. Zurück in Frankreich wird ihr Adoptivsohn bei einem mysteriösen Autounfall schwer verletzt und fällt ins Koma. Schon bald kommen Diane Zweifel: Sollte ihr Sohn ermordet werden? Diane will das Geheimnis ihres Adoptivsohnes ergründen und stößt dabei auf eine ganze Serie von unerklärlichen Todesfällen. Ihre Nachforschungen führen sie bis in die Tiefen der Mongolei und an die Grenzen des wissenschaftlich Erklärbaren ...
»Einmal mehr zieht Grangé alle Register seines Könnens, versetzt den Leser in einen Zustand faszinierten Grauens und atemloser Spannung.« Margarete von Schwarzkopf in »Bücherwelt«, NDR
Jean-Christophe Grangé führt uns in eine Welt, in der Grausamkeit und dunkle Gesetze herrschen. Sein Markenzeichen ist Gänsehaut pur.
Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies Jean-Christophe Grangé bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Das Imperium der Wölfe
Das schwarze Blut
Das Herz der Hölle
Choral des Todes
Der Ursprung des Bösen
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Erster Teil: Die ersten Anzeichen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Zweiter Teil: Die Wächter
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Dritter Teil: Tokamak
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Epilog
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein Kind, vom anderen Ende der Welt, das ein Geheimnis in sich trägt. Gnadenlose Mörder, die seinen Tod wollen. Und eine Frau, die alles tun wird, um das Kind zu retten.
Als die Tierforscherin Diane Thiberge einen kleinen Jungen aus Indonesien adoptiert, ahnt sie nicht, dass ihr Leben zu einem tödlichen Abenteuer wird. Zurück in Frankreich wird ihr Adoptivsohn bei einem mysteriösen Autounfall schwer verletzt und fällt ins Koma. Schon bald kommen Diane Zweifel: Sollte ihr Sohn ermordet werden? Diane will das Geheimnis ihres Adoptivsohnes ergründen und stößt dabei auf eine ganze Serie von unerklärlichen Todesfällen. Ihre Nachforschungen führen sie bis in die Tiefen der Mongolei und an die Grenzen des wissenschaftlich Erklärbaren …
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
DER STEINERNEKREIS
Aus dem Französischen von Barbara Schaden
Für Virginie Luc
Erster Teil Die ersten Anzeichen
Kapitel 1
Insgesamt hatte Diane Thiberge genau achtundvierzig Stunden zur Verfügung.
Vom Flughafen Bangkok musste sie mit einem Inlandsflug nach Phuket weiterreisen und von dort aus mit einem Leihwagen in nördlicher Richtung nach Takuapa an der Küste der Adamanensee fahren. Dort würde sie eine kurze Nacht im Hotel verbringen und sich um fünf Uhr morgens wieder auf den Weg machen, immer weiter nach Norden. Zu Mittag wäre sie dann in Ranong an der Grenze zu Birma, wo sie noch die Mangrove überwinden musste, um ans Ziel ihrer Reise vorzudringen. Danach brauchte sie nur auf demselben Weg zurückzukehren und am darauffolgenden Abend die Maschine nach Paris zu erwischen. Die Zeitverschiebung arbeitete zu ihren Gunsten – sie würde gegenüber der Pariser Zeit fünf Stunden gewinnen und konnte am Montagmorgen, dem 6. September 1999, wieder im Büro sein. Wie eine Blume.
Aber die Maschine nach Phuket kam nicht.
Überhaupt lief nichts wie geplant.
Mit verkrampftem Magen stürmte Diane zu den Toiletten. Wie eine Welle schwappte die Übelkeit über ihr zusammen, und sie sagte sich: Es ist der Jetlag, mit meinem Vorhaben hat das gar nichts zu tun. Im nächsten Augenblick übergab sie sich, bis ihre Eingeweide ihr in der Kehle brannten. Das Blut hämmerte in den Adern, kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn, und das Herz raste, irgendwo und überall in ihrem Körper. Sie musterte sich im Spiegel. Sie war aschgrau. In diesem Land kleiner glatthaariger brünetter Menschen fühlte sie sich mit ihren blonden Locken mehr denn je fehl am Platz, und noch viel absurder war ihre Größe – diese enorme Körpergröße, die ihr seit ihrer Jugend zu schaffen machte.
Diane wusch sich das Gesicht, säuberte den goldenen Ring im linken Nasenloch, rückte ihre runde Hippiebrille zurecht und kehrte in die Transithalle zurück, umwallt von ihrem weiten T-Shirt wie ein Geist. Der klimatisierte Raum schien ihr eisig.
Wieder studierte sie die Abflugtafel. Keine Ankündigung für Phuket. Sie ging ein paar Schritte. Ihr Blick fiel auf die überall ausgehängten Warnungen – zweisprachig, auf Thai und auf Englisch: Wer innerhalb Thailands im Besitz harter Drogen verhaftet wird, hat mit dem Tod durch Erschießen zu rechnen. Im selben Moment gingen hinter ihr zwei Polizisten vorbei. Kakiuniformen. Gewehre mit geriffeltem Kolben. Sie biss sich auf die Lippen: Alles an diesem verfluchten Flughafen erschien ihr feindselig.
Sie setzte sich und versuchte ihr Zittern unter Kontrolle zu bringen. Zum tausendsten Mal an diesem Vormittag ging sie die Einzelheiten ihrer Reise durch. Sie musste es schaffen. Es war ihre Entscheidung. Ihr Leben. Sie konnte nicht unverrichteter Dinge nach Paris zurückkehren.
Um zwei Uhr nachmittags hob die Maschine nach Phuket endlich ab. Diane hatte fünfeinhalb Stunden verloren.
Erst hier, in Phuket, erkannte sie die Tropen wieder. Es war eine Erleichterung. Bläuliche Wolkenstreifen zogen sich den Horizont entlang, am Himmel blitzten silberne Feuer. Farblose Bäume flimmerten neben der Landebahn, über die der Staub in aufgeschreckten Spiralen wirbelte. Und dann, vor allem, der Geruch. Der Monsungeruch, heiß, drückend, schwer von Früchten, Feuchte und Fäulnis. Die Trunkenheit des Lebens, wenn es die Schwelle überschreitet und Verwesung wird. Diane schloss die Augen vor Entzücken und hätte sich am liebsten auf der Gangway lang ausgestreckt.
Sechzehn Uhr.
Sie hastete zum Schalter der Autovermietung, riss der Angestellten den Schlüssel aus der Hand und lief zu ihrem Wagen. Unterwegs fing es an zu regnen. Zuerst nur ein paar Tropfen, doch gleich darauf folgten wahre Sturzbäche, die auf das Wagendach hämmerten und einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugten. Gegen die rötliche Schlammflut waren die Scheibenwischer machtlos. Diane klammerte sich mit beiden Händen ans Steuer und fuhr mit der Nase an der Scheibe.
Achtzehn Uhr. Kurz vor Einbruch der Nacht ließ der Wolkenbruch nach, und die Landschaft funkelte im Abendrot. Leuchtend grüne Reisfelder, braune Häuser auf Pfählen, goldene Büffel mit schmalen, spitzen Hörnern. Dazwischen hin und wieder ein ziselierter Tempel mit geschwungenem Dach … Und über allem der Himmel, von Blitzen gestreift und schwarz marmoriert, über den sich rechts nun ein dunkles Rot ergoss.
Um zwanzig Uhr erreichte sie Takuapa. Erst jetzt begann sie sich zu entspannen. Trotz der Verspätung, trotz der Panik war sie noch in der Zeit.
Sie fand ein Hotel im Zentrum der Stadt, in der Nähe eines hohen Wasserturms, und aß im Freien zu Abend, unter einem kleinen Vordach. Nun fühlte sie sich schon viel besser. Der Regen, der wieder eingesetzt hatte, umhüllte sie mit einer Aura wohltuender Frische.
In diesem Moment tauchten die Mädchen auf. Kleine Mädchen, viel zu grell geschminkt, in kunstledernen, hautengen Miniröcken, die Oberkörper in winzige Tops gezwängt. Diane beobachtete sie. Zehn, zwölf Jahre, älter waren sie nicht. Die hohen Absätze Beleidigungen ihrer kindlichen Gesichter. Am anderen Ende des Saals drängten sich schon die blonden Kolosse, Deutsche oder Australier, massig wie Schlachtvieh, und Diane nahm auf einmal eine Feindseligkeit wahr, die ihr selbst galt – als störte ihre Anwesenheit die Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Parteien.
Ein galliger Geschmack stieg ihr in die Kehle. Noch mit knapp dreißig konnte sie den Gedanken an Sex nicht ertragen, ohne dass ihr ein Abscheu, ein unbezähmbarer Ekel den Hals zuschnürte. Sie floh in ihr Zimmer ohne einen Blick zurück, ohne das geringste Mitgefühl mit diesen Kindern, die nun der männlichen Gier ausgeliefert waren.
Dann lag sie unter dem Moskitonetz und dachte wieder an ihr Ziel. Kurz bevor sie einschlief, sah sie die Warntafeln vom Flughafen vor sich, die Uniformen der Polizisten, die Kolben ihrer Waffen, und meinte in der Ferne das Klacken eiserner Riegel zu hören und dahinter das Dröhnen eines Hubschraubers …
Um fünf Uhr morgens war sie wieder auf den Beinen. Von der Übelkeit war nichts mehr zu spüren. Die Sonne schien, das Fenster öffnete sich auf eine üppig blühende Pracht – es war wie der Ausblick durch das Bullauge eines Schiffs auf einen Urwald. Diane war in der Stimmung, notfalls den gesamten Dschungel umzugraben.
Sie machte sich wieder auf den Weg und war am späten Vormittag in Ranong. Genau wie geplant. Sie erspähte das Meer: Es sah eher aus wie ein verschwommener Streifen aus morastigen Tümpeln, die sich zwischen ein Geflecht von Bäumen direkt über dem Wasser schoben. Irgendwo am Ende dieses Wasserlabyrinths verbarg sich die Grenze zu Birma. Ein Fischer erklärte sich wortlos bereit, sie mitzunehmen, und gleich darauf glitten sie durch das schwarze Wasser. Die Hitze, das Licht, die vorüberziehenden grünen Mauern: Mit ausgedörrter Kehle und prickelnder Haut nahm Diane jede Empfindung stoisch hin.
Eine Stunde später erreichten sie eine Landzunge, auf der mehrere Gebäude aus Beton aufragten. Sie setzte einen Fuß auf den Sand und verspürte ein Triumphgefühl wie ein kleines Mädchen: Sie hatte es geschafft. Nirgendwo auf dem Planeten gab es einen Ort, zu dem sie nicht vordringen konnte …
Vor der Poliklinik tobten Kinder herum, gleichgültig gegen die mittägliche Gluthitze. Diane betrachtete die schwarzen Mähnen, die dunklen Augen unter den geschwungenen Wimpern. Sie betrat das Hauptgebäude und fragte nach Térésa Maxwell. Der Schweiß rann an ihr herab, und es kam ihr vor, als durchschritte sie einen Spiegel. Einen Spiegel, den sie sich so oft herbeigeträumt hatte, dass er beinahe blind war.
Eine alte Frau erschien, in einen dunkelblauen Pullover gekleidet, aus dem ein breiter weißer Kragen ragte. Modell Tortenheber. Das breite, eigentlich gutmütige Gesicht unter den kurzen grauen Haaren schien zu einer Miene ständigen Argwohns erstarrt. Diane stellte sich vor. Madame Maxwell führte sie durch eine offene Galerie zu einem Büro, das bis auf einen wackligen Tisch und zwei Stühle völlig kahl war.
Diane zog ihre Akte hervor, die sie auf das Wesentliche reduziert hatte. In misstrauischem Ton fragte Térésa: »Haben Sie Ihren Mann nicht mitgebracht?«
»Ich bin nicht verheiratet.«
Das Gesicht verspannte sich. Die Frau musterte den goldenen Nasenring.
»Wie alt sind Sie?«
»Fast dreißig.«
»Sind Sie unfruchtbar?«
»Ich denke nicht.«
Térésa blätterte in den Unterlagen und murmelte vor sich hin: »Ich weiß nicht, was sich die in Paris einbilden …« Dann sagte sie, lauter, den Blick auf Diane geheftet: »Sie haben eigentlich nicht das richtige Profil, Mademoiselle. Sie sind jung, hübsch, unverheiratet – was wollen Sie hier?«
Diane fuhr auf wie unter Strom. Ihre Stimme war heiser – sie hatte zwei Tage lang kaum gesprochen: »Madame, ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um bis zu Ihnen zu kommen. Ich musste einen endlosen Papierkrieg führen, Verhöre über mich ergehen lassen. Man hat in meiner Vergangenheit gewühlt, in meinem Privatleben, hat mein Einkommen überprüft. Ich musste mich ärztlichen Untersuchungen und psychologischen Tests unterziehen. Ich musste neue Versicherungen abschließen, bin schon zweimal nach Bangkok geflogen und habe ein Vermögen ausgegeben. Heute ist meine Akte absolut in Ordnung, absolut legal. Ich habe soeben zwölftausend Kilometer hinter mich gebracht und muss übermorgen wieder im Büro sein. Also könnten wir jetzt bitte zur Sache kommen?«
In dem Raum aus nacktem Beton trat ein Schweigen ein, das sich qualvoll in die Länge zog. Auf einmal verzog sich das Gesicht der alten Frau zu einem unerwarteten Lächeln. »Kommen Sie«, sagte sie.
Sie durchquerten einen Saal, in dem mehrere Deckenventilatoren rotierten. Vor den Fenstern blähten sich Gardinen, und durch die Luft zogen Schwaden von Karbolsäure, wie von Fieberschüben herbeigeweht. Zwischen den Reihen aus Betten mit eisernen Gitterstäben johlten, liefen, spielten, tobten Kinder aller Altersstufen, während die Aufseherinnen die Lage in den Griff zu bekommen suchten. Die Energie der Kindheit schien sich hier gegen eine süßliche Atmosphäre der Krankheit zu wehren, und tatsächlich wurden Diane bald erschreckende Details bewusst. Verkümmerungen, Narben, Gebrechen. Dianes Blick fiel auf ein Baby, das weder Hände noch Füße hatte. Térésa Maxwell bemerkte dazu: »Er kommt aus Südindien, jenseits der Andamanen. Fanatische Hindus haben ihn verstümmelt, nachdem sie seine Eltern umgebracht hatten. Moslems.«
Diane verspürte einen neuerlichen Brechreiz, und gleichzeitig kam ihr ein absurder Gedanke: Wie erträgt die Frau bei dieser Hitze einen Pullover?
Térésa ging weiter. Sie kamen in einen zweiten Saal. Wieder nur Betten. Und bunte Luftballons, die durch den Raum schwebten. Die Frau deutete zu einer Traube junger Mädchen hinüber, die sich auf einem einzigen Bett zusammendrängten: »Sie sind vom Volk der Karen. Ihre Eltern sind letztes Jahr in einem Flüchtlingslager bei lebendigem Leib verbrannt. Sie …«
Diane umklammerte jäh den Arm der Frau, bis ihre Knöchel weiß wurden. »Madame«, flüsterte sie, »ich will ihn sehen. Sofort.«
Die Direktorin lächelte ohne Fröhlichkeit. »Da ist er doch«, sagte sie.
Diane sah sich um und erblickte in einer Ecke des Saals das Ziel ihrer Reise, die Aufgabe ihres Lebens: einen einsamen kleinen Jungen, der mit Bändern aus Krepppapier spielte. Sie erkannte ihn augenblicklich – man hatte ihr Polaroidfotos geschickt. Seine Schultern waren so schmächtig, dass man meinen konnte, der Wind müsste ihm helfen, sein T-Shirt zu tragen. Sein Gesicht, viel bleicher als das der anderen, drückte eine intensive, angespannte, beinahe allzu nervöse Konzentration aus.
Térésa Maxwell verschränkte die Arme. »Er wird sechs oder sieben Jahre alt sein, genau lässt sich das nicht sagen. Wir wissen ja überhaupt nichts von ihm, weder seine Herkunft noch seine Geschichte. Wahrscheinlich ist er ein Überlebender eines Lagers. Oder der Sprössling einer Prostituierten. Er wurde in Ranong unter den Bettlern gefunden. Er lallt in einem Kauderwelsch vor sich hin, das hier keiner versteht. Zwei Silben haben wir schließlich herausgehört, die immer dieselben sind, ›lü‹ und ›sian‹. Deswegen nennen wir ihn Lü-Sian.«
Diane versuchte zu lächeln, doch ihre Lippen gehorchten ihr nicht. Sie hatte die Hitze vergessen, die Ventilatoren, ihre Übelkeit. Sie schob ein paar Luftballons zur Seite, trat auf das Kind zu und kauerte sich neben ihm nieder. Dort verharrte sie und betrachtete ihn wie ein Wunder.
»Lü-Sian, ja?«, murmelte sie. »Na, dann werden wir dich doch Lucien nennen.«
Kapitel 2
Diane Thiberge war einmal ein ganz normales Mädchen gewesen. Ein leidenschaftliches Kind, das sich allem, was es anfing, mit Konzentration und Eifer widmete. Wenn sie spielte, in sich versunken, lag in ihrer Miene so viel Ernst, dass die Erwachsenen Hemmungen hatten, sie zu stören. Wenn sie vor dem Fernseher saß, legte sie eine solche Aufmerksamkeit an den Tag, dass man meinen konnte, sie versuchte ihrem Gedächtnis jedes einzelne Bild einzuprägen. Sogar ihr Schlaf war wie ein Willensakt, eine Hingabe ihrer gesamten Person, als hätte sie sich vorgenommen, morgens munterer und lebhafter denn je aus den Federn zu springen.
Diane wuchs voller Vertrauen heran. Sie ließ sich von den Geschichten wiegen, die man den Kindern abends vor dem Zubettgehen ins Ohr flüstert. Sie betrachtete ihre Zukunft durch trügerische farbige Filter, Zeichentrickfilme, Bilderbücher, Marionettentheater. Ihr Herz war erfüllt von Flaumfedern, und ihre Gedanken kristallisierten sich wie die dicken Schneeflocken im Frühling um glückliche Gewissheiten. Sie wusste, dass es immer einen Prinzen geben würde, der sie entführte, eine Patin, die sie in ein Lichtgewand kleiden würde, wenn es Zeit war für den Ball. Alles stand schon irgendwo geschrieben, man brauchte nur zu warten.
Und Diane wartete.
Doch es waren andere Mächte, die sie mit sich rissen.
Mit zwölf Jahren fühlte sie seltsame Begierden in sich aufsteigen. Sie hatte das Gefühl, als dehnte ihr Körper sich aus und füllte sich mit Verwirrung. Sie empfand keine zarten Sehnsüchte mehr, sondern dunkle, beängstigende Triebe, die einen geheimnisvollen Schmerz in ihre Brust gruben. Sie sprach mit ihren Freundinnen darüber. Die Mädchen grinsten und zuckten die Achseln, und Diane begriff, dass sie genau dieselben Empfindungen erlebten, doch zogen sie es vor, sich hinter ihren unsicheren Schminkversuchen oder dem Rauch ihrer ersten Zigaretten zu verschanzen. Diane passten solche Ausflüchte nicht. Sie wollte sich der Realität stellen, wie auch immer sie aussah.
Im Übrigen entwickelte sie einen erbarmungslos scharfen Blick. Sie fühlte sich jetzt in der Lage, sofort alle Lügen, alle Kompromisse ihrer Mitmenschen zu entlarven. Die Welt der Erwachsenen stürzte von ihrem Sockel. Die Männer und Frauen, die man ihr stets als Vorbilder präsentiert hatte, erschienen ihr mit einem Mal als verweichlichte, hinterhältige, heuchlerische Feiglinge.
Allen voran ihre Mutter.
Eines Morgens gelangte Diane zu der Erkenntnis, dass die Frau, mit der sie zusammenlebte, sie nicht liebte, von Geburt an nie geliebt hatte. Sybille Thiberge mochte sich noch so sehr anstrengen, ihre Tochter glaubte an die Darstellung der vorbildhaften Mutter nicht mehr. Im Gegenteil, sie empfand immer größeres Misstrauen. Zu blond war sie, zu schön, zu sinnlich. Diane zählte die kleinen Details auf, die sie als Beweise der künstlichen Natur ihrer Mutter nahm, bei der sich alles nur um sie selbst und ihre Verführungskünste drehte. Die Affektiertheit, die sie zur Schau trug, sobald ein Mann ihr schmeichelte, dieses extravagante Lachen, kaum tauchte in der Umgebung ein männliches Wesen auf – das alles war unecht, kalkuliert, geziert. Sie war eine Lüge von Kopf bis Fuß – und das Zusammenleben von Mutter und Tochter eine einzige Verstellung.
Den Beweis bekam sie, als sich der Unfall ereignete, im Juni 1983, als Diane allein von der Hochzeit ihrer Patentante Isabelle Ybert zurückkehrte. Sybille hatte es vorgezogen, am Arm ihres neuesten Liebhabers eigene Wege zu gehen. »Der Unfall.« Die Bezeichnung war keineswegs zutreffend, doch so pflegte Diane das Unglück zu nennen, das ihr in den Gassen von Nogent-sur-Marne zugestoßen war. Noch als Erwachsene weigerte sich sich, daran zu denken. Geblieben war ihr nur ein Splitter Zeit, in dem Weidenlaub und ferne Lichter blitzten und ein vermummter Kopf keuchte, ganz nah … Und wenn sie ein Zweifel an der Realität des Ereignisses beschlich, brauchte sie nur die feinen Narben zu betasten, die sich unter ihren Schamhaaren wölbten.
Das Mädchen wusste nicht, wie ein derartiger Alptraum Wirklichkeit hatte werden können, doch eines wusste sie mit Sicherheit: Es war die Schuld ihrer Mutter. Wegen ihres Egoismus, ihrer absoluten Gleichgültigkeit gegen alles, was nicht mit ihren muskulösen Hinterbacken und der wilden Begierde ihrer Liebhaber zu tun hatte, die einen unheilvollen Kreis um sie zogen. Hatte sie ihre Tochter nicht genau aus diesem Grund allein nach Hause geschickt? Hatte sie nicht Diane einfach vergessen? Der Angriff war der Beweis, der sie überführte, ein für alle Mal.
Diane war knapp vierzehn. Sie erzählte Sybille kein Wort. Ihre Rache schien ihr vollständiger, gelungener, wenn sie ihre Mutter in Unkenntnis des Dramas ließ. Allein leckte sie ihre Wunden und verschloss ihr Leid über dem Geheimnis. Dafür verlangte sie, mit dem Beginn des nächsten Schuljahrs ins Internat geschickt zu werden. Sybille sträubte sich eine Zeit lang der Form halber, doch dann gab sie der Forderung nach und war in Wahrheit nur zu glücklich, dass sie diese wortkarge Bohnenstange, in der ihr auf amourösem Gebiet allmählich eine Konkurrenz heranwuchs, endlich los war.
Wortkarg, das war Diane allerdings. Weil sie nachdachte. Sie zog Lehren aus ihrem Erlebnis. Die Welt war in Wahrheit nichts als Gewalt, Verrat, Unheil. Das Leben beruhte auf dieser unbezähmbaren Kraft, diesem verhärteten Knoten des Hasses in der Seele jedes Menschen, der sich beim geringsten Anlass entzünden konnte. Diane nahm sich vor, diese Macht zu studieren. Die strukturelle Gewalt der Welt zu begreifen, zu beobachten, zu analysieren.
Sie fasste zwei Entschlüsse.
Der erste: nach dem Abitur Biologie und Ethologie zu studieren – die Wissenschaft vom Verhalten der Tiere. Ihr Spezialgebiet kannte sie bereits: Raubtiere. Und im besonderen die Jagd- und Kampftechniken, mit deren Hilfe die Raubkatzen, Reptilien, ja die Insekten über ihr Revier herrschten und überlebten, indem sie andere vernichteten. Für sie war es eine Möglichkeit, direkt ins Wesen der Gewalt einzutauchen. Einer natürlichen Gewalt, frei von jeglicher Moral und jedem anderen Beweggrund als der einfachen Logik des Lebens. Vielleicht war es auch eine Möglichkeit, ihren »Unfall« zu legitimieren, das Grauen zu lindern, indem sie die Gewalt als solche in eine umfassendere, universalere Logik einordnete.
Soviel zur geistigen Ebene.
Auf der körperlichen Ebene entschied sich Diane für Wing-Tsun.
Wörtlich: »ewiger Frühling«. Wing-Tsun ist die schnellste, effizienteste Variante des Shaolin-Boxens. Eine Technik, die den Nahkampf bevorzugt und angeblich von einer buddhistischen Nonne entwickelt worden war. Mit Beginn des Schuljahrs 1983 schrieb sich Diane an einer Schule nahe ihrem Internat in der Umgebung von Fontainebleau ein. Bereits im ersten Jahr bewies sie ein durchaus ungewöhnliches Talent. Zu dem Zeitpunkt maß sie über eins fünfundsiebzig und wog knapp fünfzig Kilo. Trotz ihrer stangenförmigen Erscheinung legte sie die Geschmeidigkeit einer Akrobatin und eine außerordentliche Muskelkraft an den Tag.
Ihre Lehrer, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst waren, boten ihr eine vertiefte Ausbildung an, einschließlich einer Einführung ins wu-te, der Tugend der martialischen Disziplin. Diane lehnte ab. Von Philosophie oder gar kosmischer Energie wollte sie nichts hören. Sie hatte nichts anderes im Sinn, als ihren Körper zu schmieden wie eine Waffe, um nie, niemals mehr das junge Mädchen zu sein, das man überrumpeln konnte.
Die Meister, weise und unbeugsame Asiaten, gerieten durch ihre aggressive Reaktion ein wenig aus der Fassung, doch sie hatten eine außerordentliche Kämpferin vor sich, das wussten sie, und Philosophie hin oder her – solche Begabungen waren selten.
Das Training wurde verstärkt. Wettkampf folgte auf Wettkampf. 1986 errang die Schülerin Thiberge den Titel der französischen Jugendmeisterin. 1987 gewann sie bei den Europameisterschaften den silbernen und im Jahr darauf den goldenen Gürtel. Ihre Siege erfolgten blitzschnell. Die Schiedsrichter waren verdutzt und das Publikum ein wenig enttäuscht. Diane, die immer nahe war, immer nach vorn geneigt, wankte nie und hielt den Blick stets auf die Hände ihrer Gegnerinnen geheftet. Während die Mädchen noch nach einer Lücke suchten, lagen sie schon mit beiden Schultern auf dem Boden.
Nichts schien den Aufstieg der jungen Athletin aufhalten zu können. Doch im Jahr 1989 verzichtete Diane auf die Teilnahme an den Wettkämpfen. Sie war knapp zwanzig, und wie durch ein Wunder hatte ihr Gesicht nie einen Schlag abbekommen, ihr Körper nie eine ernsthafte Verletzung davongetragen. Damit wäre es früher oder später vorbei, das wusste sie – und ohnehin, fand sie, hatte sie ihr Ziel erreicht.
Sie war geworden, was sie sich vorgenommen hatte: ein in jeder Hinsicht gefährliches Mädchen, dem man lieber nicht zu nahe kam.
Kapitel 3
Diane Thiberge hörte damals Frankie Goes to Hollywood, mit einem winzigen Walkman und voll aufgedrehten Bässen. Sie liebte diese Gruppe. Weil sie am Schnittpunkt mehrerer, scheinbar unvereinbarer Richtungen stand, die sie auf geniale Weise zu einem grandiosen Sound verband.
Schon deshalb, weil sie eine Gruppe knallharter Burschen waren, Straßenjungen direkt aus Liverpool. Außerdem waren sie eine Post-Disco-Band und hatten ein Gefühl für Rhythmik, für Groove entwickelt, der jeden Discobesucher im Handumdrehen mitriss. Schließlich war Frankie eine Schwulen-Band. Und das war das Verrückteste daran: Diese geballte Wucht aus Gebrüll, barbarischen Rhythmen und kämpferischen Parolen kam von einer Bande von Irren, die direkt vom Hof Ludwigs XIII. zu stammen schienen, und diese Kombination verlieh den Musikern eine unglaubliche Leichtigkeit, Beweglichkeit und Wendigkeit, die ihnen niemand so leicht nachmachte. Das fünfte Bandmitglied spielte überhaupt kein Instrument, sondern sang nur, tanzte nur, er war der »Mann in Bewegung« im Hintergrund der Bühne, der unter seiner Lederjacke die Schultern rollen ließ. Diane überlief jedesmal ein Schaudern: Jawohl, Frankie war eine Wahnsinnsband.
Die langen Nächte der Studentin beschränkten sich allerdings mehr oder weniger aufs Musikhören. Sie ging nicht aus, tanzte nicht, traf sich mit niemandem, sondern konzentrierte sich ganz auf ihr Studium der Ethologie, saß allabendlich in ihrer Bude im Viertel Cardinal-Lemoine, vertieft in Konrad Lorenz und Johann von Uexküll, und ernährte sich von Hamburgern.
Aber einmal, an einem Abend, wollte sich Diane doch ins Gewühl stürzen.
Nathalie, die kleine Pest aus dem Biologieseminar, die es verstand, sich alles unter den Nagel zu reißen, was der Fachbereich zu bieten hatte, veranstaltete ein Fest, und Diane wollte hingehen.
Es war der richtige Augenblick: jetzt oder nie.
Der ideale Anlass, um die Probe aufs Exempel zu machen.
Später dachte Diane oft an diese entscheidende Nacht zurück. Die Ankunft in dem Mietshaus aus Quadersteinen am Boulevard Saint-Michel, die Stille im Treppenhaus, der Veloursteppich auf den Stufen. Dann das dumpfe Hämmern der Bässe, das aus einem der oberen Stockwerke drang. Sie versuchte ihr rasendes Herz zu besänftigen, das synkopisch zu den tiefen Rhythmen von oben schlug, und umklammerte den eisigen Hals der Champagnerflasche, die sie eigens besorgt hatte. Als sie oben vor der Wohnung stand, war der rhythmische Lärm so ohrenbetäubend, dass er die breite lackierte Holztür aus den Angeln zu sprengen drohte. Die hören mich nie, dachte sie, während sie auf die Klingel drückte.
Doch beinahe augenblicklich ging die Tür auf, und ein Schwall Musik quoll heraus. Diane erkannte sofort die Stimme von Holly Johnson, dem Sänger von Frankie, der brüllte: »RELAX! DON’T DO IT!« Das war ein günstiges Vorzeichen: Ihre geliebte Band, ihr Fetisch, begleitete sie bei der Prüfung. Eine Dunkelhaarige mit knochigen Gesichtszügen unter einem übertrieben grellen Make-up wippte auf der Türschwelle auf und ab. Nathalie-die-Medusa in Person.
»Diane!«, schrie sie. »Das ist ja supertoll, dass du kommst …«
Diane lächelte über die Lüge, während Nathalie sie von Kopf bis Fuß musterte. Diane trug eine schwarze Weste mit Perlmuttknöpfen und eine enganliegende lange Hose aus dunklem Molton – diesem Stoff, der damals unumschränkt über die Körper junger Mädchen herrschte. Im Übrigen war sie in einen riesigen wattierten Mantel gehüllt, der ebenfalls schwarz war.
»Bist du mit Schlafanzug und Bettdecke gekommen?«, fragte Nathalie grinsend.
Diane fasste mit Daumen und Zeigefinger das schwarze Taftkleid des Mädchens an.
»Ist doch ein Kostümfest, oder?«
Nathalie brach in Gelächter aus. Sie nahm ihr die Champagnerflasche ab und forderte sie brüllend auf: »Komm rein. Tu deine Sachen in das Zimmer da hinten.«
Drinnen tobte das Fest. Nachdem Diane ihren Mantel abgelegt hatte, bezog sie in der Nähe des Buffets Stellung, dem traditionellen Ankerplatz für alle, die niemanden kennen. Sie hatte sich vorgenommen, keinen Alkohol anzurühren, um einen klaren Kopf zu behalten, was auch immer geschah. Doch nach einer Stunde Langeweile war sie bereits beim dritten Glas angelangt. Sie nippte in kleinen Schlucken, während sie zur Tanzfläche hinüberschaute.
Die Uhr lief.
Zwar hatte Diane mit Festen dieser Art nicht viel Erfahrung, doch der rituellen Zyklen, die dabei abliefen, war sie sich jedenfalls bewusst. Um Mitternacht begann das Vorspiel. Die Mädchen tanzten, wirbelten herum, stellten sich mit übertriebenen Hüftschwüngen und Schütteln ihrer langen Mähnen zur Schau, während die Jungen sich im Hintergrund hielten, verstohlene Blicke warfen, mit flotten Sprüchen den Kontakt einleiteten …
Um zwei Uhr morgens begann eine neue Phase, das Fest begann zu brodeln, die Musik nahm an Lautstärke zu. Der Alkohol überwand jede Hemmung, alle Hoffnungen waren erlaubt. Die Jungen schritten zur Tat, brüllten über die Menge hinweg, suchten sich ihre Beute. Wieder war es Frankie, der die Menge bis zur Raserei aufpeitschte. Two Tribes. Ein Protestsong gegen den Krieg, unterlegt von einem wilden Beat, von dem Diane jede einzelne Note, jeden einzelnen Riff kannte.
Nun überließ auch sie sich der Musik. Sie stürzte sich ins Gewühl und verbarg, so gut es ging, ihre heuschreckenartigen Gliedmaßen. Sie bemerkte etliche Blicke in ihre Richtung und traute ihren Augen nicht. Schüchtern über alle Maßen, wusste sie doch, dass sie selbst noch mehr einschüchterte. In den meisten Fällen hielten ihre Schönheit, ihre Lockenmähne und ihre enorme Größe alle Kandidaten in gebührendem Abstand. Aber an diesem Abend war es anders: Ein paar ganz besonders Verwegene wagten es tatsächlich, sie anzusprechen.
Sie spürte jetzt, wie ihr Körper sich in leichten Spiralen auflöste und über dem Hämmern des Schlagzeugs schwebte, zwischen den anderen kreiste. In diesem Augenblick griff ein Typ nach ihrer Hand und wollte einen Rock ’n’ Roll tanzen. Auf allen Tanzflächen der Welt gibt es immer einen, der sich in den Kopf setzt, jedem beliebigen Rhythmus irgendwelche komplizierten Schritte aufzuzwingen. Diane wich sofort zurück. Der andere ließ sich nicht abschrecken. Abwehrend hob sie beide Handflächen. Nein. Sie tanzte keinen Rock ’n’ Roll. Nein. Sie ließ sich von keinem bei der Hand nehmen. Sie ließ sich überhaupt von niemandem irgendwo anfassen. Der Typ fing an zu lachen und verschwand in der Menge.
Einen Moment lang stand sie da wie versteinert und starrte auf ihre Hand, als hätte sie sich bei der Berührung verbrannt. Sie wankte, wich zurück bis zur Wand und ließ sich daran zu Boden gleiten. Neben sich fand sie ein halb volles Glas. Sie leerte es in einem Zug und hielt sich krampfhaft daran fest, reglos. Die Trauer überwältigte sie. Die erlebte Szene brachte ihr wieder die grausame Wahrheit zu Bewusstsein: Sie konnte nicht die geringste Berührung ertragen. Keine Liebkosung, nicht einmal ein flüchtiges Streifen ihrer Haut. Jedweder Körperkontakt war ihr unerträglich.
Um drei Uhr morgens nahm die Musik eine esoterische Wendung: O Superman von Laurie Anderson. Ein eigenartiges Wiegenlied, durchsetzt von hypnotisierendem Seufzen. Es war die Stunde der letzten Chancen. Im Halbdunkel waren nur noch ein paar vereinsamte Gestalten übrig, die sich im Rhythmus dieses Singsangs wiegten. Ein paar hartnäckige Jäger und ein paar arme Mädchen, die sich nicht geschlagen geben wollten.
Diane musterte die aufgelösten Gesichter, die schwankenden Schatten und hatte den Eindruck, sie betrachtete ein von Verwundeten und Sterbenden übersätes Schlachtfeld. Sie ging ihren Mantel holen und strich dann unauffällig entlang dem von leeren Flaschen überquellenden Buffet zur Wohnungstür. Im Geist war sie bereits draußen, stellte sich die kalte Luft vor, die sie wieder so weit ausnüchtern würde, dass sie über ihr Scheitern ausgiebig nachdenken konnte.
In diesem Augenblick spürte sie zwei Hände, die sich von hinten um ihre Taille legten.
Sie fuhr herum, an das Buffet gelehnt, gespannt wie ein Bogen.
Drei Kerle umringten sie und verströmten intensiven Alkoholdunst.
»He, Leute, da gibt’s tatsächlich noch was abzusahnen …«
Einer der Angreifer streckte von neuem die Hände nach ihr aus. Diane entzog sich ihm mit einem Hüftschwung und drehte sich wieder zum Tisch. Sie legte ihren Mantel ab, erspähte ein volles Glas und tat, als wollte sie trinken. Einen Augenblick lang dachte sie, die drei hätten aufgegeben, doch ein alkoholschwerer Atem hauchte ihr in den Nacken. Das Glas zerbarst zwischen ihren Fingern. Eine Scherbe trug Lippenstiftspuren. Diane drückte ihre Handfläche darauf und spürte, wir ihr das Glas ins Fleisch schnitt.
»Haut ab, lasst mich in Ruhe«, murmelte sie.
Die Burschen hinter ihr rückten glucksend näher.
»Oh-oh, zieren wir uns?«
Heiße Tränen traten ihr in die Augen und rannen ihr unter der Brille hervor über die Wangen. Langsam und deutlich sagte sie sich: Tu’s nicht. Aber einer der Betrunkenen gab jetzt saugende Geräusche von sich, direkt in ihr Ohr, und lallte etwas von Miezen und Würsten und Pelz, und sie dachte wieder: Tu’s nicht. Aber sie hatte bereits die Brille abgelegt und ihre Mähne zu einem Knoten geschlungen. Während sie noch mit ihrem Haar beschäftigt war, hatte einer der Burschen eine Hand unter ihre Weste geschoben, sie spürte die Wärme seiner tastenden Finger auf ihrer Brust, während eine feixende Stimme säuselte: »Mach mich nicht an, Süße, sonst …«
Das Knacken eines gebrochenen Kiefers blendete kurz die Musik von Art of Noise aus.
Der Typ wurden gegen den Kamin geschleudert und prallte mit dem Gesicht gegen eine Marmorkante. Diane hatte ihm einen Schlag mit dem Ellenbogen versetzt – jang tow. Noch einmal dachte sie: NEIN, doch gleichzeitig schoss ihre Hand vor und wie ein Rammbock in die Rippen des zweiten Gegners, die ein trockenes Splittern von sich gaben. Er landete auf dem Buffet, das unter Getöse zusammenbrach.
Diane rührte sich nicht mehr. Eines der Grundprinzipien von Wing-Tsun ist der äußerst sparsame Gebrauch von Kraft und Atem. Der letzte Angreifer hatte sich aus dem Staub gemacht. Erst jetzt wurde sie sich der entgeisterten Mienen, des verlegenen Raunens ringsum bewusst. Sie setzte ihre Brille wieder auf. Sie war selbst befremdet – nicht von ihrer Gewalttätigkeit oder dem Skandal. Sondern von ihrer eigenen Ruhe.
Irgendwo hinter ihr fing Nathalie zu kreischen an: »Bist du jetzt komplett durchgeknallt, oder was?«
Diane drehte sich langsam zu ihr um und erklärte: »Tut mir leid.«
Sie durchquerte das Zimmer, dann wiederholte sie über die Schulter, schreiend: »Tut mir leid!«
Der Boulevard Saint-Michel war genau so, wie sie gehofft hatte.
Menschenleer. Eisig. Hell erleuchtet.
Diane marschierte unter Tränen, gedemütigt und erleichtert zugleich. Jetzt hatte sie den Beweis, auf den sie gewartet hatte. Den Beweis, dass ihr Leben für immer genau so verlaufen würde: außerhalb des Kreises, fern von den anderen. Und wieder dachte sie an das Ereignis, mit dem alles begonnen hatte, diese grausame Szene, die ihre natürlichsten Impulse zerstört und rund um ihren Körper eine Festung errichtet hatte: unsichtbar, unverständlich – und uneinnehmbar.
Sie sah die Weiden wieder vor sich, die Lichter.
Sie spürte den Knebel aus Gras im Mund, den Atem unter der Vermummung.
Und sie sah auch mit einer Aufwallung von Hass das Gesicht ihrer Mutter – doch dann lächelte sie müde: An diesem Abend hatte sie nicht mehr die Kraft, irgendjemanden zu hassen. Sie erreichte die Place Edmond-Rostand, im Brunnen spiegelten sich die Lichter, und links von ihr raschelte leise das freundliche Laub des Jardin du Luxembourg. Spontan reckte sie sich und berührte mit den Fingerspitzen die Blätter an den Ästen, die über das schwarz-goldene Gitter hingen.
Mit einem Mal fühlte sie sich so leicht, dass sie meinte, nie wieder fallen zu können.
Dies geschah am Samstag, dem 18. November 1989. Diane Thiberge war soeben zwanzig geworden, aber sie wusste: Ihr Leben als junges Mädchen hatte sie für immer begraben.
Kapitel 4
»Brauchen Sie etwas?«
»Nein, danke.«
»Sicher nicht?«
Diane sah auf. Die Stewardess – blaues Kostüm und purpurnes Lächeln – bedachte sie mit einem mitfühlenden Blick. Einem Blick, der sie endgültig in Harnisch brachte. Sie mühte sich damit ab, die Fleischstücke des »Juniormenüs« zu zerkleinern, das man dem kleinen Jungen kurz nach dem Start in Bangkok vorgesetzt hatte, aber das Plastikbesteck verbog sich unter ihren Fingern, und mit ihren hektischen Gesten brachte sie nichts weiter fertig, als das Essen in der Schüssel zu zermanschen. Sie hatte das Gefühl, alle beobachteten sie und weideten sich an ihrer Ungeschicktheit, ihrer Nervosität.
Die Stewardess ging weiter. Diane hielt dem Jungen wieder einen Bissen hin. Er weigerte sich, den Mund zu öffnen. Das Blut schoss ihr in die Wangen, und sie fühlte sich vollkommen hilflos. Wieder dachte sie an den Anblick, den sie bot mit ihrem hochroten Kopf, ihren zerzausten Haaren und ihrem schwarzäugigen kleinen Jungen. Wie oft hatten die Stewardessen genau diese Szene schon beobachtet? Aufgelöste, desorientierte Europäerinnen, die ihr künftiges Schicksal mit nach Hause nahmen?
Die blaue Gestalt tauchte wieder auf. »Bonbons vielleicht?«
Diane lächelte angestrengt. »Nein, wirklich: Es ist alles bestens.«
Wieder versuchte sie dem Jungen einen Bissen einzuflößen, doch es war vergeblich. Das Kind starrte unverwandt auf den Bildschirm, auf dem ein Zeichentrickfilm lief. Sie sagte sich, dass eine verweigerte Mahlzeit keine Staatsaffäre ist, schob das Tablett beiseite und setzte Lucien die Kopfhörer auf. Dann zögerte sie. Sollte sie den englischsprachigen Kanal einstellen? Den französischen? Oder einfach nur Musik? Alles verunsicherte sie, selbst das geringste Detail. Sie entschied sich für den Musikkanal und stellte behutsam die Lautstärke ein.
Die Tabletts wurden eingesammelt, und im Flugzeug kehrte Ruhe ein. Die Beleuchtung war gedämpft, Lucien döste bereits. Diane streckte ihn auf den beiden freien Sitzen neben ihr aus, dann machte sie es sich selbst bequem und breitete die Decke der Fluggesellschaft über sich. Auf Langstreckenflügen war ihr dies sonst die liebste Stunde: die gedämpfte Beleuchtung, der flimmernde Bildschirm in der Ferne, die Passagiere reglos, zusammengekauert wie Kokons unter ihren Decken und ihren Kopfhörern … Dann schien alles zu treiben, zwischen Schlaf und Höhe zu schweben, irgendwo über den Wolken.
Diane lehnte den Kopf zurück und zwang sich zur Reglosigkeit. Nach und nach entspannten sich ihre Muskeln, die Schultern sanken herab, und eine tiefe Ruhe strömte durch ihre Adern. Mit geschlossenen Augen ließ sie auf dem schwarzen Hintergrund ihrer Lider die einzelnen Etappen vorüberziehen, die sie hierher geführt hatten, an diesen entscheidenden Wendepunkt ihres Lebens.
Die sportlichen Leistungen und mondänen Erfolge lagen weit zurück. Im Jahr 1992 hatte Diane cum laude in Verhaltensforschung promoviert. Ihre Doktorarbeit trug den Titel »Die Jagdstrategien und die Strukturierung des Reviers bei den großen Raubtieren im Nationalpark Massai Mara, Kenia«. Gleich danach hatte sie für mehrere private Stiftungen gearbeitet, die für die Erforschung und den Schutz der Natur erhebliche Summen ausgaben. Diane war durch Schwarzafrika, Südostasien und Indien gereist, vor allem durch Bengalen, wo sie an einem Programm zur Rettung des Tigers im Gebiet der Sundarbands mitarbeitete. Außerdem hatte sie eigenverantwortlich eine einjährige Studie über das Verhalten der kanadischen Wölfe durchgeführt, die sie beobachtet und bis an die Grenze der Nordwestterritorien, des nördlichsten Landesteils, begleitet hatte.
Sie führte nun das Leben einer Forschungsreisenden, immer unterwegs und immer allein, der Natur so nahe wie möglich und letztlich weitgehend im Einklang mit den Träumen ihrer Kindheit. Entgegen allen Erwartungen, trotz ihres Traumas und ihrer geheimen Defizite hatte Diane eine Art von Glück gefunden, das sie mit niemandem teilte, und war stark durch ihre Unabhängigkeit.
Aber im Jahr 1997 sah sie ein neues schicksalhaftes Datum auf sich zukommen: Auf einmal wurde sie sich bewusst, dass sie bald dreißig war.
An sich bedeutete der dreißigste Geburtstag nichts. Vor allem nicht für ein Mädchen wie Diane: Dank ihrer Konstitution und Körpergröße und ihrem Leben in der freien Natur war sie gegen den Zahn der Zeit besser gefeit als ihre Altersgenossinnen. Doch aus biologischer Sicht war die Zahl drei eine Schwelle. Als Biologin, Expertin für die Wissenschaft vom Leben, wusste sie, dass sich der weibliche Fortpflanzungsapparat von diesem Zeitpunkt an unmerklich zurückzubilden beginnt. Den Sitten und Gebräuchen der Industrieländer zum Trotz sind die weiblichen Geschlechtsorgane darauf angelegt, schon sehr früh zu funktionieren, wie die jugendlichen Mütter in Afrika – kaum älter als fünfzehn – beweisen, denen Diane so häufig begegnet war. Das Überschreiten der Schwelle rief ihr symbolisch eine ihrer tiefsten Erkenntnisse in Erinnerung: Sie würde nie ein Kind haben. Aus dem einfachen und einleuchtenden Grund, weil sie nie einen Mann haben würde.
Doch zu diesem Verzicht war sie nicht bereit. Sie machte sich auf die Suche nach Lösungen. Sie besorgte sich mehrere Fachbücher und vertiefte sich beklommen in die Welt der Reproduktionsmedizin. Da gab es zunächst die künstliche Befruchtung. In ihrem Fall musste sie eine Insemination mit Spendersamen ins Auge fassen. Das Spermienpellet käme von einer Samenbank und würde ihr während der fruchtbarsten Phase des Menstruationszyklus entweder durch den Gebärmutterhals oder direkt in den Uterus injiziert. Das bedeutete, dass die Ärzte mit spitzen, krummen, eiskalten Instrumenten in sie eindringen würden, dass die Substanz eines Fremden sich in ihren Bauch einschleichen und in ihre physiologischen Abläufe eingreifen würde. Sie stellte sich vor, wie ihre Organe – Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke – reagierten, im Kontakt mit dem »Fremden« in Aktion traten … Nein. Niemals. Für sie wäre das nichts anderes als eine klinische Vergewaltigung.
Sie befasste sich mit einer anderen Möglichkeit, der In-vitro-Fertilisation, und las, dass ihr dabei durch Punktion Follikel entnommen und im Reagenzglas künstlich befruchtet würden. Der Gedanke, dass der Vorgang außerhalb ihres Körpers stattfand, in der Sterilität eines Operationssaals, erschien ihr zunächst verlockend. Doch sie las weiter: Nach erfolgter Befruchtung werden ein oder mehrere Embryonen durch die Vagina in die Gebärmutter implantiert. Diane stockte und begriff, wie blind sie schon wieder gewesen war. Was hatte sie sich denn vorgestellt: dass sich auch die Schwangerschaft in der Retorte abspielen würde, gut geschützt hinter Milchglas? Dass sie zusehen könnte, wie der Embryo nach und nach heranwuchs, als vergeistigte Mutation?
Ihre hartnäckige Phobie errichtete eine Wand, eine unüberwindliche Mauer zwischen ihr und jedem Kinderwunsch. Ihr Körper, ihre Gebärmutter würden sich für immer gegen ihre natürliche Funktion, die wunderbare Entwicklung eines Kindes wehren. Diane versank in einer tiefen Depression. Eine Zeit lang verbrachte sie in einem Sanatorium, danach zog sie sich in die Villa zurück, die Charles Helikian, der Ehemann ihrer Mutter, am Mont Ventoux im Luberon besaß.
Dort, unter glutheißer Sonne und beim Zirpen der Grillen, fasste sie einen neuen Entschluss. Wenn ihr jeder biologische Versuch verwehrt war, wollte sie es auf anderem Weg versuchen: Adoption. Dieser Ausweg erschien Diane als der bei weitem bessere, denn er war eine echte moralische Verantwortung und nicht der zweitklassige Versuch, die Natur nachzuahmen. In ihrer Lage war diese Entscheidung die einzig vernünftige und die ehrlichste. Gegenüber sich selbst ebenso wie dem Kind gegenüber, das ihr Leben teilen würde.
Im Herbst 1997 unternahm sie die ersten Schritte. Zuerst versuchte man sie mit allen Mitteln von ihrem Vorhaben abzubringen. Auf dem Papier hatten auch Unverheiratete das Recht zur Adoption. In der Praxis jedoch war es sehr schwierig, in ihrer Situation, die auf eine homosexuelle Orientierung hindeuten könnte, die Genehmigung des Jugendamts und der Adoptionsvermittlungsstelle zu bekommen. Diane ließ sich jedoch nicht entmutigen, sondern stellte ihr Dossier für einen Genehmigungsantrag zusammen. Es folgten monatelange Gespräche, Nachforschungen, Prüfungen – das Verfahren drehte sich im Kreis und führte nie zu irgendeinem Ergebnis.
Fast eineinhalb Jahre nach ihrer ersten Anfrage war sie noch immer keinen Schritt weitergekommen. Ihr Stiefvater bot ihr an, sich für sie zu verwenden. Er könne, meinte er, ihren Antrag ein wenig befördern. Diane lehnte rundheraus ab. Diese Intervention stellte eine – wenn auch indirekte – Einmischung ihrer Mutter in ihr Leben dar. Dann besann sie sich. Sie durfte nicht zulassen, dass ihre Ängste und ihr Zorn ein so wichtiges Vorhaben vereitelten. Was Charles Helikian wirklich unternahm, erfuhr sie nie, doch einen Monat später hatte sie die Genehmigung der Adoptionsstelle.
Nun musste sie nur noch ein Waisenhaus finden, das ihr ein Kind anvertraute – Diane hatte sich immer vorgestellt, dass sie einen kleinen Jungen aus einem fernen Land adoptieren würde. Sie wandte sich an zahlreiche Organisationen, die Waisenhäuser in allen Teilen der Welt unterstützten, und fühlte sich wieder einmal verloren. Und wieder trat ihr Stiefvater als Vermittler auf den Plan. Als gelegentlicher Sponsor ließ er der Stiftung Boria-Mundi, die mehrere Waisenhäuser in Südostasien finanzierte, alljährlich eine bedeutende Summe zukommen. Falls Diane einverstanden sei, sich an diese Stiftung zu wenden, könnten die letzten Schritte sehr schnell über die Bühne gehen.
Drei Monate später suchte sie das Waisenhaus von Ranong auf, nachdem sie schon zuvor zweimal nach Bangkok geflogen war, um alle administrativen Hürden hinter sich zu bringen. Charles hatte die Auswahl des Mündels überwacht und dabei besonders den Umstand berücksichtigt, dass Diane, anders als die meisten Adoptivmütter, ein Kind von mehr als fünf Jahren bei sich aufnehmen wollte. Im allgemeinen ziehen Adoptiveltern ein Neugeborenes vor, weil sie davon ausgehen, dass dem Säugling die Anpassung leichter fällt. Diane widerstrebte dies, ja, sie empfand einen regelrechten Abscheu: Die Vorstellung, dass manche Waisen, die ohnehin alles verloren haben, zum Überfluss auch noch das Pech haben, dass sie schon zu groß sind oder zu spät ausgesetzt wurden, brachte sie ganz selbstverständlich dazu, sich gerade für die Übriggebliebenen zu interessieren …
Auf einmal schreckte der kleine Junge neben ihr auf. Diane öffnete die Augen und stellte fest, dass die Kabine des Flugzeugs von hellem Sonnenlicht erfüllt war, und sie begriff, dass sie zur Landung ansetzten. In jäher Panik drückte sie das Kind an sich und spürte, wie die Maschine auf der Rollbahn aufsetzte. Es waren nicht der Kontakt der Reifen mit dem Asphalt, es waren ihre eigenen Träume, die sich jetzt an der Wirklichkeit rieben.
Kapitel 5
Neben vielen guten Vorsätzen, die sie gefasst hatte, war Diane auch fest entschlossen, vom ersten Tag an ihre Arbeitszeit einzuhalten. Sie wollte Lucien so rasch wie möglich an den Alltag gewöhnen. Zu der Zeit war sie mit der Niederschrift eines Berichts über »die zirkadianen Rhythmen der Großräuber im Nationalpark Hwange in Zimbabwe« beschäftigt, der dringend fertig werden musste, damit sie beim WWF International, der sich bereits an der Finanzierung ihrer Expedition nach Südafrika beteiligt hatte, neue Mittel beantragen konnte. Aus diesem Grund begab sie sich allmorgendlich ins Institut für Verhaltensforschung an der Universität, wo man ihr ein kleines Zimmer in der Nähe der Bibliothek zugewiesen hatte, damit sie ihre wissenschaftlichen Quellen leicht überprüfen konnte.
Zur Betreuung ihres Sohnes hatte Diane eine junge Thailänderin engagiert, die an der Sorbonne studierte, tadellos französisch sprach und für den sanften und zärtlichen Umgang mit einem Kind wie geschaffen schien. In der ersten Woche hielt sich Diane an ihren Entschluss. Um neun Uhr morgens ging sie aus dem Haus und kam um sechs Uhr abends zurück. Doch bereits am folgenden Montag geriet ihre Disziplin ins Wanken: Sie machte sich jeden Morgen später auf den Weg und kam abends immer früher nach Hause. Ihren Vorsätzen zum Trotz zog sie ihre Anwesenheit zu Hause von Tag zu Tag in die Länge – als wäre sie frisch verliebt und könnte von den schönen Stunden nie genug bekommen.
Es war die reine Seligkeit.
Die Angst vor ihrer neuen Aufgabe als Adoptivmutter schwand in dem Maß, wie das Lächeln des Jungen strahlender wurde und seine kindliche Lebhaftigkeit über seine anfängliche Furcht die Oberhand gewann. Mit ausdrucksvollen Gesten, Grimassen, Gelächter gelang es ihm, sich verständlich zu machen, und er schien mühelos in seine neue Haut als Stadtbewohner zu schlüpfen. Diane stimmte ihm zu, antwortete ihm auf Französisch und versuchte ihr Staunen zu verbergen, so gut es ging.
So oft hatte sie sich diesen kleinen Jungen vorgestellt, dass sie sich letztlich ein Traumbild geschaffen hatte. Aber jetzt war das Kind leibhaftig da, und alles war anders. Es war ein realer Junge, mit einem realen Gesicht, einem realen Temperament. In seiner Anwesenheit zerplatzten alle ihre Vermutungen wie Seifenblasen. Lucien hatte sich mühelos aus der imaginären Gussform, die sie ihm geknetet hatte, befreit und bot ihr stattdessen die ganze Vielschichtigkeit, die ganze Lebendigkeit seines Wesens, unerwartet, überraschend und immer vollkommen richtig – weil vollkommen wahr.
Besonders bezaubernd war die Stunde des abendlichen Bads. Diane wurde nicht müde, diesen schmalen Körper zu betrachten, den weißen Rücken, dieses Knochengerüst, das ihr so zart erschien, als bestünde es aus lauter Vogelknöchelchen, aber bebend vor Energie. Sie bewunderte diese milchweiße Haut, die an Vollkommenheit grenzte, so verschieden von der Haut der anderen Kinder aus dem Waisenhaus, unter der bläuliche Adern pulsierten und feine Organe zu erkennen waren. Sie dachte an ein Küken, dessen lebenstrotzende Gestalt soeben aus seiner dünnen Schale geschlüpft ist.
Ein weiterer Augenblick reiner Kontemplation war das Zu-Bett-Gehen, wenn Diane im Halbdunkel des Kinderzimmers eine Geschichte erzählte. Lucien brauchte nie sehr lang, um einzuschlafen, und dann war sie an der Reihe, sich von den zarten Empfindungen, die sie unter den Fingerkuppen spürte, einlullen zu lassen. Diese durchdringende Wärme der Haut. Dieses kaum merkliche Auf und Nieder der atmenden Brust. Und diese Haare, die so fein waren, dass sie eine besondere Aufmerksamkeit von den Fingern zu verlangen schienen – ein verborgenes Talent des Berührens. Woher hatte er solche Haare, aus welchem genetischen Dickicht? Er war so ganz anders: Das war das Gefühl, das immer wiederkehrte, wenn sie ihn in der Dunkelheit betrachtete. Anders. Jedes Merkmal, jedes Detail dieses kleinen Körpers erinnerten sie an den fernen Ursprung des Kindes und brachten es ihr doch nahe, vereinten es mit ihr in ihrer Pariser Einsamkeit.
Luciens Persönlichkeit erhob sich wie ein gläsernes Bauwerk, das im Lauf der Tage sein inneres Gerüst, seine Windungen, seine Höhen preisgab. Sie hatte sich immer vorgestellt, Lucien wäre ein aufgeregtes, unruhiges, unberechenbares Kind, doch er war im Gegenteil von einer verwirrenden Sanftmut und Freundlichkeit. Trotz seiner Urwaldmanieren – er aß mit den Fingern, sträubte sich heftig gegen das Waschen, versteckte sich, sobald es nur an der Tür läutete – verfügte er im Grunde seines Herzens über eine Sensibilität und Intuition, die Diane entzückten. Warum sollte sie es leugnen – Lucien ähnelte in jeder Hinsicht dem Jungen, den sie selbst zur Welt hätte bringen wollen.
Die Essenz von allem, was ihr Entzücken erregte, fand Diane in einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Beschäftigung, zu der sie ihn so häufig wie möglich aufforderte: wenn Lucien tanzte und sang. Aus Lust, aus Spiel, aus natürlicher Begabung äußerte ihr Adoptivsohn seine Gefühle bei jeder Gelegenheit auf diese Weise. Nachdem sie diese seine Leidenschaft entdeckt hatte, kaufte sie ihm einen leuchtend roten Kassettenrekorder mit einem zitronengelben Mikrofon. Von nun an nahm der Junge sich jedesmal auf und trommelte dabei auf einem improvisierten Schlagzeug. Der Höhepunkt der Vorstellung war ein originelles Ballett: Unvermutet spreizte sich ein Bein in einem spitzen Winkel vom Körper ab, seine Hand zupfte an einem imaginären Schleier, dann drehte sich die ganze Gestalt im Kreis, nur um mit neuem Schwung wieder loszulegen. Aus einer kauernden, gekrümmten Stellung schnellte der kleine Körper in die Höhe und öffnete sich wie die Flügel eines Skarabäus, um sich gleich darauf im Rhythmus zu wiegen.
Bei einer dieser zügellosen Tanzvorführungen wagte es Diane, sich zu beglückwünschen. Nie hätte sie sich eine so große Seligkeit auch nur im Traum vorgestellt. Innerhalb von drei Wochen hatte sie zu einer Heiterkeit, einer inneren Gelassenheit gefunden, nach der sie sich jahrelang gesehnt hatte. Zum ersten Mal in ihrem Leben stand sie im Begriff, eine Tat zu vollbringen, die ihr ganz persönliches Dasein anging.
In diesem Augenblick fiel ihr Blick auf die roten Ziffern an ihrem Quarzwecker mit der Datumsangabe.
Montag, der 20. September.
Auch wenn alles noch so wunderbar lief, stand ihr ein schrecklicher Termin bevor, der sich unmöglich noch länger hinausschieben ließ.
Das Abendessen bei ihrer Mutter.
Kapitel 6
Die gepanzerte Tür öffnete sich vor einer schlanken Gestalt. Die Dielenbeleuchtung ließ ihren Haarknoten im Nacken in einem goldenen Lichthof schimmern. Bei ihrem Anblick erstarrte Diane auf der Türschwelle. Sie hielt den schlafenden Lucien in den Armen.
»Schläft er?«, flüsterte Sybille Thiberge. »Komm herein, zeig ihn mir.«
Diane trat einen Schritt vor und hielt gleich darauf wieder inne. Aus dem Salon drang Stimmengewirr.
»Bist du nicht allein mit Charles?«
Ihre Mutter warf ihr einen verlegenen Blick zu. »Charles hat für heute Abend ein wichtiges Essen geplant, und …«
Diane machte auf dem Absatz kehrt und wollte wieder gehen, doch Sybille hielt sie mit jener Mischung aus Autorität und Sanftheit, die ihr so teuer war, am Arm fest. »Was tust du? Bist du verrückt?«, fragte sie.
»Ein Essen im Familienkreis, hast du gesagt.«
»Es gibt Zwänge, denen man sich nicht entziehen kann. Sei nicht albern, komm herein.«
Trotz des Halbdunkels konnte Diane die Züge ihrer Mutter sehr genau erkennen. Fünfundfünfzig Jahre, und noch immer sah sie aus wie eine slawische Puppe mit ihren blonden Brauen und ihrem zerzausten Goldhaar, wie auf einem sowjetischen Propagandaplakat. Sie trug ein chinesisches Kleid – eingewebte Vögel auf schwarzem Grund –, das ihrer zarten, rundlichen Gestalt schmeichelte. Ein schmaler Schlitz öffnete sich über ihren makellosen Brüsten, die nie korrigiert worden waren – Diane wusste es. Fünfundfünfzig Jahre, und dieses Geschöpf rückte noch immer keinen Zollbreit von der Sinnlichkeit ihrer Jugend ab. Diane fühlte sich auf einmal magerer, ausgezehrter denn je.
Mit hängenden Schultern ließ sie sich hineinführen, doch währenddessen murmelte sie mit einem Blick auf Lucien: »Wenn du ihn bei Tisch auch nur mit einem Wort erwähnst, schlage ich dich zusammen.«
Ihre Mutter ging auf die gewalttätige Sprache ihrer Tochter gar nicht ein, sondern nickte nur. Diane folgte ihr durch einen sehr langen Flur, vorbei an einer Flucht geräumiger Zimmer, auf die sie keinen Blick warf; sie kannte sie ohnehin auswendig. Die exotischen Möbel, die ihre Schatten auf baldachinartige Kelims warfen, zeitgenössische Gemälde mit gewagten Farben und abstrakten Formen an strahlend weißen Wänden und in den Winkeln hinter niedrigen Tischen diskrete Lämpchen, die mit ihrem gedämpften Licht wie Wächter des puren Luxus wirkten.
In einem hellen Zimmer voller Seide und Tüll hatte Sybille ein Bett aus bemaltem Holz hergerichtet, und Diane beschlich auf einmal der Verdacht, dass ihre Mutter anscheinend Gefallen an der Großmutterrolle gefunden hatte. Doch sie wollte an diesem Abend die Waffen ruhen lassen. Sie beglückwünschte sie zu der gelungenen Ausstattung und legte Lucien behutsam ins Bett. Für einen kurzen Moment standen die beiden Frauen einträchtig vor ihm und betrachteten ihn.
Als sie das Zimmer verließen, verfiel Sybille sofort in ihr übliches Geplapper: Gesellschaftsklatsch und Anweisungen bezüglich des Abendessens. Diane hörte nicht zu. Auf der Schwelle des Salons drehte die kleine Frau sich um und musterte die Kleider ihrer Tochter. Ihre Miene drückte Bestürzung aus.
»Was?«, fragte Diane.
Sie trug einen sehr kurzen Pullover, eine extrem weite Leinenhose, die sich nur durch Reibung auf ihren Hüften hielt, und eine Jacke aus schwarzen Kunstfedern.
»Was?«, wiederholte sie. »Was ist denn?«
»Nichts. Ich sagte soeben, dass ich dich einem Minister gegenüber gesetzt habe. Einem amtierenden.«
Diane zuckte die Achseln. »Ich pfeife auf die Politik.«
Sybille pflichtete mit einem Lächeln bei, während sie die Tür zum Salon öffnete. »Sei provokant, witzig, dumm, was du willst. Aber mach bitte keinen Skandal.«
Die Gäste saßen in ziegelroten Sesseln und nippten an einem Aperitif von derselben Farbe. Die Männer waren grauhaarig, alt, laut. Ihre verhuschten Gattinnen trugen einen stummen Konkurrenzkampf aus, indem sie einander und ihre Altersunterschiede einschätzten – Wassergräben voller Krokodile. Diane seufzte: Der Abend versprach tödlich zu werden.
Jedoch traf sie auch die eher komischen kleinen Schrullen ihrer Mutter wieder an, so die Musik von Led Zeppelin, die gedämpft irgendwo im Hintergrund lief – seit ihrer wilden Jugend hörte Sybille ausschließlich Hardrock und Free Jazz – und das seltsame Glasfaserbesteck, mit dem der Tisch gedeckt war: Ihre Mutter war allergisch gegen Metall. Und was das Essen betraf, so war sie sicher, dass es im Wesentlichen aus einem süßsauren Gericht bestehen würde, denn ihre Mutter pflegte sämtliche Speisen mit Honig zu würzen.
»Mein Kleines! Komm mich begrüßen!«
Mit einem Lächeln trat Diane auf ihren Stiefvater zu, der ihr beide Hände entgegenstreckte. Klein und untersetzt, erinnerte Charles Helikian an einen Perserkönig. Er war von dunkler Hautfarbe und trug einen Kinnbart, seine abstehenden krausen Haare ballten sich wie Gewitterwolken um seinen Schädel und standen in merkwürdigem Einklang mit seinen dunklen Augen. »Mein Kleines«: Der Mann bestand auf dieser Anrede. Warum »Kleines«, wenn Diane alles andere als klein und darüber hinaus dreißig Jahre alt war? Und warum »mein«, nachdem Charles sie kennengelernt hatte, als sie bereits ein junges Mädchen von vierzehn Jahren gewesen war? Ein Rätsel. Sie hatte allerdings schon lange aufgegeben, sich mit diesen sprachlichen Koketterien zu befassen, und winkte ihm mit einer freundschaftlichen Geste zu, ohne sich zu ihm hinunterzubeugen. Charles protestierte nicht: Er wusste, dass seine Stieftochter jeglichem Gefühlsüberschwang abgeneigt war.
Man ging zu Tisch. Wie immer beherrschte Charles mit seiner Eloquenz die Unterhaltung. Diane hatte diesen vorläufig letzten Gefährten ihrer Mutter, der rasch ihr offizieller Stiefvater geworden war, von Anfang an akzeptiert. In seinem Berufsleben war der Mann eine herausragende Erscheinung. Er war als Betriebspsychologe tätig gewesen und hatte sich dann auf sehr viel diskretere beraterische Aktivitäten bei Wirtschaftsbossen und Spitzenpolitikern verlegt. Welcher Art seine Ratschläge und sonstigen Unternehmungen waren, hatte Diane nie begriffen. Sie wusste nicht, ob Charles sich etwa mit einer Stilberatung seiner Kunden begnügte oder ob er im Gegenteil an ihrer Stelle das Unternehmen leitete, was ebenso gut möglich war.
Im Grunde waren ihr sein Beruf und sein Erfolg ohnehin gleichgültig. Sie bewunderte Charles wegen seiner menschlichen Qualitäten, seiner Großzügigkeit, seiner humanistischen Überzeugungen. Als ehemaliger Linksaktivist setzte er sich über die Widersprüche hinsichtlich seines Vermögens und seiner gesellschaftlichen Stellung mühelos hinweg. Er lebte in dieser luxuriösen Wohnung, führte aber nach wie vor altruistische Reden, in denen er für die Macht des Volkes und soziale Gerechtigkeit eintrat. Er schreckte nicht davor zurück, nach wie vor die klassenlose Gesellschaft oder die Diktatur des Proletariats zu verherrlichen, die doch die meisten Völkermorde und Repressionen des zwanzigsten Jahrhunderts nach sich gezogen hatten. In seinem Mund gewannen diese geächteten Begriffe ihre einstige Faszinationskraft zurück – zweifellos deshalb, weil sich der Mann im Grunde seines Herzens einen Glauben, eine Aufrichtigkeit, eine Jugend bewahrt hatte, die noch immer intakt waren.
Diane empfand eine geheime Sehnsucht nach solchen Idealen, die sie selbst nie gekannt, die aber die Generation ihrer Mutter in Begeisterung versetzt hatten. Sie war wie jemand, der nie eine Zigarette angerührt hat, aber den aromatischen Duft von Tabakrauch schätzt. Massakern, Unterdrückung und Ungerechtigkeiten zum Trotz hatte sie sich nie von einer eigenartigen Faszination für die revolutionäre Utopie befreien können. Und wenn Charles den Kommunismus mit der Inquisition verglich, wenn er erklärte, die Menschen hätten sich der schönsten aller Hoffnungen bemächtigt und sie in einen Kult des Grauens verwandelt, dann lauschte sie ihm mit großen Augen, wie das ernsthafte kleine Mädchen, das sie einst gewesen war.
An diesem Abend drehte sich das Gespräch um die unendlichen, glorreichen, immensen Perspektiven der neuen Kommunikationsformen und insbesondere des Internet. Charles war nicht damit einverstanden: Hinter dem technischen Flitterwerk, sagte er, lauere eine neue Art der Entfremdung, die nur zu noch größerem Konsumverhalten und weiterem Verlust an Realitätsbewusstsein und menschlichen Werten beitragen werde.
Die Tischgenossen stimmten ihm bereitwillig zu. Diane musterte sie: Diesen Unternehmern und Politikern war das Internet und seine potenzielle Macht der Entfremdung zweifellos gleichgültig, nicht anders als Charles. Sie waren um des Vergnügens willen hier – sie wollten sich ungewöhnliche, mit Feuereifer vorgetragene Ansichten anhören, wollten sich von diesem Zigarrenraucher einwickeln lassen, der sie an ihre Jugend erinnerte und an den Zorn, den sie sich und ihrer Umgebung selbst hin und wieder vorspielten, aber längst nicht mehr empfanden.
Der Minister ihr gegenüber sprach sie unvermutet an: »Ihre Mutter sagte, Sie seien Ethologin?«
Der Mann hatte ein schiefes Lächeln, eine Adlernase und flinke Augen, die an japanische Algen erinnerten.
»Das ist richtig.«
Der Politiker lächelte in die Runde, als wollte er um Nachsicht bitten.
»Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was das ist«, sagte er.
Diane senkte den Blick und spürte, wie sie rot wurde. Ihr Arm war schräg gegen die Tischkante angewinkelt. In gleichmütigem Tonfall erklärte sie: »Ethologie ist die Wissenschaft vom Verhalten der Tiere.«
»Und welche Tiere studieren Sie?«
»Wilde. Reptilien, Raubvögel, Raubkatzen. Eigentlich alle Raubtiere.«
»Das ist aber kein sehr … weibliches Gebiet.«
Sie schaute auf. Sämtliche Blicke waren auf sie gerichtet.
»Das kommt darauf an. Bei den Löwen jagen zum Beispiel nur die Weibchen. Das Männchen bleibt bei den Jungen zurück, um sie vor Angriffen von anderen Rudeln zu beschützen. Die Löwin ist zweifellos das mörderischste Geschöpf der Savanne.«
»Das klingt ja schauerlich …«
Diane nahm einen Schluck Champagner. »Im Gegenteil«, sagte sie. »Das ist einfach eine Seite des Lebens.«
Der Minister stieß ein kehliges Lachen aus. »Das unausrottbare Klischee vom Leben, das sich vom Tod nährt …«
»Ein Klischee wie jedes andere: Es wartet nur auf eine Gelegenheit, sich zu bestätigen.«
Nach ihren Worten trat ein unangenehmes Schweigen ein. Sybille ließ ein hektisches Lachen hören: »Das soll Sie aber nicht daran hindern, mein Dessert zu kosten!«
Diane warf ihr einen spöttischen Blick zu und bemerkte ein nervöses Zucken im Gesicht ihrer Mutter, während sie Teller und kleine Löffel verteilte. Doch der Politiker hob die Hand: »Eines möchte ich aber doch noch wissen.«
Die Tischrunde erstarrte augenblicklich, und Diane begriff, dass der Mann während des gesamten Essens für die anderen nie aufgehört hatte, ein Minister zu sein. Er sah sie an und fragte: »Warum tragen Sie denn diesen Ring in der Nase?«
Diane breitete die Hände aus; in ihren Ringen aus getriebenem Silber funkelte das Kerzenlicht. »Um mit der Menge zu verschmelzen, nehme ich an.«
Die Gattin des Ministers, zu seiner Rechten, beugte sich zwischen zwei Kerzen vor und sagte: »Wir gehören sichtlich nicht zur selben Menge!«
Diane leerte ihr Glas. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie zuviel getrunken hatte. An den Minister gewandt sagte sie: »Von allen Zebrarassen sind einige immer noch sehr weit verbreitet. Wissen Sie, welche?«
»Selbstverständlich nicht.«
»Die Zebras, die am ganzen Körper durchgehend gestreift sind. Die anderen sind ausgestorben: Ihre Fellzeichnung war nicht ausreichend, um den stroboskopischen Effekt zu erzeugen, wenn sie durch das Gras rannten, und bot also keine ausreichende Tarnung.«
Der Minister bekundete sein Befremden: »Was hat das mit Ihrem Nasenring zu tun? Worauf wollen Sie hinaus?«
»Ich will damit sagen, dass eine Tarnung komplett sein muss, damit sie die gewünschte Wirkung erzielt.«
Sie stand auf und entblößte dabei ihren gepiercten Bauchnabel: Ein horizontaler Dorn steckte darin, an dem ein funkelnder Ring hing. Der Minister lächelte und rückte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Seine Gattin lehnte sich mit verschlossener Miene zurück. Ein verlegenes Murmeln erhob sich rings um den Tisch.