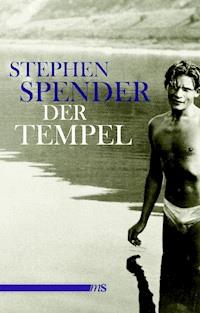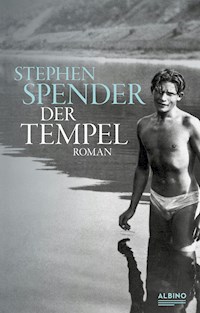
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende der 1920er Jahre reist der prüde Engländer Paul Schoner nach Hamburg. Die lustvolle Bejahung des menschlichen Körpers, die er hier in Strandbädern und Nachtbars erlebt, ist für ihn eine Offenbarung. Er befreundet sich mit dem jungen Fotografen Joachim Lenz, der den Aufbruch der befreiten Jugend in Bildern festhält. Die Beiden reisen durchs Land, genießen die Freizügigkeit. Doch Paul nimmt auch einen Wandel wahr. Die Weltwirtschaftskrise hinterlässt Spuren, antisemitische und nationale Töne werden lauter. Als Nazis Joachims Wohnung verwüsten, wird die Bedrohung real. Als "komplexes Gebilde aus Erinnerung, Fiktion und nachträglicher Erkenntnis" bezeichnete Spender selbst diesen Roman, den er Mitte der 1980er mithilfe von Tagebuchaufzeichnungen über zwei Deutschlandaufenthalte anno 1929 und 1932 vollendete. In der Figur des Joachim Lenz ist unschwer Fotograf Herbert List zu erkennen, mit dem Spender befreundet war, weiterhin treten Christopher Isherwood und W. H. Auden als William Bradshaw und Simon Wilmot auf. "Der Tempel" ist ein großer Roman über den Freiheitsdrang einer jungen Generation und ein Land am Vorabend der politischen Katastrophe, der im Angesicht des Erstarkens Neuer Rechter eine beklemmende Aktualität erfährt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DER TEMPEL
STEPHEN SPENDER
DER TEMPEL
Roman
Aus dem Englischen von Sylvia List
Die Originalausgabe erschien 1988 unter dem Titel
The Temple bei Faber and Faber Limited, London.
© by the Estate of Stephen Spender, 1988
Diese Neuausgabe weicht geringfügig von den bisherigen deutschsprachigen Ausgaben des Romans ab. Sie enthält erstmals zwei Einfügungen auf den Seiten 166–168 und 247–249, die der zweiten Auflage (1988) der Originalausgabe hinzugefügt wurden.
1. Auflage
© 2022 Albino Verlag, Berlin
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29, 10969 Berlin
© der Übersetzung: Piper Verlag GmbH, München 1991
© der verwendeten Fotografien: Herbert List Estate,
M. Scheler, Hamburg
Aus dem Englischen von Sylvia List
Umschlaggestaltung: Robert Schulze
unter Verwendung der Fotografie Franz Büchner am Rhein 1929
von Herbert List
Printed in the Czech Republic
ISBN 978-3-86300-338-8
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen:
www.albino-verlag.de
Kam Sommer wie ein Schwall, dem gierigsten Gärtner
Gelang nie reicherer Flor:
Sonntag hieß Baden im See, gebräuntere Körper,
Schönheit durch Brand:
Weit draußen im Wasser besprachen zwei Köpfe die Lage,
Aus dem Ried schoss erpelgleich der entkleidete Deutsche,
Und von den Dünen signalisierte Stephen wie ein hölzerner Irrer
«Zerstört diesen Tempel».
Dieser fiel. Der schnelle Hase erlag dem heißen Atem der Hunde.
Die Jüdin floh Südwärts.
W. H. Auden: Sechs Oden (Januar 1931)
Das ursprüngliche Manuskript von 1930 war W. H. Auden
und Christopher Isherwood gewidmet.
Nun füge ich hinzu: «Zur Erinnerung an Herbert List.»
INHALT
Englisches Vorspiel
Erster Teil: Die Kinder der Sonne
Im Hause Stockmann
Das Wochenende an der Ostsee
Bei Alerichs
Die Rheinwanderung
Zweiter Teil: Dunklen Zeiten entgegen
Epilog: 1929
Nachbemerkung des Autors
ENGLISCHES VORSPIEL
Was Paul an Marston liebte, war seine (wie er leidenschaftlich glaubte) offensichtliche Unschuld. Er hatte diese Eigenschaft gleich bemerkt, als er ihn zu Beginn ihres ersten gemeinsamen Trimesters in Oxford zum ersten Mal sah.
Eines Nachmittags stand Marston im Collegehof ein paar Meter entfernt von seinen Kameraden aus dem Footballteam. Diese gaben sich einer ihrer nachmahlzeitlichen Orgien hin, rannten wie die Wahnsinnigen im Kreis herum und warfen sich einen Brotlaib zu, den sie in der Küche gestohlen hatten, um ihn als Football zu benutzen. Mit dem Ruf «Fass ihn!» stürzten immer wieder zwei oder drei gebückt aufeinander los und griffen sich in die Geschlechtsteile. Marston schien sich nicht klar zu sein, ob er bei diesem Spiel mitmachen sollte oder nicht. Er stand am Rand und sah mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln zu. Sein Schädel war rund, das kurzgeschnittene Haar saß wie ein Helm über seinen ruhigen Zügen. Er hatte das leicht verwirrte Aussehen desjenigen, der sich unter seinen Kameraden verloren vorkommt und sich vermutlich selbst die Schuld dafür gibt, sich nicht einfügen zu können.
Paul, der diese Szene von der Vorhalle aus beobachtete, durchbrach die Barrieren seiner eigenen Schüchternheit und lud Marston zu einem Drink auf sein Zimmer ein. Bei einem Bier fragte er ihn aus. Marston antwortete freimütig. Er erzählte Paul, sein Vater sei ein erfolgreicher Chirurg, habe ein Leberleiden und sei deshalb oft wütend auf seinen Sohn. Paul konnte sich nicht vorstellen, dass irgendwer unter irgendwelchen Umständen wütend auf Marston werden konnte. Dr. Marston hatte gewünscht, dass sein Sohn dem Boxklub der Universität beiträte. Also hatte er sich aus sanftmütiger Fügsamkeit, seinem Vater zu gefallen (dachte Paul), zum Mitglied der Wettkampfriege hochgeboxt. Trotzdem, wie er Paul ziemlich munter erzählte, versetze ihn jeder Kampf in Angst und Schrecken. «Vorher wird mir übel, und ich sehe die ganze Zeit über ziemlich grün aus, alter Knabe.» Paul fragte ihn, was er vom Kapitän des College-Achters halte, der bei seinen Freunden Hell Trigger hieß. Vom Hof herauf war seine Stimme zu hören, die deftige Flüche ausstieß. «Er scheint ein ganz anständiger Kerl zu sein, aber ich glaube kaum, dass ich ihn sehen oder mit ihm gesehen werden will, sobald das Tor der Uni sich hinter mir geschlossen hat.»
Paul entwickelte sich zu einem reichlich aufdringlichen Vertrauten Marstons. Er stellte ihm Fragen und bekam ehrliche Antworten. Paul war sich nie sicher, ob es Marston gefiel, so viel von sich zu erzählen.
Einmal sagte Marston, sein größtes Vergnügen sei es, alleine zu segeln; vielleicht sei es sogar noch schöner, alleine zu fliegen. Er gehörte dem Fliegerklub der Universität an und hatte den Ehrgeiz, Pilot zu werden. Er unternahm auch gern lange, einsame Wanderungen in den ländlichen Gegenden Englands, die er für die schönsten der Welt hielt. (Er war einmal in Jugoslawien gewesen und einmal zum Skifahren in den Alpen.) Er liebte den Westen Englands. Zögernd schlug Paul vor, in den Osterferien eine gemeinsame Wanderung zu unternehmen. Marston war begeistert. Schon immer habe er die Wye entlangwandern wollen, sagte er. Er zog Karten hervor. Sie legten einen Tag fest – den 26. März –, an dem sie den Bus von London nach Ross-on-Wye nehmen wollten.
Die Wanderung dauerte fünf Tage und ging restlos daneben. Paul glaubte, Lyrik würde Marston langweilen, und hatte in der Woche, bevor sie loszogen, Bücher über Segeln, Flugzeuge und Boxen durchgeackert. Nach einer Tasse Kaffee in Ross-on-Wye folgten sie dem Treidelpfad am Flussufer entlang. Kaum waren sie aufgebrochen, begann Paul von neuen Flugzeugtypen zu reden. Marston gab sich zwar höflich, doch er schien gelangweilt, und als Paul das Thema wechselte und von Segelbooten anfing, schien ihn das fast ebenso wenig zu interessieren. Als sie am Morgen des zweiten Tages durch eine Gegend wanderten, wo die Blätter wie Flämmchen an den Zweigspitzen züngelten, sagte Marston, er habe Magenschmerzen. Wenn Marston Schmerzen eingestand, konnte das nach Pauls Meinung nur heißen, dass er Qualen litt. Die nächste Stunde beobachtete er ihn, sagte aber nichts, weil er befürchtete, das Antworten könnte ihn zu sehr anstrengen. Endlich fragte er ihn ängstlich: «Hast du noch immer Schmerzen? Sollen wir in ein Dorf gehen und versuchen, einen Arzt aufzutreiben?» – «Ach, halt doch die Klappe», sagte Marston. «Du machst ein Getue um mich wie eine alte Glucke! Na», fügte er hinzu, «ich glaube, ich scheiß‘ mal unter die Bäume da», und ging weg.
Am dritten Tag gab es eine Ablenkung durch einen Hund, der sich an sie hängte und ihnen den ganzen Tag durch grün sprießende Felder nachlief, bis sein Besitzer, ein Bauer, sie bei Einbruch der Dämmerung einholte und schrie, sie hätten seinen Hund gestohlen, er werde sie wegen Diebstahls anzeigen. Er schrieb ihre Namen und Anschriften auf. Das war eine Aufregung, die ihnen für zwei Stunden die Langeweile vertrieb.
Die Nacht verbrachten sie in einer Pension, in der sie das Bett miteinander teilen mussten. Keiner von beiden schlief. Am anderen Morgen sagte Marston beim Aufstehen: «Zu zweit in diesem Bett zu schlafen hat mir ein ziemlich grausiges Bild von der Ehe vermittelt, mein Alter.» Schweigend aßen sie ihr Frühstück.
Später machte Paul, der seine Brownie-Boxkamera mitgenommen hatte, eine Aufnahme von Marston, wie er am Flussufer saß und über einer Landkarte brütete, die auf seinen Knien ausgebreitet war.
Als sie wieder in London ankamen, sprang Marston als erster aus dem Bus auf den Bürgersteig. Ohne sich noch einmal umzudrehen oder sich zu verabschieden, ging er rasch fort. Paul schaute noch auf Marstons Rücken, als er ihn eine Melodie aus dem amerikanischen Musical Good News pfeifen hörte.
Die Fotografie war blass: graugetönte Felder, knospende Weidenruten wie Peitschenschnüre, die sich schwarz abhoben gegen den schimmernden Fluss mit den Tigerstreifen kleiner Wellen. Ein neunzehnjähriger Junge in alter grauer Flanelljacke und -hose saß auf einer grasbewachsenen Uferböschung und beugte sich über eine Landkarte, die ihr Glück hätte bedeuten sollen. Er sah aus wie ein englischer Flieger aus dem Ersten Weltkrieg, der auf französischem Boden eine Karte der Westfront studierte. Außer dem helmförmigen Hinterkopf waren nur die Wangenlinie und das Profil der Nase von ihm zu sehen. Er schien merkwürdig allein. Für Paul war das Foto ein Brennglas, in dem sich das Unvergessliche jenes englischen Frühlingsmorgens konzentrierte. Es war ein ganz gewöhnlicher Schnappschuss, so simpel in seinen drei oder vier Elementen, dass er die Teile später jederzeit im Gedächtnis zusammensetzen konnte.
Im Sommertrimester nach dieser Wanderung lernte Paul einen neuen Freund kennen, dessen Persönlichkeit sich vollkommen von der Marstons unterschied. Es war der Dichter Simon Wilmot, Sohn eines Arztes, der auch Psychoanalytiker war. Während Marston völlig unschuldig wirkte, wusste Wilmot alles über Freudsche Schuldkomplexe bei sich und anderen – Schuldgefühle, die durch die Überwindung von Hemmungen bewältigt werden mussten, wie er mit Nachdruck vertrat. Man dürfe nichts verdrängen. Verdrängung führe zu Krebs.
Wilmot war am Christ Church, dem College derer von Geblüt, von Vermögen und von Adel, denen er sich jedoch nur bei der Andacht und zu den Mahlzeiten anschloss. Außerhalb seines Colleges galt er als exzentrisches «Genie». Andere Dichter der Universität waren seine Freunde. Sie suchten ihn in seinen Räumen auf, jeder einzeln, zu einem verabredeten Zeitpunkt. Wilmot war zwar furchtbar schlampig in seinem Äußeren, in der Ordnung seiner Bücher und Papiere und auch mit den Mahlzeiten, aber geradezu pingelig in seiner Zeiteinteilung.
Paul hatte Wilmot auf einem Gartenfest des New College kennengelernt. Wilmot, dem Pauls Ruf, verrückt zu sein, gerüchteweise zu Ohren gekommen war, warf ihm aus Augen, die vielleicht ein wenig zu eng beieinander standen, einen kurzen, prüfenden Blick zu und lud ihn für den folgenden Nachmittag um halb vier zu sich in seine Räume am Peckwater Quadrangle ein.
Am nächsten Tag klopfte Paul um zwanzig vor vier an Wilmots Tür. Wilmot machte auf und sagte: «Ach, du bist es. Du kommst zehn Minuten zu spät. Na gut, komm rein.»
Es war noch heller Nachmittag, doch die Vorhänge in Wilmots Wohnzimmer waren zugezogen. Wilmot saß in einem Lehnstuhl, hinter sich eine Stehlampe. Er bedeutete Paul, auf dem Stuhl gegenüber Platz zu nehmen. Paul setzte sich und beobachtete Wilmot. Licht schien auf sein sandfarbenes Haar über der Stirn, deren Haut ihm so glatt vorkam wie unbeschriebenes Pergament. Mit seinen engstehenden rosageränderten Augen war er fast ein Albino. Sobald Paul etwas sagte, das als neurotisch gedeutet werden konnte, sah Simon zu Boden, als notierte er es auf dem Teppich.
Wilmot bombardierte Paul mit Fragen, und dieser versuchte, geheimnisvoll klingende Antworten zu geben. Er wollte als interessanter Fall erscheinen. «Ach was», sagte Wilmot, als Paul ihm erzählte, dass er mit elf Jahren seine Mutter und mit sechzehn seinen Vater verloren hatte, dass sein Bruder, seine Schwester und er hauptsächlich von ihrer Köchin Kate und deren Schwester Frieda, dem Hausmädchen, großgezogen worden waren und dass sie im Haus ihrer Großmutter in Kensington gewohnt hatten. Symptomatisch.
Simon sah zu Boden und fragte: «Was hast du vor, wenn du von Oxford abgehst?»
Paul sagte, er wolle Dichter werden. Simon fragte ihn, welche modernen Dichter er bewundere. Paul geriet in Verlegenheit. Dann sagte er auf gut Glück, ihm gefielen die Kriegsgedichte von Siegfried Sassoon.
«Siggy TAUGT NICHTS. Seine Kriegsgedichte HAUEN NICHT HIN.»
Wilmot betonte bestimmte Worte mit fast absurdem Nachdruck, als wären sie aus der Heiligen Schrift.
«Zählen Sassoons Gedichte nicht zur modernen Lyrik?», fragte Paul.
«Siggy VERKÜNDET WAHRHEITEN. Er VERTRITT MEINUNGEN. Ein Gedicht über die Kämpfe an der Westfront schließt bei ihm mit der Zeile: ‹O Jesus, lass es enden!› Das KANN ein Dichter nicht sagen.»
«Was hätte er dann schreiben sollen?»
«Alles, was ein Dichter tun kann, ist, die GELEGENHEIT zu ERGREIFEN, die die Situation ihm bietet, um ein KUNSTWERK AUS WORTEN zu schaffen. Der Krieg ist einfach Material für seine Kunst. Ein DICHTER kann den KRIEG NICHT BEENDEN. Alles, was er tun kann, ist ein Gedicht zu machen aus dem MATERIAL, das er ihm liefert. Wilfred hat geschrieben: ‹Alles, was ein Dichter heute tun kann, ist warnen.›»
«Wilfred?»
«Wilfred Owen, der einzige Dichter, der eine EIGENE SPRACHE der Westfront geschaffen hat. Wilfred sagt nicht: ‹O Jesus, lass es enden!›»
Mit eisiger, vollkommen leidenschaftsloser Stimme, jedes Wort vom folgenden trennend, als löste er es aus dem Gedicht und hielte es hoch, um es zu mustern, rezitierte er:
Lächelnd notierten sie die Lüge; Alter: neunzehn.
Die Deutschen – er dachte kaum an sie. All ihre Schuld
Und Österreichs berührte ihn nicht. Noch war die Angst
Vor Ängsten nicht in ihm. Er dachte an verzierte Griffe
Von Dolchen in karierten Socken; forsches Salutieren;
An Waffenpflege; Urlaub; Soldrückstände;
Esprit de corps; an Rat für die Rekruten;
Und bald zog man ihn ein mit Trommeln und Hurra.
Wilmot sprach die Zeilen, als wären sie bar jeder Emotion, ja, bar jeder Bedeutung; die Worte preisgegeben, dachte Paul, wie Felsen bei abgelaufener Flut, auf messingfarbenem Sand nackt unter der dörrenden Sonne. Wenn Wilmots Stimme irgendeinen Ausdruck verriet, dann den eines distanzierten, klinischen Interesses an dieser Liste soldatischer Attribute – DOLCHE IN KARIERTEN STRÜMPFEN, SOLDRÜCKSTÄNDE, FORSCHES SALUTIEREN.
Unvermittelt sagte Wilmot: «Zeig mir deine Gedichte.» Paul, der seine Gedichte bei sich trug wie ein Reisender im Ausland seine Papiere, zog zwölf abscheulich getippte Seiten aus der Jackentasche. Wilmot nahm sie ihm mit einer Geste leichter Bestürzung ab. «Welch eine Energie!», murmelte er. Er blätterte sie rasend schnell durch, stieß ab und zu ein Grunzen der Billigung oder häufiger der Missbilligung aus. An einer Stelle wieherte er los und rief: «Aber das GEHT doch nicht!»
In fünf Minuten hatte er die zwölf Seiten gelesen. Paul hob sie Seite für Seite vom Fußboden auf, wohin Simon sie hatte fallen lassen.
«Was hältst du davon?»
«Lass diese Shelley-MASCHE.»
«Sie gefallen dir also nicht?»
«Wir BRAUCHEN dich für die DICHTKUNST.» Paul kam sich vor wie ein Auserwählter.
«Du musst jetzt gehen. Ich muss arbeiten», sagte Wilmot abrupt und schob die Unterlippe vor.
Paul lud Wilmot zu einem Gegenbesuch in seine Räume im University College ein. Wilmot kniff kurzsichtig die Augen zusammen, spähte in seinen Notizkalender und sagte, es würde ihm in acht Tagen passen. Er brachte Paul an die Tür und machte sie fest hinter ihm zu.
Eine Woche später aßen sie bei Paul Sandwiches und tranken Bier. Simon aß neun von den zwölf vorhandenen Sandwiches und sagte dann mit gespielter Entrüstung: «War das schon alles? Ich mag die mit Roastbeef.»
Paul rannte in die Collegeküche hinunter, wo er nur zwei winzige Schweinspasteten auftreiben konnte. Als er in sein Zimmer zurückkam, fand er Wilmot am Schreibtisch sitzen und in seinem Notizbuch lesen. Wilmot sah sich um, nicht im geringsten verlegen über Pauls Rückkehr, und fragte lediglich: «Wer ist Marston?»
Paul war klar, dass es keinen Sinn hatte, gegen Wilmots Benehmen zu protestieren. Entweder man akzeptierte es widerspruchslos, oder man war für immer aus seinem Leben gestrichen. Paul sagte: «Marston ist ein Freund von mir.»
«Das ist klar. Was noch?»
Paul schilderte ihre Wanderung.
Simon sah zu Boden, knurrte und zitierte aus dem eben gelesenen Notizbuch Pauls Beschreibung der Szene, wie Marston am Fluss saß.
«Die Landkarte des Glücks, das wir versäumten.» Er trug die Zeile vor, als würden die Worte auf dem Mond gesprochen. Für Paul klangen sie, als wären sie nicht von ihm, sondern von Wilmot. «Das ist Dichtung.» Und dann, abwägend: «Vielleicht solltest du immer Tagebuch schreiben.» Und er fuhr fort: «Was ist denn so bemerkenswert an diesem jungen Mann?»
«Nichts.»
Wilmot schrie vor Lachen: «Mach dich nicht lächerlich, Schoner! Es muss etwas Bemerkenswertes an ihm sein! Zunächst einmal, warum hast du ihn den anderen vorgezogen? Warum hast du ihn ausgewählt? Sieht er UMWERFEND AUS?»
«Die anderen Herzchen tun so, als wären sie ganz normal und anständig. Und in Wirklichkeit sind sie laut, vulgär und angeberisch. Marston ist völlig anders als sie, ohne es zu merken. Er ist sanft und anspruchslos, und er liebt die englische Landschaft. Er ist jemand, der, wo immer er hingeht, eine Insel um sich herum schafft, auf der er allein ist. Er ist unschuldig.»
«Oh, du hältst ihn für vollkommen?» Wilmot schaute mit zusammengekniffenen Augen auf den Teppich.
«Ich glaube schon.»
«Niemand ist vollkommen.» Wilmot hob ruckartig den Kopf und sah Paul direkt ins Gesicht. «Du meinst, er ist ein EINZELGÄNGER.»
«Er ist Flieger.»
«Flieger?» Wilmot zeigte Interesse. «Ja, das wäre SYMPTOMATISCH. Alle Flieger wollen ENGEL sein.»
Paul spürte ein Triumphgefühl. Er hatte Marston als Neurotiker dargestellt. Er hatte ihm Symptome angehängt. Simon fragte: «Übrigens, bist du noch JUNGMANN?»
«Was?»
«Bist du Jungfrau?»
Paul wurde rot vor Wut: «Ich nehme es an.»
«Du müsstest schon wissen, ob ja oder nein.»
«Also: Ja. Und du?»
«Es ist nicht gut möglich, nach Berlin zu gehen (wohin meine Eltern mich aufgrund irgendeiner unbegreiflichen Verirrung geschickt haben – sie müssen völlig übergeschnappt gewesen sein –, ich war siebzehn) und noch Jungfrau zu sein. Deutschland ist der EINZIGE ORT für Sex. England TAUGT NICHTS.»
Paul wusste nicht, was er sagen sollte. Er fragte: «Sollen wir zu Blackwell gehen? Ich möchte mir The Sacred Wood kaufen.» Simon hatte ihm gesagt, das einzige seit dem Krieg veröffentlichte literaturkritische Buch, das man in die Hand nehmen könne, sei T. S. Eliots The Sacred Wood. Als sie eine Stunde später aus der Buchhandlung kamen, liefen sie in der Broad Street Marston über den Weg. Paul machte Marston mit Simon bekannt, der ihn mit unverhohlener Neugier anstarrte. «Paul hat mir von dir erzählt», sagte er. «Oh!» brachte Marston, leicht verdattert, heraus. «Bis nächste Woche, Paul», sagte Wilmot und ging.
Als Paul das nächste Mal zu Simon kam, fragte er ihn nach seiner Meinung über Marston. Wilmot schielte an seiner Nase entlang und sagte: «Der BEHELMTE FLIEGER.»
«Wie fandest du ihn?»
«Er schien SEHR NETT zu sein», sagte Wilmot eisig. «Natürlich, es ist ganz offensichtlich, warum du dich zu ihm hingezogen fühlst.»
«Warum denn?»
«Dir ist klar, dass er sich nur dreitausend Meter über dem Erdboden wohl fühlt. Du und er, ihr seid euch sehr ähnlich», fügte er geheimnisvoll hinzu.
«Wieso? Ich habe immer das Gefühl, dass wir restlos verschieden sind.»
«Ihr seid beide HIMMELSTÜRMER. Deswegen bist du auch so groß. Du willst weg von deinen EIERN. Du magst ihn, weil du ihm gleichgültig bist. Für dich ist GLEICHGÜLTIGKEIT IMMER ANZIEHEND. UNWIDERSTEHLICH. Du hast Angst vor körperlicher Berührung und verliebst dich deshalb in Leute, bei denen du dich SICHER fühlst.»
«Du meinst, Marston mag mich nicht?»
«Ich könnte mir denken, dass er dich liebt, weil du ihn INTERESSANT findest. Das würden schließlich nicht viele von uns tun.»
«Na schön, was soll ich machen?»
«Du musst ihm sagen, was du empfindest, darum kommst du nicht herum.» Wilmot starrte mit zusammengekniffenen Augen auf den Teppich, seine Miene war die eines Wissenschaftlers, der eine Probe untersucht.
Mit dem Gefühl, dass es das letzte Mal war, lud Paul Marston zu einem Spaziergang im Oxford Park ein. Marston zögerte, sah ihn misstrauisch an und sagte dann mit entschlossener Fröhlichkeit: «In Ordnung, alter Junge.»
Sie gingen zu dem schmalen Flusslauf der Cherwell hinunter und ließen sich an der Böschung nieder. Marston wandte sich Paul zu und sah ihm direkt ins Gesicht. «Warum hast du mich gebeten, mit dir spazieren zu gehen? Wolltest du mich etwas fragen?» Seit damals war er nie wieder auf die Wanderung zu sprechen gekommen.
«Wir sollten uns vielleicht nicht mehr treffen.»
«Warum?» Marston sah verwirrt aus, doch er wartete geduldig, als sei es Pauls Sache, über ihr Verhältnis zu bestimmen.
«Na ja, unsere Wanderung war ein totaler Reinfall, oder nicht?»
«Ich glaube schon.» Er sah in die Ferne. Dann lächelte er auf eine hinreißende Weise und sagte mit seiner munteren Stimme: «Ja, das war sie.»
«Ich habe dich fünf Tage lang ununterbrochen gelangweilt.»
«Ja, das stimmt schon, Alter. Aber ...»
«Was, aber?»
«Vielleicht hättest du mich nicht so gelangweilt, wenn du dir nicht so verzweifelte Mühe gegeben hättest, mich zu unterhalten.»
«Wie?»
«Indem du ständig auf Sachen herumgeritten bist, von denen du meintest, dass sie mich interessieren würden, und in den fünf Tagen nicht einen Augenblick von etwas anderem quatschen konntest. So war‘s doch, oder, mein Alter?», fragte er und sah Paul wieder ganz direkt an.
«Worüber hätte ich denn reden sollen?»
«Du hättest von Dingen reden können, die dich und nicht mich interessieren.»
«Lyrik! Das hätte dich zu Tode gelangweilt.»
«Ja», er lachte. Dann trafen seine Blicke plötzlich die Blicke Pauls. Er brach wieder in Lachen aus, hielt sich dann die Hand vor den Mund und tat so, als erstickte er ein Gähnen. «Wir hätten vielleicht ein Thema finden können, das uns beide interessiert.»
Es war an der Zeit, der Wahrheit ins Gesicht sehen. Was, dachte Paul, verbindet uns außer meiner Zuneigung für ihn? Ich hätte von ihm sprechen sollen. Ich hätte ihm klinische Fragen stellen sollen – bist du noch Jungmann? –, wie Wilmot sie mir stellt. Er sah es deutlich vor Augen – es hätte funktionieren können. Aber während er das dachte, sank ihm das Herz. Er begriff, dass die einzig mögliche Grundlage einer echten Beziehung gegenseitiges Interesse sein musste. Grundlage. Abgrund. Sie hatten keine gemeinsamen Interessen, außer sich selbst. Marston, der wirklich nicht vulgär, der unschuldig, aufrichtig, kühn und gutaussehend war – all das, was Paul Wilmot gegenüber in seiner marktschreierischen Art behauptet hatte –, würde ihn langweilen. Und er langweilte Marston natürlich längst. Er sagte: «Ich glaube, wir sollten uns entschließen, einander nicht mehr zu treffen.»
«Wie du willst.» Marston sah weg auf ein leuchtend grünes Spielfeld – Bühnenbild für die Sportler, die sich dort tummelten. Dann sagte er: «Aber ist das nicht ziemlich schwierig, wo wir doch beide am selben relativ kleinen College sind?»
«Wir werden uns sehen, aber nicht mehr miteinander reden.»
«Von mir aus, alter Knabe, wenn du es so haben willst.» Er zögerte, als warte er darauf, dass Paul noch etwas sagte.
«Also dann, leb wohl», sagte Marston, stand von der Böschung auf und ging in Richtung der Sportler. Aber dann drehte er sich noch einmal um und fragte: «Geht das übrigens auf deinen Freund Wilmot zurück, dass du dich nicht mehr mit mir treffen willst?»
«Nein, er hat nichts dergleichen gesagt, ganz im Gegenteil.»
«Ach so, das wollte ich nur wissen. Tut mir leid.» Dann setzte er hinzu: «Um ganz ehrlich zu sein, dies war das erste Gespräch zwischen uns, das mich nicht gelangweilt hat. Dieser Nachmittag hat mich überhaupt nicht gelangweilt.»
Wieder im College, zog Paul seinen Talar über und ging zum Dekan, um die Erlaubnis zu erbitten, nicht im Speisesaal essen zu müssen. Dekan Close war erst fünfundzwanzig. Er machte den Eindruck, als habe das College sich ihn «geschnappt», weil er so jung war und ein frischfröhlicher Typ, ganz im Gegensatz zum Rest des Lehrkörpers mit seiner Aura von staubiger Entrücktheit. Dekan Close trug graue Flanellhosen, die noch abgetragener wirkten als die «Oxfordsäcke» der meisten Studenten. Paul konnte nicht umhin, ihn für einen Spion zu halten, der von den Alten ins Feindesland der Jungen entsandt worden war. Seltsamerweise rief gerade das in Paul den Wunsch hervor, sich ihm anzuvertrauen, ihm Dinge zu beichten.
Er klopfte an die Tür. Sie wurde unmittelbar darauf vom Dekan geöffnet, der seinen Kopf heraussteckte und laut und herzlich sagte: «Komm herein, mein Lieber! Was kann ich für dich tun?» Mit rotem Gesicht erklärte Paul in wenigen stockenden Sätzen, dass er von ihm die Erlaubnis haben wolle, für den Rest des Trimesters nicht im Speisesaal zu essen. Dekan Close lachte und fragte ihn nach dem Grund dieser exzentrischen Bitte. «Weil ich Marston nicht begegnen möchte.» – «Warum denn nicht?», fragte der Dekan. «Ich verstehe nicht viel davon, aber es hat mich immer gewundert, dass ihr beide, Marston und du, Freunde wart. Ich habe mich oft gefragt, welche gemeinsamen Interessen ihr zwei Burschen wohl haben könntet.» – «Ich bin in ihn verliebt, und wir haben vereinbart, dass wir uns für den Rest des Trimesters nicht mehr treffen. Danach ist Sommer, und da sehen wir uns sowieso nicht mehr», sagte Paul. Dekan Close wurde fürchterlich rot, zögerte und sagte dann herzlich: «Wir sind etwas in der Bredouille. Ich muss meine Kollegen von deiner Bitte in Kenntnis setzen, aber ich nehme an, dass sie nichts dagegen haben werden, dass du nicht im Speisesaal isst. Das Trimester ist ja bald vorbei. Ich muss ihnen keinen Grund nennen.» Und in einem Ausbruch ungestümer Offenheit: «Unter uns, alter Junge, bist du sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Solltest du es nicht lieber durchstehen?» – «Absolut sicher», sagte Paul und zog ein Gedicht aus seiner Jackentasche, ein Bekenntnis seiner Empfindungen für Marston. Dekan Close nahm es und las es aufmerksam:
Beim Wachliegen in der Nacht
Zeigt sich wieder der Unterschied
Zwischen meiner Schuld und seiner Unschuld.
Ich schwöre, lichtgeboren war er,
Und das Dunkel schloss nach und
Nach ihm die Augen,
Er wachte, er schläft – so natürlich.
So, naturgeboren, unter Menschen göttlich,
War er das Abbild der Sonne, sie selbst.
Sein Gemüt war Donner
Im Zorn,
Doch meistens gelassen, englisch.
Dekan Close las das Gedicht zweimal durch, sagte: «Kann ich das behalten? Hast du noch ein Exemplar?» Und steckte es ein.
Seit Paul nun nicht mehr im Speisesaal aß, kochte er sich zu den Mahlzeiten ein Ei oder machte Würstchen auf einem Gaskocher heiß, den das College ihm zur Verfügung gestellt hatte, oder er aß auswärts, oft mit Wilmot. Sie unternahmen lange Spaziergänge in der ländlichen Umgebung Oxfords, nahmen sich Sandwiches mit, die Wilmot so gern mochte, und aßen sie in den Feldern. Paul lernte Wilmot als jemanden kennen, der die Szenen eines Stücks ausprobierte, in dem er eine Hauptrolle in einem Ensemble von Schriftstellern spielte. Wilmot hielt nicht viel von denen, die zurzeit auftraten. Auch wenn das Ganze etwas absurd war, so hatten doch die Texte, die er für seine Rolle geschrieben hatte – seine Gedichte – eine Feierlichkeit des Tons, etwas seltsam Unpersönliches, fast Entrücktes, jedenfalls waren sie ganz und gar ernsthaft. Als er eines seiner Gedichte rezitiert hatte – er kannte sein gesamtes Werk auswendig –, sagte er: «Sie warten nur auf JEMANDEN.» Er war dieser JEMAND. Aber noch höher als sich selbst stufte er einen früheren Schulfreund ein, William Bradshaw, den ROMANSCHRIFTSTELLER VON MORGEN. «Alles, was ich schreibe, schicke ich Bradshaw. Ich akzeptiere sein Urteil BEDINGUNGSLOS. Wenn er ein Gedicht gut findet, behalte ich es, wenn ihm eins nicht gefällt, werfe ich es augenblicklich weg. Bradshaw kann sich NICHT IRREN. Er ist der ROMANSCHRIFTSTELLER DER ZUKUNFT.»
«Was macht er zurzeit?»
«Er studiert Medizin am University College Hospital in London. Er ist der Ansicht, ein SCHRIFTSTELLER müsse heutzutage nicht nur die Psychologie, sondern auch die Physiologie der Personen kennen. Sein Interesse für VERHALTENSWEISEN ist KLINISCHER NATUR.»
Simon hielt Briefeschreiben für ein Sich-Gehenlassen, da jeder Schreiber seine Briefe nicht an den Briefpartner, sondern an sich selbst richte. Dementsprechend beschränkte er seine Mitteilungen auf das absolute Minimum. In der letzten Trimester-Woche schickte er Paul per Collegeboten einen Zweizeilenbrief. In seiner mikroskopisch kleinen Handschrift beanspruchte er eine Fläche von Größe und Form einer Briefmarke in der Mitte eines Blattes. Die Zeilen lauteten:
Lieber P., muss alle Verabredungen mit Oxforder Freunden diese Woche absagen. Bradshaw hier. Simon
Eine Stunde später folgte ein zweiter Brief:
Liebster P., bitte komm morgen um drei. Bradshaw möchtedich kennenlernen. Herzlich, Simon
Paul erschien um fünf vor drei. Ein entrüsteter Wilmot öffnete die Tür und sagte: «Du kommst zu früh. Wir sind noch beim Arbeiten.» Er schien ihn gar nicht anzusehen. Bradshaw, der an dem mit Typoskriptseiten bedeckten Tisch saß, blickte auf und zeigte ein strahlendes Lächeln. Er war klein und gepflegt, hatte einen sehr großen Kopf mit leuchtenden Augen, die mit einem Ausdruck über den Tisch hinweg sahen, als wollten sie sagen: Achte nicht auf Simon! Wilmot reichte Bradshaw eine getippte Seite. Bradshaw las sie durch, was mindestens drei Minuten völliger Totenstille zu beanspruchen schien. «Also, was hältst du davon?», fragte Wilmot etwas ungeduldig. «Wie soll ich mich konzentrieren, Simon, wenn du dasitzt und mir die Pistole auf die Brust setzt?» Simon wurde rot.
Bradshaw blickte vom Manuskript auf und sagte mit einer Stimme, die auf unglaubliche Weise wie die von Wilmot klang:
Nach der Liebe sahen wir
Schwingen dunkeln am Horizont.
«Bussarde», hört ich dich sagen.
Bradshaw hob die Hände vom Tisch, schaute zur Decke hinauf und brüllte vor Lachen.
«Aber Simon, das kannst du doch nicht machen», sagte er mit Simons eigener Stimme. «Ich sehe das förmlich vor mir! Da sind die beiden in dem Tal, liegen im Gras, und dann schaut einer von ihnen zum Horizont und sagt: ‹Bussarde.› – ‹Was hast du gesagt?›, fragt der andere. ‹Bussarde!› – ‹Na und, was meinst du, was zum Teufel die Bussarde denken werden, was wir sind?›»
Simon lachte – etwas verlegen, dachte Paul. «Gut, das kommt raus», sagte er, nahm einen Bleistift und strich drei Zeilen.
«Sollten wir nicht lieber aufhören, Simon?», sagte William Bradshaw und sah durch das Zimmer zu Paul hin. «Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Simon, aber du hast Besuch. Vielleicht wärst du so nett, uns miteinander bekanntzumachen.»
«Mr Schoner – Mr Bradshaw», sagte Wilmot mürrisch.
Wilmot verließ den Raum. Bradshaw sah Paul an und sagte: «Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe Simon gebeten, ein Treffen zu arrangieren. Er hat mir einige Ihrer Werke gezeigt. Ich muss sagen, sie haben mich beeindruckt, mit das Interessanteste, was ich von einem jungen Autor gesehen habe.» Er sprach, als wäre er unendlich alt und reif. «Die Geschichte über Ihren Freund Marston ist mir unvergesslich. So traurig und dabei so wahnsinnig komisch, die Szene mit dem Hund.»
Einige Tage danach stand Paul kurz vor dem Mittagessen in der Vorhalle des University College und fragte sich, ob Marston auf seinem Weg zum Essen wohl hier vorbeikommen würde. Er schaute ihn gerne jeden Tag an, genauso wie er jeden Tag eine Zeichnung von Leonardo im Ashmolean-Museum anschaute. Als Paul dort herumtrödelte und so tat, als läse er die Collegenachrichten, tauchte Dekan Close von der Hofseite her auf und blieb bei ihm stehen: «Paul Schoner! Genau der, den ich gesucht habe. Was für ein glücklicher Zufall, dass ich dich treffe! Ich möchte, dass du meinen jungen deutschen Freund Dr. Ernst Stockmann kennenlernst. Darf ich euch bekanntmachen: Paul – Ernst. Ernst – Paul!» Dr. Stockmann, der ein wenig älter als die meisten Studenten und ein wenig jünger als Dekan Close aussah, trug einen Collegeblazer des Downing College in Cambridge.
Dekan Close verschwand und ließ Paul mit Dr. Stockmann stehen, der mit klarer, ruhiger Stimme von der Collegekapelle jenseits des Hofes zu sprechen begann. Dr. Stockmann sagte, ihre Architektur erinnere ihn an die religiösen Sonette von John Donne und einigen deutschen mystischen Lyrikern, deren Werk mit dem Donnes eine gewisse Verwandtschaft habe. Er erzählte Paul, er habe in Cambridge studiert, wäre aber viel lieber nach Oxford gegangen, und zwar gerade ans University College, um dessen Architektur betrachten zu können, die zwar nicht überragend sei, aber eine ruhige Sicherheit ausstrahle – eine Art überkommener Unschuld –, die ihm ungemein englisch vorkomme. Er setzte ein beziehungsreiches Lächeln auf, als er «englisch» sagte, dann fügte er hinzu: «Sie erinnert mich an Ihr Gedicht über einen Ihrer Freunde, er heißt Marston. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass mein Freund Hugh Close es mir gezeigt hat.»
Paul war geschmeichelt. Er hätte nie gedacht, dass Dekan Close sein Gedicht einem Fremden zeigen würde. Er sagte mit Wärme in der Stimme, auch er hätte gewünscht, dass Dr. Stockmann an seinem College studiert hätte, denn dann hätte er einen Freund gehabt, mit dem er über Lyrik hätte reden können, «die meine Kommilitonen an diesem College verabscheuen».
Dr. Stockmann lächelte verständnisvoll und machte den Vorschlag, Paul solle ihm beim Lunch Gesellschaft leisten, den er mit ein paar Freunden im Mitre Hotel auf der anderen Seite der High Street einnehmen wolle. «Ich könnte mir denken, dass Sie vielleicht ein, zwei Leute treffen, die Ihnen sympathisch sind.»
Am Tisch saßen mehrere schick und gepflegt gekleidete junge Männer von der Art, wie Paul sie eigentlich nicht ausstehen konnte, von denen er aber insgeheim doch beeindruckt war. Er war außerstande, sich an ihrer Unterhaltung zu beteiligen. Sein Einkommen in Oxford betrug nur dreihundertfünfzig Pfund im Jahr, während die anderen Gäste Jahreseinkommen von fünfhundert bis zu mehreren tausend Pfund hatten. Er benahm er sich deshalb noch unbeholfener als sonst. Er erzählte eine Geschichte, die keinen rechten Sinn ergab, und begann ein französisches Zitat, nur um feststellen, dass er einzelne Wörter vergessen hatte und andere nicht aussprechen konnte. Verächtliches Schweigen senkte sich über die jungen Männer, von denen Paul keinen je zuvor getroffen hatte. Doch Dr. Stockmann rettete Paul aus seiner unglücklichen Lage, indem er, obwohl er Deutscher war, Pauls verunglückten englischen Satz aufgriff und das, was er hatte sagen wollen, verdeutlichte und harmonisch in das allgemeine Gespräch einfügte. Dr. Stockmann war Pauls Tischnachbar. Gegen Ende des Essens, als sie alle ziemlich betrunken waren, wandte er sich ihm zu und sagte, Dekan Close sei der Meinung, er habe eine große Zukunft, wenn auch vermutlich nicht nach strikt akademischen Maßstäben.
Paul erzählte ihm, er wolle in den langen Sommerferien nach Deutschland fahren, da er für die Examensarbeit in Philosophie Deutsch lernen müsse. Dr. Stockmann, der Pauls Ungeschicklichkeiten offenbar sämtlich übersah, ja ihn sogar entzückend naiv zu finden schien, lud ihn daraufhin ein, zu ihm in sein Elternhaus nach Hamburg zu kommen. Paul nahm sofort an – vielleicht nicht in erster Linie aus Dank für die Einladung als vielmehr für Dr. Stockmanns offensichtlichen Glauben an seine Begabung.
Es dauerte noch einige Wochen bis zum Ferienbeginn. Zeit genug für Paul, darüber nachzudenken, dass diese Einladung, die Dr. Stockmann nur eine Stunde, nachdem sie sich kennengelernt hatten, ausgesprochen und wenige Tage später in einem sehr freundlichen Brief aus Hamburg bestätigt hatte, ziemlich merkwürdig war. Paul fragte sich, was Dekan Close Dr. Stockmann über ihn erzählt hatte.
Was ihn aufmerken ließ, war ein zweiter Brief von Dr. Stockmann, den er am 10. Juli erhielt und in dem Ernst, wie Dr. Stockmann nun unterzeichnete, ihn wissen ließ, er erwarte ihn am 20. des Monats. Paul buchte für die Nacht vom 19. eine Überfahrt auf der Bremen, einem Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, das von Southampton nach Cuxhaven fuhr.
Am Vorabend seiner Abreise nach Hamburg besuchte Paul William Bradshaw in dem kleinen, frühviktorianischen Stuckhaus seiner Mutter, das in einer ruhigen, gartenähnlichen Villengegend in Bayswater lag. Als er die Vordertreppe hinaufstieg, wurde die Tür von einer Dame geöffnet, die – obwohl der Friedensschluss zehn Jahre zurücklag – dunkle Kriegerwitwenkleidung trug. Sie sah ihn aus ebenso großen und wachsamen Augen an, wie William sie hatte, aber die ihren waren auf die Molltöne von Trauer und Resignation gestimmt und schauten in die Vergangenheit, während aus seinen Augen die Dur-Stimmung der Zukunft blickte. Der verhangene Ausdruck entrückter Verträumtheit auf Mrs Bradshaws Gesicht verbarg jedoch nicht ganz den fest entschlossenen Blick. Sie sagte mit gezwungen freundlich klingender Stimme: «Sie müssen der Gast meines Sohnes sein. Er ist etwas unpässlich gewesen, daher freut er sich sicher, Sie zu sehen» (sich selbst nahm sie stillschweigend von dieser Freude aus, dachte Paul). «Ich muss leider aus dem Haus, um einen sehr alten Freund zu besuchen, dem es alles andere als gut geht. Wenn Sie diese erste Treppe hinaufsteigen, finden Sie William in seinem Arbeitszimmer, erste Tür oben rechts. Unser Kranker wartet zweifellos schon auf Sie.»
Leise schloss sie die Tür und ließ Paul in der Diele stehen. Er lief die Treppe hinauf und klopfte an die Tür des Arbeitszimmers. Kaum hatte William ihn hereingelassen, fragte Paul: «War das deine Mutter?» – «Wer sonst?», sagte William bitter. «Bestimmt hat sie in ihrem Unterstand gewartet und durch die Vorhänge geschaut, um sich eine Meinung über meinen Besuch zu bilden, bevor sie das Haus verlässt. Von jedem meiner Freunde vermutet sie das Schlimmste. Wenn es nach ihr geht, soll dieses Haus ein Gefängnis sein und sie selbst meine Aufseherin. Gott, wie werde ich froh sein, wenn ich dieses Höllenloch verlasse. Von Simon weiß ich, dass du diesem Land entfliehst.»
«Ich reise morgen nach Hamburg.»
«Wie ich dich beneide. Sobald ich hier weg kann, will ich nach Berlin.»
«Aber kannst du ohne Schlussexamen weg vom Krankenhaus?»
«Diese Frage stellt meine Mutter mir jeden Morgen beim Frühstück. ‹In dieser Welt muss man durchhalten, so schwierig man das auch finden mag. Denk daran, lieber William, dein Vater hat den Krieg durchgehalten.› Ich habe das so oft erzählt bekommen, dass ich sie heute gefragt habe: ‹Was wäre dir letztlich lieber, Mutter, dass mein Vater durchgehalten hat und gefallen ist? Oder dass er nicht durchgehalten hätte und jetzt hier am Tisch mit uns frühstückte?›»
«Was hat sie gesagt?»
«Was sie in solchen Fällen immer sagt – ‹Lieber William, du scheinst heute Morgen etwas unpässlich zu sein.›»
«Trotzdem, kannst du vor dem Examen mit dem Medizinstudium aufhören?»
William zuckte die Schultern. «Ich habe ihnen praktisch schon gesagt, dass ich über das Sezieren menschlicher Leichen alles gelernt habe, was ich wissen wollte. Jetzt habe ich vor, menschliche Leben zu sezieren. Sobald ich mir die Fahrkarte zusammengespart habe – von dem winzigen Einkommen, das mir mein perverser reicher Onkel William, nach dem ich genannt bin, zukommen lässt, falls er daran denkt –, fahre ich nach Berlin. Ich will raus aus diesem Land, wo die Zensur James Joyce verbietet und die Polizei eine Razzia in der Galerie veranstaltet, in der die Bilder von D. H. Lawrence ausgestellt sind.»
«Hast du heute im Mirror die Geschichte von der Polizistin gelesen, die einen Nacktschwimmer verhaftet hat?»
«Nein, erzähl!»
«Irgendwo an der Küste von Dover beobachtete eine Polizistin vom Kliff aus durch das Fernrohr einen Mann weit draußen im Meer, der nackt schwamm. Also ging sie zum Strand hinunter und verhaftete ihn, als er aus dem Wasser kam.»
«Also wirklich, Paul, das musst du erfunden haben.» William lachte. «Ich glaube das einfach nicht.»
«Kein bisschen. Und das Komischste ist, dass er seine Badehose anhatte, als er aus dem Wasser kam. Er hatte sie erst beim Schwimmen ausgezogen und wie ein Hund zwischen den Zähnen gehalten.»
«Dann sollten wir wohl der Polizistin gratulieren, dass der Schwimmer ihr den Anblick seines Penis‘ erspart hat.»
«Vielleicht kann der Schwimmer darauf plädieren, dass er sich in exterritorialem Gewässer befunden hat und nicht in England.»
William lachte, verfiel dann aber wieder in theatralisches Schweigen. Im Bewusstsein, einen fürchterlichen Verweis zu riskieren, fragte Paul: «Was macht dein Roman?»
«Ich kann in diesem Haus kein Wort schreiben.»
Bei diesen Worten überkam William ein Ausdruck unendlicher Müdigkeit. In Pauls Augen schien jeder Gegenstand in dem kleinen Arbeitszimmer auf William zu lasten: die säuberlich aufgestellten Reihen englischer Klassiker in den Regalen, die beiden Lehnstühle, in denen sie am Kamin saßen, der Tisch mit Williams Schreibmaschine darauf und das Aquarell über dem Kaminsims, Hasenglöckchen im Wald, das sein Vater gemalt hatte, Colonel Bradshaw, der am 15. Februar 1916 an der Westfront vermisst gemeldet worden war und von dem man nie wieder etwas gehört hatte. «Worum geht es in deinem Roman?»
Paul stellte diese Frage aus dem einfachen Grund, weil er es leidenschaftlich gern wissen wollte.
William warf Paul einen gereizten Blick zu, als sei er entschlossen, sich nichts entlocken zu lassen. Dann änderte er jäh seine Haltung und sagte: «Ich habe noch mit niemandem darüber gesprochen, nicht einmal mit Wilmot, aber schließlich sind wir ja hier, um über unsere Sachen zu reden. Wir sind Kollegen, Schriftstellerkollegen wie Henry James und Turgenjew, die sich über ihre Arbeit unterhalten. Vielleicht bin ich imstande, meinen Roman zu schreiben, wenn ich dir die Idee erzähle.»
Einige Augenblicke lang schwieg er wieder. Dann hob er plötzlich den Kopf und sah Paul an. Das Leuchten seiner Augen wurde stärker. «Um dir meine Idee zu erklären, sollte ich am besten erst einmal erzählen, wie es anfing.»
Wieder folgte eine Pause, und dann sagte William: «Es begann eigentlich in der Schule, in Repton, als Simon und ich zusammen im Geschichtskurs der Sechsten waren. Am Anfang unseres letzten Schuljahres bekamen wir einen neuen Lehrer, nicht viel älter als wir, zweiundzwanzig, höchstens dreiundzwanzig. Er hieß Hugh Salop und war ein ungewöhnlich mitreißender Lehrer. Anstelle von Namen und Jahreszahlen führte er uns lebendige Menschen vor und gab uns das Gefühl, genau in den Abschnitt der Vergangenheit zurückversetzt zu sein, den wir gerade durchnahmen. Kaum betrat er die Bibliothek, wo er uns unterrichtete, war es, als wäre alles frisch und neu, als spielte sich irgendeine vergangene Schlacht oder Krise gerade jetzt ab und niemand wüsste, wie es ausgehen würde ... Nur um dir ein Beispiel zu geben – da war dieser kleine Mann, eine Mischung aus einem modernen Zeitungsverleger wie Northcliffe und einem hochintelligenten Populärwissenschaftler wie H. G. Wells, der aus Korsika kam, wo er als Kind mit seinen Geschwistern Krieg gespielt hatte, und der sich, als er als junger Mann auf das französische Festland kam, sehr für die Wissenschaft und all die revolutionären Ideen in der damaligen Revolutionszeit begeisterte. Er war ein großartiger Reformer und Verwalter, nur konnte er das Kriegspielen nicht lassen – das ist albern, ich weiß. Was ich sagen will, ist, dass Mr Salop Geschichte so brachte, als liefe sie gerade in der letzten Wochenschau. Er versetzte Simon und mich auch aus einem ganz anderen Grund in Aufregung. Er hatte an der Westfront gekämpft – mit siebzehn hatte er sich zum Kriegsdienst gemeldet – und sich eine Schützengrabenneurose zugezogen. Es gab Augenblicke, wo wir spürten, dass er mit einem Teil seiner Gedanken noch immer an der Westfront war. Mitten beim Erzählen aus der französischen Geschichte konnte er plötzlich nach einem Halbsatz abbrechen, eine erschreckende Grimasse ziehen, etwas sagen wie ‹Flandern – nicht gerade ein Ruhmesblatt!›, und dann, einen Augenblick später, weiter unterrichten. Und manchmal sagte er etwas ganz Verrücktes ...»
«Zum Beispiel?»
«Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, weil Simon daraus eine Gedichtzeile gemacht hat. Er redete von der alten englischen Bauernschaft, Ackerbau und so weiter, und brach plötzlich ab, trat ans Fenster, starrte auf die frisch gepflügten Felder – das Getreide fing schon an zu sprießen – und sagte: ‹Die Pflugschar schneidet einen Schrei.›»
«Was meinte er damit?»
«Simon und ich brachten heraus, dass er an die Felder in der Normandie dachte, wo die Westfront verlaufen war. Dort kommen beim Pflügen natürlich noch immer Kriegsüberbleibsel ans Tageslicht – Helme, Riemen, Eiserne Kreuze, Granathülsen. Jedenfalls betrieben Simon und ich in der Schule einen ziemlichen Kult um Mr Salop. Wir versuchten herauszufinden, wie er über den Krieg dachte, aber wir konnten ihn fast nie dazu bringen, davon zu erzählen. Und wenn wir ihn dazu bekamen, waren wir nicht sicher, ob er uns nicht auf den Arm nahm. Oder vielleicht war er auch nur verrückt. Zum Beispiel sagte er einmal: ‹Ich habe jeden Augenblick des Kriegs geliebt. Ich hatte ein weißes Pferd, auf dem ich hinter den Linien ritt.› Einmal fragten wir ihn, ob er die Deutschen gehasst habe.»
«Und was hat er geantwortet?»
«Er sagte: ‹Ich habe alle Soldaten in den Schützengräben geliebt, egal, auf welcher Seite sie waren, aber besonders die Deutschen, gerade weil man uns gelehrt hatte, sie zu hassen. Öffentlicher Hass erzeugt private Liebe. Liebet eure Feinde! Mein Gott, ich liebe die Feinde Englands.›»
«Wie habt ihr darauf reagiert?»
«Wilmot, der schon eine Menge von Psychoanalyse verstand, wurde misstrauisch. Ich schien Mr Salop wohl ziemlich zu gefallen. Wilmot sagte: ‹Pass auf, wenn er mit dir ausgeht und anfängt, dich in den Po zu kneifen.›» – «Bist du denn jemals mit ihm ausgegangen?»
«Natürlich wünschte ich mir nichts sehnlicher als das. Aber bevor er oder vielmehr wir dazu kamen, wurde er gefeuert.»
«Warum?»
«Der Direktor erzählte uns, er sei krank: aber in einem Ton, der mit ‹Krankheit› eindeutig ‹sexuelles Fehlverhalten› meinte.»
«Und was geschah dann mit ihm?»
«Genau darum geht es in meinem Roman. Wir haben es nie erfahren.»
«Was passiert dann also im Roman?»
«Er beginnt in der Schule mit diesem Lehrer, der aus dem Krieg zurückgekehrt ist und unterrichtet, aber mit einem Teil seiner Gedanken nach wie vor in den Schützengräben ist. Schule ist ja eine Art Krieg zwischen Schülern und Lehrern, oder? Er ist ein Lehrer, der auf Seiten der Schüler steht, so wie er in gewisser Weise auf Seiten der Deutschen war. Er hat einen Schützengrabenschock, er ist neurotisch, und ein besonders hellsichtiger Schüler erkennt das. Für diese Figur ist natürlich Wilmot das Vorbild. In meinem Roman gewinnt ‹W.› eine Art Überlegenheit über ‹Mr S.› (nennen wir die beiden so). Mr S. wird nicht gefeuert, sondern bekommt einen Nervenzusammenbruch, vielleicht weil W., dieser schlaue psychoanalytische Schüler, ihm zu viele Wahrheiten sagt: So, wie Rimbaud es vermutlich mit seinem Lehrer Izambard gemacht hat. Und nun passiert folgendes: Mr S. geht, ohne dass W. davon weiß, nach Berlin und unterzieht sich einer psychoanalytischen Behandlung, eventuell bei einer amerikanischen Psychoanalytikerin. (Ich brauche eine Frau in dem Roman.) Zwei Jahre später kommt W. nach Berlin und trifft dort ganz zufällig Mr S. in einer Bar. Sie sind hocherfreut, sich wiederzusehen: Mr S. glaubt, ohne die widrigen Umstände des Schullebens könne er W. jetzt nachstellen, und W. ist ganz beglückt, wieder Macht über Mr S. ausüben zu können. Aber nach ein paar Wochen ist W. von Mr S. restlos gelangweilt, weil er ihm das Gefühl gibt, als wären sie beide wieder in der Schule, in einem Moment, wo W. gerade alle Zwänge abstreifen will. Außerdem empfindet er körperlichen Ekel vor Mr S., besonders, seit er aus psychoanalytischem Interesse mit ihm ins Bett gegangen ist. Diese Szene wird bei mir zum Brüllen komisch.» Er kicherte.
William machte eine Pause von mindestens einer Minute.
«Und was passiert dann?»
«Ja, nun kommt der allerschwierigste Teil. Es ist ein ähnliches Problem wie das, dessen Lösung Forster in The Longest Journey nicht gelungen ist. Die Sache ist die, dass ich mich in eine Ecke verrannt habe, wo die Lösung einfach melodramatisch sein muss. Zumindest müssen die Abläufe des Melodrams nachvollzogen werden.»
«Was passiert?», fragte Paul ungeduldig. «Was passiert als nächstes?»