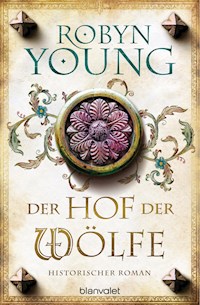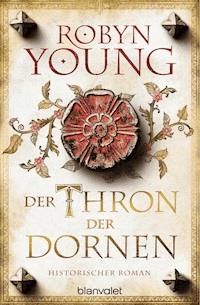
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jack Wynter
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Rosenkriege sind vorbei, doch der englische Thron ist voller Blut und Dornen.
Sevilla 1483: Jack Wynter wurde von seinem Vater auf eine geheime Mission nach Spanien entsandt, um eine verschlossene Kiste zu bewachen und sie mit seinem Leben zu schützen. Doch dann wird Jacks Vater des Hochverrats angeklagt, und die ganze Familie steht im Mittelpunkt einer tödlichen Intrige. Jack kann nicht anders: Er muss das Geheimnis der rätselhaften Truhe lüften und zurück nach England reisen, wo der junge Prinz Edward den Thron besteigen soll und dessen Onkel Richard von Gloucester bereits plant, die Herrschaft an sich zu reißen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 864
Ähnliche
Buch
Sevilla 1483: Jack Wynter wurde von seinem Vater auf eine geheime Mission nach Spanien entsandt, um eine verschlossene Kiste zu bewachen und sie mit seinem Leben zu schützen. Warum, das weiß er nicht. Als Jack erfährt, dass sein Vater in der englischen Heimat des Hochverrats angeklagt wurde und in Gefangenschaft geraten ist, wird ihm klar, dass seine Familie im Mittelpunkt einer tödlichen Intrige steht. Doch welches Geheimnis hütet die rätselhafte Truhe? Die Antwort liegt nicht in Spanien, sondern in England, wo der junge Prinz Edward den Thron besteigen soll. Dort spinnt dessen Onkel Richard of Gloucester einen teuflischen Plan, um seinen Neffen zu entmachten und die Herrschaft an sich zu reißen. Jack Wynter beschließt, in die Heimat zurückzukehren und ein Geheimnis zu lüften, das ihn bis ans Ende der bekannten Welt führen wird …
Autorin
Mit ihrem Debüt Die Blutschrift gelang der Britin Robyn Young in Großbritannien und den USA ein großartiger Durchbruch, der sie auf die Bestsellerlisten schnellen ließ. Geboren 1975 in Oxford, begann sie schon früh, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Aber erst während eines Seminars in Kreativem Schreiben fand sie den Mut, ihre Ideen für einen Roman zu Papier zu bringen. Heute lebt Robyn Young in Brighton, und wenn sie nicht gerade an einer Trilogie schreibt, unterrichtet sie Kreatives Schreiben an verschiedenen Colleges.
Von Robyn Young bereits erschienen
Die Blutschrift · Die Blutritter · Die Blutsfeinde · Rebell der Krone · Krieger des Friedens · König des Schicksals · Der Thron der DornenBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ROBYN YOUNG
Historischer Roman
Deutsch von Nina Bader
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Sons of the Blood« bei Hodder, London. Copyright der Originalausgabe © 2016 by Robyn Young Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Redaktion: Werner Bauer Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© steveball, © Groundback Atelier, © ollen, © Oksana Alekseeva, © Benjamin Abram) Karte: Rodney Paull BL · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-20471-6 V002 www.blanvalet.de
Meinem Opa gewidmet:für die Geschichten
1
Im Morgengrauen waren sie auf dem Weg zu ihm, um ihn zu holen; in scharfem Galopp preschten sie die römische Straße entlang. Die aufgehende Sonne ließ jeden Schwertknauf golden funkeln und fing sich feurig in den gebogenen Klingen zahlreicher Äxte. Unter den sich bauschenden schlammbespritzten Umhängen waren die wattierten Brigantinen – die mit Eisenplättchen besetzten Panzerhemden der Soldaten – deutlich zu erkennen. Die Männer gaben ihren Pferden die Sporen, bis jedes Tier blutete; ihre Muskeln schmerzten ob des gnadenlosen Tempos, und sogar unter den ledernen Handschuhen bildeten sich auf ihren Handflächen offene Blasen. Die feuchte, schneidende Luft verwandelte den Atem der Pferde in weiße Wölkchen, die ihren geblähten Nüstern entquollen. Raureifflecken auf der Straße zerstoben unter trommelnden Hufen.
Über den Köpfen der Truppe wehten keine Banner, auch trugen sie keine Livreen, denn an diesem Aprilmorgen waren sowohl Anonymität als auch Eile ihre Verbündeten. Dort, wo die Watling Street schnurgerade auf den Great Ouse zuführte, stieß der letzte der Wachposten, die vorausgeritten waren, um zu verhindern, dass sich die Nachricht von ihrem Kommen verbreitete, zu der Gruppe, und gemeinsam donnerten die Reiter auf den kleinen Marktflecken Stony Stratford und das Ziel ihrer wilden Jagd zu: den Jungen, der König geworden war.
Thomas Vaughan stieß die Gasthaustür auf und schützte die Augen vor dem goldenen Glanz des Morgens. Heute war Markttag, und auf der Hauptstraße vor dem Rose and Crown herrschte geschäftiges Treiben. Er trat in das Getümmel hinaus und ging die Straße hinunter. Es war noch früh, doch die Frühlingssonne, die voll auf die weiß getünchten Gebäudefassaden fiel, verströmte bereits eine zaghafte Wärme. Ihre strahlende Helligkeit spiegelte sich in den Gesichtern der Händler wider, die die Vorübergehenden ansprachen. Die meisten derer, die sich auf der Straße drängten, waren bereits seit einigen Stunden auf den Beinen und in Werkstätten oder draußen auf den Feldern tätig gewesen. Jetzt waren sie auf der Suche nach einer Mahlzeit, um ihr Fasten zu brechen, hierhergekommen, angelockt von dem Duft fetttriefender Pasteten und der in Kesseln köchelnden Eintöpfe aus Fleisch und Gerste.
Während Vaughan sich einen Weg durch die Menge bahnte, spürte er, dass zahlreiche Augen auf ihm ruhten, und die Rufe der Händler wehten laut und eifrig in seine Richtung. Obwohl seine Hose und seine Stiefel nach dem Ritt von Ludlow hierher Pferdeschweißflecken aufwiesen und seine Kleider eher zweckmäßig als modisch geschnitten waren, hob er sich mit seiner Federkappe und seinem reich mit Brokat verzierten Wams und Umhang von diesen Männern und Frauen in ihrer Werktagskluft ab. Trotz der unwillkommenen Aufmerksamkeit fühlte es sich gut an, sich im Freien aufzuhalten und sich zu bewegen. Er war lange vor Tagesanbruch erwacht und hatte keinen Schlaf mehr finden können, und seine innere Unruhe war mit den langsam verstreichenden Stunden nur noch gewachsen.
Es war schwer, den genauen Grund für sein Unbehagen zu benennen. Die Nachrichten, die sie nach dem plötzlichen Tod des Königs erreicht hatten – von heftigen Szenen, die sich wegen Arrangements für die Krönung zwischen der Königinwitwe Elizabeth Woodville und Verbündeten ihres Schwagers, dem Duke of Gloucester, abgespielt hatten –, waren ungelegen, aber nicht unerwartet gekommen. Es war eine schwierige Zeit, und die Stimmung würde vom Feuer der Unsicherheit noch angeheizt werden. Vielleicht hatte Gloucesters zähe Beharrlichkeit, sich der Gruppe anzuschließen, die seinen Neffen nach London eskortierte, irgendwie seinen Argwohn geweckt? Oder vielleicht, sinnierte Vaughan, suchte er nach Drohungen, wo es nur Schatten gab. Aufgrund all dessen, was in diesem letzten Jahr geschehen war – Ereignisse, die bewirkten, dass er ständig über seine Schulter spähte und auf eine Klinge wartete, die sich in seinen Rücken bohren wollte –, war es nicht weiter verwunderlich, dass sein Vertrauen erschüttert war.
Dennoch war Vorsicht oft ein besserer Freund als Unbesonnenheit, etwas, das er in seinen dreiundsechzig Lebensjahren nur zu gut gelernt hatte, weshalb gestern, als Gloucesters Einladung an ihre Truppe, in Northampton mit ihm zu speisen, beschlossen worden war, dass Anthony Woodville, der Earl Rivers, allein gehen würde, um die Absichten des Herzogs auszuloten, bevor sich die beiden Parteien für die geplante Prozession nach London zusammenschlossen. Rivers, der Onkel und Statthalter des neuen Königs, war am späten Nachmittag aufgebrochen, um die achtzehn Meilen Richtung Norden zurückzulegen. Ein Teil seiner Männer hatte ihn begleitet, während der Rest der königlichen Eskorte ausgeschwärmt war, um in den umliegenden Weilern ein Bett für die Nacht zu finden. Den jungen Edward hatten sie mit einer kleinen Wächtertruppe, Dienern, seinem Halbbruder Richard Grey und Vaughan, seinem Kammerherrn, in Stony Stratford zurückgelassen.
An einer Kreuzung vor ihm, wo die Stände und die Menschenmenge sich lichteten, wurde die Straße von dem Monument zu Ehren Königin Eleanors beherrscht. Der helle Schein der gotischen Bogen, die die Statue der lang verstorbenen Königin umgaben, schien im Sonnenlicht zu glühen. Auf der Straße von Lincoln nach London gab es zwölf solcher Denkmäler; sie waren vor zwei Jahrhunderten von König Edward I. errichtet worden, um die Orte zu kennzeichnen, wo der Leichnam seiner Frau auf dem Weg zur Beerdigung geruht hatte. Vaughan schritt an dem Monument vorbei und schlenderte auf den Great Ouse zu, der sich schlangengleich durch die Wiesen wand und dessen Wasser fast einen Kreis um die Stadt zog.
Hier wich das Stimmengewirr des Marktes aufgeregtem Vogelgezwitscher und dem Rascheln des Windes in den Eichen. In einiger Entfernung überspannte eine Brücke den Fluss, auf der ein Karren stand. Der Fahrer war abgestiegen und unterhielt sich mit den Männern, die die Zahlstation besetzten; ein Geschirr klirrte vernehmlich, als eines der vor den Karren gespannten Saumpferde den Kopf hochwarf. Dahinter führte die Watling Street weiter nach Norden und verschwand im Schatten eines Waldes. Vaughan blieb stehen und ließ den Blick über die Bäume in der Ferne schweifen. Der Wirt des Rose and Crown hatte sie mit neugierigen Fragen bezüglich des hellhaarigen Jugendlichen überhäuft, den sie begleiteten, und schon waren Gerüchte über einen königlichen Besucher in der Stadt im Umlauf. Je eher sie auf dem Weg in die Hauptstadt waren, desto besser, und das nicht nur wegen des Schutzes, den sie bot. Englands Thron war jetzt seit drei Wochen unbesetzt, und Vaughan wusste nur zu gut, wie leicht der Ehrgeiz von Männern aufflammen konnte.
Er kehrte der verlassenen Straße den Rücken und trat den Rückweg an. Möge Gott ihm Geduld schenken. Sie würden bald genug dort sein. Dann würde der Junge in Westminster gesalbt werden, und das große Werk, dem sich Vaughan dieses vergangene Jahrzehnt unter so vielen Opfern verschrieben hatte, würde Früchte tragen. Als das steinerne Monument vor ihm aufragte, dachte er an den Mann, der es in den Tagen, als das Haus Plantagenet in Stärke vereint gewesen war, hatte erbauen lassen. Die Blutlinie dieses Königs war in all den Jahren danach weitergeführt und aufgeteilt worden, war durch die Adern der Nachkommen von John of Gaunt geflossen und schließlich in die eines weiteren langbeinigen Kriegerkönigs namens Edward geströmt – des vierten dieser Linie.
Fast zwanzig Jahre lang hatte Vaughan verfolgt, wie sich die großen Häuser Lancaster und York – zwei rivalisierende Zweige der Plantagenet-Dynastie, beide mit Söhnen mit Thronansprüchen – im Kampf um die Krone auf englischem Boden in blutige Fetzen gerissen, ein Heer von Würmern mit dem Fleisch ihrer Gefallenen gemästet und in jeder neuen Generation von Männern den kalten Stahl des Hasses geschmiedet hatten. Er trug die Narben dieses Krieges am Körper und auch auf der Seele. Mit dem Frieden, der vor einem Jahrzehnt mit König Edwards zweiter Herrschaft angebrochen war, schien England mit einer weiteren langen, fruchtbaren Regierungszeit gesegnet worden zu sein. Aber jetzt war Edward – die Rose von Rouen und weiße Hoffnung von York, Held von Mortimer’s Cross und Lancasters Verderben – tot. Der König hatte die Hölle der Schlachtfelder überlebt, nur um zu lange beim Fischen zu verweilen und die Kälte und Feuchtigkeit in seine Knochen sickern zu lassen. Die Krankheit hatte ihn nur Wochen vor seinem einundvierzigsten Geburtstag dahingerafft. Sein von den unstillbaren Gelüsten, die seine letzten Jahre überschattet hatten, aufgeblähter Körper ruhte jetzt in Windsor, was bedeutete, dass die Krone auf seinen zwölfjährigen Sohn und Erben überging. Wieder ein Minderjähriger. Sie hatten diesem Königreich selten gute Dienste geleistet.
Das Donnern von Hufen lenkte Vaughans Aufmerksamkeit abrupt auf die Straße zurück. Reiter lösten sich aus dem Wald und hielten auf die Brücke zu. Seine Hoffnung stieg, sank aber sogleich wieder, als er erkannte, dass die Reiter in schlichte schwarze Umhänge und Tuniken gekleidet waren. Keiner trug die Farben von Earl Rivers und auch nicht die von Gloucester oder Buckingham. Nichtsdestoweniger boten sie einen fesselnden Anblick: ungefähr fünfzig Reiter in vollem Galopp, unter den Hufen der Pferde aufspritzender Schlamm, das unverwechselbare Schimmern von Waffen. Vaughan kniff die Augen zusammen, hielt nach vertrauten Gesichtern Ausschau, aber die Gruppe war zu weit weg und seine Sehkraft nicht mehr das, was sie einmal gewesen war. Er erhaschte einen Blick auf einen bluthell aufblitzenden scharlachroten Umhang in ihrer Mitte, der ihm verriet, dass sich zumindest ein Edelmann unter ihnen befand.
Die Reiter verlangsamten ihr Tempo, als sie sich der Brücke näherten, auf der der Karren stand. Vaughan hörte einen Ruf.
»Zur Seite! Macht Platz für den Duke of Gloucester!«
Eine eisige Faust der Furcht schloss sich um Vaughans Herz. Das war nicht das vom Herzog versprochene Staatsgefolge, das den neuen König nach London eskortieren sollte! Es gab keine Banner oder Livreen, kein Zeichen von Rivers – nur strapazierte Pferde und bewaffnete Männer in anonymem Schwarz. Der Knoten des Unbehagens in seinem Inneren löste sich auf. Er drehte sich um und rannte los, jagte zwischen den Reihen von Ständen hindurch zurück, rempelte in seiner Hast Leute an. Sein rechtes Knie, das er sich verletzt hatte, als er im Kanonenfeuer von Tewkesbury von seinem Pferd gezerrt worden war, pochte schmerzhaft. Die Menge auf dem Markt würde die Reiterschar behindern und ihm Zeit verschaffen. Aber nicht viel.
Als er sich nach Atem ringend dem Rose and Crown näherte, sah Vaughan Edward in der Tür des Gasthauses stehen. Der langgliedrige Junge, der versprach, genauso groß zu werden wie sein Vater, hatte eine Hand gehoben, um seine Augen vor der Sonne zu schützen, die sein schulterlanges helles Haar fast weiß schimmern ließ.
Beim Anblick Vaughans, der jetzt in einen schnellen Laufschritt verfiel, lächelte der junge König. Sein Gesicht, das dieselben feinen Züge wie das seiner Mutter, der Königin, aufwies, aber noch weich und ohne Falsch war, hellte sich auf. »Sir Thomas. Ihr habt meinen Onkel gesichtet?«
Vaughan nahm seine Kappe ab und verbeugte sich; nutzte die Geste, um seine Fassung zurückzugewinnen. Dann hob er den Kopf und begegnete dem erwartungsvollen Blick des Jungen. Er war zusammen mit Earl Rivers Edwards Haushalt in Ludlow zugeteilt worden, als der Prinz gerade zwei Jahre alt gewesen war, sein Vater die letzten seiner lancasterianischen Feinde ausgelöscht und Frieden sich wie ein fadenscheiniges, unsicheres Leichentuch über das Reich gelegt hatte. In dem seither verstrichenen Jahrzehnt war der Junge wie ein Sohn und noch viel mehr für ihn geworden, aber das Schicksal hatte Vaughan nur die Zeit beschert, eine Sache in just diesem Augenblick zu tun, und der König hatte bei ihm nicht oberste Priorität.
»Nein, Mylord. Es gibt kein Zeichen von ihm.« Vaughan lächelte, um die Lüge zu überdecken. »Aber ich werde dafür sorgen, dass die Stallburschen die Pferde bereithalten.«
Als Edward ihn mit einem Nicken entließ, ging Vaughan zu den Ställen hinter dem Gasthaus; dabei stülpte er seine Kappe wieder auf sein eisengraues, jetzt schweißfeuchtes Haar.
Bevor er das Rose and Crown verlassen hatte, hatte er seinen Knappen angewiesen, seine Habseligkeiten zu packen. Stephen beaufsichtigte gerade die Träger, die Bündel und Truhen nach unten brachten. Vaughan sah, dass sein Schwert in seiner roten Lederscheide neben einem Stapel von Taschen an der Stalltür lehnte. Es waren noch andere Männer da – die Leibwächter des Königs, Richard Greys Diener und Earl Rivers’ Knappen –, die mit ähnlichen Tätigkeiten beschäftigt waren. Stallknechte stopften Ausrüstungsgegenstände in Satteltaschen. Die Pferde, zumeist noch nicht aufgezäumt, verzehrten ihr morgendliches Futter. Vaughan ließ seine Entscheidung in sein Bewusstsein einsickern. Es blieb nicht genug Zeit, den König fortzuschaffen. Nicht sicher.
Stephen erblickte ihn. »Fast fertig, Sir«, rief er, während er auf ihn zuging. »Und ich habe Will zum Markt geschickt, um noch mehr Vorräte zu kaufen. Das sollte dann bis London reichen.«
»Stephen, du musst mir genau zuhören.«
Bei seinem Tonfall veränderte sich der Gesichtsausdruck des Knappen, und seine Augen wurden augenblicklich wachsam.
Vaughan blickte sich um, als einer von Rivers’ Männern mit einem auf die Schulter gewuchteten Packen an ihnen vorbeikam. Er hätte es vorgezogen, nicht so offen sprechen zu müssen, nicht hier. Aber ihm blieb keine Wahl. »Ich möchte, dass du nach St. Albans gehst – zum Saracen’s Head. Warte dort auf mich. Wenn ich in drei Tagen nicht nachkomme …« Vaughan hielt inne; ihm war bewusst, welche enorme Last er seinem Knappen aufbürdete. »Stephen, du musst meinen Sohn aufsuchen.«
Stephen runzelte fragend die Stirn, doch da er schon seit Jahren in Vaughans Diensten stand, wog sein Gehorsam mehr als seine Neugier. »Ja, Sir. Harry?«
»Nicht Harry. Meinen anderen Sohn.«
Rivers’ Mann hatte seinen Packen fallen lassen und kam wieder auf sie zu.
Vaughan ging über Stephens Überraschung hinweg, beugte sich vor und murmelte dem Knappen letzte Anweisungen ins Ohr. »Hier«, schloss er und zog dabei drei der vier Ringe, die er trug, von seinen Fingern. Der erste – ein Hochzeitsgeschenk von seiner Frau Eleanor, die seit fast vierzehn Jahren tot war – bestand aus Gold und war mit zwei kleinen Rubinen besetzt, bei dem zweiten handelte es sich um einen schlichten Silberreif, und auf dem dritten prangte eine goldene Scheibe, in die zwei um einen geflügelten Stab gewundene Schlangen mit silbernen Markierungen eingraviert waren, die glitzerten, als er Stephen die Ringe in die Handfläche drückte. Jetzt schmückte nur noch ein Siegelring seine Hand. »Nimm die und mein Schwert. Eleanors Ring wird für die Überfahrt reichen. Gib die beiden anderen und mein Schwert meinem Sohn. Er wird sie für seine eigene Reise brauchen.«
Jetzt brach Stephen das Schweigen. »Sir, was hat das zu bedeuten?«
»So Gott will, sehe ich dich morgen im Saracen’s Head, und wir können bei einem Krug Ale über meine Torheit lachen. Aber wenn nicht …« Es gab noch viel mehr, was Vaughan Stephen sagen wollte. So viel mehr als die Metallreifen, mit denen er Stephen fortschicken wollte. Aber er konnte von der Straße her bereits barsche Rufe und Hufgeklapper hören. Ihm blieb keine Zeit mehr. Vaughan schob seinen Knappen in Richtung der Ställe. »Geh! Geh jetzt!«
Stephen gehorchte. Er griff nach einem der Packen mit Vorräten sowie nach Vaughans Schwert und verschwand im Stall. Einige der Diener und Stallburschen starrten ihn an und fragten sich, was die Eile wohl zu bedeuten hatte.
Einer von Rivers’ Knappen ging mit zusammengezogenen Brauen zu Vaughan hinüber. »Stimmt etwas nicht, Sir Thomas?«
»Keine Sorge, es ist alles in Ordnung.«
Die Rufe von der Straße her waren jetzt lauter geworden. Einige der Männer im Hof hielten mit ihrer Tätigkeit inne und drehten sich um, um nach der Quelle Ausschau zu halten. Vaughan steuerte auf die Geräusche zu, wobei er inbrünstig hoffte, dass er all dies falsch gedeutet hatte – dass seine bösen Vorahnungen unbegründet waren, lediglich ein Produkt seiner Befürchtungen und seiner Fantasie. Vor den Blicken anderer geschützt, blieb er an der Seite des Gasthauses stehen und verfolgte, wie die Gruppe schwarz gekleideter Reiter vor dem Rose and Crown abstieg. Marktbesucher, von denen einige aufgeregte Kinder von den Pferden wegzogen, traten zurück, um die Männer wachsam, aber neugierig anzustarren. Vaughans Blick fiel auf Edward, der neben dem Ring stampfender, schlammbespritzter Tiere fast zwergenhaft wirkte. Die Leibwächter des Königs waren aus dem Gasthaus gekommen und standen mit ihren Schwertern in den Händen schützend vor dem Jungen. Auch der Sohn der Königinwitwe aus erster Ehe, Edwards Halbbruder, war bei ihnen.
»Mylord König.«
Beim Klang der vertrauten Stimme – etwas hoch für einen Mann, aber dennoch schneidend vor Autorität – sah Vaughan, wie sich Richard, Duke of Gloucester, Erster Oberhofmeister und Großadmiral von England, aus der Reitergruppe löste. Der Herzog, hochgewachsen, wenn auch nicht ganz so groß wie sein Bruder, der verstorbene König, und sehr viel schlanker, war ganz in Schwarz gekleidet, nur ein an seinem Umhang befestigtes Abzeichen schimmerte silbern. Es war wie ein Keiler geformt.
Richard näherte sich seinem Neffen. Sein steifer Gang rührte, wie Vaughan wusste, von einer Fehlstellung seiner Wirbelsäule her. Die Missbildung, unter der der Herzog seit seiner Jugend litt, war unter den Falten seines Samtumhangs kaum zu erkennen, aber Vaughan wusste, dass sie da war. Er hatte nach der Schlacht von Barnet, als der Arzt Richard das Hemd von seinem blutüberströmten Körper gestreift hatte, die durchaus schmerzhaft aussehende Rückenverkrümmung des Mannes gesehen.
Der Herzog nahm seine schwarze Samtkappe ab und kniete vor dem König nieder. Sein schulterlanges dunkles Haar fiel ihm ins Gesicht. Die Wächter, die Edward beschützten, ließen die Schwerter sinken. Der Rest von Richards Truppe folgte seiner Geste, auch sein Vetter Henry Stafford, der Duke of Buckingham, der sich von den anderen abhob. Eine auffallende bunte Blume zierte seine scharlachroten Gewänder. Vaughan, der Gloucester nie nahegestanden hatte, obwohl er ihm jahrelang gedient und ihn als Anführer respektiert hatte, war überrascht gewesen, als er hörte, dass Richard sich mit Buckingham zusammengetan hatte. Der junge Herzog, dem jahrelang jegliche königliche Gunst verwehrt geblieben war, stand in dem Ruf, arrogant und ungestüm zu sein.
Buckingham erhob sich als Erster und klopfte den Staub von seinem Seidengewand. Auch er trug ein Abzeichen, das sein Emblem zeigte: einen Schwan mit einer Krone und einer Kette um den Hals.
Gloucester erhob sich gleichfalls und wandte sich an seinen Neffen. »Mylord, ich bringe schlechte Nachrichten.«
Edward musterte die Gruppe besorgt. »Onkel, wo ist Sir Anthony? Er ist gestern aufgebrochen, um Euch zu treffen.«
Als er Stimmen hinter sich hörte, drehte Vaughan sich um und sah einige der Diener und Wächter des Königs von den Ställen herüberkommen. Das Verstauen des Gepäcks war vergessen. Über ihre Köpfe hinweg erhaschte er einen Blick auf Stephen, der eine der vom Hof wegführenden Gassen hinunterritt.
»Mylord, es schmerzt mich, Euch mitteilen zu müssen, dass Earl Rivers einer Verschwörung gegen Euch überführt worden ist.« Gloucesters Blick wanderte zu Richard Grey. »Zusammen mit Eurem Halbbruder und Eurem Kammerherrn Sir Thomas Vaughan. Sie haben vor, die Kontrolle über Euer Reich zu übernehmen.«
Vaughan fuhr herum. Seine Erleichterung über Stephens Abreise gefror angesichts dieser Worte in seinem Inneren zu Eis. Lieber Gott, was hatte Gloucester herausgefunden? Hatte Rivers enthüllt, was sie zu schützen geschworen hatten? War er verraten worden? Er rieb mit dem Daumen über das Ende seiner Finger, wo der goldene Schlangenreif einen weißen Ring hinterlassen hatte.
»Lügen!«, brüllte Grey mit vor Wut rot angelaufenen Wangen. Er wandte sich an Edward. »Mylord, Ihr dürft kein Wort davon glauben!«
Gloucester fuhr ruhig fort: »Ich habe Beweise dafür, dass sie geplant haben, mich auf der Straße in einen Hinterhalt zu locken. Ich glaube gar, sie wollten mich töten.«
Vaughans Schreck schlug in Zorn um. Er trieb ihn aus seinem Versteck heraus. »Was für Beweise?«
Gloucesters Blick schweifte zu Vaughan, als dieser um die Hausecke kam. Der Gesichtsausdruck des Herzogs veränderte sich, als wäre er dankbar, ihn zu sehen.
Auf Buckinghams Geste hin lösten sich zwei Männer aus der Gruppe und schritten auf Vaughan zu. Sie flankierten ihn, als er weiterging, ohne seine Augen von Gloucester abzuwenden. Weitere von Buckinghams Wächtern rückten vor, um Edwards Dienern den Weg zu versperren, und zwei traten zu Richard Grey. Ein Teil der Menge auf dem Markt zerstreute sich, fürchtete Schwierigkeiten, aber andere drängten sich vor, weil sie wissen wollten, was hier vor sich ging – wollten Zeugen dieser offensichtlichen Staatsangelegenheit werden. »Ich frage noch einmal, Mylord Gloucester, welche Beweise habt Ihr für eine solche Verschwörung?«
»Meine Verbündeten bei Hof haben von einem Komplott erfahren, mich von meinem Posten als Protektor des Reiches abzusetzen; dem Amt, das mir mein Bruder auf dem Sterbebett übertragen hat. Kurz gesagt, man will einen königlichen Befehl missachten.«
Jetzt begriff Vaughan. Gloucester hatte sich der Reisegruppe, die den König begleitete, nicht anschließen, sondern die Kontrolle über sie übernehmen wollen. Er hatte damit gerechnet, dass der Mann eine hochrangige Position am Hof des jungen Edward anstreben würde, weil er zweifellos fürchtete, von der Königinwitwe und ihren Anhängern in der neuen Regierung kaltgestellt zu werden. Nun, er hatte harte Verhandlungen und widerwillige Kompromisse erwartet. Aber diese Wendung? Vaughan kannte Richard of Gloucester, der halb so alt war wie er, seit dessen Geburt. Er hatte an seiner Seite gekämpft und mit ihm für die Sache seines Bruders sein Blut vergossen. »Die einzige Verschwörung, die ich hier sehe, Mylord Gloucester, ist die Eure.«
Edward trat vor. »Onkel, das muss ein Irrtum sein.« Er deutete auf Vaughan und Grey, die beide von Buckinghams Wächtern in die Mitte genommen worden waren. »Sir Thomas, mein Bruder, mein Onkel Rivers – sie würden nie etwas gegen mich unternehmen. Oder gegen Euch.« Er drehte sich mit flehender Miene zu Gloucester um. »Lasst uns gemeinsam zu meiner Mutter gehen. Sie wird helfen, dieses Problem zu lösen.«
»Eure Mutter ist das Problem«, fauchte Buckingham. »Schon immer gewesen.«
Gloucester musterte den Herzog mit zusammengekniffenen Augen. »Das Ganze ist kein Irrtum, Mylord. Aber ängstigt Euch nicht. Ihr steht jetzt unter meinem Schutz. Ich werde Euch sicher nach London geleiten.« Er richtete seine Aufmerksamkeit auf Vaughan und Grey. »Sir Thomas Vaughan, Sir Richard Grey, Ihr seid wegen Verschwörung gegen die Minister des Königs und des Versuchs, die königliche Autorität zu untergraben, verhaftet.«
Vaughan sah, dass die Schaulustigen bei den Marktständen erregt miteinander tuschelten. Zahlreiche Augen ruhten auf ihm. Nach außen hin blieb er ruhig und gefasst, aber sein Herz hämmerte wie vor einer Schlacht. Buckinghams Männer packten ihn bei den Armen. Er hatte kein Schwert, und der Dolch in seinem Gürtel würde ihm wenig nützen.
»Der Rest von euch kann gehen«, wandte sich Gloucester mit erhobener Stimme an das Gefolge des Königs. »Händigt meinen Männern eure Waffen aus und tretet zur Seite. Ihr seid hiermit von euren Pflichten entbunden.«
Edward starrte Vaughan mit vor Furcht verzerrtem Gesicht hilflos an.
Vaughan nickte ihm zu. »Geht mit Eurem Onkel, Mylord. Earl Rivers und ich sehen Euch dann bei Eurer Krönung, wenn die falschen Beschuldigungen gegen uns fallen gelassen worden sind.« Er sagte es sowohl, um den Jungen zu beruhigen, als auch, um die Herzöge herauszufordern, aber die Worte klangen in seinen eigenen Ohren hohl, als Gloucester eine Hand fest auf die Schulter des jungen Königs legte und ihn davonführte.
Als Vaughan zusammen mit Grey abgeführt wurde, sah er, wie Buckinghams Wächter näher kamen, um den Rest der Männer des Königs ungeachtet ihrer Proteste zu entwaffnen. Hinter ihm sah er einen Mann in einem blauen Umhang die Gasse bei den Ställen hinunterreiten. Er schlug die Richtung ein, in die Stephen verschwunden war.
2
Sonnenlicht drang wie eine gleißende Klinge durch einen Spalt zwischen den Fensterläden. Es bohrte sich in die Augen des auf dem Bett liegenden Jack Wynter und riss ihn aus den Tiefen unruhiger Träume. Er zuckte zusammen, als er erwachte, und drehte sich von dem Lichtstrahl weg, wobei sich die dünne Decke um ihn wickelte. Schmerzen schossen durch seinen Kopf, und er blieb einen Moment still liegen, um sie abebben zu lassen, bevor er sich aufsetzte und die mit seinem Schweiß durchtränkte Decke mit den Füßen wegstieß.
Auf der Bettkante sitzend, entdeckte er auf den wurmstichigen Bodendielen neben seinen Füßen einen halb mit Wein gefüllten Becher. Er leerte ihn, spülte den sauren Geschmack in seinem Mund weg. Dann stand er leicht schwankend auf und ging zum Fenster hinüber, wo Staub in den Lichtstrahlen tanzte. Als er die Läden aufstieß, flatterten zwei Vögel mit wild schlagenden Flügeln vom Fensterbrett auf. Der grelle Sonnenschein wurde von den weißen Mauern zurückgeworfen, die ihn zu allen Seiten umgaben, blendete ihn in den Augen und verstärkte den Schmerz tief in seinem Kopf. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er lange genug in die Helligkeit blinzeln konnte, um den engen Hof unter sich mit seinem Baumurwald erkennen zu können. Insekten schwirrten um die karminroten Blüten, die wie Blutklumpen auf den Ästen klebten. Der Himmel strahlte wolkenlos blau, und obwohl es noch Morgen war, konnte Jack die in der Luft pulsierende Hitze spüren. In ein paar Stunden würde es glühend heiß sein.
Ein Windzug strich durch ein mit Fliegenhüllen gesprenkeltes Spinnennetz in einer Ecke des Fensters. Vor einem Monat hätte der Wind den Orangenblütenduft zu ihm hochgeweht, der die gesamte Stadt parfümierte. Heute konnte er lediglich den Gestank des Flusses, schale Kochdünste und den beißenden Rauch der Brennöfen der Töpfer riechen. Es war sein zweiter Sommer in Sevilla. Der erste war so ganz anders gewesen – die Stadt schien von Möglichkeiten erfüllt, die darauf warteten, gekostet, genossen und erforscht zu werden. Jetzt waren die Orangen von den Bäumen gefallen, die Hitze stieg, und er war noch immer hier in dieser Schmiedeesse gefangen, auf das Wort wartend, das ihn von diesen von der Sonne ausgedörrten Straßen erretten würde.
Das Knarren des Bettes verriet ihm, dass Elena aufgestanden war. Er hörte ihre leisen Schritte hinter ihm.
»Du hast das hier schon wieder verloren.«
Jack drehte sich um.
Elena hielt mit einem Finger eine silberne Kette hoch, an der ein kleiner Eisenschlüssel baumelte. »Du willst mir nicht verraten, was man damit aufschließen kann?«
Aus ihrem Mund klang die kastilische Sprache satt und reich, zu süßem Zucker gebrannt. Im Laufe des letzten Jahres hatte Jack sich die Grundbegriffe der Sprache angeeignet. Genug, um zurechtzukommen. Genug, um sich Freunde und Feinde zu machen.
Als er ihr die Kette abnahm, empfand er den Drang, sie aus dem Fenster zu schleudern – sollte sie doch in den Bäumen im Hof hängen bleiben oder in dem mit einem Schaumfilm überzogenen Springbrunnen versinken. Stattdessen streifte er sie über den Kopf und ließ das vertraute Gewicht von seinem Hals baumeln. Bei der Bewegung zwickte seine Schulter. Die Muskeln schmerzten noch von dem Kampf im letzten Monat, obwohl die Blutergüsse auf seinem Oberkörper und seinen Armen inzwischen verblasst waren.
Elena schüttelte den Kopf, während sie ihn von oben bis unten musterte. Sie zog ihr Kleid von dem zerwühlten Bett, schlüpfte hinein und zupfte es über ihren Brüsten zurecht. »Wenn du heute verlierst, wird dich Carrillo an seine Hunde verfüttern.«
Jack erwiderte nichts darauf. Ihre kühle Gleichgültigkeit ärgerte ihn. Sie war nachts so anders, wenn er nach einem Sieg durch die Türen kam und Triumphlieder und das Gelächter der Fremden mitbrachte, die er als Freunde bezeichnete. Jedes Mal, wenn er in den Bann des Weines aus Málaga, ihres Parfüms und der sich in ihren Augen widerspiegelnden Kerzenflammen geriet, bewirkte ihr Lächeln, dass er sich wie der einzige Mann in dem überfüllten Raum vorkam. Am Morgen, wenn seine Börse leer und sein Körper ausgelaugt waren, war der Bann gebrochen. Dennoch kam er zurück, wann immer seine Gewinne ihm dies erlaubten; magisch angezogen von dem Wein und der süß duftenden Dunkelheit.
Als er seine Hose zuschnürte, klopfte jemand an die Tür. Elena öffnete, und Jack sah Pedro, einen der jüngeren Brüder von Diego, der die Schänke führte und die Mädchen beaufsichtigte, die in den oberen Räumen arbeiteten, in den Raum spähen. Pedro grinste Jack an, der sich abgewandt und sein Hemd nebst Wams angezogen hatte. Das samtene Kleidungsstück, einst tief dunkelblau, war von der spanischen Sonne ausgebleicht.
»Der Freund des Engländers ist unten und hämmert an die Tür.«
Antonio, dachte Jack, dankbar dafür, dass der junge Mann ihm nicht wie letzte Nacht angedroht die Freundschaft aufgekündigt hatte. Nachdem er seine Stiefel angezogen hatte, deren weiches Leder abgewetzt und abgetragen war, befestigte er seinen Beutel an seinem Gürtel und drängte sich an dem feixenden Pedro vorbei.
»Mein Bruder sagt, es wäre eine Schande, einen seiner Besten zu verlieren.«
Jack blieb stehen und drehte sich um. »Sag Diego, ich bin zum nächsten Kampf zurück. Dann kann er mir zahlen, was er mir schuldet.«
Unten rieb er sich in dem Versuch, den stechenden Schmerz zu lindern, über die Stirn, während er an der Tür darauf wartete, dass der alte Mann ihm sein Schwert und seinen Dolch zurückgab. Vor neun Monaten, kurz nachdem er Gerüchten bezüglich Diegos Arena gefolgt und hierhergekommen war – an einen Ort, wo Männer von niedriger Geburt, denen die Turnierfelder und Stierkampfarenen verwehrt blieben, ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten –, war ein Stammgast Amok gelaufen und hatte zwei Mädchen umgebracht. Jack war sich vorgekommen, als wäre er wieder auf einem Schlachtfeld. Die Schreie, das Durcheinander, das Blut. Seither war es den Männern untersagt, Waffen mitzubringen. Er schnallte den Schwertgurt um, dessen Gewicht er als beruhigend empfand, und warf dem Alten zum Dank eine Münze zu, die dieser geschickt aus der Luft fing.
Draußen fand Jack Antonio im Schatten an eine Mauer gelehnt vor. Obgleich er Kastilier und Christ war, zeugten Antonios olivfarbene Haut und sein schwarzes Haar von fast achthundert Jahren maurischer Herrschaft in Andalusien. Die Mauren, die eine Minderheit in der Stadt bildeten, seit Königin Isabella und König Ferdinand dem Königreich Granada den Krieg erklärt hatten, hatten sowohl bei den Menschen als auch den Gebäuden, wo Zitate aus der Bibel und dem Koran auf denselben Wänden Gott priesen, ihre Spuren hinterlassen. Für Jack war es so, als würde sich eine andere Welt in die bekannten Grenzen seiner eigenen drängen, so tief war die Grundessenz ihres Wesens hier in die Landschaft gesickert. So tief, dass er ihren Staub in der Luft und ihren Geruch in ihren Gewürzen spüren konnte.
»Mein Freund.« Antonio breitete die Arme aus. »Du siehst aus, als könnte dich eine leise Brise umwehen.« Sein Lächeln war gezwungen und erreichte seine Augen nicht. »Es ist ein Tag, um am Fluss im Schatten zu sitzen, ja? Bei einem Krug Wein? Und ein paar Datteln und Mandeln vom Markt?«
»Ein andermal, Antonio.«
Das Lächeln des jungen Mannes erstarb. »Sag mir nicht, dass du mit diesem Wahnsinn Ernst machen willst.« Als Jack sich in Bewegung setzte, beeilte sich Antonio, mit ihm Schritt zu halten. »Du hast Carrillo schon besiegt. Ihn gedemütigt.«
»Er hat bekommen, was er verdient hat. Er dachte, er wäre besser als wir – dachte, er könnte uns auf unseren Platz verweisen.«
»Und du hast ihm in der Arena das Gegenteil bewiesen. Reicht das nicht?«
»Er hat mich herausgefordert. Wenn ich nicht annehme, würde mein Sieg nichts bedeuten. Es ist eine Frage der Ehre.«
»Manchmal redest du wie sie«, murmelte Antonio.
»Wie wer?«
»Estevan Carrillo und seine Freunde.« Der junge Mann winkte abweisend in Richtung der Stadt auf der anderen Seite des Flusses. »Edelleute.«
Sie bogen in eine schmale Gasse ein, die zwischen den eng beieinanderstehenden Gebäuden hindurch zum Wasser führte. Vor der höhlengleichen Öffnung einer Schänke leckten zwei knochige Hunde an einer Pfütze aus getrocknetem Erbrochenen. Weiter unten durchwühlte eine Frau mit ledriger Haut einen Abfallhaufen. Sie funkelte sie finster an, als sie vorbeigingen.
Triana war ein Ort der Nacht, die Dunkelheit legte einen Schleier über seine Hässlichkeit. Es war ein Ort für Seeleute und Huren, Außenseiter, Gesetzlose; diejenigen, die am Rand der Gesellschaft existierten, und diejenigen, die von einem anderen Leben träumten. In Triana waren Hoffnung und Verzweiflung enge Nachbarn; man sah es in den fremdländischen Gesichtern derer, die mit Geschichten von Wunderbarem und Entsetzlichem mit den Booten aus fernen Ländern kamen. Es war dort, in Diegos staubiger Arena, wo sich mittellose junge Männer um der Chance auf einen Gewinn willen blutig prügelten; dort in den Schänken, wo Füße zum Klang von Lauten und Trommeln stampften und Mädchen für Männer mit Münzen in den Händen tanzten. Jack fühlte sich hier zu Hause.
»Du musst doch wissen, dass Estevan nicht nur eine Chance will, sein Geld zurückzugewinnen. Er will Blut. Geh fort, mein Freund.«
Als sie auf die Flussufer hinaustraten, drehte sich Jack zu Antonio um. »Fortgehen?« Seine Stimme klang rau vor Ärger.
»Geh zu Jakob zurück, nur für eine Weile. Estevan weiß nicht, wo du wohnst. Ich habe gehört, Königin Isabella beabsichtigt, sich nach diesem Sieg über die Mauren bei Lucena zu dem König zu begeben. Estevan und sein Vater werden sie zweifellos begleiten.«
»Ich soll mich verstecken, meinst du?«
»Du kämpfst heute nicht in der Arena. Estevan wird sich nicht an Diegos Regeln halten.«
»Wir haben uns auf Abbruch nach der ersten blutenden Wunde geeinigt.«
»Du hast dich darauf geeinigt.«
Jack sagte nichts. Er blickte über den Fluss hinweg. Über dem blauen Wasser des Guadalquivir schimmerte am anderen Ufer der Torre del Oro in der Sonne. Bei den Docks des goldenen Turms ankerten drei große Schiffe, die Dutzende kleinerer Boote und Fischerkähne überragten. An den Hauptmasten der Galeeren hing jeweils eine weiße Fahne, auf der Jack das rote Kreuz des heiligen Georg ausmachen konnte. Englische Schiffe. Noch vor ein paar Monaten hätte Jacks Herz bei diesem Anblick einen Satz beschrieben, und er wäre über die Puente de Barcas gerannt, um unter den Männern, die an Land gingen, nach dem Gesicht seines Vaters Ausschau zu halten. Heute verspürte er keine derartige Hoffnung mehr.
Auf dem Kai waren Männer, die große Säcke ausluden. Mit Wolle gefüllt, vermutete Jack. Wenn sie ablegten, würden sich auf ihren Decks Olivenöl und Seife, Wein und Silber stapeln, alles Waren, die sie die Mündungen des Severn oder der Themse hoch zu den Märkten von Bristol und London schaffen würden. Hinter den Docks wurde Sevillas Gewirr aus roten Dächern und Türmen von dem Glockenturm der Kathedrale beherrscht, die sich hoch über der Stadt erhob. Als er gerade angekommen war, hatte Jakob ihm erzählt, dass einst das Minarett der Moschee an ihrer Stelle gestanden hatte. Östlich der Kathedrale lag das Straßenlabyrinth der judería. Der Gedanke, zu Jakob zurückzukehren, um sich in dem kleinen dunklen Haus des alten Mannes zu verbergen, während Jugendliche Steine gegen die geschlossenen Fensterläden warfen und skandierten, dass Juden entweder konvertieren oder sterben müssten, versetzte ihn in Wut.
Er war mit einer ganz anderen Absicht in diese Stadt gekommen, aber diese Absicht war in den darauffolgenden leeren Monaten dahingewelkt und gestorben und hatte nur einen Schlüssel an einer Kette um seinen Hals hinterlassen. Jetzt zählten diese Ziele für ihn: seine Siege in Diegos Arena und sein wachsendes Ansehen in Triana. Er würde allein sein Glück machen, allein aus der Gosse seiner Geburt nach oben kommen. Dazu brauchte er weder die Hilfe seines Vaters noch weitere gebrochene Versprechen.
Die Glocke im Kathedralenturm läutete, der Klang hallte über die Stadt hinweg und verriet ihm, dass ihm noch zwei Stunden blieben, bis er Estevan Carrillo in den Olivenhainen in der Nähe von La Cartuja treffen sollte. Jack schielte zu Antonio, der gegen einen Stein trat. Als sich der junge Mann vor sechs Monaten ihm angeschlossen hatte, hatte er das nie infrage gestellt. Freundschaften kamen und gingen wie die Galeeren, die die Docks passierten und deren Decks Staub aus anderen Ländern verstreuten. Jack fragte sich, ob er mehr für Antonio war als nur jemand, mit dem er sich einen Krug Wein teilen konnte. In Trianas Unterströmungen, in denen ein Mann ertrinken konnte, wenn er nicht achtgab, glich er vielleicht einer Art Treibgut – etwas, woran man sich festklammern konnte.
»Du hast Hunger, ja?«, fragte er Antonio und lächelte den bedrückten jungen Mann an. »Komm. Wir wollen uns ein paar von diesen Datteln holen.«
Als Stephen im Schatten der Galeere auf den Kai hinaustrat, gaben seine Knie nach, und er musste sich an einem Kistenstapel festhalten, um sich abzustützen. Nach zwei Wochen an Bord der GOLDENFLEECE war es ungewohnt, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, der sich immer noch anfühlte wie das unter ihm wogende Meer. Hinter sich hörte er raues Gelächter.
»Pack deine Seemannsbeine weg«, rief einer von der Mannschaft, der einen Sack mit Wolle auf das Deck warf. »Jetzt brauchst du deine Landstelzen.«
Stephen blieb stehen, bis er das Gefühl hatte, sicher laufen zu können, und rückte Vaughans Kriegsklinge zurecht, die viel länger und schwerer war als sein eigenes Schwert. Als er die Richtung zum Glockenturm einschlug, die ihm einer der Seeleute gezeigt hatte, hörte er den Mann hinter sich erneut brüllen.
»Wir segeln morgen beim ersten Tageslicht. Du willst doch nicht zu spät kommen!«
Stephen überquerte, begleitet vom Lärm der Fässer und Kisten, die verladen wurden, und den schroffen Rufen der Seeleute, den Kai. Männer, die er für Zollbeamte hielt, bewegten sich zwischen ihnen umher und überprüften Ladungen und Dokumente. Jetzt, wo er das Wasser und den Wind hinter sich gelassen hatte, traf ihn die volle Kraft der spanischen Sonne. Stephen legte seinen Umhang ab und hängte ihn über die Ledertasche, die er seit St. Albans immer bei sich trug. In manchen Momenten, wenn die GOLDENFLEECE zwischen sich bergartig auftürmenden Wellen gefangen war, hatte er gedacht, seine Mission und zugleich sein Leben würden auf dem Grund des Ozeans enden. Er war erleichtert, es bis hierher geschafft zu haben, obwohl er wünschte, er hätte gar nicht erst herkommen müssen.
Drei Tage lang hatte er ohne ein Zeichen von seinem Herrn im Saracen’s Head ausgeharrt. Am Morgen des vierten zwang er sich zu tun, was Sir Thomas ihm aufgetragen hatte, und traf Vorkehrungen für seine Reise. Als er in London auf seine Passage mit einer Wollflotte wartete, hatte er gehört, dass Richard of Gloucester und der Duke of Buckingham in der Stadt eingetroffen waren. Gloucester, so hieß es, hatte seinen Neffen in den königlichen Gemächern des Towers untergebracht, während die Arrangements für die Krönung des jungen Königs besprochen wurden. Er erfuhr zudem, dass die Berater des jungen Königs, darunter auch Vaughan, in Gloucesters Bollwerken im Norden eingekerkert worden waren, und so war er mit einem schweren Herzen von Englands Ufern in die rauen Winde des Kanals hinausgesegelt.
Als Stephen die befestigte Stadt durch einen großen steinernen Torweg betrat und um eine Ecke bog, tauchte die Kathedrale von Sevilla vor ihm auf. Es war ein riesiges Bauwerk, leicht so groß wie St. Paul’s. Mächtige Reihen von Strebepfeilern gestützter ockerfarbener Mauern erstreckten sich hintereinander zu einem großen Hauptschiff, auf das ein hoch aufragender Glockenturm hinabblickte. Ein Teil der Fassade war von Gerüsten verdeckt, und ein diesiger Staubschleier hing in der drückend heißen Luft. Auf den breiten Stufen tummelte sich eine Vielzahl von Menschen, die paarweise oder in kleinen Gruppen zusammensaßen. Alle waren in ernste oder angeregte Unterhaltungen verstrickt. Die Treppe schien einen Treffpunkt darzustellen, wo Hunderte von Transaktionen und Geschäften gleichzeitig abgewickelt wurden. Entlang der gegenüberliegenden Seite des Platzes verlief eine hohe, zinnenbewehrte Mauer, hinter der etwas lag, bei dem es sich um einen mit gefliesten Kuppeln und Bäumen durchsetzten weitläufigen Komplex von Gebäuden zu handeln schien. Stephen fielen die bewaffneten Männer auf, die vor den Toren Wache standen.
Er hielt sich östlich von der Kathedrale. Schweiß rann in den Bart, den er sich auf der Reise hatte stehen lassen. In den schmalen Straßen hinter dem Platz gelangte er in lange Streifen ersehnten Schattens, folgte ihrem gewundenen Verlauf in ein Labyrinth aus Gassen und überdachten Durchgängen und hielt nach dem Ort Ausschau, den Vaughan ihm im Hof des Rose and Crown in aller Eile beschrieben hatte. Je tiefer er in das Judenviertel vordrang, desto ruhiger wurden die Straßen. Worte waren auf Türen und Wände geschmiert worden. Stephen verstand sie nicht, aber das rote Gekritzel schien auf den Hausfassaden mit den kleinen, in verschiedenen Farben gestrichenen Fensterläden zornig zu leuchten.
Nachdem er im Kreis gelaufen und sich immer wieder an derselben Stelle wiedergefunden hatte, blickte er sich nach jemandem um, den er nach dem Weg fragen konnte. Als er nicht weit hinter ihm einen Mann in einem blauen Umhang und mit trotz der Hitze hochgeschlagener Kapuze sah, steuerte Stephen auf ihn zu. Doch ehe er ihn erreichte, huschte der Mann in eine Gasse und verschwand. Fluchend ging Stephen weiter, bis er endlich auf eine Frau stieß, die Abfälle von einer Türschwelle wegkehrte. Als er näher kam, spannte sich ihr Gesicht vor Furcht an.
Stephen setzte ein Lächeln auf. »Iglesia de Santa Cruz?«
Sie deutete auf einen Durchgang weiter oben in der Straße und nahm ihre Tätigkeit wieder auf. Ihr Besen fegte über den Boden. Als er an ihr vorbeiging, stieg Stephen ein starker Geruch nach Exkrementen in die Nase, und ihm wurde klar, dass es kein Abfall war, den sie da wegkehrte. Er überquerte die Straße und betrat den Durchgang. Hinter ihm ertönte ein vernehmlicher Knall, als die Frau ihre Tür zuschlug. Am Ende der Gasse wurde er mit dem Anblick eines weiß getünchten Turmes belohnt, der die anderen Gebäude überragte und in dessen Spitze eine Glocke leicht hin und her schwang. Direkt hinter der Kirche lag – wie Vaughan gesagt hatte – ein Haus mit blauen Läden.
Als Stephens Blick darauf fiel, beschleunigte er seine Schritte. Er klopfte an die blaue Tür, behielt dabei aber die verlassene Straße im Auge. Niemand antwortete. Er versuchte es erneut. Nach einem Moment hörte er Geräusche hinter der Tür. Ein Riegel rasselte, die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet, und ein kleiner, verhutzelter Mann mit grauem Bart kam zum Vorschein. Als er Stephen sah, runzelte er die Stirn und sagte mit scharfer Stimme etwas auf Kastilisch.
»Mein Name ist Stephen Greenwood. Ich komme im Auftrag meines Herrn, Sir Thomas Vaughan. Seid Ihr Jakob?«
»Ich bin Jakob«, erwiderte der Mann nach einer Pause in einem stark akzentbehafteten Englisch. »Aber woher soll ich wissen, dass Ihr der seid, für den Ihr Euch ausgebt?«
Stephen zögerte. Vaughan hatte ihm nicht gesagt, dass er sich würde ausweisen müssen. Nach einem Moment hatte er eine Eingebung; er griff in die Ledertasche, verlangsamte aber seine Bewegungen, als er sah, wie Jakob zurückschrak. Er förderte einen Beutel zutage und schüttete zwei Ringe in seine Handfläche: Vaughans Goldreif, das Geschenk seiner Frau, besaß er nicht mehr, da er sich damit die Überfahrt auf der GOLDENFLEECE erkauft hatte. Jetzt hatte er nur noch den schlichten Silberring und den mit dem gravierten runden Goldplättchen.
Jakob griff nach der Brille, die er an einer Kette um den Hals trug, und schob sie sich auf die Nase. Während der alte Jude den Ring mit den um den Stab gewundenen Schlangen anstarrte, veränderte sich seine Miene. »Kommt herein«, sagte er, öffnete die Tür und winkte Stephen in das dahinterliegende Dämmerlicht.
3
Es war Mittag, als Jack und Antonio sich dem Olivenhain außerhalb der Mauern des Klosters La Cartuja näherten. Mit dem süßen Geschmack von Dattelsaft im Mund waren sie, sich im Schatten haltend, am Fluss entlanggegangen, vorbei an dem massigen steinernen Castillo de San Jorge, das sich über der Puente de Barcas erhob, der Bootsbrücke, die Triana mit Sevilla verband. Jack hatte viele im Burghof zusammengedrängte Menschen gesehen; sie sahen aus, als würden sie sich aus irgendeinem Grund dort versammeln.
Das Castillo de San Jorge, einst Teil der maurischen Zitadelle, diente nun als Hauptquartier der Inquisition, die Königin Isabella und König Ferdinand vor zwei Jahren hier ins Leben gerufen hatten. In dieser Zeit waren die Inquisitoren eifrig damit beschäftigt gewesen, Conversos und Moriscos aufzustöbern – konvertierte Juden und Muslime –, von denen man glaubte, sie hätten das ultimative Verbrechen begangen, sich heimlich wieder ihrem früheren Glauben zuzuwenden. Gerüchten zufolge waren in den Verliesen der Burg Geldverleiher und Ärzte eingepfercht, die auf das reinigende Feuer warteten. In der judería, wo die Juden strengen Einschränkungen unterworfen waren, flüsterten die Leute ängstlich von einer Säuberungsaktion.
Als sie auf das Kloster zusteuerten, hämmerte Jacks Herz wild in seiner Brust. Er dachte an Diegos Arena, an Estevan Carrillo, der überheblich und höhnisch grinsend auf ihn zustolzierte. Er hatte dem Mann das Grinsen mit seinen Fäusten aus dem Gesicht gewischt. Aber hatte der Sieg ihn vielleicht zu dem Arroganteren von ihnen gemacht? War er ein Narr, wenn er sich einbildete, Estevan würde in einem Duell ohne Zeugen ehrlich kämpfen? Zweifel keimten in ihm auf.
Letzte Nacht hatte der Wein ihn hitzig gestimmt, hatten die Jubelrufe der Männer in Diegos Schänke ihn angespornt, als er ihnen gesagt hatte, er hätte Estevans Herausforderung angenommen. Jetzt war sein Herz schweißdurchtränkt, und der Wein hatte sich in seinem Körper in Gift verwandelt. Einen Augenblick lang dachte er daran, umzukehren, Antonios Bitte zu erfüllen und zu Jakob zurückzugehen. Er würde sich mit dem alten Mann versöhnen, mit ihm im Dunkeln ausharren, jenen verschlossenen Kasten und seinen Inhalt bewachen und den Schwur erfüllen, den er seinem Vater geleistet hatte, auch wenn dieser sein Wort nicht hielt – selbst wenn er niemals kam. Aber seine Füße trugen ihn wie von selbst weiter. Körperliche Wunden würden heilen. Der Verlust der Ehre schmerzte mehr.
»Sie sind hier.«
Jack folgte Antonios Blick zu der Stelle, wo vier Gestalten im Schatten einer Reihe von Olivenbäumen lungerten. Ganz in der Nähe waren vier mit den Schweifen schlagende Pferde angebunden. Abgesehen von einigen Leuten, die auf den Feldern arbeiteten, war niemand in der Nähe. Die einzigen Geräusche, die Jack hören konnte, waren seine eigenen Schritte und das Summen der Fliegen. Sein Gegner hatte einen abgelegenen Ort gewählt. Er schloss die Hand um das abgewetzte Leder, mit dem der Griff seines Schwertes überzogen war.
Estevan Carrillo beobachtete, wie er näher kam. Er und seine Freunde trugen Hemden aus feinem Leinen. Ihre makellos gefältelten Wämser wurden in der Taille von mit Filigranarbeit verzierten Gürteln aus Korduanleder zusammengehalten. Schwerter und Dolche in kunstvollen Scheiden hingen an ihren Hüften. Ihre Stiefel waren poliert, ihre Hüte mit Juwelen und Federn geschmückt. Alles an ihnen – ihre Kleidung, ihre Haltung, ihre geschmeidigen, muskulösen Pferde – zeugte von Wohlstand und Status. Jack kannte Männer wie sie, war mit ihnen aufgewachsen und der Bosheit der einen wie auch der Freundschaft der anderen ausgesetzt gewesen. Einst hatte er geglaubt, so wie sie zu sein; hatte gedacht, sich auf demselben Weg wie sie zu befinden, obwohl er anderswo herkam. Dieser Weg war ihm damals so sicher erschienen, jeder Schritt der Reise vorgezeichnet: vom Pagen zum Knappen, dann weiter zum Ritterschlag mit all den sich daraus ergebenden glanzvollen Möglichkeiten. Die Fußstapfen seines Vaters zeichneten sich vor ihm ab und wiesen ihm die Richtung.
Estevan erkannte jedoch nichts von einem Gleichgestellten in ihm. Als der Kastilier ihn musterte, wusste Jack, dass alles, was er sah, ein schmuddeliger, schäbig gekleideter gemeiner Bürgerlicher war; ein Mann, der so tief unter ihm stand, dass er es für unter seiner Würde erachtete, sich auch nur mit ihm im selben Raum aufzuhalten. Eine Erinnerung flammte auf: die Wälder von Lewes, er mit dem Gesicht zuunterst im Schmutz, von Jungen umringt, deren Verhöhnungen ihn mehr trafen als Fäuste.
Schlechtes Blut! Hurensohn! Bastard!
Dann sah er den jetzt verblassten, aber unübersehbaren Bluterguss an der Seite von Estevans spöttischem Mund – Resultat jenes letzten befriedigenden Schlages, der den Mann in den Staub der Arena geschickt hatte. Der Anblick verlieh ihm Kraft.
Estevan schien die Veränderung nicht zu entgehen, denn sein Lächeln verschwand, und er straffte sich, als Jack näher kam, und seine Augen blickten plötzlich wachsam. Doch als er sprach, klang seine Stimme spröde vor Verachtung. »Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, Jack Wynter.«
»Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht.«
Estevan grinste seine Freunde an. »Wie ritterlich.«
Jack ignorierte ihr Gelächter. »Also bis zur ersten blutenden Wunde?«
Estevans Augen wurden schmal, doch er nickte. »Nur Schwerter. Keine Dolche.« Er reichte einem seiner Kameraden sein Messer; gab sich jetzt schroff und kühl. »Keine Schläge gegen Kopf oder Gesicht.«
Als Jack Antonio sein Essmesser übergab, bemerkte er, dass Estevans Schwert etliche Zoll länger und breiter war als sein eigenes. Was aber auch hieß, dass es schwerer sein würde. »Und der Einsatz?«
»Das, was du mir abgenommen hast«, beschied Estevan ihn knapp.
Als Jack nickte, machte Estevan einem seiner Kumpane ein Zeichen. Der Mann, der, soweit Jack sich erinnerte, Rodrigo hieß, ging zu den Pferden hinüber. Als er zurückkam, hielt er zwei Brigantinen in den Händen. Eine reichte er an Estevan weiter, die andere mit einem unfreundlichen Ausdruck in den Augen an Jack. Der Schutzpanzer war mit grünem Samt überzogen und mit Zinn beschichteten Nägeln verziert, die dazu dienten, die Stahlplättchen unter dem Leder an Ort und Stelle zu halten. Er war steif und schwer und roch nach dem Schweiß eines anderen Mannes. Als Estevan seinen anlegte, folgte Jack seinem Beispiel und ließ sich von Antonio mit den Schnallen helfen. Die Brigantine saß um die Brust herum ziemlich eng, doch als er ein paarmal mit dem Schwert ausholte, stellte er fest, dass er genug Bewegungsfreiheit hatte. Rodrigo gab ihm ein paar am Handgelenk ausgestellte, an den Knöcheln gleichfalls mit Stahlplättchen verstärkte Lederhandschuhe. Antonio nickte ermutigend, aber sein Gesicht wirkte angespannt, als er mit Rodrigo und den anderen zurücktrat, um Jack und Estevan Raum zu verschaffen.
Estevan rollte die Schultern und vollführte dann ein paar Hiebe. Seine Klinge blitzte im Sonnenlicht auf. Gut in Form und treffsicher, das muss man ihm lassen, dachte Jack. Aber er hatte viele erfahrene Männer auf dem Schlachtfeld zu Boden gehen sehen, bei einigen davon hatte er selbst dafür gesorgt. Er dachte an die Jungen damals in Lewes. Am Ende hatte er es ihnen gezeigt, so wie er es Estevan gezeigt hatte. Sie hatten alle dieselbe Bestie geweckt. Und jetzt, als er das Schwert in der Hand vor und zurück schwang, öffnete er sich ihrer Wildheit – ließ sie heulen.
Die Erde unter ihren Füßen war ausgedörrt, das Gras von der Sonne verbrannt. Sie umkreisten einander, machten sich mit den Raumverhältnissen vertraut, spannten die Muskeln an. Jack blendete die Welt ringsum aus. Jetzt konnte er nur noch seinen Widersacher und die verletzlichen Stellen sehen, auf die er zielen würde. Der Schmerz in seinem Kopf war verflogen, sein Blickfeld klar. Sein Herz raste, pumpte Blut in seine Adern. Estevan führte den ersten Streich, drang erbittert auf ihn ein. Jack parierte den Hieb, und das Klirren der Klingen zerriss die Stille des Olivenhains.
Erhitzt und niedergeschlagen eilte Stephen durch Trianas Straßengewirr. Der Kathedralenglocke zufolge war es erst Mittag. Ihm blieb reichlich Zeit, seine Botschaft auszurichten und zur GOLDENFLEECE zurückzukehren, aber er ärgerte sich, dass er auf der Suche nach dem unauffindbaren jungen Mann quer durch die ganze Stadt gehetzt wurde.
Der Jude Jakob hatte mit Besorgnis vernommen, was Thomas Vaughan in England widerfahren war, was ihn aber nicht davon abgehalten hatte, wortreich sein Missfallen darüber zu äußern, den Sohn des Mannes beherbergen zu müssen, der eindeutig kein musterhafter Gast gewesen war, sondern betrunken und blutend von Raufereien zurückkehrte, wenn er überhaupt kam. Stephen war überrascht. Er kannte Vaughans Sohn seit der Zeit, als der junge Mann als Page in Vaughans Haushalt gedient hatte, obwohl er erst lange danach von dessen wahrer Beziehung zu ihrem Herrn erfahren hatte. Er war stets fleißig und pflichtbewusst gewesen, hatte immer danach getrachtet, alle zufriedenzustellen und zu lernen. Ein solches Verhalten wie bei Jakob sah ihm gar nicht ähnlich.
Nachdem er dem Juden versichert hatte, dass seine Zeit als widerwilliger Gastgeber und Aufseher vorüber war, war Stephen zu einer Schänke auf der anderen Seite des Flusses geschickt worden, die der junge Mann offenbar häufiger besuchte, nur um dort zu erfahren, dass er an diesem Morgen das Wirtshaus verlassen hatte. Nachdem er dem Wirt, der gerade genug Englisch sprach, um sich verständlich zu machen, Silber in die Hand gedrückt hatte, wurde Stephen der Weg zu einem Kloster am Fluss beschrieben.
Zu seiner Rechten öffnete sich der Zugang zu einer kühlen, schattigen Gasse, an deren Ende der Fluss lag. Als Stephen sie hinunterging, konnte er die Brücke sehen, die er zuvor überquert hatte. Eine Art Prozession schien sich darüber hinweg auf die Stadt zuzubewegen. Er konnte zahlreiche Männer in zeremoniellen schwarzen Gewändern ausmachen. Davon abgelenkt, bemerkte Stephen die leisen Schritte nicht, die sich ihm von hinten näherten. Ein Arm schlang sich um seine Brust und hielt ihn fest. Er schrie auf, als ihm ein Dolch an die Kehle gesetzt wurde.
»Schrei noch einmal, und ich schneide dir die Zunge heraus. Verstanden?«
»Ja.« Stephen schluckte trocken, spürte, wie sein Adamsapfel an der Klinge hüpfte. Das Englisch, das sein Angreifer sprach, war irgendwie noch beunruhigender als die Waffe. Wo hatte dieser Mann gelernt, es so zu sprechen, dass er es verstand? War er ihm von der Schänke aus gefolgt? Aus dem Augenwinkel heraus konnte Stephen die Falten eines blauen Umhangs erkennen. Ein blauer Umhang? Er dachte an den Mann in dem Judenviertel, der verschwunden war, bevor er ihn nach dem Weg hatte fragen können.
»Ich weiß, warum du hergekommen bist. Sag mir, wo es ist.«
Stephens Herz raste. Großer Gott. War ihm dieser Mann von England aus gefolgt?
»Ist es bei den Juden? Oder hat Vaughans Sohn es?«
Stephen gab keine Antwort. Seine Finger zuckten, wollten den Griff von Vaughans Schwert packen, aber er wusste, dass er tot sein würde, bevor er es ziehen konnte.
»Wir haben immer vermutet, dass er damit weggeschickt wurde.« Der Mann presste die Klinge gegen Stephens Hals, bis Blut aus dem Kratzer quoll. »Aber wir wussten nie, wohin.«
»Wir?«
»Ich kann zu der Schänke zurückgehen – herausfinden, was der Wirt dir erzählt hat. Er sieht aus, als würden ein paar Münzen reichen. Wo ist es, Stephen Greenwood?«
Er kannte also seinen Namen. Stephen wollte sich unbedingt umdrehen, seinem Angreifer ins Gesicht blicken, in Erfahrung bringen, wer er war. Gleichzeitig spürte er, dass er dadurch seinen Tod herbeiführen würde. Er schloss die Augen.
»Du hast nicht die geringste Vorstellung davon, was Vaughan vorhat, oder? Keine Ahnung, zu welch immensem Bösen du hier an seiner Stelle beitragen sollst.« Der Mann stieß Stephen gegen die Gassenmauer und legte ihm eine Hand fest auf den Rücken, damit er sich nicht rührte. »Verdammt, Stephen! Sag mir, wo es ist!«
Jetzt war Stephens Kopf so gedreht, dass er das Gesicht seines Angreifers im Schatten der Umhangkapuze undeutlich sehen konnte. Es versetzte ihm einen Schock, als er ihn erkannte.
Mit ineinander verkanteten Schwertern versuchten sie, einander wegzuschieben. Schweiß brannte in ihren Augen. Jack drängte seine Klinge gegen die Estevans und drückte sie mit einem metallischen Kreischen weg. Er stürzte sich in die Lücke und griff mit seiner freien Hand nach Estevans Arm, doch der Mann brachte sich mit einem Satz außer Reichweite, und Jack gelang es nur, sein Hemd zu fassen zu bekommen. Der Ärmel zerriss mit einem knirschenden Geräusch. Estevan fluchte, als er sich befreite; sein Gesicht war vor Anstrengung und Wut gerötet. Er hob sein Schwert und umkreiste Jack schwer atmend.
Jacks Lunge brannte, und er hatte einen metallischen, blutähnlichen Geschmack im Mund. Er konnte kaum genug Speichel sammeln, um auszuspucken. Die Brigantine fühlte sich wie ein seine Brust umschließender Käfig an, der jeden Atemzug abschnürte. Anfangs hatten Rodrigo und die anderen Estevan noch angefeuert. Jetzt waren sie verstummt. Jack wandte den Blick nicht von Estevan, fragte sich, wie lange sie beide in dieser Hitze durchhalten konnten. Trotz ihrer erbitterten Versuche war bislang kein Blut geflossen. Sie waren einander ebenbürtig und einer so entschlossen wie der andere, kein Pardon zu gewähren.
Estevan griff erneut an, ließ sein Schwert in einem gewaltigen Bogen niedersausen.
Jack holte zu einer Parade aus und schlug die gegnerische Klinge weg. Der Zusammenprall schickte einen sengenden Schmerz durch seine Armmuskeln. »Keine Schläge gegen den Kopf!«, donnerte er wütend, da ihm klar wurde, dass der Hieb seinen Hals durchtrennt hätte, wenn er ihn nicht hätte abwehren können.
Estevan schien ihm keinerlei Beachtung zu schenken. Er griff erneut an; zielte diesmal auf Jacks ungeschützten Oberschenkel. Jack hieb die Klinge zur Seite, trat zu und traf Estevan oberhalb des Knies. Das Bein des Mannes knickte unter ihm weg, und er stürzte zu Boden. Trotzdem riss er sein Schwert rasch wieder hoch und parierte Jacks gefährlichen Stich, bevor er seine eigene Klinge nach oben stieß. Jack taumelte zur Seite, sodass die Spitze ihn nur um ein paar Zoll verfehlte. Der Hundesohn hatte auf seine Leistengegend gezielt.
Als Estevan sich auf die Füße zog, ging Jack auf ihn los. Der Mann hob sein Schwert gerade noch rechtzeitig, um den Hieb abzuwehren, doch während ihre Klingen ineinander verkeilt waren, rammte Jack ihm den Kopf ins Gesicht. Ein befriedigendes Knacken erklang, als seine Stirn gegen Estevans Nase prallte. Estevan torkelte zurück. Blut strömte aus seinen Nasenlöchern. Knurrend schob er einen seiner Freunde weg, der ihm offenbar helfen wollte.
»Das erste Blut!«, keuchte Jack.
Estevan wischte sich mit dem Arm über die Nase, wobei sich sein zerrissener Ärmel rot färbte. Er spie in den Staub, dann sah er Jack an. Sein Gesicht war zu einer Maske nackter Wut verzerrt. Als er sein Schwert hob, wusste Jack, dass das erste geflossene Blut keine Option mehr war. Estevan hatte gesagt, er wolle zurück, was er ihm in der Arena genommen hatte. Damit war kein Geld gemeint. Nein, es ging um etwas Tieferes, Kostbareres. Das Ganze war gerade zu einem Kampf auf Leben und Tod geworden. Auch Antonio schien das zu begreifen, denn er kam mit einem Schrei näher. Rodrigo packte ihn, bevor er Jack zu Hilfe eilen konnte.
Hinter ihm hallte ein Ruf durch den Olivenhain.
»James? James Wynter?«
Beim Klang seines Geburtsnamens zuckte Jack vor Schreck zusammen. Er fuhr herum und sah einen Mann in einem blauen Umhang auf sich zukommen. Er kannte ihn nicht.
»Wer ist das?«, wollte Estevan, den das Auftauchen des Unbekannten ablenkte, wissen. Er klang argwöhnisch, und das aus gutem Grund. Ein ungenehmigtes Duell auszufechten konnte jedem von ihnen beträchtlichen Ärger einbringen.
»James?«, fragte der Mann erneut. Er atmete schwer.
Jack nickte, hielt sein Schwert aber trotzdem drohend erhoben.
»Ihr müsst mit mir kommen. Euer Vater ist vom Duke of Gloucester wegen eines Komplotts gegen seine Person verhaftet worden. Er wird des Verrats beschuldigt.«
Rodrigo hatte Antonio von einem seiner Freunde bewachen lassen, war vorgetreten und murmelte Estevan jetzt etwas ins Ohr. Wie benommen registrierte Jack, dass er das Englisch des Fremden übersetzte.
»Verhaftet?« Jack bemühte sich, diese Nachricht trotz seiner Erschöpfung in sein Bewusstsein einsickern zu lassen. »Verrat?«
»Ich habe Plätze auf einer Galeere reserviert, die uns nach England zurückbringt. Aber wir müssen sofort aufbrechen.« Der Blick des Mannes wanderte zu Estevan und den anderen. Er dämpfte seine Stimme. »Habt Ihr den bewussten Gegenstand?«
Jack wusste sofort, was er meinte. »Ja, aber …«