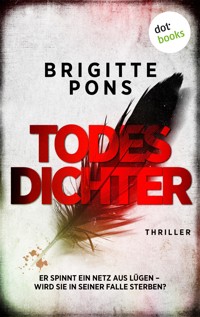Der Winter, in dem ich den Aufstand probte, eine Wagenladung Weihnachtsbäume veruntreute und die Freiheit der Liebe entdeckte E-Book
Brigitte Pons
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- humorvoll ironische Freundinnen-Krimi-Komödie - Cora Bergmanns Leben stürzt ins Chaos, als der Firmenbuchhalter ausgerechnet kurz vor Weihnachten mit einem Haufen Bargeld verschwindet und zwei Steuerprüfer vor der Tür ihres Arbeitsgebers stehen. Plötzlich verändert sich ihr sonst so freundlicher Chef. Hat Herr Karlsson etwas zu verbergen? Oder steckt seine Frau hinter alldem? Cora ist alarmiert. Ihr Job könnte in Gefahr sein! Um zumindest das Weihnachtsgeld für sich und die Belegschaft zu retten, greift sie zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Und zu allem Überfluss setzt auch noch ihre eingeschlafene Libido zu ungeahnten Kapriolen an ... Titel der Erstausgabe: Cora Bergmann und die Weihnachtsbaumverschwörung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Pons
Der Winter, in dem ich den Aufstand probte, eine Wagenladung Weihnachtsbäume veruntreute und die Freiheit der Liebe entdeckte
*Freundinnen-KRIMI-Komödie*
IMPRESSUM
© 2024 Brigitte Pons
Überarbeitete Neuauflage
Umschlag: erstellt mit dem tredition Cover-Designer
Erstausgabe 2016, Ullstein Midnight unter dem Titel:
Cora Bergmann und die Weihnachtsbaumverschwörung
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg,
Deutschland
ISBN
Softcover978-3-384-10263-8
E-Book978-3-384-10264-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Brigitte Pons, Platanenallee 29, 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Der Winter, in dem ich den Aufstand probte, eine Wagenladung Weihnachtsbäume veruntreute und die Freiheit der Liebe entdeckte
IMPRESSUM
Vorspiel
Hotte Hüh!
Couch Potatoe zum Ersten
Solidarität?
Piraten, Piraten! Piraten?
Naturgewalten
Es fährt ein Bus nach Nirgendwo
Couch Potatoe zum Zweiten
Oh Tannenbaum
Advent, Advent der Hotte rennt
Vom Himmel hoch, da komm ich her
Joseph, lieber Joseph mein
Weiber-Weihnacht oder: Melancholie ohne Südsee
Fröhliche Weihnacht – Ho-ho-ho
Mission Impossible
Intermezzo
Same procedure?
Couch Potatoe zum Letzten
Alles kann – nichts muss
Undercover I
Von Räubern und Spießgesellen
Vier Freundinnen für alle Fälle
Feldversuch oder: Undercover II
Requiem
Projekt heiße Nadel
Nachspiel
*Rezepte*
Zimtsterne
Kokosmakronen
Rumkugeln
Vanillekipferl
Bethmännchen
Florentiner
Spritzgebäck
Terrassenplätzchen
Glühweingelee »Cora-Art«
Oberräder Spezial-Döner
Feuerzangenbowle à la Jupp und Achim
Julglögg »Karlsson-Style«
Danke!
Die Autorin
Vorspiel
Es gab eine Zeit, da war ich wie alle anderen, träumte ihre Träume, schätzte ihre Werte. Ich glaubte an die eine große Liebe und die Monogamie, und dass der Weg zum Glück über eine Heiratsurkunde und einen Bausparvertrag führt. Es gab Gut und Böse, Richtig und Falsch, Wahrheit und Lüge. Das Leben war einfach, das Leben war sicher und es war eindeutig.
Und noch ein wenig früher glaubte ich an den Weihnachtsmann.
Hotte Hüh!
Der Teufel steckt im Detail, heißt es immer. Aber bei uns steckte der Teufel in der Buchhaltung und ab und an in der Chefsekretärin. Sein Name war Horst.
An dem Tag, an dem alles begann, steckte Horst allerdings kurzfristig im Drucker fest, was dazu führte, dass der Anruf, der eigentlich ihn erreichen sollte, von mir entgegengenommen wurde. Das war am dreizehnten Dezember, einem Montag, was irritierend ist, denn ein Freitag hätte im Nachhinein betrachtet zu alldem viel besser gepasst. Nicht dass ich abergläubisch wäre, aber ich klopfe schon mal auf Holz oder spucke über die Schulter zum obligatorischen toi, toi, toi.
An diesem Montagnachmittag also hatten sich nach Horst Schusters lauten Hilfeschreien alle in Rufweite befindlichen Kräfte um seinen Drucker versammelt. Bei dem Versuch mit möglichst wenig Aufwand die Tonerkassette zu wechseln, war einer seiner Finger im Gehäuse stecken geblieben. Natürlich hatte Horst das Gerät weder ausgeschaltet noch so platziert, dass man ihm mit Anstand hätte helfen können.
Sieglinde Sander, die Chefsekretärin, die ihn wohl schon in so ziemlich jeder Körperhaltung zu Gesicht bekommen hatte, rutschte zu seinen Füßen herum und versuchte den Stecker herauszuziehen. Diesmal den des Druckers, versteht sich.
Ich grinste still vor mich hin und bemühte mich weitergehende Gedanken an gemeinschaftliche Turnübungen der beiden zu unterdrücken. Wobei Horst durchaus attraktiv war und sein – wenn auch unfreiwillig – weit herausgestrecktes Hinterteil einen zweiten Blick wert. Die graue Anzugshose spannte und brachte die Rundung gut zur Geltung; auch die Oberarme unter dem Hemd ließen mich spontan von einer wilden Umarmung fantasieren. Ihm zu helfen kam trotzdem nicht infrage. Denn eigentlich war Horst Schuster als Ganzes gesehen ein Arsch. Daran änderte auch sein leckerer Körper nichts.
Während also seine obere Hälfte quer über dem Drucker lag, Sieglinde Sander auf dem Boden weilte, um ihn vor dem Gegrilltwerden zu bewahren, und Gerd, der Lagerist, ihm beherzt an der Hand zerrte, klingelte das Telefon. Nach dem dritten Klingeln räusperte ich mich und nahm widerstrebend ab. Ich erwartete, von einem Hustenanfall unterbrochen zu werden, denn ich plagte mich seit einer guten Woche mit einer Erkältung herum, die mich ziemlich wortkarg hatte werden lassen.
»Karlsson Baustoffhandel Frankfurt, guten Tag -«, weiter kam ich nicht mit meiner heiser gehauchten Begrüßungsfloskel.
»Hey Hotte, was ist los, wie lang soll ich noch warten? Wo bleibt die Überweisung?«, tönte es mir entgegen. »Und tu nicht so, als hättest du die Kontonummer vergessen. Darauf falle ich nicht noch mal rein, klar?«
Merkwürdiger Umgangston, dachte ich, aber offenbar kannten sich die beiden schon länger. Da ich von den Finanzen der Firma keinen Schimmer hatte, wollte ich mich lieber raushalten und mich dem Herrn als falscher Ansprechpartner zu erkennen geben.
»Also, ich glaube …«, knarzte ich los, um nun doch noch meinen Hustenkoller vom Stapel zu lassen.
Den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt, fummelte ich ein Bonbon aus meiner Hosentasche. Peinlich, die Kundschaft am Telefon so zuzuröcheln. Aber was blieb mir übrig? Alternativ hätte ich höchstens auflegen können, was auch nicht gerade höflich gewesen wäre. Horst fuchtelte derweil von seinem Liegeplatz aus wild mit dem freien linken Arm in meine Richtung und zog Grimassen, die ich nicht zu deuten imstande war, während der Typ rücksichtslos weiterredete und meine Atemnot schlicht ignorierte.
»Ist scheiße gelaufen am Wochenende für dich. Dicke Verluste, sehe ich ein, aber ein Deal ist ein Deal und heute ist Zahltag, Alter. Also, hör auf den sterbenden Schwan zu markieren – das nutzt nichts.«
Ich japste und gurgelte, prustete in meinen Schal und gab mir Mühe dabei das Bonbon mit der Zunge im Mund zu halten.
»Hör auf hier rumzukotzen, Hotte. Klartext jetzt: Hat dir die Bank das Konto gesperrt? Oder warst du mal wieder am Tresor und ich kriege die Kohle in bar? Der Vollpfosten hat wohl immer noch nicht gemerkt, was du da abziehst. Zählen hat der Alte nicht gelernt, oder?«
Da nun ganz langsam eine Besserung meiner Lungenfunktion zu bemerken war, setzte auch meine Hirntätigkeit wieder ein. Moment mal – was hatte der Kerl da gesagt? Erstaunlich schnell schaltete ich, als just in diesem Moment besagter Vollpfosten durch die Tür rauschte, die Krawatte lässig über die Schulter geworfen, die Ärmel aufgekrempelt, um seinen Buchhalter zu retten.
»Noch mal bitte«, nuschelte ich in den Hörer und packte Herrn Karlsson am Ellbogen, der überrascht stehen blieb. »Ich habe das akustisch nicht mitgekriegt, wegen meinem Husten.« Ich drückte auf die Lautsprechertaste, die Stimme plärrte durch den Raum und alle verstummten.
»Ob der alte Sack immer noch nicht geschnallt hat, dass du dich am Firmentresor bedienst, habe ich gefragt, Hotte! Also, was ist, blätterst du mir nachher Bares auf den Tisch?«
Draußen schneite es in dicken fluffigen Flocken. Ich glaubte, jede Einzelne auf dem Boden aufschlagen zu hören, wie eine Explosion. Die Stille, in die der Typ noch zweimal »Hotte?« rief, ehe Karlsson auflegte, war allumfassend. Ein merkwürdiges Wort, aber ich fand kein anderes, das passte, so sehr ich auch grübelte. Laut, lauter, am lautesten. Das funktionierte. Aber still, stiller, am stillsten? Natürlich ist diese Steigerungsform sowohl zulässig als auch grammatikalisch richtig, nur ging sie mir einfach nicht weit genug. Was kommt nach absoluter Stille? Gibt es so etwas wie negative Geräusche – analog zu negativen Zahlen – ein Minusgeräusch, ähnlich einem Vakuum, auf der Tonebene? Kurz bevor das Vakuum sich meines Geistes bemächtigen konnte, hörte ich die Schneeflocken wieder. Mein philosophischer Ausflug konnte höchstens einige Millisekunden gedauert haben, die aber dazu ausgereicht hatten, Karlssons Kopf in dekorativen Rot- und Violettschattierungen leuchten zu lassen.
»Horst?«, fiepte Sieglinde Sander weinerlich und krabbelte zwischen seinen Beinen hindurch. Schwankend kam sie auf die Füße, strich den eng anliegenden Rock glatt und zupfte hier und da und dort hektisch an ihrer Garderobe herum, als ob ihr Äußeres jetzt irgendjemanden interessiert hätte.
Horst hing nach wie vor über dem Drucker. Schweigend und weit weniger dekorativ als zuvor; die Körperspannung zusammengebrochen ähnelte er einem Teppich, den man zum Lüften in den Garten gehängt hatte, und der auf den Klopfer wartete.
»Frau Bergmann«, knirschte der potenzielle Klopferschwinger, zwischen zusammengebissenen Zähnen. »Öffnen Sie den Schreibtisch.«
Frau Bergmann, das bin ich. Brav trottete ich um den Schreibtisch herum und tat wie mir geheißen. Horst fand seine Sprache wieder und lamentierte und erklärte und lachte hysterisch in dem Bemühen Karlsson davon zu überzeugen, der Kumpel am Telefon sei ein dämlicher Spaßvogel und er würde doch nie, also wie Karlsson denn so was glauben könnte und überhaupt, was er alles für die Firma geleistet hätte. Blablabla. Ich amüsierte mich köstlich – ich habe ein Faible für groteske Situationen – und packte alles, was Karlsson an Unterlagen haben wollte, aus den Schubladen in einen Karton, aus dem ich das Kopierpapier kurzerhand unter das Fenster gekippt hatte.
»Das ist privat! Das geht niemand was an!«, jaulte Horst. Zwischen Geschäftspapieren und Notizzetteln blitzten mir Fotos von der Sander entgegen, die ich diskret zurück in die Schublade gleiten ließ. Die musste wirklich keiner sehen. Karlsson blätterte durch den Terminkalender und grunzte gelegentlich.
Dann entdeckte ich die Umschläge. Der eine war randvoll gestopft mit Wettscheinen, sogar ich erkannte das sofort, obwohl ich nie zuvor einen gesehen hatte. Fußballergebnisse, Boxen und Pferde: Silvermoon auf Sieg im zweiten Rennen; Morningstar im dritten Lauf und Ähnliches. Gerade als ich Umschlag zwei an Karlsson weiterreichte, stieß unser zwangsgeouteter Zocker ein tierisches Brüllen aus. Ich erwartete angesichts der Wucht, mit der er am Drucker riss, sich aufbäumte und nun schmerzhaft endlich selbst befreite, dass er sich augenblicklich in Hulk verwandeln würde. Aber sein Hemd platzte nicht unter schwellenden Muskeln auf und er verfärbte sich auch nicht grün. Nur sein Finger brach, mit einem hässlichen Knacken, aber vielleicht war das auch der unschuldige Drucker, der auf dem Boden zerschellte. Hulk-Horst nutzte den Überraschungseffekt, machte einen Satz nach vorn, entriss den zwischen Karlsson und mir in der Luft befindlichen Umschlag im Moment der Übergabe unseren Händen und verschwand durch die Bürotür. Rückblickend sehe ich ihn immer im Galoppschritt enteilen, als hätte er ein Steckenpferd zwischen die Beine geklemmt. Doch vermutlich war ihm lediglich der Drucker auf den Fuß gefallen und er hinkte ein wenig.
In Zeitlupe segelten zwei Fünfzigeuroscheine hinter ihm durchs Zimmer. Die Ära des Buchhalters Horst Schuster im Baustoffhandel Karlsson war dann wohl Geschichte, überlegte ich und ging schon mal gedanklich die Liste der Kollegen durch, die sich in den nächsten Tagen darum prügeln würden, seinen Platz einzunehmen. Vor dem Fenster senkten sich weiter weiche Flöckchen auf die verlassene Gwinnerstraße, und wieder einmal wurde mir bewusst, dass das fehlende »e« im Straßennamen einen gewissen Symbolcharakter für die mir bekannte Belegschaft aufwies. Die Anzahl der Loser in meiner Kartei war bei Weitem länger als die der Siegertypen.
Noch war mir nicht im Geringsten bewusst, welches Drama sich hier anbahnte und mir blieb vorerst auch keine Zeit zu weiteren Überlegungen.
Gerd Wolther fing sich als Erster und machte sich an die Verfolgung des Flüchtigen, was schon beinahe rührend anmutete. Schwer übergewichtig, herzkrank und kurz vor der Rente, hatte er selbstverständlich nicht den Hauch einer Chance. Aber vielleicht hatte er den Kalender im Blick, auf dem für den Fünfzehnten die Auszahlung des Weihnachtsgeldes und eventueller Boni für besondere Leistungen stand. Zu spät ist es bekanntlich nie. Sieglinde Sander beschränkte sich aufs Heulen und ich trottete einem stummen Fingerzeig folgend mit dem Karton im Arm hinter Karlsson her über den Flur, durch Sieglindes Vorzimmer in die Chefresidenz. Für einen Firmeninhaber fand ich die Einrichtung schon immer sehr spartanisch, aber zu ihm passte das. Er beschränkte sich auf das Notwendige, und wäre nie auf die Idee gekommen, für persönliche Belange Geld zu verschwenden. Durch und durch Skandinavier – im Grunde seines Herzens genügte ihm ein Kiefernholzregal zum Glücklichsein. Immer noch wortlos öffnete er den Tresor. Ich wusste nicht, welchen Anblick er erwartet hatte, mir fiel nichts Besonderes auf, als ich mich auf die Zehenspitzen hob und diskret über seine Schulter spähte. Doch nach Karlssons Reaktion zu urteilen entsprach die Anzahl der Geldbündel, die in Reih und Glied auf die obere Ablage gepackt waren, nicht seiner Vorstellung. Resignierend kippten seine Schultern nach vorn, sein Kopf sackte auf die Brust und dann der ganze Mann auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch. Sein Stöhnen aus der Kategorie deprimierter Elch traf mich mitten ins Herz, aber als ich den Mund öffnete, wehrte er ab. Keine Trostworte. Ich verstand. Große Männer leiden lieber einsam.
Leise zog ich mich zurück und kollidierte unmittelbar hinter der Tür mit der Sander. Ihr Kostüm saß inzwischen wieder tadellos, auch die Frisur wirkte wie frisch modelliert – sie hätte damit ganz klassisch dem Flieger entsteigen und den Haarspray-Werbefilmern Schreie des Entzückens entlocken können. Nur die Augen erinnerten mich an ›Tanz der Vampire‹. Mein Mitleid mit ihr hielt sich in Grenzen, obwohl ich eigentlich ein wirklich weiches Herz habe: Ich heule bei jeder Schnulze im Fernsehen, auch bei der fünften Wiederholung, und die senilen Ratten meiner Tochter Lara habe ich gehätschelt bis zum bitteren Ende, gewaschen, trockengeföhnt und mit Babynahrung gefüttert. Aber Sieglinde Sander zählte nicht zu meinen Lieblingskolleginnen – auch wenn mich ihr Gebiss ein wenig an die beiden süßen Nager erinnerte – dazu war sie zu jung, zu schön, zu ehrgeizig. Nein, neidisch war ich nicht. Nur skeptisch. Ich reichte ihr ein Taschentuch und startete die Neugier-Offensive.
»Käffchen, Frau Sander? Und ein Weihnachtsplätzchen? Nun setzen Sie sich doch, Sie sind ja ganz aufgelöst!«
Sanft packte ich sie an der Schulter, drückte sie in ihren sauteuren, ergonomisch geformten Chefsekretärinnensessel und eilte zur Kaffeemaschine. Auf Antwort zu warten, sparte ich mir – schließlich wollte ich kein Nein hören. Ich gedachte die geballte Erfahrung meiner dreiundvierzig Lebensjahre gegen ihre höchstens fünfundzwanzig auszuspielen. Das strebsame Küken wechselte selten ein privates Wort mit den gewöhnlichen Sterblichen, und ich, mit meinem dürftig bezahlten Teilzeitjob, bewegte mich ganz am anderen Ende der Rangordnung dieser Firma. Nichtsdestotrotz gehörte ich zu den bestinformiertesten Mitarbeitern. Als angelerntes Büro-Mädchen-für-Alles war ich niemandes Konkurrenz, aber willkommenes Leihohr für die Sorgen und Nöte dieser Welt und offen für Tratsch jeder Couleur. Absolut verschwiegen, selbstverständlich.
Ich füllte zwei große Tassen mit Kaffee, stellte Milch, Zucker und die Dose mit den Plätzchen auf ein Tablett und bedachte Sieglinde Sander mit einem besonders freundlichen und besorgten Lächeln.
»Wird schon wieder!«, tröstete ich. »Das klärt sich bestimmt alles auf. Milch? Zucker?« Ich gönnte mir zwei Löffel der weißen Sünde, während sie beides mit kaum merklichem Kopfschütteln ablehnte. Hätte ich mir denken können, ihr Körper kündete von eiserner Disziplin und nicht von schokoladensüchtiger Schwäche.
»Der Herr Schuster ist doch ein ganz Korrekter, das muss alles ein Missverständnis sein. Nicht wahr?«
Ich schob ihr die Tasse hin, nahm selbst einen Schluck und hielt ihr dann die Dose unter die Nase, weil sie sich immer noch nicht bewegte. »Selbst gebacken«, verkündete ich nicht ohne Stolz, mit weiterhin männlich herbem Timbre, das den Genuss von täglich drei Schachteln ›Blauer Dunst – ohne Filter‹ suggerierte. Zu meiner Überraschung langte mein Gegenüber zu. Sie schob einen Zimtstern zwischen die Zähne, seufzte, schob eine Rumkugel nach, seufzte wieder, und komplettierte das Ensemble mit einem Vanillekipferl. Dann versuchte sie – seufzend – zu kauen.
»Gar nichts wird wieder, Frau Bergmann«, murmelte sie schließlich. »Überhaupt nichts. Das ist der Anfang vom Ende. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich jetzt gern allein.«
Das traf mich unerwartet. Doch ein kluger Stratege weiß, wann die Zeit zum Rückzug gekommen ist. So trollte ich mich und ließ meine Plätzchen zurück. Zutrauen geht ebenso sehr durch den Magen wie die Liebe – und beim nächsten Mal würde Sieglinde Sander gesprächiger sein, da war ich mir sicher.
Couch Potatoe zum Ersten
Nachdem ich weder Herrn Karlsson noch Sieglinde Sander in ihrem Kummer beistehen konnte, und auch sonst keiner mehr meiner Hilfe bedurfte, beschloss ich, meinem Arbeitsplatz für diesen Tag den Rücken zu kehren. Seit Anfang Dezember hatte Karlsson – wie jedes Jahr um diese Zeit – unsere Produktpalette um Christbäume erweitert, was dazu führte, dass nicht nur ich saisonal bedingt Überstunden anhäufte. Irgendwer musste sich, zusätzlich zum normalen Geschäft, um das Grünzeug kümmern – von der Anlieferung, über die Präsentation bis zum Verkauf. Der durchschnittliche Heimwerker verbrauchte über den Winter kaum Material für den Außenbereich und so gab es ausreichend Platz auf dem Hof. Eine Ecke des Parkplatzes wurde mit einem Zaun abgetrennt, mit Lichterketten und Tannengrün geschmückt und dahinter wechselten sich die Lagerarbeiter umschichtig ab, das erntefrische Spessartgemüse an den Mann zu bringen. Um die Kauflust anzuregen, schepperten ganztägig Weihnachtslieder aus einem Lautsprecher, und an der Kasse, die in einer Holzbude wie auf dem Weihnachtsmarkt untergebracht war, konnte man heißen Glühwein erwerben. Zum symbolischen Preis von einem Euro – für einen guten Zweck. Typisch Karlsson, die Aktion.
Ehe ich das Firmengelände verließ, schaute ich noch kurz bei den mit Handschuhen und Zipfelmützen ausgerüsteten Kollegen vorbei. Hubi, Anfang dreißig mit der Statur eines Sumoringers und dem Horizont einer Eintagsfliege, versuchte gerade einer alten Dame eine zwei Meter Nordmanntanne anzudrehen – ungeachtet der Tatsache, dass sie kein Auto dabeihatte. Angelo, groß gewachsener Bodybuilder, süße – sehr süße – achtzehn, kämpfte mit der Netzmaschine, die aber anscheinend über den höheren IQ verfügte, und daher gute Chancen hatte, ihn zu besiegen. Nur Achmed, das Hirn der Truppe, hatte kurz Zeit für ein Schwätzchen und spendierte mir ein Heißgetränk. Dankbar schlürfte ich das aromatische Gebräu und genoss das entspannende Gefühl des Alkohols, das unmittelbar in meine Glieder strömte. Achmed war genauso alt wie ich – ein guter Jahrgang – und er war kein bisschen überrascht, als ich von den merkwürdigen Ereignissen im Büro berichtete.
»Der Schuster ist ein schlimmer Finger«, erklärte er mir. »Das weiß doch jeder. Der macht krumme Geschäfte.«
Die Bemerkung traf mich. Sollte ausgerechnet ich, die ich mich immer rühmte, ein guter Menschenkenner zu sein, das übersehen haben? Ich hatte ihn nur für einen Schürzenjäger und Arschkriecher mit dem Drang nach oben gehalten.
Achmed füllte meinen Becher noch mal nach und grinste tröstend. »Nicht ärgern, Frau Bergmann, ist doch bald Weihnachten.« Und dann schmetterte er ›Stille Nacht‹ mit dem Lautsprecher um die Wette, schubste mich auffordernd an und gab sich erst zufrieden, als ich krächzend mit einstimmte. Die gesangliche Eskapade endete in heftigem Husten, der mich zum Aufbruch brachte, nachdem ich meinen Hals – auf Achmeds Anraten hin – mit einem dritten Glühwein desinfiziert hatte. Zum Glück fanden meine Füße den Weg zur Bushaltestelle auch ohne mein Zutun.
Kurz darauf schaukelte ich, selig eingehüllt in eine beachtliche Fahne, die die anderen Fahrgäste auf Abstand hielt, gen Heimat. Vom Frankfurter Nordosten, bis nach Oberrad, in den Frankfurter Süden. Die Buslinie hatte der liebe Gott persönlich für mich eingerichtet, daran gab es keinen Zweifel.
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, eine weitere Fuhre Plätzchen zu backen. Nicht dass das nötig gewesen wäre, meine Regale in der Küche konnten die Vorräte kaum noch fassen. Aber mir half diese Beschäftigung beim Denken, was glühweinbedingt in diesem Falle leider fruchtlos blieb. So kreiste mein Verstand in einer trägen Dauerschleife um das Sexualleben meiner Kollegen Schuster und Sander, die Frage, ob Hubi die Nordmanntanne losgeworden war, was Achmed genau mit krummen Geschäften gemeint hatte und wieso, verdammt noch mal, der Bursche mehr wusste als ich!
Jupp, mein Angetrauter, hatte sich mit der lapidaren Nachricht auf dem Anrufbeantworter verewigt, dass es mal wieder spät werden könne. Mangels seiner beruhigenden Gegenwart buk ich im Akkord weiter – nichts konnte mich aufhalten – bis der Nebel in meinem Gehirn sich lichtete. Bethmännchen glänzten, Florentiner klebten und Terrassenplätzchen stapelten sich zu Pyramiden auf.
Als mein Jupp endlich durch die Tür stolperte, hatte ich gerade so die Spuren meines Backanfalls beseitigt. Siedend heiß fiel mir ein, dass ein Abendessen in meiner Tagesplanung bislang nicht vorgekommen war, so sehr hatte Hottes Walkürenritt mich blockiert. Folgerichtig überredete ich Jupp, mit säuselndem Kratzbariton, zuerst ein heißes Bad zu nehmen; das verschaffte mir die nötige Luft eine Pizza zu erhitzen und ein paar Flaschen Bier zu kühlen. Nein, er ist kein echter Macho, der mir mein Versäumnis vorgehalten hätte, doch mich plagte das schlechte Gewissen der Perfektionistin, die mal wieder den eigenen Ansprüchen hinterherhechelte.
Ich servierte auf dem Sofa und zufrieden kuschelten wir die Köpfe aneinander, jeder einen Pizzateller auf dem Bauch, Jupp ein Bierchen in Reichweite und ich eine heiße Zitrone mit Honig. Das schmeckte zur Pizza ziemlich eigenartig, aber mein Bedarf an Alkohol war für heute gedeckt. Gemächlich kauten wir und starrten dabei eine Weile schweigend auf die Mattscheibe. Jupp zappte gelangweilt durch die Programme, bis er fand, was sein Männerherz erfreute: Fußball. Okay, dachte ich mir, zur Zerstreuung ist es ja ganz nett, den Jungs beim Hin- und Herrennen zuzusehen – und mit den Mannschaften an der Spitze kannte ich mich auch recht gut aus – aber 2. Bundesliga, musste das wirkliche sein?
»Ostderby – total spannend, Cora, wirst schon sehen.« Jupp verspeiste das letzte Pizzastück und kraulte mir gedankenverloren den Nacken. Spannend, das war mein Stichwort. Endlich konnte ich ihm berichten.
»Hm«, machte er, als ich geendet hatte und ergänzte die Rede um ein: »Jetzt guck dir das an!«, was sich aber nicht mehr auf meine spektakuläre Bürogeschichte, sondern auf einen Fehlpass im Strafraum bezog.
»Jupp, hörst du mir überhaupt zu? Der Karlsson war völlig von der Rolle und die Sander auch und der Achmed meint, der Horst – also der Herr Schuster … Jupp?« Das Nackenkraulen hatte wieder eingesetzt und ich fühlte mich wie ein Schoßhündchen, das um Zuwendung bettelte. Verärgert schubste ich seine Hand weg und rückte ein Stück von ihm ab.
»Ach Cora, nun sei nicht gleich so. Ist doch halb so wild. Wahrscheinlich war es dem Schuster nur unangenehm, dass ihr das mit den Sportwetten herausgefunden habt und am Telefon war wirklich nur ein Stammtischbruder.«
»Und wieso hat dann der Karlsson die Krise gekriegt vorm Tresor?«
Jupp zuckte die Schultern. »Was weiß denn ich. Wart es halt ab. Heute Abend rettest du die Welt sowieso nicht mehr.«
Der nächste Pfiff des Schiedsrichters forderte seine ungeteilte Aufmerksamkeit und ich erwog ebenfalls zu unlauteren Mitteln und Schienbeintritten überzugehen. Mein gedankliches Foulspiel wurde durch ein Klopfen an der Wohnzimmertür unterbrochen, durch die zeitgleich Timm hereinwehte, gefolgt von einem Schwall Kaltluft.
Timm, mein Lieblingssohn, der vor wenigen Monaten unserem Haushalt den Rücken gekehrt hatte, um am anderen Ende der Stadt seine erste eigene Wohnung zu beziehen. Endlich konnte er schalten und walten, schlafen und aufstehen wie es ihm beliebte, ohne dass ihm ständig ein nervendes Muttertier an den Fersen klebte. Jaja, ich war mir meiner Schwächen durchaus bewusst und ich gönnte ihm das selbstbestimmte Studentenleben von Herzen. Nein, nicht nur das. Wenn ich ganz ehrlich war, beneidete ich ihn auch ein wenig darum. Was mich allerdings erstaunte, war, dass wir ihn seit dem Auszug häufiger zu Gesicht bekommen hatten als im gesamten Jahr zuvor. Fröhlich plappernd hockte er mindestens dreimal die Woche an unserem Küchentisch. Immer zur Essenszeit, welch Zufall; und wenn ich fragte, ob er einen Happen mitessen wolle, sagte er nie nein. Ein Gebot der Höflichkeit. Hatte ich ihm das beigebracht? Vermutlich.
Als Timm an diesem Abend den schwarz gelockten Wuschelkopf durch den Türspalt schob, zog er schnuppernd die Nase kraus. Folgerichtig waren seine ersten Worte: »Hm, Pizza!«
Er boxte seinem Vater zur Begrüßung auf die Schulter, ich bekam tatsächlich ein Küsschen auf die Stirn, dann faltete er sein knappes zwei Meter Klappergestell neben mir auf das Sofa.
»Ist noch was übrig?« Logischer zweiter Satz.
»Zu spät, alles weg.« Jupp rieb sich sehr zufrieden den Bauch; fehlte nur noch das Bäuerchen. Timms enttäuschte Miene veranlasste mich sofort zum Anpreisen meiner im Backwahn entstandenen Backwaren. Irgendwer musste die schließlich essen. Für die letzte Portion hatte ich nicht mal mehr Tupperdosen gefunden. Blech und Plastik waren ausnahmslos gefüllt. Aber Timm winkte ab.
»Nö, Mama, lass mal. Nix Süßes. Hast du Chips? Oder vielleicht ein Wurstbrot? Käse? Saure Gurken?«
Dieser Wink war eindeutig und da mich das müde dahinplätschernde Fußballspiel sowieso nicht begeistern konnte, ging ich mal eben in die Küche ein paar Schnittchen richten. Darüber nachzudenken, kam mir gar nicht in den Sinn. Ich schnitt, schmierte, belegte, dekorierte und summte dabei Weihnachtslieder. Vor dem Fenster rieselte leise der Schnee und ich verfiel kurzfristig in wonnige Festtagsstimmung. Dann balancierte ich den Teller ins Wohnzimmer, wo Vater und Sohn in exakt gleicher Haltung auf der Couch hingen: So weit zusammengesackt, dass das Kinn auf der Brust klebte und der Hinterkopf ins Polster passte, die Beine weit ausgestreckt, eine Hand auf dem Bauch – dessen Umfang sie dann doch unterschied – und eine Hand lässig im Schritt. Trotz des leichten Rettungsrings fand ich meinen Jupp optisch immer noch ziemlich ansprechend; keine Glatze, nicht mal Geheimratsecken und leichte Ansätze von grau an den Schläfen, was Männer ja bekanntlich seriös aussehen lässt.
Mein Erscheinen wurde nur am Rande registriert, bildete ich doch plötzlich ein Hindernis zwischen Sitzplatz und Bildschirm; die Brote dagegen wurden freudig entgegengenommen. Der von Jupp geäußerte Wunsch nach einem weiteren Bier und das knappe: »Ich nehme auch eins!«, das Timm statt eines Dankes parat hatte, ließ mich automatisch kehrtmachen. Doch auf dem Flur bemerkte ich den Wäscheberg, der hinter der Eingangstür lag. Die Flaschen in der Hand blieb ich stehen. Verspürte ich einen leisen Unmut oder balgten sich Reste von Glühwein, Zitrone und Pizza in meinen Eingeweiden? Timms monatliches Budget war sicherlich nicht überwältigend groß; dass er die Anschaffung einer Waschmaschine nicht ganz vorne auf der Erledigungsliste hatte, erschien mir daher nachvollziehbar. Nach fast einem halben Jahr kam mir jetzt ein anderer Verdacht: Dass er den Dreckhaufen bis zu uns karrte, statt den in unmittelbarer Nähe zu seinem Domizil gelegenen Waschsalon zu nutzen, war womöglich keinen rein finanziellen Überlegungen geschuldet. Und warum zum Geier stand er montagabends nach neun Uhr mit dem Krempel auf der Matte? Weil er am Freitag nicht dran gedacht, am Samstag gefeiert und am Sonntag seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Darum. Ich verpasste dem T-Shirt-Socken-Handtuchknäuel einen Tritt und ein paar Unterhosen wirbelten auf. Schneeflöckchen – Weißröckchen, intonierte ich leise und kickte noch einmal ins pralle Leben, das einen muffigen Geruch verströmte. Raclette, dachte ich spontan, wäre was für Silvester. Mit Kartoffeln und Zwiebeln, Pilzen und Hühnchenbrust, Mais und Peperoni und … Käse – der wunderbar schmeckte, aber nach alter Socke stank. Der gerade noch angenehme Gedanke verflüchtigte sich und ein vages bauchgrummelndes Gefühl der Rebellion erwachte. Ich hatte ein bequemes, parasitäres Stinktier großgezogen! Und nun hatte ich genug. Meine folgende Kehrtwende hatte diesmal etwas Militärisches – oder Militantes – da war ich nicht sicher.
Die Fußballer rannten von links nach rechts, Jupp und Timm fläzten träge in den Kissen. Alles unverändert.
»Willst du die Klamotten heute Abend noch waschen?«
Timm druckste herum und zog sehr gekonnt sein mitleidheischendes Dackelgesicht. Die Masche funktionierte meistens, Vater und Sohn beherrschten das prächtig.
»Ach Mama, eure Waschmaschine hasst mich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Kannst du nicht – ausnahmsweise?«
»Klar kann ich.« Ich plumpste in den Sessel und legte die Füße auf den Couchtisch zwischen die leeren Bierflaschen meiner Liebsten. Die beiden vollen öffnete ich und nahm erst aus der einen, dann aus der anderen einen Schluck, obwohl ich nicht die geringste Lust auf Bier hatte. »Aber soll ich dir was sagen, Timm? Ich will nicht und du kannst mich mal.« Zwei entsetzte Gesichter starrten mich an. »Du kannst mich mal«, wiederholte ich, »in den Keller begleiten. Und dann erkläre ich dir zum fünfzehnten Mal, wie die Waschmaschine funktioniert. Auch wenn ich dir durchaus zutraue, dass du das alleine herausfindest, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst.«
In der Nacht schlief ich schlecht. Den Grund dafür konnte ich nicht genau ausmachen. Mein Magen hatte sich wieder beruhigt und Horst Schusters Schicksal machte mich eher neugierig als betroffen. Blieb nur der Angriff auf mein eigen Fleisch und Blut, dem ich erstmals die mütterliche Fürsorge verweigert hatte. Doch darauf war ich irgendwie sogar stolz.
Ich hatte meinen Hintern nicht erhoben, und nach einem Moment der inneren Sammlung war mein Junior tatsächlich ganz alleine losgezogen, um sich dem Kellermonster zu nähern, das ihn – oh Wunder! – am Leben ließ und ohne Widerrede seine Wäsche säuberte.
Seine Heldenhaftigkeit belohnte ich, indem ich ihm bei seiner Rückkehr eines der nur angebrauchten Biere überreichte. Das andere bekam Jupp, der es sich nicht verdienen musste. Die Welt ist eben ungerecht und ich bin es manchmal auch. Welcome to real life, dachte ich mir. Mein Söhnlein erhielt obendrauf noch kostenlos – aber verbindlich – eine kurze Einführung in die Geheimnisse der Wäschetrocknung auf der Leine sowie eine genaue Beschreibung des Standortes der Wäscheklammeraufbewahrungseinheit: Roter Eimer, links neben der Waschmaschine, selbst für ihn nicht zu verfehlen. Mein Humor traf nicht ganz seinen Geschmack und ich glaube, er kam ganz gut damit zurecht, dass ich mich frühzeitig ins Bett verabschiedete. Ein dicker Schal und der liebliche Duft japanischen Pfefferminzöls begleiteten mich. Letzteres konnte leider auch nicht verhindern, dass ich erbärmlich schnarchte und Jupp mich die halbe Nacht lang schubste. Vielleicht war auch dieses Schubsen der eigentliche Grund für meinen schlechten Schlaf.
Solidarität?
Früh morgens duschte ich, erneuerte den Ölfilm auf Hals und Brust, und zog auch noch wärmende Thermounterwäsche darüber zwecks Saunaeffekt. Rausschwitzen hilft immer. Zu Hause bleiben kam nicht infrage, es galt weitere Einzelheiten unseres Skandälchens ans Licht zu bringen.
Doch der Tag bei Karlssons Baustoffhandel war leider nicht dazu geeignet, meine Stimmung aufzubessern oder irgendeine Dunkelheit zu erhellen, selbst die Sonne verweigerte den Dienst. Der Schnee matschte und hinterließ Ränder auf Schuhen und Böden. Unser Chef hockte wie angenagelt in seinem Büro hinter verschlossener Tür. Keiner durfte rein und er kam nicht raus. Sieglinde Sander verschanzte sich hinter einer versteinerten Miene und einer dicken Schicht Make-up, die die Augenringe abdeckte. Statt eines kurzen Rockes trug sie einen Hosenanzug und flache Schuhe, woraus ich schloss, dass sie nicht damit rechnete, Horst Schuster käme zurück und mit ihm unser Büroalltag wieder in Ordnung. Es tuschelte inhaltslos in allen Ecken, was mir den Spaß an eigenen Spekulationen verdarb. Einzige kleine Überraschung, die ich aber für mich behielt wie einen Schatz, dessen Wert ich erst noch eruieren musste, war eine Beobachtung, die ich durch die halb geöffnete Tür von Karlssons Vorzimmer machte: Die Sander süßte ihren Kaffee! Dann verputzte sie die letzten Plätzchen aus meiner Weihnachtsdose – die am Vortag randvoll gewesen war und sicher vierhundert Gramm schwer – und öffnete den Reisverschluss ihrer Hose. Das war wahrlich nicht viel an Stoff für meinen aufklärerischen Enthüllungsdrang, aber mehr war nicht drin und Achmed, auf den ich gehofft hatte, konnte ich nicht eine Sekunde alleine erwischen.
Am Nachmittag zwang mich die Erkältung endgültig in die Knie und dann ins Bett. Nachdem ich mir den halben Inhalt unseres Medizinschrankes zu Gemüte geführt hatte – wobei ich es glücklicherweise noch schaffte, zweifelsfrei zwischen innerlicher und äußerlicher Anwendung zu unterscheiden –, schlief ich vierzehn Stunden am Stück. Daraufhin entstieg ich meinem Nachtlager frisch und strahlend, wie einst Venus ihrer Muschel.
Ich stürzte mich in den neuen Arbeitstag, fühlte mich kerngesund und voller Tatendrang. Jener verschwand im Laufe der nächsten Stunden still und leise, ohne sich noch einmal umzudrehen und von mir Abschied zu nehmen, und nahm auch gleich noch meine gute Laune mit.
Karlsson brach sein Schweigen um exakt zwölf Uhr dreißig. Unser Haus pflegte noch die antiquierte Angewohnheit mittags für eine Stunde die Türen abzuschließen, und genau diesen Augenblick hatte er abgewartet. Sogar der Weihnachtsbaumverkauf wurde vorübergehend eingestellt. Unten in der Lagerhalle, zwischen den Hochregalen und Gabelstaplern, glänzte wie gewohnt die Festtagstanne für die Mitarbeiter, die Herr Karlsson traditionell gemeinsam mit seiner Frau geschmückt hatte. Am Morgen des dreizehnten Dezembers, dem Luciatag, eben jenem, an dem uns in diesem Jahr ganz unplanmäßig unser Buchhalter abhandengekommen war.
Wie Karlsson nun da so stand, die obligatorischen Umschläge mit der Weihnachtsgrußkarte und der Sonderzahlung in Händen, hätte ich beinahe aufgeatmet und geglaubt, alles käme wieder ins Lot. Doch stattdessen lief mir ein eiskalter Schauer vom Hinterkopf abwärts, unter der Thermowäsche entlang – sicher ist sicher, lieber einen Tag länger tragen, als einen Rückschlag riskieren – und runter bis zum Steiß. War das eine böse Vorahnung oder hatte nur einer die Tür zum Hof nicht richtig zugemacht?
Karlsson beschränkte sich in seiner Ansprache auf das Wesentliche. Gleich zu Anfang entschuldigte er seine Frau, die leider unpässlich sei, und wies darauf hin, dass sich Achmed stellvertretend um die Zubereitung des Julglögg gekümmert habe, der im Anschluss konsumiert werden könne. Alkoholfrei während der Arbeit, versteht sich. Dazu gab es, nicht sehr schwedisch, aber praktisch, heiße Würstchen und Brötchen auf Firmenkosten. Alle scharten mit den Hufen, hungrig und in freudiger Erwartung der kommenden Gratifikation. Doch Karlsson holte unverhofft nochmals tief Luft und verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln, das mir einen erneuten Schauer bescherte.
»Bitte wundern Sie sich nicht, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter«, begann er bedächtig, »wenn Sie in diesem Jahr kein Bargeld in Ihren Umschlägen finden. Es war mir leider nicht möglich …« Er sammelte sich und rieb seine Nase, während die Belegschaft kollektiv den Atem anhielt.
Da war sie wieder, diese Stille jenseits des Nullpunkts.
»Die Auszahlung erfolgt in den nächsten Tagen mittels Überweisung, ähm, denke ich.«
Wildes Raunen löste die Stille ab und er versuchte, sich nochmals Gehör zu verschaffen. Seine vehement begonnenen Sätze verhedderten sich jedoch zusehends.
»Sicherlich ist Ihnen allen bereits zu Ohren gekommen, dass Herr Schuster unseren Betrieb kurzfristig verlassen hat – wie soll ich sagen – derzeit nicht zur Verfügung steht. Nun ja, die Umstände waren unschön … doch bin ich zuversichtlich, dass sich das alles klärt. Ich versichere Ihnen, dass es für Sie keinen Grund gibt sich Sorgen zu machen, auch wenn das gesamte Ausmaß derzeit noch nicht zu überblicken ist.« Karlsson räusperte sich und zog die Krawatte gerade. »Ja, also dann: Fröhliche Weihnachten.«
Wenn eine Rede dazu geeignet war eine versammelte Menschenschar zu beruhigen, dann ganz bestimmt nicht diese. Niemand hatte sich bisher ernsthaft Sorgen gemacht, was sich nun schlagartig änderte. Das Raunen wurde ohrenbetäubend.
Herr Karlsson stand unentschlossen unter seinem Julbaum, schaukelte auf den Fersen vor und zurück und klatschte die Grußkarten mit einer Hand in die Handfläche der anderen. Dann drückte er sie Achmed, der ihm am nächsten stand, vor die Brust und flüchtete mit langen Schritten die Treppe hinauf in sein Büro, ehe jemand eine konkrete Frage an ihn richten konnte.
Mir wurde schnell klar, dass die meisten Kollegen sich nur darum sorgten, ob ihr Weihnachtsgeld noch rechtzeitig vor dem letzten Adventswochenende auf ihrem Konto eintrudeln würde und somit der geplanten Shoppingtour nichts im Wege stand. Meine Gedanken rasten weiter voraus: Was, wenn Karlsson in echte Zahlungsschwierigkeiten geriet, die Gehälter auf der Kippe standen? Was hatte er mit dem »gesamten Ausmaß« gemeint? Fragen, die mich wieder zu Achmed und zu Horst Schusters krummen Geschäften führten. Darüber musste ich mehr erfahren. Vorausplanend half ich Achmed, die ungeliebten – weil scheinchenfreien – Grußkarten zügig unters Volk zu bringen. Dann packte ich erst eine Wurst mit Senf in ein Brötchen und anschließend ihn an der Schulter und zerrte ihn hinter den Weihnachtsbaum.
»Raus mit der Sprache, Achmed, was wissen Sie von dem, was hier hinter den Kulissen läuft?« Diplomatie ist eine hohe Kunst, aber nicht immer angebracht. Achmed schabte sich das schlecht rasierte Kinn, auf dem die Bartstoppeln ähnlich hochsprossen wie das, was sich auf seinem Schädel Frisur nannte.
»Wissen ist zu viel gesagt, Frau Bergmann. Der Schuster hat so was im Blick«, murmelte er und zog unwillkürlich aus dem Hemdkragen seine Kette hervor, an der das blaue Auge der Fatima baumelte. »Manchmal kommt er zu uns runter ins Lager und stöbert in den Regalen, mit dem Klemmbrett in der Hand, als ob er Inventur machen wollte. Aber solche niederen Arbeiten macht er ja nicht wirklich selbst. Ein paar Mal hat er Kisten auf einen Wagen gepackt und in Gerds Büro gebracht – aber nur, wenn der nicht da war –, hat was gefaselt von Qualitätskontrolle oder so. Und bei manchen Lieferungen will er immer unbedingt selbst dabei sein, überprüft die Vollständigkeit, klettert im Laster herum und steht allen im Weg. Er unterschreibt dann auch gleich die Ladepapiere und nimmt sie mit nach oben. Den Durchschlag für das Lager muss dann später einer von uns abholen und dem Gerd bringen, für den Bestandsordner.«
Nach stichhaltigen Beweisen klang das für mich nicht gerade, aber seltsam irgendwie schon.
»Sonst noch was?«
»Er hat was mit der Frau Sander.«
Das war nun wirklich kein Geheimnis und auch kein Verbrechen.
»Und er betrügt sie.«
Mir klappte die Kinnlade herunter. Aber leider kam genau in diesem Augenblick Hubi um die Tanne herumgewalzt und beendete damit vorzeitig unser Gespräch. Kurz hatte ich den Eindruck hinter seiner Stirn kämen die Holzzahnräder in Bewegung, als er uns beide in fast schon verfänglicher Zweisamkeit entdeckte. Aber dann reklamierte er doch nur, dass der Julglögg zur Neige ginge und wollte wissen, ob es noch Nachschub gäbe.
Achmed schaute mich an, zuckte bedauernd die Schultern und verschwand mit einem strahlenden Hubi im Schlepp, der mit dem Zeigefinger die Reste der Rosinen und Mandelblättchen aus seinem Glas pulte.
Angesichts der unklaren Finanzlage meines Arbeitgebers, die erste Zweifel an der Bezahlung meiner Überstunden aufkommen ließ, und mangels anderer Anweisung, verkrümelte auch ich mich rasch. Zwischen Achmed und mir herrschte auch ohne viele Worte konspirative Einigkeit, den jeweils anderen so bald als möglich über neue Entwicklungen in Kenntnis zu setzen.
Aus dem Busfenster fiel mein Blick auf die Tribüne des FSV-Stadions, das vor dem Umbau oval gewesen war wie mein Spritzgebäck. Spontan entschied ich, nicht nach Hause zu fahren. Ich fürchtete die Begegnung mit meiner Küche. Backen durfte ich nicht mehr, das hatte Jupp mir strengstens untersagt, unter der Androhung, meine Bankkarte sperren zu lassen, damit ich nicht das ganze Dezembergehalt in Zitronat und Ähnliches umsetzte. Dass ich über den Gedanken, unser Geld zu verbackpulvern, herzlich lachte, nahm er mir tatsächlich übel. Was also tun, um den Nachmittag totzuschlagen und die Gedanken zu sortieren? Mir fiel nur Elfi ein. Elfi zu besuchen war meistens eine gute Idee. So tauschte ich den Bus gegen die U-Bahn.
Obwohl ich schon mehr Jahre in Frankfurt wohnte, als ich zuvor andernorts verbracht hatte, war ich noch immer unfähig mir zu merken, ob ich mich oben, unten, vorne oder hinten in einer Straße befand, und konnte daher mit Wegbeschreibungen der Eingeborenen meist wenig anfangen. Da es der Stadt in meinen Augen an extremen Höhenunterschieden fehlte, definierte ich den Main als unten, was mir jedoch nicht mehr weiterhalf, sobald ich ihn aus den Augen verlor. So nutzte ich liebend gern die praktischen schematischen Darstellungen der Netzlinienpläne im öffentlichen Nahverkehr. Unteririsch mutierte ich zum Orientierungs-Crack. Und an der Oberfläche, nun ja, fragte ich mich eben Stück für Stück durch. Die Strecke zu Elfi kannte ich allerdings im Schlaf. Haltestelle Bornheim Mitte, von dort aus konnte nichts mehr schiefgehen. Nur noch einige hundert Meter geradeaus, dann einmal abbiegen. Wenn man in die richtige Richtung trabte eine Kleinigkeit. Zu Anfang war mir das nicht immer gelungen und daher wusste ich aus leidvoller Erfahrung, dass die Bergerstraße nicht nur über zahlreiche nette Geschäfte, sondern auch über verdammt viele Meter verfügte.
Das Glück ward mir hold und ich traf meine Freundin in ihrem Laden an. Diesen empfand ich von außen betrachtet, allein durch die Dekoration des Schaufensters, als ein wenig zwielichtig. Künstliche Krallen in Korallenrot, Pink und Neongrün mit Strass-Steinen beklebt, reckten sich den Passanten entgegen; durchsichtige Pantoletten mit Federbüscheln kuschelten sich in ein feuerrotes Tuch; und seit Anfang Dezember grinste dazwischen ein fetter Nikolaus mit lüsternem Blick hervor. Von der Decke baumelte ein Kronleuchter mit flackernden elektrischen Kerzen. Der erste Eindruck bestätigte sich im plüschigen Innern. Elfis Nagelstudio hätte genauso gut ein Puff sein können. Zumindest stellte ich mir die Einrichtung eines solchen ganz ähnlich vor. In diesem Punkt musste ich mich auf meine Fantasie verlassen. Im vorderen Teil des Raumes, direkt hinter dem Fenster, konnte man in einer samtigen Sitzecke verweilen, wenn man auf Elfi warten musste. Hier servierte sie je nach Bedarf Kaffee oder auch mal ein Gläschen Sekt. Hinter einem Paravent – dunkle Holzornamente bespannt mit seidigem Stoff – versteckte sich der eigentliche Arbeitsbereich der kreativen Seele, die sich den vergänglichen Kunstwerken am lebenden Objekt verschrieben hatte. Mir war es unbegreiflich, wie man mit den von ihr gestalteten extralangen Fingernägeln ein einigermaßen produktives Dasein führen konnte. Sie war eine meiner besten Freundinnen – und ich ihre schlechteste Kundin. Einmal und nie wieder! Mit künstlichen Nägeln fühlte ich mich wie Edward mit den Scherenhänden – monströs – fast schon deformiert. Zwei Tage hatte ich mich mit der Entscheidung gequält, ihr dann gestanden, dass ich die Dinger so schnell wie möglich wieder los sein wollte. Entgegen meiner Befürchtungen war Elfi nicht beleidigt gewesen, nur ihre spitzen Bemerkungen zu meiner modischen Untauglichkeit musste ich seither gelegentlich einstecken.