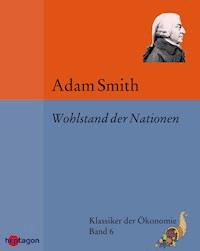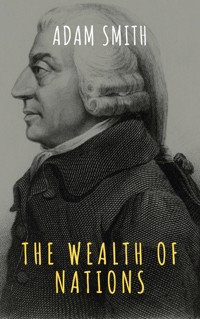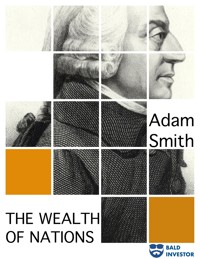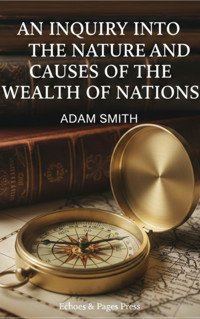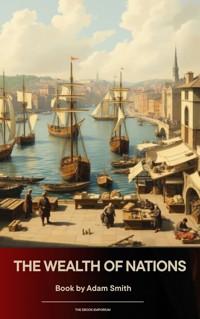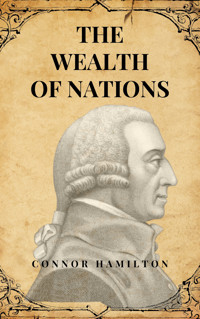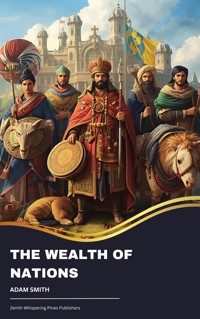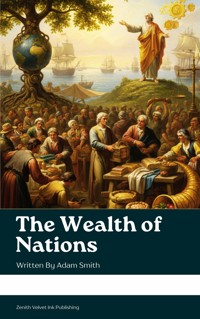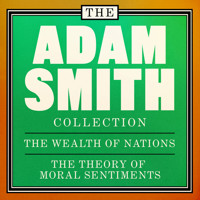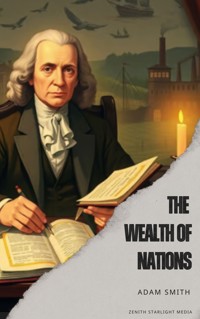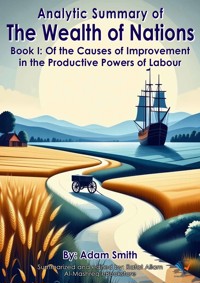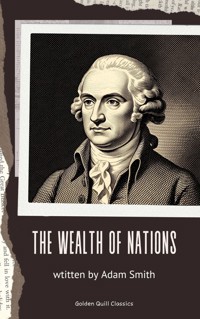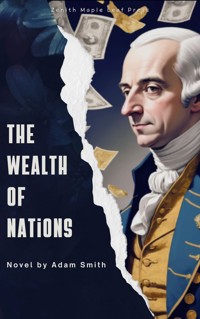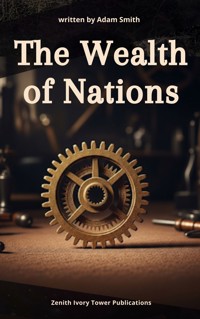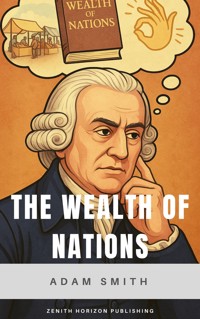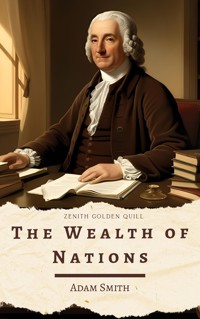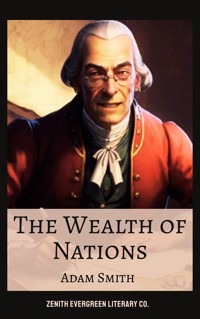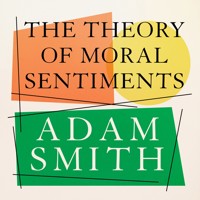14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: dtv bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker Erschienen 1776, also vor rund 240 Jahren, gilt ›Der Wohlstand der Nationen‹ nach wie vor als einer der einflussreichsten Texte der Neuzeit, als Geburtsstunde der Volkswirtschaftslehre. Adam Smith (1723-1790) hat hier zentrale Begriffe und Konzepte der Ökonomie wie etwa Angebot und Nachfrage oder Arbeitsteilung geprägt. »Die unsichtbare Hand« wurde zum geflügelten Wort. Gekürzt und mit einem Vorwort zur Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Adam Smith
Der Wohlstand der Nationen
Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen
Herausgegeben und gekürzt von Georg von Wallwitz
Übersetzt von Horst Claus Recktenwald
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorwort des Herausgebers
Adam Smith, Porträt im Profilstich, 1787 (© ullstein bild – Granger, NYC)
Ein Text wird zum Klassiker, wenn er nicht nur eine Ära abschließt, sondern mit ihm gleichzeitig auch eine neue beginnt.[1] Newton nimmt sich altbekannter Probleme an und nach ihm ist die Physik nicht mehr ohne seine Gesetze denkbar. Freud stellt die altehrwürdige philosophische Disziplin der Psychologie auf ein völlig anderes Fundament. Nach Richard Wagner können keine Opern mehr im Stil von Mozart oder Verdi geschrieben werden. Und nach Adam Smiths ›Der Wohlstand der Nationen‹ (WN) ist die Ökonomie als Wissenschaft nicht mehr wiederzuerkennen. Seit das Buch 1776 erschienen ist – im Jahr der Amerikanischen Unabhängigkeit –, kann kein wirtschaftswissenschaftlicher Text mehr erscheinen, ohne wenigstens implizit darauf Bezug zu nehmen.
Adam Smith, geboren 1723, studierte zunächst in Glasgow Latein, Griechisch, Moralphilosophie (bei Francis Hutcheson), Mathematik (bei Robert Simon, nach der Methode Euklids) und »Naturphilosophie«, als deren Speerspitze in dieser Zeit das Werk Newtons verstanden wurde. Von 1740 bis 1746 führte er seine Studien in Oxford fort – wohl eher um die Menschen und ihre Sitten kennenzulernen als akademisch weiterzukommen. Jedenfalls hatte er später keine guten Worte übrig für Englands Universitäten (V,3,2)[2]. Ab 1748 finden wir ihn in Edinburgh, wo er Vorlesungen über Rhetorik hielt und 1751 zum Professor für Logik und im Jahr darauf zum Professor für Moralphilosophie berufen wurde. Sechs Jahre später begleitete er den damals 18-jährigen Herzog von Buccleuch auf einer zweijährigen Kavaliersreise auf den Kontinent, wo er unter anderem mit Voltaire zusammentraf, sowie mit Turgot und Quesnay, den bedeutendsten Vertretern der damals in der Ökonomie tonangebenden »Physiokraten« (die der Meinung waren, der Wohlstand einer Nation sei in ihren Bodenschätzen und im Ackerbau begründet). Mit einer jährlichen Leibrente von 300 Pfund zog er sich anschließend in sein Elternhaus zurück, um in den folgenden zehn Jahren den ›Wohlstand der Nationen‹ zu schreiben. 1777 zog er wieder nach Edinburgh (mit seiner Mutter), wo er zum Aufseher über das Zollwesen ernannt wurde. Diese Arbeit ließ ihm genug Zeit für seine literarischen Interessen, die er insbesondere mit seinem Freund David Hume verfolgte. Er starb 1790 als angesehener Mann.
Sein Werk war eng mit der schottischen Aufklärung verwoben. Die wissenschaftliche Methode nach dem Vorbild Newtons, bei der durch genaue Beobachtung ein möglichst allgemeines Naturgesetz gefunden wurde, aus dem sich dann die Theorie entwickeln ließ, galt als Ideal. Die Aufklärer glaubten an den Fortschritt ihrer Zivilisation und die schrittweise Verbesserung der sozialen Bedingungen. Sie schätzten Recht, Eigentum, Manieren und Tugend, lasen Montesquieus ›Vom Geist der Gesetze‹ und Voltaires ätzende Kritik der Verhältnisse im absolutistischen Frankreich. Der ›Wohlstand der Nationen‹ war aber auch in ganz praktischer Hinsicht mit seiner Zeit verbunden: Smith konnte beobachten, wie sich die Öffnung der Englischen Märkte (durch die Union von 1707) für Schottland endlich auszahlte. Er war Zeuge eines erheblichen Bevölkerungswachstums, insbesondere in den Städten (Glasgows Bevölkerung verdreifachte sich in Smiths Lebensspanne). Er konnte in den Salons den einflussreichen Tabakhändlern dabei zusehen, wie sie die Preise absprachen und sich ansonsten bemühten, in ihrem Auftreten den Landadel nachzuahmen. Er begriff die Bedeutung eines effizienten Bankwesens bei der Finanzierung des Kanals zwischen den Flüssen Forth und Clyde, dem Großprojekt seiner Zeit, mit welchem Glasgow und Edinburgh verbunden wurden. Er sah aber auch die damit verbundene Spekulation, die 1772 zum Zusammenbruch der Ayr Bank führte. Die Schwerindustrie erlangte in Schottland aber erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts Bedeutung und entsprechend hatte Smith immer nur eine sehr kleinteilige »Industrie« vor Augen, als er sein großes Buch schrieb.
Der Wohlstand wächst, wenn die Menschen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen mehr produzieren. Die Produktivität steigt in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in der sich die Arbeiter mit »Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung« (Einleitung, S. 3) auf das konzentrieren, was sie am besten können. Kugelstoßer treten ja auch nicht beim Marathon an. Die Gewinne des Unternehmers fördern die Entwicklung eines Kapitalstocks (in Smiths Welt: Maschinen), wenn er nur schottisch sparsam wirtschaftet. Bessere Fabriken und besser ausgebildete Arbeiter führen zu höherer Produktivität und höherem Pro-Kopf-Konsum. Motor dieser Entwicklung ist der Wettbewerb in freien Märkten. Er gibt den Anreiz, fleißig zu sein und in der richtigen Menge die Produkte herzustellen, die die Menschen auch tatsächlich wollen. Voraussetzung einer funktionierenden Marktwirtschaft sind Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, eine funktionierende Infrastruktur und eine gut ausgebildete Bevölkerung.
Anreize funktionieren grundsätzlich besser als Zwang. In einem freien Markt produzieren die Menschen aus Eigeninteresse, nicht weil sie eine Vorgabe des Gutsherrn oder des Staates haben – und arbeiten damit besser als in einer Kommandowirtschaft. Dem aufgeklärten Schotten ist wichtig, dass der freie Markt nicht nur für effiziente Produktion sorgt, sondern die Menschen auch zu einem gewissen Grade aus ihrer Unmündigkeit befreit. Teilnehmer an einem freien Markt sind, im Gegensatz zu Knechten, gezwungen, sich selbst Gedanken zu machen, was sie mit ihrer Zeit und Kraft anfangen. Das Eigeninteresse der Produzenten gebietet es, gute Ware günstig anzubieten. Davon profitiert – so lange echter Wettbewerb herrscht – in erster Linie der Konsument. Obwohl das Interesse des Einzelnen nicht darauf ausgerichtet ist, fördert es dennoch das Gemeinwohl, gesteuert von der berühmten unsichtbaren Hand: »gerade dadurch, dass er das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun.« (IV,2) Freie Märkte sorgen für eine Win-win-Situation. Smiths etwas überspitzte Konklusion, jeder staatliche Eingriff (Ausnahmen: Militär, Bildung, Justiz, Infrastruktur) führe zu einer Minderung des Wohlstands, muss ein heutiger Leser zwar nicht mitmachen – sein Verdacht, Staatsversagen sei häufiger und gravierender als Marktversagen, hat in den letzten 250 Jahren jedoch viel Nahrung erhalten.
Adam Smith beobachtet fasziniert den Beginn der Industriellen Revolution. Immer größere Betriebe brauchen immer mehr Kapital, immer bessere Straßen und Kanäle, sowie immer größere Märkte. Der Blick wendet sich daher auch auf den internationalen Handel, in dem keine anderen Kräfte wirken als auf den nationalen Märkten. Smith lehnt den Protektionismus zwischen den Nationen aus denselben Gründen ab, wie er die Zünfte innerhalb eines Landes ablehnt. Abgeschottete Märkte sind dem Wohlstand immer abträglich, egal auf welcher Ebene der Eingriff stattfindet, denn sie führen letztendlich zu steigenden Preisen, welche die vermuteten Vorteile sofort wegfrühstücken. Damit wendet er sich insbesondere gegen den damals herrschenden Merkantilismus – der bis heute aber immer wieder in der einen oder anderen Erscheinungsform auftritt.
Die unsichtbare Hand wirkt über den Preis. Smith kennt einen natürlichen Preis, der abhängt von der Arbeit, die in ein Produkt investiert wurde, aber auch von dem Zins, den der Grundeigentümer oder Maschinenbesitzer erwarten kann. Er kennt aber auch den Marktpreis (der tatsächlich beobachtbare Preis), der Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringt (also eine dezentrale Lenkungsfunktion hat) und mittelfristig um den natürlichen Preis schwanken sollte (I,7). Womit er sich nicht weiter aufhält, ist die Frage nach dem gerechten Preis, der insbesondere in der Theologie immer wieder eine Rolle gespielt hatte. Bei Smith muss der Preis keine Gerechtigkeit produzieren: Der Gewinn ist keine Frage der Moral, er ist weder Ausdruck von Gottes Segen und Prüfung (wie bei Calvin), noch unanständiges Ergebnis entfesselter Gier (wie später bei Marx). Smith sieht im Gewinn einen Ausdruck gesamtwirtschaftlichen Erfolgs, der den allgemeinen Wohlstand mehrt. Solange das Streben nach Gewinnmaximierung in fairen und freien Märkten erfolgt, bedarf es daher keiner weiteren Rechtfertigung.
Die Wirtschaft muss wachsen, wenn bei steigender Bevölkerungszahl die einzelnen Kuchenstücke nicht immer kleiner werden sollen, bis das Leben schließlich zu einem bloßen Existenzkampf wird (»Malthusianische Falle«). Sie wächst mit der Verbesserung des Kapitalstocks – insbesondere durch technischen Fortschritt – sowie durch die bessere Ausbildung der Menschen. Das Wachstum entsteht im privaten Sektor, wo der Wettbewerb innovatives Denken zu einer Notwendigkeit macht, aber auch indem der Staat für gute Schulen sorgt.
Wie wird das Wachstum verteilt? Arbeitgeber sitzen in Lohnverhandlungen zwar kurzfristig am längeren Hebel (weil sie tiefere Taschen haben und Streiks aussitzen können (I,8)), aber Löhne bestimmten sich durch viele Faktoren (die Mühe der Arbeit, die nötige Ausbildung, die Zuverlässigkeit des Arbeitnehmers etc. (I,10)) und in Adam Smiths Konzeption liegen sie in der Regel spürbar über dem Existenzminimum. Gut ausgebildete Arbeitnehmer, die mehr als ihre bloße Muskelkraft verkaufen können, haben mittelfristig einen höheren Lebensstandard und der Staat ist gut beraten, ein System öffentlicher Schulen zu subventionieren (V,1,3). Insgesamt interessiert die Verteilungsfrage, die später so wichtig wird, Smith aber nur am Rande.
Die Frage der Moral, die Smith schon aus beruflichen Gründen interessieren musste, taucht im ›Wohlstand der Nationen‹ in zwei ganz anderen Zusammenhängen auf. Erstens beschreibt Smith die Wirtschaft als einen erstaunlichen Mechanismus, der Menschen, die einander noch nie gesehen haben, dennoch in friedlichen Austausch kommen lässt. In der Familie oder im Dorf mag ein Gefühl der Sympathie genügen, um friedliche Koexistenz zu ermöglichen (dies war ein Thema der ›Theory of Moral Sentiments‹, des anderen großen Buches von Smith). Im Kontakt mit Fremden ist dieses soziale Schmiermittel der Markt. So kommt ein Philosoph dazu, einen ökonomischen Klassiker zu schreiben.
Zweitens ist Smith überzeugt, dass die Marktwirtschaft nicht nur für die Effizienz, sondern auch für die Moral gut ist. Der Wohlstand, den freie Märkte erzeugen, führt dazu, dass immer weniger Menschen aus Not gezwungen sind, unmoralisch zu handeln (Einleitung und I,8). In einer Handel treibenden Gesellschaft sind die Menschen weniger roh und brutal. Je reicher eine Gesellschaft ist, desto einfacher wird es, sich moralisch zu verhalten. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die unpersönlichen Beziehungen, die der Markt ermöglicht, befördern eine Freiheit, die in einer feudalen Gesellschaft unmöglich ist (III,4). Freier Handel geht mit zivilisiertem Benehmen, mit der Herrschaft des Rechts und der Institutionen einher. Er bedarf der Rechtssicherheit nicht weniger als der Gerechtigkeit und des Vertrauens. Wo es keine freien Märkte gibt, ist die Knechtschaft nicht weit – und umgekehrt.
Smith ist keineswegs blind für die negativen Seiten der reinen Marktwirtschaft: Er ist sich bewusst, dass die Habgier leicht überhandnehmen kann (IV,3 und IV,8). Er sieht die Gefahr, dass die Kaufleute durch Absprachen den eigenen Wohlstand vergrößern, den allgemeinen aber zerstören. Er empfiehlt den Fabrikanten, höhere Löhne als nötig zu zahlen, um die Menschen zu motivieren, nicht nur das Nötigste zu tun. Er sieht, dass Fabrikarbeit stumpfsinnig machen kann – und damit der Moral ebenfalls nicht förderlich ist. Er empfiehlt daher eine staatlich geförderte Volksbildung. Smith hat wenige Illusionen über die Nachteile einer reinen Marktwirtschaft. Von den Alternativen (Zunftwesen und Merkantilismus) hält er aber noch deutlich weniger.
Einen Klassiker zeichnet es aus, dass seine Fragen und Thesen über die Zeit aktuell bleiben. Protektionismus und Merkantilismus kosten Wohlstand. Wachstum entsteht in der privaten Wirtschaft und staatliche Eingriffe sind mit großer Vorsicht zu betrachten. Gewinne sind eine gute Sache und allen zu gönnen, die sie in einem freien und fairen Wettbewerb erzielen. In die Verteilung greift der Staat am besten nur ein, indem er dafür sorgt, dass seine Bürger gut ausgebildet sind und sich selber helfen können. Moral und Rechtssicherheit sind Voraussetzungen, ohne die ein Markt nicht langfristig funktionieren kann.
All diese Thesen sind bis heute unbequem und umstritten. Aber, so würde Smith heute sagen, wie könnte es auf einem freien Marktplatz der Argumente und Überzeugungen auch anders sein?
Adam Smith hat viele Jahre am ›Wohlstand der Nationen‹ geschrieben, aber wenig Zeit für Kürzungen aufgewendet. Viele Passagen haben heute nur noch historischen Wert, etwa die Ausführungen zum Silberhandel. Wir haben daher gestrichen, was heute nur noch für den Spezialisten interessant ist, der sowieso das englische Original zur Hand nehmen wird.
In der vorliegenden Ausgabe haben wir, um einen Überblick zu geben, das vollständige Inhaltsverzeichnis abgedruckt. Kapitel, die wir weggelassen haben, sind dabei grau gedruckt und ohne Seitenzahlen.
ADAM SMITHDER WOHLSTAND DER NATIONEN
Inhaltsverzeichnis ›Der Wohlstand der Nationen‹
[Für diese Ausgabe gestrichene Kapitel sind kursiv gesetzt.]
Adam Smiths Vorbemerkungen zur dritten und vierten Auflage
Einführung und Plan des Werkes
Erstes Buch
Was die produktiven Kräfte der Arbeit verbessert und nach welcher natürlichen Ordnung sich ihr Ertrag auf die einzelnen Schichten der Bevölkerung verteilt
1. Kapitel Die Arbeitsteilung
2. Kapitel Das Prinzip, das der Arbeitsteilung zugrunde liegt
3. Kapitel Die Größe des Marktes – eine Grenze für die Arbeitsteilung
4. Kapitel Ursprung und Gebrauch des Geldes
5. Kapitel Der Real- und Nominalpreis der Güter oder ihr Arbeits- und ihr Geldwert
6. Kapitel Die Bestandteile der Güterpreise
7. Kapitel Der natürliche Preis und der Marktpreis der Güter
8. Kapitel Der Lohn der Arbeit
9. Kapitel Der Kapitalgewinn
10. Kapitel Lohn und Gewinn bei verschiedener Verwendung der Arbeit und des Kapitals
1. Teil Ungleichheiten, die sich aus der Art der Verwendung selbst herleiten
2. Teil Ungleichheiten, die ihren Grund in der Wirtschaftspolitik in Europa haben
11. Kapitel Die Bodenrente
1. Teil Bodenprodukte, die immer eine Rente abwerfen
2. Teil Bodenprodukte, die zuweilen eine Rente abwerfen, mitunter nicht
3. Teil Veränderungen im Wertverhältnis zwischen einem Ertrag, der stets und einem solchen, der nur bisweilen eine Rente abwirft
Schwankungen im Wert des Silbers während der letzten vier Jahrhunderte – Ein Exkurs
Erste Periode · Zweite Periode · Dritte Periode
Veränderungen im Verhältnis zwischen dem Wert des Goldes und dem des Silbers
Gründe für die Vermutung, daß der Wert des Silbers weiterhin fallen wird
Unterschiedliche Folgen des wirtschaftlichen Fortschritts für den Realpreis dreier Arten von Rohprodukten
Erste Gruppe · Zweite Gruppe · Dritte Gruppe
Abschluß des Exkurses über die Veränderungen des Silberwertes
Der Einfluß des wirtschaftlichen Fortschritts auf den Realpreis gewerblicher Erzeugnisse
Schluß des Kapitels
Zweites Buch
Natur, Ansammlung und Einsatz des Kapitals
Einleitung
1. Kapitel Die Zusammensetzung des Kapitalbestandes
2. Kapitel Geld als ein besonderer Bestandteil der Kapitalanlagen eines Landes oder der Aufwand zur Erhaltung des Volksvermögens
3. Kapitel Bildung von Kapital oder produktive und unproduktive Arbeit
4. Kapitel Kapitalverleih gegen Zins
5. Kapitel Verschiedene Verwendung der Kapitalien
Drittes Buch
Die unterschiedliche Zunahme des Wohlstands in einzelnen Ländern
1. Kapitel Das natürliche Wachstum des Wohlstandes
2. Kapitel Die Behinderung der Landwirtschaft im alten Europa nach dem Untergang des Römischen Reiches
3. Kapitel Gründung und Wachstum der Städte nach dem Untergang des Römischen Reiches
4. Kapitel Wie der Handel der Städte zur Entwicklung des Landes beigetragen hat
Viertes Buch
Systeme der Politischen Ökonomie
Einleitung
1. Kapitel Grundsätze des Handels- oder Merkantilsystems
2. Kapitel Einfuhrbeschränkungen für ausländische Güter, die im Lande selbst hergestellt werden können
3. Kapitel Außerordentliche Einfuhrbeschränkungen für fast alle Güter aus Ländern, gegenüber denen die Handelsbilanz angeblich nachteilig ist
1. Teil Die Unvernunft hinter solchen Beschränkungen – selbst nach den Grundsätzen des Merkantilismus
Exkurs über Depositenbanken, namentlich die von Amsterdam
2. Teil Die Unvernunft solch außerordentlicher Beschränkungen, die mit Hilfe anderer Prinzipien begründet werden
4. Kapitel Rückvergütungen
5. Kapitel Prämien
Exkurs über den Getreidehandel und die Getreidegesetze
6. Kapitel Handelsverträge
7. Kapitel Kolonien
1. Teil Motive für die Gründung neuer Kolonien
2. Teil Ursachen für das Gedeihen neuer Kolonien
3. Teil Vorteile, die Europa aus der Entdeckung Amerikas und der Passage um das Kap der Guten Hoffnung nach Ostindien gezogen hat
8. Kapitel Schlußbemerkungen zum Merkantilismus
9. Kapitel Agrarsysteme oder solche Systeme der Politischen Ökonomie, die im Bodenertrag die einzige oder die Hauptquelle für Einkommen und Wohlstand eines Landes sehen
Fünftes Buch
Die Finanzen des Landesherrn oder des Staates
1. Kapitel Die öffentlichen Ausgaben
1. Teil Ausgaben für die Landesverteidigung
2. Teil Ausgaben für das Justizwesen
3. Teil Ausgaben für öffentliche Anlagen und Einrichtungen
1. Abschnitt: Öffentliche Anlagen und Einrichtungen zur Erleichterung von Handel und Verkehr in einem Lande
1. Solche, die ganz allgemein hierzu erforderlich sind
2. Öffentliche Einrichtungen und Anlagen, die zur Erleichterung des Handels in einzelnen Zweigen notwendig sind
2. Abschnitt: Ausgaben der Bildungseinrichtungen für die Jugend
3. Abschnitt: Ausgaben der Bildungseinrichtungen für Menschen jeden Alters
4. Teil Ausgaben für Repräsentation des Staatsoberhauptes
Schluß des Kapitels
2. Kapitel Die Quellen der allgemeinen oder öffentlichen Einnahmen eines Landes
1. Teil Herkunft oder Quellen der Einkünfte, die ausschließlich dem Landesherrn oder dem Gemeinwesen gehören können
2. Teil Steuern
1. Abschnitt: Steuern auf Renten und Grundrenten
Steuern, die nach dem Bodenertrag anstatt nach der Rente bemessen werden
Steuern auf die Rente von Häusern
2. Abschnitt: Steuern auf Gewinn oder auf Einkommen (revenue) aus Vermögen
Steuern auf Gewinn in einzelnen Erwerbszweigen
Anhang zum 1. und 2. Abschnitt – Steuern auf den Kapitalwert von Grundbesitz, Häusern und Vermögen
3. Abschnitt: Steuern auf Arbeitslohn
4. Abschnitt: Steuern, die mit Absicht jede Art Einkommen (revenue) unterschiedslos belasten sollen
Kopfsteuern
Steuern auf Verbrauchsgütern
3. Kapitel Staatsschulden
Einführung und Plan des Werkes
Die jährliche Arbeit eines Volkes ist die Quelle, aus der es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird, die es im Jahr über verbraucht. Sie bestehen stets entweder aus dem Ertrag dieser Arbeit oder aus dem, was damit von anderen Ländern gekauft wird.
Ein Volk ist daher um so schlechter oder besser mit allen Gütern, die es braucht, versorgt, je mehr oder weniger Menschen sich den Ertrag der Arbeit oder das, was sie im Austausch dafür erhalten, teilen müssen.
Zwei Faktoren bestimmen nun in jedem Land diese Pro-Kopf-Versorgung: Erstens die Produktivität der Arbeit als Ergebnis von Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung, und zweitens das Verhältnis der produktiv Erwerbstätigen zur übrigen Bevölkerung. Von beiden Umständen muß es jeweils abhängen, ob in einem Land das Warenangebot im Jahr über reichlich oder knapp ausfällt, gleichgültig, wie groß ein Land ist oder welchen Boden und welches Klima es hat.
Überfluß oder Mangel an Gütern dürfte vorwiegend von der Produktivität der Arbeit abhängen. In primitiven Völkern ist jeder Arbeitsfähige zumeist als Jäger oder Fischer mehr oder weniger nützlich tätig. Er ist dabei bestrebt, so gut er kann, sich selbst und die Angehörigen der Familie und des Stammes zu versorgen, die für Jagd und Fischfang schon zu alt, noch zu jung oder zu schwach sind. Solche Völker leben jedoch in so großer Armut, daß sie häufig aus schierer Not gezwungen sind oder es zumindest für notwendig erachten, Kinder, Alte und Sieche bedenkenlos umzubringen oder auszusetzen, so daß sie dann entweder verhungern müssen oder wilden Tieren zum Opfer fallen. In zivilisierten und wohlhabenden Gemeinwesen ist das Sozialprodukt hingegen so hoch, daß alle durchweg reichlich versorgt sind, obwohl ein großer Teil der Bevölkerung überhaupt nicht arbeitet und viele davon den Ertrag aus zehn-, häufig sogar hundertmal mehr Arbeit verbrauchen als die meisten Erwerbstätigen. Selbst ein Arbeiter der untersten und ärmsten Schicht, sofern er genügsam und fleißig ist, kann sich mehr zum Leben notwendige und angenehme Dinge leisten, als es irgendeinem Angehörigen eines primitiven Volkes möglich ist.
Die Ursachen dieser Verbesserung in den produktiven Kräften der Arbeit untersuche ich im ersten Buch, ebenso die Ordnung, nach der sich der Ertrag der Arbeit natürlicherweise auf die einzelnen Schichten und nach der sozialen Stellung der Menschen verteilt.
Wie entwickelt auch immer die Grundlagen der Arbeitsproduktivität sein mögen, jährliche Fülle oder Mangel an Waren muß auf jeder Entwicklungsstufe eines Volkes jeweils davon abhängen, wieviel Menschen im Jahr über nützlich und produktiv tätig sind und wieviele unproduktiv arbeiten. Wie sich später zeigen wird, entspricht überall die Zahl der produktiven Arbeitskräfte der Ausstattung an Kapital, das zu ihrer Beschäftigung eingesetzt wird, und außerdem der besonderen Art, wie das Kapital dabei verwendet wird. Das zweite Buch behandelt daher die Fragen, was der Kapitalstock eigentlich ist, wie er nach und nach wächst und wie sich seine unterschiedliche Verwendung auf das Angebot an Arbeitsplätzen auswirkt.
Völker, die es zu einiger Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung bei der Arbeit gebracht und sehr unterschiedliche Pläne und Ziele beim allgemeinen Einsatz oder der Lenkung der Arbeitskräfte verfolgt haben, hatten nicht immer den gleichen Erfolg, was die Höhe des Arbeitsertrages anlangt. In einigen Staaten förderte die Politik einseitig die Erwerbstätigkeit auf dem Lande, in anderen wiederum die in der Stadt. Kaum ein Staat hat die einzelnen Erwerbe gleich und unparteiisch behandelt. Seit dem Untergang des Römischen Reiches hat die Politik in Europa Handwerk, Gewerbe und Handel, also den Erwerbsfleiß in den Städten, mehr begünstigt als die Agrarwirtschaft, also den Haupterwerb auf dem Lande. Die Gründe, die zu dieser Politik geführt und sie auch durchgesetzt haben dürften, werden im dritten Buch erklärt.
Obwohl sich zu Anfang die verschiedenen Ziele der Politik wahrscheinlich aus privaten Interessen und Vorurteilen einzelner Bevölkerungsschichten hergeleitet haben, ohne daß die Folgen für die Wohlfahrt des Landes überhaupt bedacht oder vorhergesehen wurden, gaben sie doch Anstoß zu recht gegensätzlichen Theorien der Politischen Ökonomie, von denen einige die Bedeutung der städtischen, andere die Vorteile der ländlichen Gewerbe preisen. Diese Theorien haben in allen Ländern die Ansichten innerhalb der Wissenschaft ebenso stark beeinflußt wie die praktische Politik der Herrscher und Staatsmänner. Ich habe mich bemüht, die Theorien im vierten Buch so ausführlich und genau wie möglich zu erklären. Außerdem untersuche ich dort ihre hauptsächlichen Wirkungen in verschiedenen Epochen auf die einzelnen Völker.
In den ersten vier Büchern erkläre ich, worin das Einkommen der breiten Schicht eines Volkes besteht oder welches eigentlich die Quellen oder Fonds gewesen sind, aus denen die Güter stammen, die sie zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern Jahr um Jahr konsumiert hat. Das fünfte und letzte Buch handelt von den Finanzen des Souveräns oder des Staates. Hier habe ich mich, erstens, zu zeigen bemüht, welche öffentlichen Ausgaben notwendig sind, zu welchen Ausgaben die Allgemeinheit beisteuern soll und für welche lediglich eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft oder einzelne ihrer Mitglieder aufkommen sollen. Zweitens untersuche ich dort die verschiedenen Methoden, mit denen man die Staatsausgaben, für welche die Allgemeinheit aufkommen muß, finanzieren kann, wobei ich auch auf deren hauptsächlichen Vorteile und Nachteile eingehe. Schließlich befasse ich mich, drittens, mit der Frage, warum fast alle modernen Regierungen einen Teil ihrer Einnahmen verpfänden oder Schulden machen mußten. Außerdem erkläre ich, wie die Staatschulden auf den wirklichen Wohlstand, nämlich den jährlichen Ertrag aus Boden und Arbeit eines Landes, eingewirkt haben.
Erstes BuchWas die produktiven Kräfte der Arbeit verbessert und nach welcher natürlichen Ordnung sich ihr Ertrag auf die einzelnen Schichten der Bevölkerung verteilt
Erstes KapitelDie Arbeitsteilung
Die Arbeitsteilung dürfte die produktiven Kräfte der Arbeit mehr als alles andere fördern und verbessern. Das gleiche gilt wohl für die Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung, mit der sie überall eingesetzt oder verrichtet wird.
Man kann den Einfluß der Arbeitsteilung auf die gesamte Volkswirtschaft leichter verstehen, wenn man sich zunächst klarmacht, auf welche Weise sie in einzelnen Erwerbszweigen durchgeführt wird. Es hat gewöhnlich den Anschein, als sei sie in einigen unbedeutenden Gewerben am weitesten entwickelt, doch sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn in solchen Gewerben, die nur den bescheidenen Bedarf eines kleinen Kundenkreises zu decken haben und folglich nur eine begrenzte Anzahl Arbeitskräfte beschäftigen, können diese häufig in einer einzigen Werkstatt untergebracht werden. So fällt es dem Betrachter sofort auf, daß sie verschiedene Arbeiten verrichten. Anders ist es in den großen Gewerbezweigen, die für den Massenbedarf der Bevölkerung produzieren. Hier benötigt man für jeden einzelnen Arbeitsgang so viele Menschen, daß man sie unmöglich alle in derselben Werkstatt einsetzen kann. Wir sehen daher im allgemeinen nicht mehr als eine einzige Abteilung des Betriebes. Tatsächlich mag aber die Arbeitsteilung hier verzweigter sein als in unbedeutenden Gewerben, was allzu leicht übersehen wird, da sie auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist.
Wir wollen daher als Beispiel die Herstellung von Stecknadeln wählen, ein recht unscheinbares Gewerbe, das aber schon häufig zur Erklärung der Arbeitsteilung diente. Ein Arbeiter, der noch niemals Stecknadeln gemacht hat und auch nicht dazu angelernt ist (erst die Arbeitsteilung hat daraus ein selbständiges Gewerbe gemacht), so daß er auch mit den dazu eingesetzten Maschinen nicht vertraut ist (auch zu deren Erfindung hat die Arbeitsteilung vermutlich Anlaß gegeben), könnte, selbst wenn er sehr fleißig ist, täglich höchstens eine, sicherlich aber keine zwanzig Nadeln herstellen. Aber so, wie die Herstellung von Stecknadeln heute betrieben wird, ist sie nicht nur als Ganzes ein selbständiges Gewerbe. Sie zerfällt vielmehr in eine Reihe getrennter Arbeitsgänge, die zumeist zur fachlichen Spezialisierung geführt haben. Der eine Arbeiter zieht den Draht, der andere streckt ihn, ein dritter schneidet ihn, ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift das obere Ende, damit der Kopf aufgesetzt werden kann. Auch die Herstellung des Kopfes erfordert zwei oder drei getrennte Arbeitsgänge. Das Ansetzen des Kopfes ist eine eigene Tätigkeit, ebenso das Weißglühen der Nadel, ja, selbst das Verpacken der Nadeln ist eine Arbeit für sich. Um eine Stecknadel anzufertigen, sind somit etwa 18 verschiedene Arbeitsgänge notwendig, die in einigen Fabriken jeweils verschiedene Arbeiter besorgen, während in anderen ein einzelner zwei oder drei davon ausführt. Ich selbst habe eine kleine Manufaktur dieser Art gesehen, in der nur 10 Leute beschäftigt waren, so daß einige von ihnen zwei oder drei solcher Arbeiten übernehmen mußten. Obwohl sie nun sehr arm und nur recht und schlecht mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet waren, konnten sie zusammen am Tage doch etwa 12 Pfund Stecknadeln anfertigen, wenn sie sich einigermaßen anstrengten. Rechnet man für ein Pfund über 4000 Stecknadeln mittlerer Größe, so waren die 10 Arbeiter imstande, täglich etwa 48 000 Nadeln herzustellen, jeder also ungefähr 4800 Stück. Hätten sie indes alle einzeln und unabhängig voneinander gearbeitet, noch dazu ohne besondere Ausbildung, so hätte der einzelne gewiß nicht einmal 20, vielleicht sogar keine einzige Nadel am Tag zustande gebracht. Mit anderen Worten, sie hätten mit Sicherheit nicht den zweihundertvierzigsten, vielleicht nicht einmal den vierhundertachtzigsten Teil von dem produziert, was sie nunmehr infolge einer sinnvollen Teilung und Verknüpfung der einzelnen Arbeitsgänge zu erzeugen imstande waren.
In jedem anderen Handwerk und Gewerbe wirkt sich die Arbeitsteilung oder Spezialisierung ähnlich wie in diesem doch recht unbedeutenden Erwerbszweig aus, wenn auch in vielen von ihnen der gesamte Produktionsablauf nicht so stark zerlegt und auf einzelne Verrichtungen zurückgeführt werden kann. Sobald aber die Teilung der Arbeit in einem Gewerbe möglich ist, führt sie zu einer entsprechenden Steigerung ihrer Produktivität. In diesem Vorteil dürfte der Grund zu suchen sein, daß es überhaupt zu verschiedenen Gewerben und Berufen kam. Auch ist die Spezialisierung gewöhnlich in Ländern am weitesten fortgeschritten, die wirtschaftlich am höchsten entwickelt sind. Was in einem primitiven Volk ein einzelner an Arbeit leistet, verrichten in einer zivilisierten Gesellschaft zumeist mehrere. So ist in einer entwickelten Nation der Bauer in der Regel nur Bauer, der Handwerker gewöhnlich nichts anderes als Handwerker. Auch die Arbeit, die zur Fertigung irgendeines Werkstückes notwendig ist, teilen sich durchweg viele. Wie viele verschiedene Berufe gibt es allein in den einzelnen Zweigen des Leinen- und Wollgewerbes, angefangen mit den Erzeugern von Flachs und Wolle bis hin zu den Bleichern und Glättern des Leinens oder den Färbern und Tuchmachern! Die Eigenart der Landwirtschaft läßt indes eine so weitgehende Spezialisierung wie im Gewerbe nicht zu, auch nicht eine solch scharfe Abgrenzung der einzelnen Tätigkeiten gegeneinander. So ist es einfach unmöglich, die Viehzucht so eindeutig vom Getreideanbau zu trennen, wie das zwischen dem Gewerbe eines Zimmermanns und dem eines Schmiedes der Fall ist. Der Spinner und der Weber sind durchweg zwei Personen, dagegen pflügt, eggt, sät und erntet häufig ein und dieselbe Arbeitskraft. Da alle diese Arbeiten zu verschiedenen Jahreszeiten anfallen, könnte eine einzelne Person unmöglich fortwährend nur mit einer davon beschäftigt sein. Der Grund, warum die Produktivität der Arbeit in der Landwirtschaft nicht immer mit der im Gewerbe Schritt hält, dürfte in der Tat darin zu suchen sein, daß es unmöglich ist, die verschiedenen Arbeiten und Tätigkeiten nach Berufen streng und vollständig voneinander zu trennen. Die reichsten Nationen sind zwar allen ihren Nachbarn gewöhnlich auf beiden Gebieten, in der Landwirtschaft wie im Gewerbe, überlegen, doch ist ihr Vorsprung in der Agrarwirtschaft durchweg geringer als in den übrigen Erwerbszweigen. Ihr Boden wird in der Regel besser kultiviert und wirft, bezogen auf Fläche und natürliche Fruchtbarkeit, mehr ab, da mehr Arbeitskräfte und Kapital eingesetzt werden. Doch übersteigt dieser Mehrertrag den Mehraufwand an Arbeit und Kapital selten um ein beträchtliches. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist mithin in reichen Ländern nicht immer wesentlich produktiver als die in armen, zumindest ist sie niemals um so viel höher als es, vergleichsweise, durchschnittlich im Gewerbe der Fall ist. Deshalb wird auch das Getreide eines wohlhabenden Landes nicht unbedingt billiger auf den Markt kommen als gleich gutes des armen. So kostet polnisches Getreide ebensoviel wie französisches gleicher Qualität, obwohl Frankreich reicher und höher entwickelt ist. Getreide aus den französischen Anbaugebieten ist wiederum mindestens ebenso gut wie englisches und in den meisten Jahren genauso teuer, obgleich Frankreich ärmer und wirtschaftlich weniger entwickelt sein mag. Und dennoch sind die englischen Getreidefelder besser als die französischen bestellt, und der französische Anbau soll wiederum besser als der polnische betrieben werden. Ein armes Land kann also durchaus trotz unterlegener Bodenkultur mit dem reichen in Preis und Qualität seines Getreides bis zu einem gewissen Grade konkurrieren, sein Gewerbe jedoch kann einen solchen Wettbewerb nicht durchstehen, am wenigsten dann, wenn Boden, Klima und Lage des reichen Landes für solche Gewerbe geeignet sind. So sind französische Seiden besser und billiger als englische, da dort das Klima für die Seidenverarbeitung günstiger als in England ist, zumindest bei den gegenwärtig hohen Einfuhrzöllen für Rohseide. Dagegen sind englische Eisen- und Metallwaren und grobe Wollstoffe unvergleichlich besser als französische und bei gleicher Qualität noch dazu weit billiger. In Polen, so wird behauptet, soll es kaum ein nennenswertes Gewerbe geben, wenn man von wenigen Manufakturen absieht, die einfache Haushaltsgeräte herstellen, auf die ein Land nicht gut verzichten kann.
Die enorme Steigerung der Arbeit, die die gleiche Anzahl Menschen nunmehr infolge der Arbeitsteilung zu leisten vermag, hängt von drei verschiedenen Faktoren ab: (1) der größeren Geschicklichkeit jedes einzelnen Arbeiters, (2) der Ersparnis an Zeit, die gewöhnlich beim Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen verlorengeht und (3) der Erfindung einer Reihe von Maschinen, welche die Arbeit erleichtern, die Arbeitszeit verkürzen und den einzelnen in den Stand setzen, die Arbeit vieler zu leisten.
(1) Aufgrund der größeren Geschicklichkeit kann der einzelne natürlich erheblich mehr leisten, und umgekehrt steigert die Arbeitsteilung zwangsläufig auch die Geschicklichkeit oder Handfertigkeit des Arbeiters beträchtlich, da sie jede Tätigkeit, die ein Arbeiter sein ganzes Leben lang ausübt, auf einen einfachen Arbeitsgang zurückführt. Ein gewöhnlicher Schmied, der zwar mit dem Hammer umzugehen versteht, aber nicht gewohnt ist, Nägel anzufertigen, wird kaum imstande sein, wie man mir versichert, mehr als zwei- oder dreihundert Nägel am Tage herzustellen und noch dazu recht schlechte, wenn er aus besonderem Anlaß dazu gezwungen ist. Ein anderer Schmied, der zwar hin und wieder Nägel macht, aber kein ausgesprochener Nagelschmied ist, kann, selbst bei größter Anstrengung, selten mehr als 800 bis 1000 Stück am Tage herstellen. Ich habe nun selbst gesehen, daß von noch nicht zwanzigjährigen Burschen, die nie etwas anderes getan hatten als Nägel zu schmieden, jeder einzelne über 2300 Stück täglich herstellen konnte, wenn er sich demnach anstrengte. Dabei ist das Schmieden von Nägeln keineswegs eine sehr einfache Arbeit. Ein und derselbe Arbeiter bedient nämlich den Blasebalg, reguliert nach Bedarf das Feuer, erhitzt das Eisen bis es glüht und schmiedet die einzelnen Teile des Nagels. Zum Formen des Kopfes muß er außerdem auch noch das Werkzeug wechseln. Im Vergleich dazu sind die einzelnen Arbeitsgänge, in welche sich die Anfertigung einer Nadel oder eines Metallknopfes aufteilen läßt, allesamt viel einfacher, und die Handfertigkeit eines Menschen, der zeitlebens nur diese Tätigkeit ausgeführt hat, ist gewöhnlich entsprechend größer. Die Geschwindigkeit, mit der Arbeiter in solchen Manufakturen die einzelnen Handgriffe durchführen, übertrifft alles, was man menschlicher Fertigkeit zutraut, bevor man dies nicht selbst gesehen hat.
(2) Die Ersparnis an Zeit, die sonst beim Wechsel von einer Tätigkeit zu einer anderen verlorengeht, ist viel größer, als wir auf den ersten Blick annehmen möchten. Man kann sich nämlich nicht sehr schnell von einer Arbeit auf eine andere umstellen, die noch dazu an einem anderen Platz und mit ganz anderen Werkzeugen ausgeführt wird. So muß ein Weber auf dem Land, der gleichzeitig eine kleine Landwirtschaft betreibt, eine Menge Zeit vertun, um von seinem Webstuhl aufs Feld und von dort zurück zum Webstuhl zu gelangen. Der Verlust an Zeit wäre zweifellos wesentlich geringer, wenn beide Tätigkeiten in der gleichen Werkstatt durchgeführt werden könnten, trotzdem ist er selbst dann noch erheblich. Gewöhnlich trödelt man ein wenig beim Übergang von einer Arbeit zur anderen, zudem beginnt man eine neue Tätigkeit kaum mit großer Lust und Hingabe, ist noch nicht ganz bei der Sache, wie man zu sagen pflegt, und vertut einige Zeit mit Nebensächlichem, anstatt ernsthaft zu arbeiten. Die Gewohnheit, gemächlich und lässig-nachlässig seiner Arbeit nachzugehen, die der Arbeiter auf dem Lande, der alle halbe Stunde seine Tätigkeit und sein Handwerkszeug wechseln und zeitlebens zwanzigerlei Dinge im Laufe des Tages tun muß, unwillkürlich, ja zwangsläufig annehmen wird, läßt ihn vielfach träge, schwerfällig und sogar unfähig werden, sich wenigstens dann tatkräftig einzusetzen, wenn es dringend geboten wäre. Schon allein aus diesem Grunde, ganz unabhängig von seiner mangelnden Geschicklichkeit, muß seine Arbeitsleistung stets beträchtlich unter dem liegen, was er eigentlich zu leisten vermag.
(3) Es leuchtet ohne weiteres ein, wie sehr der Einsatz geeigneter Maschinen die Arbeit erleichtert und verkürzt, so daß ich auf Beispiele verzichten kann. Ich möchte lediglich bemerken, daß es vermutlich die Arbeitsteilung war, die den Anstoß zur Erfindung solcher Maschinen gab. Jemand, der ausschließlich mit einem einzelnen Gegenstand befaßt ist, wird wahrscheinlich eher einfachere und geeignetere Methoden entdecken, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, als wenn seine Aufmerksamkeit auf viele Dinge gerichtet ist. Als Folge der Arbeitsteilung konzentriert sich nun jeder ganz von selbst auf einen verhältnismäßig einfachen Gegenstand, weshalb man auch erwarten kann, daß der eine oder andere bei einer bestimmten Arbeit bessere Wege herausfinden sollte, die seine Tätigkeit erleichtern, wo immer dies möglich ist. Viele Maschinen, die in ausgesprochen arbeitsteiligen Gewerben verwendet werden, sind ursprünglich von einfachen Arbeitern erfunden worden. Da sie ständig die gleichen Handgriffe ausführen mußten, suchten sie ganz von selbst nach Methoden, wie sie ihre Tätigkeit vereinfachen und erleichtern könnten. Wer des öfteren solche Manufakturen besucht hat, dem wurden sicherlich häufig imponierende Maschinen gezeigt, die Arbeiter in der Absicht erfunden haben, den eigenen Beitrag zum Werkstück leichter und schneller zu leisten. So war bei den ersten Dampfmaschinen ein Junge dauernd damit beschäftigt, den Durchlaß vom Kessel zum Zylinder abwechselnd zu öffnen und zu schließen, wenn der Kolben herauf- oder herunterging. Einer dieser Jungen, der lieber mit den anderen spielen wollte, beobachtete dabei folgendes: Verbindet er den Griff des Ventils, das die Verbindung öffnet, durch eine Schnur mit einem anderen Teil der Maschine, so öffnet und schließt sich das Ventil von selbst, und es bleibt ihm dadurch Zeit, mit seinen Freunden zu spielen. Auf diese Weise entdeckte ein Junge, der sich Arbeit sparen wollte, eine der bedeutendsten Verbesserungen an der Dampfmaschine seit ihrer Erfindung.
Natürlich haben keineswegs nur Arbeiter Maschinen verbessern und weiterentwickeln helfen, die sie bedient haben. In vielen Fällen verdanken wir den technischen Fortschritt der Erfindergabe der Maschinenbauer, nachdem der Maschinenbau ein selbständiges Gewerbe geworden war. Andere Entdeckungen machten sogenannte Philosophen oder Theoretiker, deren Aufgabe es weniger ist, die Dinge zu verändern als sie zu beobachten. Sie sind aufgrund ihrer Spekulationen häufig imstande, Phänomene, die sehr verschieden sind und wenig Bezug zueinander haben, sinnvoll zu verknüpfen. Mit der Entwicklung einer Gesellschaft werden auch Wissenschaft und Forschung, wie jede andere Beschäftigung, zum Hauptberuf oder zur ausschließlichen Tätigkeit einer bestimmten Schicht von Bürgern. Wie jede andere Beschäftigung, so spaltet sich auch die Wissenschaft in verschiedene Zweige. Auf diese Weise entstehen Spezialisten für die einzelnen Wissens- und Forschungsgebiete. Und wie in allen Berufen fördert die Arbeitsteilung auch hier die Fertigkeit und erspart Zeit. Jeder sammelt Erfahrung und wird Fachmann in seiner Disziplin, alles in allem wird mehr geleistet, und der Wissensstand wächst beträchtlich.
Und dieses ungeheure Anwachsen der Produktion in allen Gewerben, als Folge der Arbeitsteilung, führt in einem gut regierten Staat zu allgemeinem Wohlstand, der selbst in den untersten Schichten der Bevölkerung spürbar wird. Wer arbeitet, verfügt über ein Leistungspotential, das größer ist als das, welches er zum eigenen Leben benötigt, und da alle anderen in genau der gleichen Lage sind, kann er einen großen Teil der eigenen Arbeitsleistung gegen eine ebenso große Menge Güter der anderen oder, was auf das gleiche hinauskommt, gegen den Preis dieser Güter eintauschen. Er versorgt die anderen reichlich mit dem, was sie brauchen, und erhält von ihnen ebenso reichlich, was er selbst benötigt, so daß sich von selbst allgemeiner Wohlstand in allen Schichten der Bevölkerung ausbreitet.
Man braucht sich nur die Ausstattung eines ganz gewöhnlichen Handwerkers oder Tagelöhners in einem entwickelten und aufstrebenden Land anzusehen, um sofort zu erkennen, daß die Zahl derer, die an seiner Versorgung beteiligt sind, wie klein auch immer ihr Beitrag sein mag, alle Schätzungen übertrifft. So ist die Wolljacke, die der Tagelöhner trägt, so grob und derb sie auch aussehen mag, das Werk der Arbeit vieler. Der Schäfer, der Wollsortierer, der Wollkämmer oder Krempler, der Färber, der Hechler, der Spinner, der Weber, der Walker, der Zuschneider und viele andere mußten zusammenwirken, um auch nur dieses anspruchslose Produkt zuwege zu bringen. Wie viele Kaufleute und Fuhrleute waren außerdem mit dem Transport des Materials von dem einen Handwerker zum anderen beschäftigt, der häufig weit entfernt lebt! Wieviel Handel und namentlich wieviel Schiffahrt, wie viele Schiffsbauer, Seeleute, Segelmacher und Seiler mußten eingesetzt werden, damit der Färber seine verschiedenen Rohstoffe bekommt, die oft aus den entlegensten Ländern der Welt stammen! Wievielerlei Arbeiten sind außerdem nötig, um das Werkzeug für das einfachste dieser Handwerke herzustellen, von so komplizierten Maschinen wie einem Schiff, einer Walkmühle oder selbst einem Webstuhl ganz zu schweigen! Bedenken wir nur, welch vielfältige Arbeiten erforderlich sind, um ein so gewöhnliches Werkzeug wie die Schere des Schäfers anzufertigen. Der Bergmann, der Erbauer des Schmelzofens für das Erz, der Holzverkäufer, der Köhler, der die Holzkohle für die Schmelzhütte brennt, der Ziegelbrenner, der Maurer, die Arbeiter, die den Ofen bedienen, der Metallwalzer, der Grobschmied und der Feinschmied, sie alle müssen zusammenwirken, um die Schere des Schäfers zustande zu bringen. Wir könnten ähnliche Überlegungen auch für andere Kleidungsstücke und Haushaltsgeräte unseres Tagelöhners anstellen: Sein grobes Leinenhemd, das er auf dem Leib trägt, die Schuhe an seinen Füßen, das Bett, in das er sich legt und das aus vielen Teilen besteht, der Herd in der Küche, auf dem er sein Essen zubereitet; die Kohlen, die er dazu verwendet, stammen aus dem Innern der Erde und erreichen ihn vielleicht erst nach einem langen Transport mit Schiff oder Wagen. Zu denken ist auch an alle Küchengeräte, den Tisch, die Messer und Gabeln, die irdenen Teller oder das Geschirr aus Zinn, auf denen er seine Speisen aufträgt und zerteilt, ferner an alle, die mitgearbeitet haben, um sein Brot zu backen und sein Bier zu brauen. Wieviel Kenntnis und Fertigkeit waren nötig, um das Glasfenster herzustellen, das Wärme und Licht einläßt und Regen und Wind abhält und ohne das man in den nördlichen Breitengraden kaum angenehm und behaglich wohnen könnte, nicht zu vergessen die Werkzeuge, mit denen alle ausgestattet sind, die diese angenehmen Dinge des Lebens hergestellt haben. Wenn wir uns alle diese Gegenstände vor Augen halten und bedenken, welch eine Vielfalt von Arbeit auf jeden einzelnen von ihnen verwandt ist, wird uns bewußt, daß ohne Mithilfe und Zusammenwirken Tausender von Menschen in einem zivilisierten Land nicht einmal der allereinfachste Mann selbst mit jenen Gütern versorgt werden könnte, die wir gewöhnlich, fälschlicherweise, grob und anspruchslos nennen. Natürlich muß sein Besitz äußerst bescheiden und ärmlich anmuten, vergleicht man ihn mit dem überfeinerten Luxus der Reichen. Doch sollte man bedenken, daß die Lebenshaltung eines Fürsten in Europa sich von der eines fleißigen und genügsamen Bauern vielleicht weniger unterscheidet, als die des letzteren von der manches Herrschers in Afrika, der uneingeschränkt über Leben und Freiheit von zehntausend nackten Wilden gebietet.
Zweites KapitelDas Prinzip, das der Arbeitsteilung zugrunde liegt
Die Arbeitsteilung, die so viele Vorteile mit sich bringt, ist in ihrem Ursprung nicht etwa das Ergebnis menschlicher Erkenntnis, welche den allgemeinen Wohlstand, zu dem erstere führt, voraussieht und anstrebt. Sie entsteht vielmehr zwangsläufig, wenn auch langsam und schrittweise, aus einer natürlichen Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen.
Ob es sich bei dieser Neigung um eine jener angeborenen oder ursprünglichen Eigenschaften der menschlichen Natur handelt, die nicht weiter erklärt werden kann, oder ob sie, was wohl wahrscheinlicher sein dürfte, die notwendige Folge der menschlichen Fähigkeit, denken und sprechen zu können, ist, diese Frage wollen wir hier nicht näher untersuchen. Jene Eigenschaft ist allen Menschen gemeinsam, und man findet sie nirgends in der Tierwelt, wo es im übrigen weder einen Austausch noch eine andere Form gegenseitigen Übereinkommens zu geben scheint. Gelegentlich erwecken zwei Windhunde, die gemeinsam einen Hasen jagen, den Eindruck, als ob sie sich in einer Art von Übereinkunft das Wild gegenseitig zutrieben. Ein solches Verhalten beruht indes nicht auf irgendeiner Vereinbarung, sondern entspringt den zufällig zur selben Zeit auf dasselbe Objekt gerichteten Instinkten. Niemand hat je erlebt, daß ein Hund mit einem anderen einen Knochen redlich und mit Bedacht gegen einen anderen Knochen ausgetauscht hätte, und niemand hat auch je beobachtet, daß ein Tier durch sein Verhalten einem anderen bedeutet hätte: Das gehört mir und das gehört dir, ich bin bereit, dieses für jenes zu geben. Will ein Tier von einem Menschen oder einem anderen Tier irgend etwas haben, so kennt es kein anderes Mittel, als die Gunst dessen zu gewinnen, von dem es etwas möchte. So umschmeichelt ein junger Hund seine Mutter, und ein Spaniel versucht alles, um die Aufmerksamkeit seines Herrn, der beim Essen ist, auf sich zu ziehen, damit für ihn ein Bissen abfällt. Der Mensch verhält sich gelegentlich ebenso. Erreicht er auf andere Weise sein Ziel nicht, versucht er, die Gunst des Mitmenschen durch Unterwürfigkeit und Schmeichelei zu erlangen. Ein solcher Weg ist allerdings recht zeitraubend und deshalb auch nicht immer gangbar. In einer zivilisierten Gesellschaft ist der Mensch ständig und in hohem Maße auf die Mitarbeit und Hilfe anderer angewiesen, doch reicht sein ganzes Leben gerade aus, um die Freundschaft des einen oder anderen zu gewinnen. Fast jedes Tier ist völlig unabhängig und selbständig, sobald es ausgewachsen ist, und braucht in seiner natürlichen Umgebung nicht mehr die Unterstützung anderer. Dagegen ist der Mensch fast immer auf Hilfe angewiesen, wobei er jedoch kaum erwarten kann, daß er sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, daß es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht. Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor: Gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes, und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. Niemand möchte weitgehend vom Wohlwollen seiner Mitmenschen abhängen, außer einem Bettler, und selbst der verläßt sich nicht allein darauf. Mildtätige Menschen geben ihm zwar, was er zum Leben unbedingt benötigt, doch weder wollen noch können sie ihn mit allem unmittelbar versorgen, was er gerade braucht. Auch ein Bettler deckt seinen gelegentlichen Bedarf überwiegend wie alle anderen Menschen, nämlich durch Verhandeln, Tausch und Kauf. Mit dem erbettelten Geld kauft er sich etwas zum Essen, geschenkte, alte Kleider tauscht er gegen andere, die ihm besser passen, gegen eine Unterkunft, Essen oder Geld, mit dem er wiederum Lebensmittel, Kleidung oder eine Schlafstätte, je nach Bedarf, kaufen kann.
Wie das Verhandeln, Tauschen und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen Diensten, die wir brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch den Anstoß zur Arbeitsteilung. Unter Jägern oder Hirten stellt beispielsweise ein Mitglied des Stammes besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen Gefährten gegen Vieh oder Wildbret ein, und er findet schließlich, daß er auf diese Weise mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinaus geht, um es zu jagen. Es liegt deshalb in seinem Interesse, daß er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur Hauptbeschäftigung macht und somit gleichsam zum Büchsenmacher wird. Ein anderer zeichnet sich beim Bau der Gestänge und Verkleidung der einfachen Hütten oder Zelte aus. Es wird allmählich für ihn zur Gewohnheit, seinen Nachbarn auf diese Weise zu nützen, die ihn dafür mit Vieh und Wildbret entlohnen, bis auch er schließlich findet, daß es im eigenen Interesse liegt, sich nur noch dieser Beschäftigung zu widmen, und er wird so etwas wie ein Zimmermann. Auf gleiche Art wird ein dritter Fein- oder Kupferschmied, ein vierter Gerber oder Zuschneider von Häuten oder Fellen, aus welchen die Bekleidung in primitiven Völkern hauptsächlich gefertigt ist. Sobald nun der Mensch sicher sein kann, daß er alle Dinge, die er weit über den Eigenbedarf hinaus durch eigene Arbeit herzustellen vermag, wiederum gegen überschüssige Produkte anderer, die er gerade benötigt, eintauschen kann, fühlt er sich ermutigt, sich auf eine bestimmte Tätigkeit zu spezialisieren, sie zu pflegen und zu vervollkommnen, je nach Talent oder Begabung.
Der Unterschied in den Begabungen der einzelnen Menschen ist in Wirklichkeit weit geringer, als uns bewußt ist, und die verschiedensten Talente, welche erwachsene Menschen unterschiedlicher Berufe auszuzeichnen scheinen, sind meist mehr Folge als Ursache der Arbeitsteilung. So scheint zum Beispiel die Verschiedenheit zwischen zwei auffallend unähnlichen Berufen, einem Philosophen und einem gewöhnlichen Lastenträger, weniger aus Veranlagung als aus Lebensweise, Gewohnheit und Erziehung entstanden. Bei ihrer Geburt und in den ersten sechs oder acht Lebensjahren waren sie sich vielleicht ziemlich ähnlich, und weder Eltern noch Spielgefährten dürften einen auffallenden Unterschied bemerkt haben. In diesem Alter etwa oder bald danach hat man begonnen, sie sehr verschieden auszubilden und zu beschäftigen. Nunmehr kommen die unterschiedlichen Talente zum Vorschein, prägen sich nach und nach aus, bis schließlich der Philosoph in seiner Überheblichkeit kaum noch eine Ähnlichkeit mit dem Lastenträger zugeben wird. Ohne die Neigung oder Anlage zum Tauschen und Handeln müßte also jeder selbst für alle Dinge sorgen, die er zum Leben und zu seiner Annehmlichkeit haben möchte. Alle würden die gleichen Pflichten zu erfüllen und die gleiche Arbeit zu leisten haben, und es gäbe keine unterschiedlichen Berufe und Tätigkeiten, die allein Gelegenheit bieten können, daß sich Talente so verschieden entfalten.
Jene menschliche Neigung zum Tausch prägt nicht nur die Vielfalt der Talente, die unter Menschen verschiedener Berufe so auffällt, sie macht diese Unterschiede auch nützlich und sinnvoll. Viele Tierarten, die man allgemein zur gleichen Gattung rechnet, unterscheiden sich von Natur aus nach Begabung weitaus stärker, als dies unter Menschen der Fall zu sein scheint, bevor Gewohnheit und Erziehung Einfluß auszuüben beginnen. Von Natur aus unterscheidet sich ein Philosoph in Begabung und Veranlagung nur halb so viel von einem Lastträger wie eine Bulldogge von einem Windhund oder ein Windhund von einem Spaniel oder ein Spaniel von einem Schäferhund. Diese verschiedenen Hunderassen sind einander kaum von Nutzen, obwohl sie alle zur gleichen Gattung gehören. Der Stärke der Bulldogge kommt weder die Schnelligkeit des Windhundes, noch der Spürsinn des Jagdhundes, noch die Gelehrigkeit des Schäferhundes zugute. Da ihnen die Fähigkeit oder Neigung zum Handeln und Tauschen fehlt, können Talente und Anlagen der verschiedenen Hunderassen sich weder gegenseitig ergänzen, noch im geringsten das Leben der Gattung verbessern helfen. Jedes Tier bleibt, allein und auf sich selbst gestellt, darauf angewiesen, sich am Leben zu erhalten und zu verteidigen, und es kann keinerlei Vorteile aus der Vielfalt der Talente ziehen, mit der die Natur seine Artgenossen ausgestattet hat. Im Gegensatz hierzu nützen unter Menschen die unterschiedlichsten Begabungen einander. Die weithin verbreitete Neigung zum Handeln und Tauschen erlaubt es ihnen, die Erträge jeglicher Begabung gleichsam zu einem gemeinsamen Fonds zu vereinen, von dem jeder nach seinem Bedarf das kaufen kann, was wiederum andere aufgrund ihres Talentes hergestellt haben.
Drittes KapitelDie Größe des Marktes – eine Grenze für die Arbeitsteilung
So, wie die Fähigkeit zum Tauschen Anlaß zur Arbeitsteilung ist, so muß das Ausmaß dieser Fähigkeit und damit die Marktgröße den Umfang der Arbeitsteilung begrenzen. Ist der Markt sehr klein, kann sich niemand ermutigt fühlen, sich ausschließlich einer Beschäftigung zu widmen, da er das, was er über den eigenen Bedarf hinaus herstellt, also den Überschuß seines Arbeitsertrages, nicht gegen die überschüssigen Erzeugnisse anderer, die er benötigt, eintauschen kann.
Es gibt nun einige Gewerbe, wozu sogar sehr einfache gehören, die man nur in einer großen Stadt ausüben kann. So kann ein Lastträger an keinem anderen Ort Beschäftigung und Auskommen finden. Ein Dorf ist für ihn ein zu enges Betätigungsfeld, und selbst ein gewöhnlicher Marktflecken ist kaum groß genug, um ihm ständig eine Beschäftigung zu bieten. Auf Einzelhöfen und in kleinen Dörfern, die verstreut in einer so verlassenen Gegend wie dem schottischen Hochland liegen, muß jeder Bauer zugleich sein eigener Metzger, Bäcker und Brauer sein. Man darf kaum erwarten, unter solchen Umständen selbst Schmiede, Zimmerleute und Maurer in einem Umkreis von weniger als zwanzig Meilen antreffen zu können. Die Familien leben weit verstreut, oft 8 bis 10