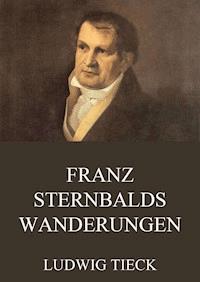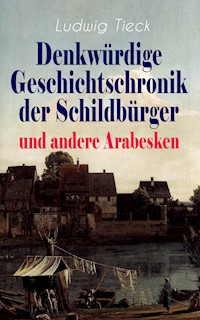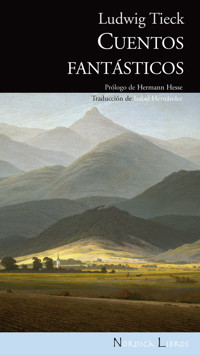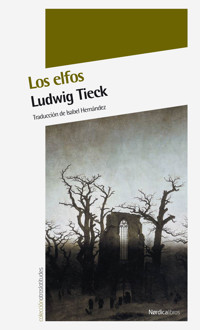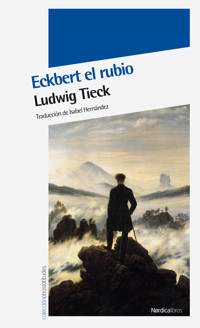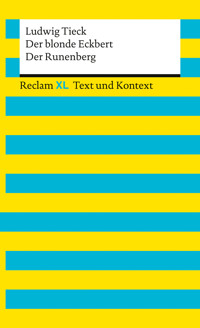Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seiner ältesten historischen Novelle vermittelt Tieck ein facettenreiches Bild der Stadt London im 16. Jahrhundert. Die beiden Dichter und Schriftsteller Marlowe und Greene führen ein vorwiegend unbeschwertes Künstlerleben, arbeiten an ihrem dichterischen Nachlass und halten auch sonst nicht viel von bürgerlichen Konventionen. Dafür verbreiten sie sich intensiv über Literatur und leben vom Zuwendungen ihrer Gönner und Auftraggeber, die vertröstet werden: "Die Musen sind nicht zu allen Zeiten willig." - Am Schuss der Novelle tritt ein Shakespeare auf, der als Schreiber für die beiden Dichtern tätig war und nunmehr sein eigenes Werk vorlegt. Erster und Zweiter Teil
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung des Herausgebers
Dichterleben
Dichterleben. Zweiter Theil.
Der Dichter und sein Freund. 1831.
Einleitung des Herausgebers
Es ist bekannt, daß unsern Dichter sein ganzes Leben hindurch der Plan beschäftigt hat, in einem großen umfassenden Werke seine durch die vielseitigsten Studien erlangten Urteile über Shakespeare und seine Zeit niederzulegen, und ebenso bekannt ist es, daß er niemals dazu gekommen ist, diesen Plan auszuführen. Nur einige Entwürfe und kurze Fragmente konnte Köpke aus des Dichters Nachlaß veröffentlichen, und bei Lebzeiten hat Tieck die Resultate seiner wissenschaftlichen und ästhetischen Beschäftigung mit dem großen Dramatiker in einzelnen Aufsätzen, Vorreden ec. nur sehr teilweise bekannt gemacht. In unsrer allgemeinen Einleitung ist näher ausgeführt, inwiefern Tieck, trotzdem er uns das verheißene Shakespeare-Werk schuldig geblieben, durch Wort und Schrift für ein besseres Verständnis des englischen Dichters in Deutschland gewirkt hat. Bei weitem das Schönste und Bleibendste aber, das seiner Liebe zu Shakespeare entquoll, ist nicht ein wissenschaftliches, sondern ein poetisches Werk, die Novelle, welche die nachfolgenden Blätter unsern Lesern darbieten. Das »Dichterleben«, dem 1824 zwei andre Novellen: »Die Gesellschaft auf dem Lande« und »Pietro von Abano«, vorausgingen, ist noch 1824 begonnen, und am 20. August des folgenden Jahres konnte der Verfasser seinem Freunde Karl Förster die vollendete Dichtung vorlesen.1 Sie erschien zuerst in »Urania, Taschenbuch auf das Jahr 1826«2. und ist bei Lebzeiten des Dichters noch dreimal gedruckt worden.3. Schon am 4. April 1809 hatte A. W. Schlegel, der auf Tieck wegen seiner Shakespeare-Kritik nicht ohne eine gewisse Eifersucht blicken mochte, dem Freunde geschrieben: »Auch über Shakespeare ... wolltest Du schreiben. Ich gestehe, ich bestellte mir von Dir lieber etwas als über etwas.«4. Sechzehn Jahre später kam Tieck diesem Wunsche gleichsam nach, indem er Shakespeare schrieb, nicht über Shakespeare, d. h. er faßte, wie Minor5. sagt, » dichterisch zusammen, was er kritisch in seinem Buche nicht loswerden konnte und auch später niemals mehr losgeworden ist. Was er in jener Rezension des Correggio6. verlangt: daß der Künstler in seiner ganzen Eigenart, wie er sich in seinen Werken zeige, erscheine – das hat er auf Grund der Ansichten, welche er sich eigentümlich und nicht frei von subjektiven Einflüssen über Shakespeare gebildet hatte, in großem Stile ausgeführt.
Und wie jenes kritische Werk auch das ganze Zeitalter der Elisabeth in demselben Lichte, in welchem er es einst dem Aufklärungszeitalter gegenübergestellt hatte, schildern sollte, so wird auch hier die Person des Dichters nicht isoliert, sondern auf dem breiten Hintergrund seines ganzen Zeitalters hingestellt.« Sehr richtig hatte der Dichter am 27. April 1818 an Solger7 geschrieben: »Shakespeare ist nur der Mittelpunkt des englischen Theaters und der neuen Kunst; kennt man nicht genau, was vor ihm war, so bleibt er ein Rätsel, und man schreibt ihm am leichtesten das zu, was er mit allen gemein hat; seine Zeit und Nachwelt muß man auch studieren, um erst vollständig überzeugt zu sein, wie er uns der Schlüssel unsrer Welt und aller unsrer Zustände ist. Leider bleibt er so vielen immer nur noch eine Rarität.« Diese Überzeugung Tiecks gibt uns die Erklärung an die Hand, warum in der ersten und besten seiner Shakespeare-Novellen der große Dichter selbst »gleichsam nur im Hintergrund vorübergeht«8, während im Vordergrund seine dichterischen Vorgänger und Mitstreber stehen: der geniale, aber maßlose Marlow und der weichliche, leichtsinnige und selbst-quälerische Green. Nur durch die Wirkung der Gegensätze konnte es ihm gelingen, »die innige Harmonie, die wahre Regel«, in welcher Shakespeare »uns ewig Muster bleiben« müsse, »diese tiefste Wahr-heit, die durch sich selbst Poesie« werde, die »große Vernunft, die den Shakespeare so himmlisch und echt human«9 mache, dem Leser zu deutlicher Empfindung zu bringen. Die herrliche, tief ergreifende Erzählung machte auf die poetisch fühlenden Zeitgenossen des Verfassers einen mächtigen Eindruck. »Hinreißend« nannte sie A. W. Schlegel10 und meinte, ins Englische übersetzt, müsse sie Furore machen; und viel später, als er mit Tieck nicht ohne Grund wegen dessen eigenmächtiger Behandlung der von ihm übersetzten Shakespeare- Stücke grollte, bezeichnete er in einem vertraulichen Briefe11, der im übrigen voll Bitterkeit gegen den Jugendfreund ist, das »Dichterleben« als eine »unvergleichliche Darstellung« und rief aus: »Es sind Porträte, aus der Idee gemalt, aber von einer so individuellen Wahrheit, daß man schwören sollte, die Personen hätten ihm dazu gesessen.« Der geistvolle Immermann12 erklärte in einem Briefe vom 18. Juli 1831, hier sei ihm »das geheimnisvolle Schaffen von Tiecks wunderthätiger Phantasie am klarsten geworden«, er könne den Eindruck, den sie auf ihn gemacht, nicht anders be-zeichnen, als indem er sage: wenn es nicht so zugegangen ist, hätte es doch notwendig so zugehen müssen. Die feinsinnige Tochter des Dichters, Dorothea, schrieb am 31. Mai 1832 an Üchtritz13:. »Ich muß gestehen, daß unter allen Novellen meines Vaters mir keine so hoch steht als der erste Teil des ›Dichterlebens‹14; so schön die andern auch sind, so kommt mir diese doch immer als einzig und unerreicht vor.« Hebbel15,. der an der Charakterzeichnung Shakespeares (aber wohl mehr in Bezug auf die Fortsetzung der Novelle von 1829) zu tadeln fand, urteilte doch: »Die Situationen sind unvergleichlich ersonnen und dargestellt; Marlow ..., insonderheit aber Robert Green, dieser zum fliegenden Fisch degradierte Halbadler, sind meisterhaft gezeichnet.« Niemand aber hat den Sinn des Dichters und sein poetisches Verdienst klarer erkannt als die geniale Adelheid Reinbold, die in einem Briefe an Tieck vom 19. Juni 1829 unter anderm schreibt16: »Dieses Werk muß vor allen andern, die ich von Ihnen kenne, so recht aus Ihrem Innersten geflossen sein; denn so nah', so sichtbar möchte ich sagen, hat Sie noch keines vor meinen Geist gestellt. Wie herrlich zeichnen Sie den Kampf der wilden chaotischen Kraft mit dem Menschlichen, den Kampf der Götter mit den Titanen, wie lernen wir Ihren Dichter lieben und bewundern, wie trifft er so wahr und so entschieden immer das Rechte, und doch können wir dabei auch dem Titanen Marlow unsre Liebe und Bewunderung nicht versagen, ja er reißt sie gewissermaßen noch mehr an sich als Shakespeare, den Sie mehr als die ruhige Kritik auftreten lassen, er erobert unsre Zuneigung, wie der Handelnde es immer thut, während der andre sie von Rechts wegen gewinnt. Ich finde in dieser Novelle den Stoff zu einem Trauerspiel, welches Sie Marlow nennen könnten, und über welches ich Goethes Motto schreiben möchte:
›Auch ohne Parz' und Fatum, spricht mein Mund,
Ging Agamemnon, ging Achill zu Grund‹,17
und dem es nur noch an Handlung fehlte, denn den ganzen innern Gehalt eines Trauerspiels, die Gedanken, welche sich untereinander verklagen und nicht aufs reine kommen können, ja es ihrer Grundlage nach vielleicht nie können, hat Ihre Novelle schon18. Es ist eine Göttergestalt, dieser Marlow, der an nichts als an sich selbst hätte zu Grunde gehen können. Und wie schön ist nun wieder der Kontrast des sanften, weichen Green, der eben in der süßen Milde seines Gemütes uns doch wieder auf dem Sterbebett die poetische Beruhigung zeigt, die sein Leichtsinn ihm auf immer zu entreißen droht.« Auch dieser Novelle liegt eine sittliche Wahrheit zu Grunde, die für Tieck charakteristisch ist: sie zeigt, wie Kultus des Genies sowohl als Kultus der Empfindung in ihrer Einseitigkeit ihre Vertreter ins Verderben führen, und anderseits, wie der Mensch, vor allem aber der Dichter, nur des wahren innern Glückes teilhaft werden und das Höchste erreichen kann, wenn er sich die volle Harmonie aller Geistes- und Seelenkräfte zu eigen macht. Auf einzelne Schönheiten – wie auf die prächtige Einführung Shakespeares oder auf die milde Rührung, die das schreckliche Ende Marlows verklärt – kann hier nicht näher eingegangen werden. Wir verweisen auf die feine Würdigung der Meisternovelle, nebenbei bemerkt, der ältesten historischen Novelle Tiecks, durch Jakob Minor19. Am Schlusse seiner Betrachtung sagt Minor sehr treffend: »Alles ist darauf angelegt, zu zeigen, wie Shakespeares Stern im Hintergrund aufgeht, während sich seine Vorgänger zu Grabe neigen. Es will uns als eine große Geschicklichkeit des Dichters erscheinen, daß er das dürftige Vorleben Shakespeares umgeht; auch was er als Schreiber war, wird nicht gesagt; er tritt nur mit seinen Gedanken in die Handlung ein und ist, während uns Green und Marlow im Vordergrund beschäftigt haben, bereits als großer Dichter aufgestanden ... In diesem Teile erscheint Shakespeare als eine halb mythische, heilige Person; wie Pallas springt er fertig aus dem Haupte Jupiters hervor. Seine Schwäche, Unwürdigkeit, Niedrigkeit wird uns erlassen; besonders die drückenden Verhältnisse seiner Kindheit und Jugend werden übergangen. Auch mit dem unausstehlichen Herkules in den Windeln werden wir verschont.« Man möchte fast bedauern, daß Tieck dieser »weisen Absicht« später untreu geworden ist. Im Jahre 1828 schrieb er einen »Prolog zum Dichterleben«: » Das Fest zu Kenelworth«20 in welchem eine Episode aus Shakespeares Knabenjahren anmutend erzählt wird.
Adelheid Reinbold spricht in dem oben angeführten Briefe nicht mit Unrecht von dem »heitern, kindlich-lieblichen Prolog mit seinen schlummernden Gefühlen und Blütenknospen«, wenn auch leider, wie Minor bemerkt, der Knabe »etwas altklug ausgefallen« ist und »zu oft und absichtlich den künftigen großen Dichter« verrät. Weit schwächer aber als dieser Prolog, der immerhin einen gefälligen Eindruck hinterläßt, ist eine im Jahre 1829 verfaßte Fortsetzung des »Dichterlebens«21, als »zweiter Teil« bezeichnet, später auch unter dem Titel: » Der Dichter und sein Freund«22 Adelheid Reinbold hatte als Aufgabe des Dichters sehr richtig erkannt, daß Tieck nun »seinen eigentlichen Helden und Liebling einmal im Kampfe mit sich selbst zeige, und wie er sich das Ungeheuere und die nach allen Seiten überströmende Kraft durch das Menschliche und in diesem Sinne Göttliche bändigt«23. Aber diesem gewaltigen Problem gegenüber erlahmte des Dichters Kraft; dieser »zweite Teil« ist nicht nur in Bezug auf Komposition weit schwächer als der erste, auch die Charakteristik Shakespeares entspricht nicht dem Bilde, das wir uns von dem fertigen großen Manne machen müssen, und der Schluß, der in einen recht schmutzigen Liebeshandel und daraus entspringenden Zwist zwischen Shakespeare und seinem Freunde Southampton ausläuft, ist durchaus unbefriedigend. Daß sich in Einzelheiten, z. B. in dem meisterhaft gezeichneten Charakterbild von Shakespeares Vater, die poetische Kraft des Verfassers in glänzendem Lichte zeigt, kann freilich nicht geleugnet werden.
Zum Schlusse sei bemerkt, daß die Haupthandlung dieser ersten historischen Novelle Tiecks (und auch die des zweiten Teils) eine geniale Erweiterung der verschiedenen Traditionen ist, die uns über Shakespeares und seiner dichterischen Zeitgenossen Leben und Treiben überkommen sind, und daß die auffallend frische und kräftige Lokalfärbung aller drei Novellen sich nicht nur durch Tiecks gründliche Studien, sondern auch durch seine mit Burgsdorff 1817 unternommene englische Reise, auf der er alle für seinen Liebling Shakespeare bedeutsamen Örtlichkeiten selber in Augenschein nahm, erklärt. Bewundernswerter als diese äußere historische und geographische Treue will uns der geschichtliche Sinn des Dichters erscheinen, der uns das geistige Leben der geschilderten Kreise, das seltsame Treiben der damaligen poetischen Genies und nebenbei der religiösen Schwärmer in so knapp bemessenem Raume mit voller Deutlichkeit und Wahrheit vorführt, wogegen wenig in Betracht kommt, daß Tieck in den Gesprächen zwischen Green, Marlow und Shakespeare dem letztern zuweilen Kunsturteile in den Mund legt, die im Grunde die des Verfassers selbst sind.
1 Vgl. »Biographische und litterarische Skizzen aus dem Leben und der Zeit Karl Försters« (Dresden 1864), S. 319 f.
2 Leipzig, bei Brockhaus, 1826 (Spätjahr 1825), S. 1-139
3 1828 im 6. Bande der »Novellen« (Berlin), 1844 im 18. Bande der »Schriften« und 1853 im 2. Bande der »Gesammelten Novellen«
4 »Briefe an Tieck«, Bd. 3, S. 296
5 In dem vortrefflichen Aufsatz »Tieck als Novellendichter« (»Akademische Blätter«, 1884, S. 150)
6 Von Öhlenschläger, f. das chronologische Verzeichnis unter 1827
7 Solgers »Nachgelassene Schriften und Briefwechsel«, Bd. 1, S. 623.
8 Minor a. a. O.
9 Tieck an Solger a. a. O.
10 »Briefe an Tieck«, Bd. 3, S. 296.
11 An Georg Reimer; s. M. Bernays in den »Preußischen Jahrbüchern«, Bd. 68, S. 549.
12 »Briefe an Tieck«, Bd. 2, S. 52 f.
13 »Erinnerungen an Fr. von Üchtritz«, S. 164
14 Die 1825 vollendete Novelle »Dichterleben«.
15 »Tagebücher«, Bd. 1, S. 122
16 »Briefe an Tieck«, Bd. 3, S. 125 f.
17 Aus dem Gedächtnis citiert. In Goethes »Prolog zur Eröffnung des Berliner Theaters im Mai 1821« sagt die Muse des Dramas: »Und ohne Zeus und Fatum, spricht mein Mund, Ging Agamemnon, ging Achill zu Grund.«
18Ernst von Wildenbruch, der hochbegabte Dramatiker, hat 1884 ein Trauerspiel, »Christoph Marlow«, veröffentlicht, das Tieck viel verdankt. So reich an einzelnen Schönheiten das Drama auch ist, so hat es der ältern Novelle die Palme der Meisterschaft doch nicht entwinden können.
19 A. a. O., S. 150 ff.
20 Im 6. Bande der »Novellen«, Berlin, Reimer, 1828.
21 Zuerst 1830 gedruckt in Tiecks »Novellenkranz« auf das Jahr 1831.
22 Seitdem erhielt die ursprüngliche Novelle »Dichterleben« (1825) auf dem Titel den Zusatz: »Erster Teil«. gedruckt.
23 A. a. O., S. 126.
Dichterleben
»Ha! meine lieben täglichen Gäste!« rief der runde Wirt Die Szene ist das besonders durch Shakespeare und Walter Raleigh weltbekannt gewordene Wirtshaus » at the mermaid« (zum Meermädchen) in London- Southwark, Bread Street. mit seiner tönenden Stimme; »seid mir gegrüßt, werte, geehrte Herren! der Platz ist schon für euch zubereitet.«
Zwei Männer waren in den geräumigen Saal getreten, dessen Kühlung ihnen bei der zunehmenden Hitze der Sommertage angenehm dünkte. Der Tisch stand am großen Fenster, welches um einige Schuhe in die Straße hinaus gebaut war; das Morgenlicht glänzte durch die runden, in Blei gefaßten Scheiben und malte sich auf dem Boden, den man mit frischen grünen Binsen bestreut hatte. Der älteste von den Fremden war ein Mann von mittlerer Größe, mit schönen braunen Augen, einer fein gebogenen Nase und kräftigen, freundlichen Lippen. Der jüngere Mann war höher und schlanker, seine Augen glänzten feuriger, und seine Gebärden sowie sein Gang waren rasch und heftig. »Ist der fremde Mensch, der immer da hinten sitzt, noch nicht wieder erschienen?« fragte dieser mit hochfahrendem Ton.
»Seitdem nicht wieder«, antwortete der Wirt, »als Ihr ihn neulich etwas hart angelassen habt. Er wird sich wohl haben wegschüchtern lassen, denn er scheint eine stille Seele.«
»Das sollte mir leid thun«, sagte der heroische junge Mann, »sowohl um ihn als um Euch. Ich spreche auch manchmal selbst gern mit dergleichen mittelmäßigen Gesellen, denn man lernt auch von diesen furchtsamen Geistern. Und ich muß keine Vogelscheuche für Eure Gäste werden. – Aber wer ist er denn eigentlich?«
»Darauf kann ich Euch nicht dienen«, sprach der Wirt mit unterdrückter Stimme, indem er sich furchtsam umsah, ob auch der Fremde, von dem die Rede war, nicht unbemerkt eintrete; »denn er läßt sich nicht ausfragen. Ich kann nur so viel melden, daß ich ihn schon so ein sechs oder sieben Jahre über die Straßen wandeln gesehn; und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist er eine Zeitlang Schreiber und Gehülfe bei einem Sachwalter gewesen, und dieselbe Würde mag er auch wohl noch bekleiden,«
»Wie? neugierig! Freund Christoph,« Christopher Marlowe ( Marlow, 1564 – 93), der bedeutendste Vorläufer Shakespeares auf dem Gebiet der Tragödie, kraftvoll und leidenschaftlich, aber auch oft roh und geschmacklos. sagte der ältere Mann, der sich indessen schon behaglich niedergesetzt hatte; »es freut mich, daß doch auch eine weibliche Tugend Eure männliche heroische Kraft etwas mildert und mäßigt.«
»O Robert! Robert Greene ( Green, ca, 1560–92), nächst Marlowe der begabteste, englische Dramatiker vor Shakespeare, anmutig und oft voll lyrischer Zartheit aber ungleich und zu schwach, um zur Vollendung emporzudringen trinklustiger Robert!« rief der jüngere, indem er sich zu ihm setzte; »dir währt es zu lange, den Wein im Becher rieseln zu hören. Dein Gemüt ist ganz auf die Flasche gerichtet, und die Nachrichten, die sie dir mitteilen kann, scheinen dir die einzig wichtigen. – Aber ist sonst nichts Neues vorgefallen?« so wandte er sich wieder an den Wirt, der das Zimmer schon verlassen wollte.
»Ein reicher Squire aus Jorkshire York oder Yorkshire, die größte englische Grafschaft, zwischen der Nordsee im Osten und Lancaster und Westmoreland im Westen. ist gestern abend angekommen, mit Pferden und Leuten«, antwortete der Wirt, »und hat meine besten Zimmer da droben gemietet. Übrigens ein vernünftiger Mann, der mit allen Dingen zufrieden ist. Er sagt, er sei schon vor vier Jahren hier in London gewesen, damals, als wir mit der unüberwindlichen spanischen Armada bekanntlich 1588 durch die Engländer (Drake) vernichtet. zu thun hatten; er will sogar hier gewohnt haben, aber ich kann mich seiner nicht erinnern. Ein Patriot ist er, wie es nur einen geben kann; denn von unserer Königin Elisabeth Elisabeth von England (geb. 1533) regierte 1558–1603. spricht er nur mit Verbeugungen und der Hand auf dem Herzen.«
»Das muß ein echter Engländer sein«, sagte Robert, als der Wirt hinausgegangen war. »Aber trinkt doch, Christoph, Ihr scheint mir heut' nicht so heiter als gewöhnlich.«
»Ich bin es auch nicht«, sagte jener, indem er den vollen Becher nachdenkend erhob. »Ist es dir wohl schon vorgekommen, daß du das Ende eines Gedichtes nicht finden konntest, welches du mit Begeisterung angefangen hattest?«
»Nein«, sagte Robert, »denn ich kann gar nicht schreiben, wenn es mir nicht leicht wird, und von allen Dingen ist mir der Schluß am leichtesten, ich fange gewissermaßen mit ihm an, denn er ist fast das Erste, worüber ich mit mir selber einig werden muß, und so strebt denn nachher alles von selbst diesem Ziele zu.«
»So ist es nicht gemeint«, sagte der heftige Mann, »und du hast die Gabe, mich mißzuverstehn. So im wachen Schlummer weiter dichten und das Ding nun endlich auch schließen, je nun, das kann ich wohl ebenfalls, wenn ich diesen schläfrigen Fleiß einmal in Anspruch nehmen will. Aber neu zu sein am Schluß, mit großen Gedanken zu endigen, mit Gefühlen und Erschütterungen, die bis dahin in der Tragödie selbst noch nicht auftraten, und die doch in der Sache liegen, so ein Gemälde hinzustellen, das nun noch endlich, nach allen vorhergegangenen Rührungen die ganze Seele umwühlt und das Herz wie zerschmettert: das Bild dieser erhabenen Angst steht mir so lebhaft vor Augen, daß ich mich selbst verwundern muß, wie ich es nicht schon längst viel mächtiger irgendwo habe abzeichnen können.«
»Ja, ja«, sagte Robert wie gerührt, »dies verwünschte Theaterwesen, das uns unsre Bemühungen doch so wenig dankt und belohnt, es reibt unsere besten Kräfte auf; und dich nun gar mit deiner Teufelstragödie, diesem Faust, Marlows dramatische Bearbeitung des deutschen Volksbuchs von »Doktor Faustus entstand wahrscheinlich 1588, ward aber erst 1604 gedruckt: übersetzt wurde sie von Wilhelm Müller, Adolf Böttiger u. a. den dir selbst ein böser Geist als Arbeit hingeschoben hat. Du bist seit dieser Anstrengung, die dich quält, niemals wieder so übermütig gewesen wie im Frühjahr. Ich erlebe es noch, daß er sich vor seinen eignen Teufeln fürchtet und von den Mißgeburten seiner Phantasie bekehren läßt.«
»Wenn ich Robert Green hieße!« erwiderte jener; »o du zerknirschter Sünder. Eine merkwürdige Schrift Greenes, die Tieck vielfach für die Reden desselben benutzt hat: »Eines Pfennigwertes Witz, erkauft mit einer Million Reue« (1592), enthält die kläglichsten Selbstvorwürfe, die, ebenso wie ein erhaltener Brief von ihm an seine treulos verlassene Gattin, einen schwachen, unmännlichen Charakter verraten. der du immer nur in dem Eise der Untugend und im Auftauen der Reue und Buße lebst, wie Aprilwetter, Schnee und Sonnenschein im unbefestigten Gemüt, der sich nur im Hin- und Herschwanken seiner selbst bewußt wird, der nur davon weiß, daß er lebt, alle Morgen die besten Vorsätze zu fassen und sie alle Mittage beim ersten Glase Wein in schlaffer Begeisterung zu vergessen. Deine Tugend ist ein Tagesschmetterling, der das Abendrot nicht leuchten sieht. Wenn ich dich noch einmal stark und konsequent sehen sollte, so würde ich ohne Bedenken alle Wunder glauben.«
Robert lachte herzlich, indem er sagte: »Du bist noch niemals zur Reue und Buße reif geworden, deine Verstocktheit hältst du für Kraft, und doch ist sie eben die schlimmste Schwäche. Wenn dein Herz einmal aufginge und sich zerknirschen lernte, so würdest du über die Macht und Fülle erstaunen, die von dort aus dein ganzes Wesen kräftigte. Aber der gebrechliche Mensch hält den Felsenstein für stärker als die Blüte der Pflanzen, und doch sind es die Wurzeln des Baumes, die jenen sprengen, wenn dieser allgemach und unmerklich in die Klippe hinein wächst. Doch laß deinen Hohn, ich schweige und will durch meine Worte den Teufel nicht um sein rechtmäßiges Eigentum bringen.«
»Wenn er sich noch um mich bemüht«, sagte jener laut auflachend, »so hat er dich schon vergessen, und das ist es eben, was dich kränkt, so daß du ihn täglich bettelnd anläufst und ihn mit Thränen anflehst, er möge dich doch nicht ganz verschmähen, du seist ja ein ganz gutes Stück Menschenwesen und ein trefflicher Kopf, wie sie alle sagen, und tragest Inklination zu ihm und Liebe; er möge sich also durch das bißchen Reue und Frömmigkeit, das du der schwachen Gesundheit wegen alle Morgen beim Frühstück zu dir nehmen müssest, nicht irre machen lassen, denn es sei so böse nicht gemeint; kenne er doch selbst dein beständiges Herz, das von seiner alten Liebe nicht lasse. Nicht wahr, du Dreiviertel-Epikuräer und Einachtel-Puritaner, so ist dein Verhältnis zu deinem Lehnsherrn, der höchstens einmal mit dir mault, wenn er an dich denkt?«
Als sie sich umsahen, hatte sich der junge Mann, den sie für einen Schreiber hielten, wieder still mit seinem Wein in den Hintergrund des Zimmers gesetzt. »Glaubt Ihr auch einen Teufel?« rief der Redende zu jenes Tisch hinüber.
Der Unbekannte, nachdem er den Fragenden erst anständig begrüßt hatte, antwortete mit einem stillen Lächeln: »Herr Marlow, wenn man ihn glaubt, muß man sich nur hüten, nicht an ihn zu glauben, und wenn man ihn leugnet, daß er es nicht selber sei, der uns die Worte in den Mund legt,«
»Sieh, lieber Green«, sagte Marlow, »da hat uns der gute junge Mann eine nachdenkliche Rede zur Antwort gegeben.«
»Eines Doktors nicht unwürdig«, antwortete Green, »ob sie gleich deiner Frage nicht genug thut.«
Das Gespräch wurde unterbrochen, indem sich oben im Saal die Glasthür öffnete, die einen Altan verschloß. Der Wirt zeigte sich oben und mit ihm ein fein gekleideter Mann, der auf die Gesellschaft unten mit großer Aufmerksamkeit herniedersah, sie dann höflich begrüßte und sich mit dem Wirt wieder entfernte. Man hörte hierauf im obern Zimmer sprechen. Nicht lange, so erschien unten ein zierlich gekleideter Page, der auf einem silbernen Teller eine Flasche alten Rheinwein, Zucker und eingemachte Früchte trug. Der junge Mensch sah sich verlegen im Saale um, musterte die Sitzenden und ging dann mit bäurischem Wesen auf den jungen unbekannten Mann am Nebentischchen zu, indem er stotternd sagte: »Mein gnädiger Herr, der Squire Wallborn von Eschentown in Yorkshire, empfiehlt sich und bittet in dieser geringen Gabe um die Erlaubnis, mit dem werten Herrn durch Besuch und Gespräch eine Bekanntschaft anzuknüpfen.«
»Mit mir?« sagte der Mann im schwarzen Kleide; »Ihr irrt Euch, junger Freund.«
»Gewiß nicht«, antwortete der Page, »mein Herr hat mir Euch deutlich beschrieben und mir noch obenein gesagt: ich könnte gar nicht fehlen, denn der Herr sei gemeint, der solch edles königliches Wesen habe«
Die beiden Freunde am Fenster, die das Mißverständnis sogleich begriffen, konnten ein lautes Lachen nicht unterdrücken, und der Fremde, der darüber weder verlegen noch beleidigt schien, ergötzte sich ebenfalls an demselben. Nur der Squire, den das Gelächter, welches er nicht erwartet hatte, wieder auf den Altan lockte, teilte die frohe Stimmung nicht, sondern rief mit lauter Stimme von oben herab: »Dummkopf!« und winkte mit heftiger Gebärde, so daß der Page, noch verlegener, stumm und unentschlossen in der Mitte des Saales stand, indem sein Herr fortfuhr: »Dorthin! zum Herrn im roten Mantel sollst du gehn, zu dem großen majestätischen Mann!« Der Page folgte, im ganzen Gesichte blutrot, der ungestümen Anweisung, konnte aber jetzt kein Wort mehr hervorbringen, sondern setzte zitternd das Silbergeschirr mit allem, was darauf stand, auf den Tisch und entfernte sich dann mit einer stummen Verbeugung. Beschämt über die eigne Heftigkeit, hatte indessen auch der Squire den Altan wieder verlassen, er trat jetzt zu den übrigen in den Saal und nahte sich der Gruppe am Fenster, indem er sagte: »Verzeiht, meine geehrtesten Herren, die Ungeschicklichkeit meines jungen, noch unerfahrenen Dieners und haltet es für keine Anmaßung, wenn ein Fremder, der keine Verdienste für sich kann reden lassen, von dem Rufe so ausgezeichneter Geister angezogen, den Wunsch hegt, mit Männern in Bekanntschaft zu treten, die ihrem Vaterlande so große Ehre machen.«
Green verbeugte sich stillschweigend, und Marlow, der wohl gesehen, daß nur ihm eigentlich die Botschaft des Edelmannes gegolten hatte, nahm das Wort und drückte mit Beredsamkeit die große Freude aus, die ein Dichter empfinden müsse, wenn es seinen Versuchen gelänge, ihm auch in der Ferne und unter angesehenen und ausgezeichneten Männern Freunde zu erwerben, unter denen der Beifall Eines Verständigen das unbestimmte Urteil Unzähliger aus der unwissenden Menge aufwiege.
Der Squire, der ein Mann von Erziehung war, hielt es für notwendig, auch jenem Unbekannten eine kleine Entschuldigung zu sagen; doch dieser kam ihm, als er seine Rede eben erst begonnen hatte, mit Freundlichkeit zuvor, indem er sprach: »Bemüht Euch nicht, Sir! Mir thut nur der arme junge Mensch leid, den Ihr beschämtet; laßt Euch nicht stören, ein Gespräch fortzusetzen, das Euch zu wichtig sein muß, um die Zeit mit einem Unbekannten zu verlieren.«
Diese Worte, höflich, aber sorglos hingesprochen, vermochten den Edelmann, auch diesen Unbekannten mit an jenen Tisch zu laden, welchen die Aufwärter von neuem mit Wein und Früchten besetzten. Der gleichgültige Green machte dem Schreiber, wie man ihn nannte, freundlich an seiner Seite Platz; doch Marlow rückte mit einer kleinen Empfindlichkeit weiter zurück und dem Edelmanne näher. Diesem entging diese Unart nicht, und er sagte gutmütig: »Wer sich nicht selber als Dichter zeigen kann, der wird wenigstens dadurch geadelt, wenn er die Werke edler Geister versteht und liebt; und darum dränge ich mich mit halbem Vertrauen in eure Gesellschaft und bitte diesen jungen Mann, sich uns zu nähern, da seine Worte und sein Wesen wohl deutlich verraten, daß er die Dichter seines Landes zu würdigen weiß.« Der Wein und heitere Gespräche machten bald alle, die sich bis dahin fremd gewesen waren, miteinander bekannt. Der hochfahrende Marlow vergaß es endlich, daß der Edelmann ihn nach seiner Meinung durch das Herbeiziehen des Fremden ebensosehr gedemütigt, als durch seine zuvorkommende Höflichkeit ihm geschmeichelt hatte. »Wie wohl ist es mir«, sagte der Squire, »jetzt wirklich neben dem Manne zu sitzen, der mein ganzes Herz schon lange bewegt hat, der unter den Dichtern, die jetzt leben, oder von denen ich wenigstens Kunde habe, unbedingt den ersten Platz einnimmt!«
»Es gibt Stunden«, antwortete Marlow errötend, »in denen sich mein berauschter Geist auch wohl dergleichen träumen läßt; aber noch habe ich weder die Muße noch die Stimmung gefunden, um etwas von dem ausrichten zu können, was die Begeisterung meiner Jugend sich vorgesetzt hat. Alles, was die Welt von mir kennt, sind nur Spiele und Übungen.«
»Ihr seid zu bescheiden«, erwiderte der Squire; »wo haben wir nur etwas Ähnliches, wie Eure Übersetzungen des Ovid oder des Musäus? Marlowe war klassisch gebildet und hat die Liebeselegien des Ovid und das kleine Epos des griechischen Dichters Musäos (5.-6. Jahrh. n. Chr.) »Hero und Leander« bearbeitet. Ihr macht unsere Sprache erst mündig, daß sie die Töne der Kraft, Bedeutsamkeit und Tiefe lieblich aussprechen lernt. Eure Lieder sind zart und wohllautend, Eure Tragödien donnernd, und in allem, was Ihr dichtet, regiert ein Ungestüm, ein Sturm der Leidenschaft, der uns auch wider unsern Willen in fremde Regionen hinüberreißt, was mir eben das wahre Kennzeichen eines echten Dichters zu sein scheint.«
»Ich kann auch nur dichten«, fuhr Marlow fort, »wenn eine Stimmung mich aufregt und unwiderstehlich zu Versen und Erfindungen zwingt. Scheint es mir doch manchmal in süßer Täuschung, als führe ein fremder, höherer Geist dann meine Feder. Ich kann wohl selbst, wenn diese edle Raserei mich wieder verlassen hat, über das erstaunen, was ich niedergeschrieben habe. Ich glaube auch nicht, daß man in der Tragödie auf andere Art etwas leisten kann; denn wie soll das Übermenschliche zur Sprache kommen, wenn der Dichter nicht selbst außer sich versetzt wird, und in jenem zitternden Zustand des prophetischen Wahnsinns mit seinem unsterblichen Auge die Dinge wahrnimmt, die seinem irdischen immerdar verschlossen bleiben? Glaubt mir, von allen Trefflichkeiten, die ich an meinem Freunde Green hier bewundere, beneide ich ihm die Gabe am meisten und begreife sie am wenigsten, daß er in allen Stunden und Stimmungen, sowie er sich nur dazu entschließt, schreiben und dichten kann.«
»Wenn das nur irgend Wahrheit enthält«, antwortete Green mit furchtsamer Stimme, »was Ihr kurz vorher geäußert habt, so dürfte dies Talent kein beneidenswertes sein, da es mir durch dieses ja eben aus ewig unmöglich wird, das Höchste oder die wahre Krone der Poesie zu erfassen. Ich bleibe gewiß nicht darin zurück, den Schwung Eures Geistes zu bewundern, und es mag seine vollkommene Richtigkeit haben, daß nur in Stunden der Weihe, wenn der Himmel unsers Innern ganz klar und blau ist, dieser Adler am freudigsten seine Schwingen entfaltet, um in der höchsten Region die Strahlen der Sonne zu trinken: – aber es ist nicht zu leugnen, daß Ordnung, Ausdauer und Festigkeit viel über uns vermögen, die Ihr, mein edler Freund, bei Euern Arbeiten eben allzusehr verschmäht. Diese Ordnung, wenn Ihr sie Euch aneignen möchtet, würde Euch wohl jene Begeisterung selbst zugänglicher machen, so daß Ihr, der freieste und kühnste aller Menschen, nicht fast täglich der Sklave Eurer Laune und Stimmung zu sein brauchtet.«
»Gar recht«, erwiderte Marlow, »wenn es ein anderer sagt; für mich aber unpassend, weil ich eben ein anderer sein müßte, als der ich bin, um solchem guten Rate Folge leisten zu können.«
»Ich im Gegenteil«, fuhr Green fort, »fühle mich fast immer in einer gewissen gerührten, poetischen Stimmung; mein äußeres und inneres Leben, Wirklichkeit und Phantasie sind gar nicht so getrennt wie bei Euch und vielen andern Menschen: darum arbeite ich ganz leicht und ohne andere Unterbrechung, als die ich mir selbst willkürlich mache. Daher kommt es auch, daß ich Lust und Spaß in meinen Dichtungen besser brauchen kann als Ihr: denn so viel Euch die Natur auch mag geschenkt haben, so ist Euch denn doch der Scherz versagt, und so oft Ihr, der Minerva zum Trotz, das Lachen habt erregen wollen, ist es Euch niemals damit geglückt.«
»Nein«, fiel der Edelmann ein, »vielleicht ist es auch unmöglich, das Heroische, Große und Furchtbare so schön ausdrücken zu können und zugleich so leichtes Blut zu haben, daß Witz, Scherz und Lust aus dem schäumenden Becher der Begeisterung sprudeln. Ich glaube fast, ohne irgend einem geehrten Talent zu nahe zu treten, diese Lust sei auf einer niedrigern Stufe zu finden und verlange auch darum nicht so die Anstrengung des ganzen Menschen und aller seiner Kräfte. Ein Riese kann nicht zugleich, wenn er Bäume entwurzelt, ein zierlicher Tänzer sein.«
Der junge Mann im schwarzen Wams lächelte still vor sich hin. »Ihr scheint nicht ganz meiner Meinung«, sagte der Squire zu ihm, indem er ihm von neuem einschenkte. – »Verzeiht«, antwortete dieser, »mir fiel nur ein, ob der Mensch nicht mehr sei als der Riese; wir freuen uns wenigstens in den Gedichten, wenn der Gigant von der edlern Kraft bezwungen wird, und ein Alexander oder Heinrich der Fünfte von England Heinrich V. (1413–22; geboren 1387), der Sieger von Azincourt (1415); Shakespeare (der »Schreiber«) hat später in den Fallstaffszenen in »Heinrich IV.« sein ausgelassen lustiges Jugendleben, in »Heinrich V.« seine Herrschertugenden dargestellt. kann nach der gewonnenen Schlacht schwärmen und trinken, ohne sich zu entadeln; und so gibt es auch vielleicht eine Poesie, die alles verbinden mag.«
»Wenn der Blinde von der Farbe spricht«, fuhr Marlow dazwischen und sah den Unbekannten mit einem zornigen Blicke an, »so erfahren wir freilich neue Dinge, die aber von der Sache selbst weit entfernt sind.«
Der Squire, welcher Streit vermeiden und seinen Liebling bei guter Laune erhalten wollte, wendete das Gespräch auf die weichen Verse und üppigen Schilderungen, in welchen Marlow damals den größten Ruhm genoß, deswegen aber auch von Gegnern und moralischen Lesern getadelt wurde, so daß das geistliche Gericht selbst seine Übersetzungen der ovidischen Gedichte verbieten wolltet. Der Erzbischof von Canterbury ließ Marlowes Übertragung der ovidischen Liebeselegien öffentlich verbrennen »Der Streit«, fuhr der Edelmann fort, »über die Unmoralität der Poesie ist noch nie so lebhaft als in unsern Tagen geführt worden, und wenn die Gegner derselben nur einigermaßen recht haben sollten, so muß man zugestehen, daß ein frommer Wandel, bürgerliche Tugend und Unbescholtenheit sich nicht mit der Dichtkunst vereinigen lassen.«
»Diese Gegner«, sagte Marlow sehr lebhaft, »sind doch nur jene puritanischen Reiniger und Ausfeger, die nicht nur die Poesie, sondern alle Kunst, selbst Wissenschaft, ja, wenn man ihnen folgte, den Unterschied der Stände, Adel, König und Geistlichkeit aus dem Staate hinaus reinigen möchten. Wie es aber bei der großen Gliederung der menschlichen Gesellschaft nicht möglich ist, die scheinbaren Gebrechen, Armut, Druck, Gewalttätigkeit, Laster, völlig aus dem Ganzen herauszunehmen, weil man dadurch nicht nur die Tugenden zugleich mit vernichten, sondern auch das Gebäude der majestätischen Weisheit zertrümmern würde: so ist es auch auf ähnliche Weise mit der Poesie beschaffen. Wir wissen es alle und beklagen es in vielen Stunden, daß der Reiz der Sinne so mächtig über uns walte, aber wir müssen auch zugleich im Bereuen gestehen, daß es unmöglich ist, ihn zu vernichten: denn die Erscheinung des Lebens selbst müßte mit ihm zugleich zu Grunde gehen. Wo sich das Bewußtsein des Lebens in kräftiger Brust erhebt und in Bildern, süßen Tönen und Akkorden seine Regung kundgeben will, da nimmt es diesen innigsten Trieb in seinen glänzenden Banden gefangen und führt ihn an die höchste Grenze des Sichtbaren, in Üppigkeit, Reiz und Wollust hinein, dahin, wo die reinste und heißeste Flamme des Lebens brennt. In dieser Flamme schwingt sich der Geist der Dichtkunst kühn und in allen Farben und Gestalten um; und so wie Liebe, Sehnsucht Schmerz und das geistigste Verlangen sinnlich in Befriedigung, in irdischer Sättigung erlöschen und sich sänftigen: so kann das Himmlische, Lautere, Wundervolle nicht anders als in Reiz und sinnlicher Üppigkeit seine Blumenkrone und seinen farbigen Ausdruck finden. Wie die verschiedenen menschlichen Geister auch gestimmt oder mißtönend sein mögen, hier verstehen sich alle, wenn sie noch unbefangen und natürlich sind.
Diejenigen, die mich also hierüber tadeln, schelten nur die Begeisterung selbst, jene Lebenskraft, die im geheimen Dunkel der Seele in Sehnsucht sich erhebt und um sich schaut, mit klaren und immer glänzendem Augen das Wunder ihrer Bestimmung erkennt und so den süßen Trieb, der die ganze Welt erregt, in Liebe mit sich nimmt, um das in Bild und Figur zu setzen, was sonst ewig tot und formlos sein würde. Ist es nun anders mit der Sehnsucht nach Schmerz und Leid? In einem geheimnisvollen Gelüste, aus Furcht, Grauen und Mitleid gemischt, greift die Seele zum Schrecklichen und sättigt ihren furchtbaren Hunger an Gebilden von Blut und Mord; Grausamkeit, Mordlust, die in der Brust des Menschen schlafen, werden von ihren Ketten gelöst, und in der Erhabenheit triumphiert die wilde Natur, rot von Blut, in Schauder und Graus. Und dieser Trieb, der den Menschen in der Wirklichkeit wie in der Poesie hoch über sich selbst hinaus reißt, ist innigst mit jener schmelzenden Wollust verwandt, ist wohl derselbe magische Wunsch, zu schaffen und zu vernichten, in der höchsten Liebe zu verderben und in der Blutgier mit den feinsten Herzensfibern zu schwelgen. Daher sind der Tragödie die Tyrannen so notwendig; daher die Liebe keinem Gedicht fehlen darf, das unsere Seele vom Schlaf erwecken soll; darum wird auch die Liebe, wenn ihre Begeisterung gestört, wenn ihr Genuß gehindert wird, in wilden Gemütern Mord, und darum sind alle Tyrannen wollüstig gewesen und in der Gier der Liebe am furchtbarsten.«
»Trefflich!« rief der Squire; »dies grauenhaft Gespenstische, innigst mit dem Lieblichen vermählt, zieht mit feingeistigen Schauern durch die fernsten Tiefen unserer Seele. Wie habt Ihr soeben herrlich Eure große Tragödie: ›Die Herrschaft der Lust‹, Dieses Drama ( »Lust's dominion, or The lascivious queen«), erst 1657 gedruckt, steht in den von Tieck vielfach benutzten »Old English Plays« (London 1814 f.) allerdings unter Marlowes Namen, stammt aber von einem andern, unbekannten Verfasser. charakterisiert, in welcher wir den gräßlichen Mohren hassen und bewundern, uns vor ihm entsetzen und ihn doch gewissermaßen lieben müssen. Dieses ganz in Blut getauchte Trauerspiel sowie Euer ›Jude von Maltha‹ Gedichtet 1589 oder 1590, gedruckt 1633; übersetzt von Eduard von Bülow (»Altenglische Schaubühne«, 1. Bd. 1831). haben mir immer vorzüglich gefallen.«
So willig und mit leichtem Sinne Green in alle diese Bewunderung einstimmte, so mochte es ihn doch etwas verdrießen, daß von ihm so wenig die Rede sei; er sagte daher mit einem launigen Lächeln, das ihm sehr gut stand: »Ich wette, unser junger Gast dort, wenn er nur reden dürfte, hat auch hierüber manches zu sagen: denn auf seiner hohen Stirn schienen mir einige Gedanken und Zweifel wie leichte Wolken hinzuschweben, und in den feingezogenen Augenbraunen wandelten Einwürfe aller Art, die der Mund nur verschweigen muß.«
Der Squire sah den Fremden nachdenkend an, und Marlow rief: »Er rede! Das soll von mir nicht gesagt werden, daß ich wie ein Tyrann das Gespräch beherrsche; daß in meiner Gegenwart, er sei auch, wer er sei, wenn er einmal zu unserer Gesellschaft gehört, irgend einem Manne nicht zu sprechen erlaubt sei.«
»Nun?« sagte der Squire, »laßt hören, junger Freund, ob sich Herr Green in Ansehung Eurer Mienen nicht geirrt hat, und ob Ihr wirklich von der Sache etwas versteht.«
»Der Gegenstand ist zu wichtig«, antwortete der Unbekannte, »als daß ich mir einbilden könnte, über ihn, besonders Meistern gegenüber, etwas Bedeutendes zu sagen. Herr Marlow hat Gedichte geliefert, die wir alle bewundern, das ist die Hauptsache. Jener Sinnenreiz, von welchem er behauptet, daß er gewissermaßen den Einschlag unsers Lebens ausmacht, so daß ohne ihn kein Gewebe und noch weniger künstliche Figuren in demselben möglich sind, ist gewiß nicht abzuleugnen. Nur fragt es sich, ob er an sich selbst, als Naturtrieb, in seiner Wirkung und Kraft, seien sie auch gewaltig, eben schon eine Aufgabe für die Poesie oder gar die Krone derselben sei. Wie alles Schaffen doch nur ein Verwandeln ist, so dünkt mir, wäre es der Zweck des Dichters und sei es von je gewesen, denselben Trieb, der das Tier roh und stark und die Blume geheimnisreich erregt und entwickelt, in himmlische Klarheit, in Sehnsucht nach dem Unsichtbaren zu steigern, so das Leibliche mit dem Geistigen, das Ewige mit dem Irdischen, Cupido und Psyche, im Sinne des alten Märchens, Von Lucius Apulejus (geboren um 130 n. Chr.). auf das innigste in Gegenwart und mit dem Beifall aller Götter zu vermählen.«
»Seht!« sagte Marlow, »der junge Freund ist nicht ganz ohne Belesenheit; nur muß ich glauben, daß auf diesem Wege Leidenschaft und Feuer sich in ein Nichts hinein verflüchtige und zerstreue. Wer das Leben auf diese Art auflösen will, findet immer nur den Tod. Das möchte denn eben wohl das Gegenteil aller Poesie werden und in jene kalten Allegorieen ausarten, die als leere Schemen jedes Herz mit Frost ernüchtern. So waren die alten Moralitäten, Mittelalterliche Schauspiele, die einzelne Sätze der Sittenlehre durch erfundene Beispiele erläuterten. deren wir noch einige besitzen; so sprachen die hochgepriesenen Gedichte jenes petrarkischen Surrey, Henry Howard, Graf Surrey (1516 – 47), eleganter Lyriker, führte das Sonett und den iambischen Blankvers in die englische Litteratur ein. des Freundes von unserm achten Heinrich; daran leidet, seine Bewunderer mögen sagen, was sie wollen, die herrliche Feenkönigin unseres Spenser, Edmund Spensers (1552-99) unvollendetes Hauptwerk, das Epos »Die Feenkönigin«, ist eine Allegorie auf die Königin Elisabeth. den viele, die sich selbst die Bessern nennen, zum größten, ja zum einzigen wahren Dichter Englands stempeln wollen. Da würdet Ihr, Sir, mit der Bewunderung Eures armen Marlow nur übel ankommen, der sich zwar selbst gern in diesen grünen Waldschatten der Spenserschen Dämmerung ergeht, die so lieblich vom Bachgeriesel und seinem Nachtigallenton erfrischt, von Duft durchhaucht und Mondlicht durchspielt wird, aber auch im Genuß mit Schlummermüdigkeit und schweren Träumen nicht selten bedrückt.«
»Diese ersten drei Bücher, die nur noch erschienen sind«, sagte der Squire, »sind plötzlich so wundersam da, wie zuweilen der Frühling mit allem Laube und seinen Blüten. Das Wunder erstaunt, entzückt und betäubt gewissermaßen; ob Sommer und Herbst schöner oder in anderer Art herrlich sein könnten, fällt uns fürs erste nicht ein. Das scheint mir ausgemacht, ein neuer Ton, ein neues Streben, eine so noch nie vernommene Sprache und Versart erklingt bezaubernd; ja selbst jene Dämmerung und süße Ermattung, von welcher Ihr eben spracht, scheint mir diesem Werke und seinen dunkeln Schatten und tiefen, harmonischen Farben unentbehrlich.«
»Zwölf solcher Bücher«, sagte Marlow, »und jedes Buch von zwölf Gesängen soll das Ganze enthalten, wenn es vollendet ist. Wer wird es lesen können? Werden nicht eine Menge leerer Lückenbüßer, viele allegorische nüchterne Schilderungen und Reden sich einfinden müssen, um nur das weitläufige Gebäude, welches hier einen Flügel, dort eine Kolonnade der Symmetrie wegen alsdann notwendig macht, völlig auszubauen? Schon jetzt ist dergleichen prosaische Notdurft, die aus der Poesie nicht entspringt, nicht zu verkennen. Aber Ihr habt recht, diese Gesänge berauschen wie ein neuer Wein die ganze Nation. Wenn ich über diesen Punkt etwas verschieden denke, so geht es mir mit der gepriesenen ›Arkadia‹ unsers Philipp Sidney Philipp Sidney(1554-86), neben Spenser der Hauptvertreter der höfischen Kunstdichtung zur Zeit Elisabeths; die »Arkadia« (1578) ist die älteste englische Hirtendichtung. nicht anders. Meiner Ungeduld sind dergleichen Bücher zu lang; am wenigsten kann sie der oft lesen, der selbst etwas hervorbringen will. Von der ›Feenkönigin‹ wollen viele jetzt behaupten, sie werde die Grundlage unserer wahren Nationalpoesie für die Zukunft ausmachen; und ich schmeichelte mir oft, daß ich und meine Freunde diese auf unsere Weise befestigen würden: denn wie jene, wenn auch poetischen, doch sonderbaren Gesänge jemals vom Volke ganz sollen verstanden und mit Wohlgefallen genossen werden, bin ich nicht fähig einzusehen. Seit unserm Chaucer. Geoffroy Chaucer (ca. 1340 – 1400), der Vater der englischen Dichtkunst; sein Meisterwerk, die »Canterbury-Geschichten« (frühstens 1393 verfaßt), ein Cyklus von Novellen in Versen. denk' ich, ist nichts gedichtet worden, was eben dem ganzen Volke gehöre, und von dem herrlichen Alten sind es doch auch eigentlich nur die Canterbury- Erzählungen, die ich hier meine, und unter diesen wieder die witzigen und komischen, samt der unvergleichlichen Schilderung der Personen, die jeden Engländer für alle Zeiten als Muster gelten sollten. Das ist die hellste Lustigkeit und der klarste Verstand, die mir in allem, was ich nur gelesen habe, jemals vorgekommen sind.«
»Ihr habt«, fing der Edelmann wieder an, »schon genug gethan, auch Eure Freunde stehn Euch darin bei, und Eure Schüler und Nachkommen werden hoffentlich darin fortfahren, das Ferne, Unbestimmte, Vergeistigte zu vermeiden. Wie erfreulich, daß Ihr in Eurem ›Eduard dem Zweiten‹ Von einigen für Marlowes bedeutendste Tragödie angesprochen; gedruckt 1598, übersetzt von Prölß (»Altenglisches Theater«, I. Bd. 1880). unsere vaterländische Geschichte, die reich an großen und tragischen Begebenheiten ist, so edel habt auftreten lassen! Herr Green hat einige märchenhafte Sagen In den Stücken »George Greene, der Flurschütz von Wakefield«, gedruckt 1599 (übersetzt von Tieck im 1. Bd. des »Altenglischen Theaters« 1811), und »Die wunderbare Sage vom Pater Baco«, gedruckt 1594 (übersetzt [von Dorothea Tieck] in Tiecks »Shakespeares Vorschule«, 1. Bd. 1823). trefflich bearbeitet, so leicht und behaglich, daß man mehr dergleichen wünscht. Auch Euer Freund Georg Peele George Peele (zwischen 1550 und 1598), nächst Marlowe und Greene der bedeutendste Vorläufer Shakespeares, behandelt in seinem historischen Drama »König Eduard I.« (gedruckt 1593) einen vaterländischen Stoff. wandelt auf demselben Wege, und man hat mir erzählen wollen, daß einige Unbekannte noch mehr vaterländische Gegenstände schon mit dem größten Beifall dem Theater gegeben haben.«
»O ja!« rief Green spöttisch, »es wird bald dahin kommen, daß der Schüler der Chroniken entbehren und die englische Geschichte lustiger vom Theater lernen kann. O die Bühne, die liebe vortreffliche Anstalt! könnten wie armen Autoren nur wenigstens von dieser erlöst werden.« »Warum«?« fragte der Squire.
»Wir«, fuhr der sonst freundliche Mann zornig fort, »sind fast die ersten gewesen, die den Komödianten und ihren einfältigen Vorstehern etwas Vernünftiges gegeben und in den Mund gelegt haben; aber das haben sie nun, nachdem das Volk zugelaufen ist und Lust am Theater bekommen hat, längst vergessen. Nun glauben sie unser nicht mehr zu bedürfen, und Werke von Stümpern, von unbekannten Pfuschern, sind ihnen ebenso lieb, ja noch lieber, und die armseligen Versuche, die oft nur so wie gedankenlos hingeschrieben sind, erhalten nicht weniger Beifall als die Gedichte, die uns Zeit und Nachtwachen gekostet haben. Wir haben die Theaterunternehmer erst zu dem gemacht, was sie sind, und sie auch zugleich verdorben. – Und was ist es auch am Ende um das beste Theaterstück? Mein und meines Freundes wahrer Ruhm kann doch nur auf unsern andern Werken beruhen: denn es zeigt sich immer deutlicher, daß fast jeder Mensch ein unterhaltendes Schauspiel schreiben kann, besonders wenn es die Komödianten gut spielen; und es ist nicht zu leugnen, daß diese mit jedem Tage besser werden und in ihrer sogenannten Kunst etwas viel Höheres leisten, als man vor zehn Jahren für möglich halten konnte.«
»Diese geistlosen Schauspieler«, fuhr Marlow fort, »werden bald darauf verfallen, selber alles zu schreiben, was ihre Bühnen bedürfen Uns kann es gleichgültig sein, denn unser Leben und Ruhm hängt nicht von diesem augenblicklichen und wechselnden Beifall ab. Einige Sachen aus unserer englischen Historie haben schon Glück gemacht, weil man eben alte Erinnerungen, das Wohlwollen für gewisse Männer und die sogenannte Vaterlandsliebe in Thätigkeit setzte und durch alle diese Würzen die blöde und unwissende Menge bestach. Was geht aber den wahren Dichter sein sogenanntes Vaterland an? Der Boden, auf welchem er zufällig geboren ist? Das ganze Reich der Phantasie, Süden und Norden, die Welt der Geister dazu steht ihm offen und ist seiner Herrschaft unterworfen. Wer sich, wenn er für Glück und Unglück, Großmut, Bosheit und furchtbare Begebenheiten sich begeistern will, noch für jenen kleinen Fleck interessieren kann, auf welchem er das Licht erblickte, und nicht ablassen mag, jene Erinnerungen aus der Kindheit willkürlich in die großen Gemälde zu verflechten, der ist gewiß das vollkommene Gegenteil eines Poeten. Darum habe ich meinen Tamerlan Der Held von Marlowes Doppeltragdödie »Tamerlan der Große«, gedruckt 1590. mit mehr Schmuck und Herrlichkeit ausgestattet, als jene nur jemals ihrem Talbot, Gloster oder dem schwachen sechsten Heinrich Heinrich VI. (1422–61 und 1470– 71 König) sowie der berühmte Feldherr John Talbot, Graf von Shrewsbury (1373–1453), und Humphrey, Herzog von Gloucester, Oheim Heinrichs VI., 1422–47 für letztern Regent, treten in Shakespeares »Heinrich VI.« auf. geben können, oder gar den alten vergessenen Märchenfiguren, die eine kränkliche Erschlaffung uns wieder vorzuführen strebt. Darum ist mir meine letzte Tragödie, die Fabel vom deutschen Zauberer Faust, so wert, weil hier das Entsetzen, Grauen und alle Furchtbarkeit im Wechsel mit fratzenhaften komischen Begebenheiten so ganz selbständig auftritt, sich in seinem eignen Elemente bewegt und keine Sitten unserer Zeit oder Stadt bedarf. Auch in meinem ›Eduard‹ habe ich es vermieden, das sogenannte Vaterland, oder Bedrückung, Volk und dergleichen mitspielen zu lassen; der Kampf der Parteien und das unsägliche Unglück des schwachen Königs genügt und erregt jeden Zuschauer zu Mitgefühl und Entsetzen, eben weil er nur ein Mensch ist.«
Der Unbekannte stand jetzt auf. »Schon wieder böse?« fragte Marlow mit rauher Stimme. – »Ich bin es noch niemals gewesen«, sagte jener mit dem freundlichsten Tone, »und fühle mich im Gegenteil hochgeehrt, daß ich am Gespräch so trefflicher Männer habe teilnehmen dürfen. Meine Zeit aber ruft mich ab, da ich nicht so unabhängig bin, wie Ihr soeben von Euch gerühmt habt.«
»Wenn es Euch«, sagte Marlow, »Euer Sachwalter oder sonstige Beschäftigung irgend erlaubt, so sagt noch jetzt, was Ihr irgend einzuwenden habt.«
»Euer Verlangen«, antwortete jener, Shakespeare spricht im folgenden die Meinung Tiecks aus. Doch stimmen seine Worte zugleich völlig mit der patriotischen Gesinnung überein, die er in Wirklichkeit wiederholt bekundet hat, z. B. »Richard II.«, 2, 1, in der berühmten Verherrlichung Englands durch Gaunt. »soll mir als Befehl gelten, und als dramatischer Dichter müßt Ihr ja auch die Meinung, die von der Eurigen ganz verschieden ist, besser brauchen können als die gewöhnlichen Menschen. Erst wolltet Ihr jenen Grundtrieb unserer Natur, den Sinnenreiz, unbedingt als die höchste Aufgabe der Poesie gelten lassen, ihn, den alle Menschen miteinander, ja sogar mit den Tieren teilen. In dieser Befangenheit glaubtet Ihr die höchste Freiheit zu finden; dagegen verwerft Ihr als ein fesselndes das Gefühl des Patriotismus und wollt als Dichter kein Vaterland und keine Zeit anerkennen. Und dennoch könnt Ihr den Elementen, die Euch ernährt, den Umgebungen, die Euch erzogen haben, nicht entfliehen. Wenn der Mensch kein Mannesalter finden wird, der keine Kindheit gehabt hat, worauf soll denn die Welt, die der Dichter uns gibt, feststehen, wenn er selbst den notwendigsten Stützpunkt, der ihn tragen muß, wegwirft? Die Vaterlandsliebe ist ja ein gebildetes, erzogenes Naturgefühl, ein zum edelsten Bewußtsein ausgearbeiteter Instinkt. Wie sie nur da möglich wird, wo ein wahrer Staat ist, ein edler Fürst regiert und jene Freiheit gedeihen kann, die dem Menschen unentbehrlich ist, so bemächtigt sie sich auch in diesen echten Staaten der edelsten Gemüter und gibt ihnen die höchste Begeisterung, diese unsterbliche Liebe zum Boden, zur überlieferten Verfassung, zu alten Sitten, frohen Festen und wunderlichen Legenden. Wenn sie sich nun mit der innigsten Verehrung zum Herrscher verbindet, so wie es uns Engländern vergönnt ist, unserer erhabenen Königin zu huldigen, so erwächst aus diesen mannigfaltigen Kräften und Gefühlen ein solcher Wunderbaum von Leben und Herrlichkeit, daß ich mir kein Interesse, keine erfundene Dichtung, keine Liebe und Leidenschaft denken kann, die mit dieser höchsten Begeisterung in den Kampf treten dürften. Auch findet hier der Dichter schon die Poesie, die seinem Gemüte, wenn er sie nur erkennen will, im glänzendsten Schmucke entgegenschreitet. Wem schlägt denn wohl das Herz nicht höher, wenn er Cressy und Azincourt Die Schlachten bei Crecy (ober Cressy, 1346) und Azincourt (1415), glorreiche Siege der Engländer über die Franzosen. nennen hört? Welche Gebilde, dieser dritte Eduard, Eduard III. (1327-77 König), der Sieger von Crecy. der fünfte Heinrich, die Bürgerkriege der Rosen, der redliche Gloster, der hohe Warwick, der furchtbare Richard! Krieg der Roten Rose (Haus Lancaster) und der Weißen Rose (Haus York) 1455-85. – Richard Neville, Graf von Warwick, ein Hauptheld in den Kriegen der Rosen auf seiten der Yorks, fiel 1471 in einem Treffen bei Barnet. – Richard III. (1483-85 König), allbekannt aus Shakespeares gleichnamiger Tragödie. oder die Riesengestalt des Gaunt, neben dem zu leichtsinnigen und unglücklichen Richard von Bordeaux! Johann von Gaunt, Graf von Richmond und Herzog von Lancaster (gestorben 1399), Eduards III. dritter Sohn, Oheim Richards II. (1377 bis 1399 König, in Bordeaux geboren). Vgl. Shakespeares »Richard II.« der schwarze Prinz, den der Feind mit Ehrfurcht nannte, jener Löwenherz, oder dessen größerer Vater, der glücklichste und unglücklichste der mächtigen Monarchen! Eduard, Prinz von Wales (1330-76), nach seiner Rüstung der »Schwarze Prinz« genannt, ältester Sohn Eduards III., einer der volkstümlichsten Helden Englands, – Richard I., Löwenherz (1189-99 König), am bekanntesten durch seine Teilnahme am dritten Kreuzzug und seine Gefangenschaft in Deutschland. Sohn König HeinrichsII. (1154-89), eines der wohlmeinendsten und thatkräftigsten englischen Herrscher; unglücklich war Heinrich II. besonders insofern, als die zwei besten seiner Söhne vor ihm hinstarben, die beiden andern aber teils durch