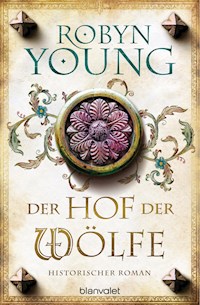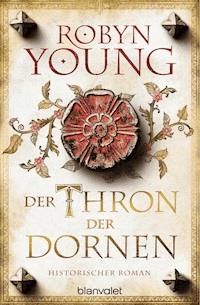8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brethren
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Liebe, Freundschaft, Kampf und Verrat ...
Paris, 1260: Unter den strengen Augen seiner Lehrer durchläuft der junge Will Campbell die Ausbildung zum Tempelritter – denn dereinst soll er im fernen Heiligen Land die christlichen Pilger beschützen. Doch nicht nur die harte Disziplin der Templer macht ihm dabei zu schaffen, sondern auch seine zunehmend verwirrenden Gefühle für Elwen, die schöne Nichte seines Meisters. Und dann erhält Will einen Auftrag, der ihn jäh in einen Strudel aus Intrigen und Verrat zieht: Er soll ein gestohlenes Buch zurückbringen, das die Identität einer Geheimgesellschaft innerhalb der Templer enthüllt – und deren gefährliche Pläne …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1033
Ähnliche
Buch
Im späten 13. Jahrhundert, zu einer Zeit, als Kampf ein adäquates Mittel schien, um die Verbreitung des Christentums zu erreichen, wachsen der junge Will Campbell und sein Freund Garin de Lyons zu jungen Männern heran. Schon von Kindesbeinen an ist es ihnen vorbestimmt, im Orden der Templer zu leben, um dort zu stolzen Rittern ausgebildet zu werden. Obwohl Will, der nicht dem englischen Erbadel entstammt, sehr talentiert ist, ha er schwer mit der harten Disziplin der Templer zu kämpfen. Und dann sind da noch das gefährliche Geheimnis, das den Ritter Everard umgibt – und seine verwirrenden Gefühle für Elwen, die schöne Nichte seines Lehrmeisters. Dann erhält Will einen Auftrag, der ihn jäh in einen Strudel aus Intrigen und Verrat zieht: Er soll ein gestohlenes Buch zurückbringen, das die Identität einer Geheimgesellschaft innerhalb der Templer enthüllt – und deren gefährliche Pläne ...
Autorin
Mit ihrem Debüt Die Blutschrift gelang der Britin Robyn Young in Großbritannien und den USA ein großartiger Durchbruch, der sie auf die Bestsellerlisten schnellen ließ. Geboren 1975 in Oxford, begann sie schon früh, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Aber erst während eines Seminars in Creative Writing fand sie den Mut, ihre Ideen zu Die Blutschrift zu Papier zu bringen. Heute lebt Robyn Young in Brighton und wenn sie nicht gerade an einer historischen Trilogie schreibt, unterrichtet sie Creative Writing an verschiedenen Colleges.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Aus dem Gralsbuch:
Heller als die Sonne selbst erstrahlt Der See; das Wasser brodelnd schäumt Und obgleich jedes lebend Wesen Vergehen müsst in dieser Glut Erblickte Parsifal Geschöpfe dort Schwarz und grässlich anzuschauen Wie von der Hölle ausgespien Mit Flammenschwingen, Feuerklau’n Sich windend in dem gleißenden Schlund Doch am Ufer stand ein Ritter Gehüllt in einen Mantel weiß wie Schnee Auf der Brust ein blutrot’ Kreuz Er wandte sich zu Parsifal Zum See den Arm streckte er hin Alsdann erscholl laut sein Befehl Parsifal, bring nun dein Opfer dar!
Zu Stein erstarrt stand Parsifal Sein Herz ward schwer, nicht lassen mocht’ er Von dem Schatz in seiner Hand Erneut erklang des Ritters Stimme Diesmal laut wie Glockenhall Wir sind Brüder, Parsifal Ein Bruder dir nie Übles will
Wiedererlangt wird, was du verloren geglaubt Zum Leben erwacht, was tot du wähnst Und Parsifal, mit neu erstarktem Glauben Beugte sich vor, sprach ein Gebet Und warf die Schätze in den See Das Kreuz aus schwerem, purem Gold Den siebenarmigen Leuchter, aus Silber gehämmert Zuletzt den Halbmond aus dunklem Blei Der lautlos in der Flut versank
Dann plötzlich erfüllte Gesang die Luft Unirdische Stimmen, zu einer vereint Wehten vom Windhauch sachte getrieben Lockend über den Himmel hinweg Das Feuer des Sees erlosch alsbald Das Wasser lag klar und ruhig da Und ihm entstieg ein Mann aus Gold Mit silbernen Augen und jettschwarzem Haar Parsifal sank auf die Knie Von schierem, reinem Glück durchströmt Hob er den Kopf und rief dreimal Gelobt seist du, o Herr!
Erster Teil
1
Ayn Jalut (Teiche des Goliath), Königreich Jerusalem
3. September A. D. 1260
Die gleißende Sonnenscheibe näherte sich dem Zenit und verwandelte den satten Ockerton des Wüstensandes in das fahle Weiß ausgebleichter Knochen. Über den Kuppen der Hügel, die die Ebene von Ayn Jalut säumten, zogen Bussarde ihre Kreise; ihre heiseren Schreie hallten durch die glutheiße Luft. Am westlichen Rand der Ebene warteten zweitausend berittene Krieger geduldig auf das Zeichen zum Angriff. Obwohl ihre Überwürfe und Turbane ihnen wenig Schutz vor der erbarmungslos auf sie niederbrennenden Sonne boten, ließ keiner der Männer einen Laut der Klage vernehmen.
Baybars Bundukdari, der Befehlshaber des Bahri-Regiments, griff nach dem Wasserschlauch, der neben zwei Krummsäbeln, deren Klingen mit Kratzern und Kerben übersät waren, an seinem Gürtel hing. Nachdem er einen tiefen Schluck genommen hatte, rollte er die Schultern, um die verkrampften Muskeln zu lockern. Der Rand seines weißen Turbans war schweißdurchtränkt, und das Kettenhemd, das er unter seinem blauen Umhang trug, fühlte sich ungewöhnlich schwer an. Der Morgen verstrich, die Hitze nahm zu, und das Wasser hatte zwar Baybars’ ausgedörrte Kehle besänftigt, nicht aber den quälenden Durst zu stillen vermocht, der tief in seinem Inneren brannte.
»Amir Baybars«, murmelte ein jüngerer Offizier, der neben Baybars’ schwarzem Hengst an der Spitze der Truppe auf seinem Pferd saß. »Die Zeit verrinnt. Die Kundschafter müssten schon längst wieder hier sein.«
»Sie werden bald zurückkommen, Ismail. Hab Geduld.« Während Baybars den Wasserschlauch wieder an seinem Gürtel befestigte, ließ er den Blick über die Reihen des Bahri-Regiments schweifen, die hinter ihm Stellung bezogen hatten. Auf den Gesichtern aller Männer lag derselbe Ausdruck grimmiger Entschlossenheit, den er schon oft bei Kriegern kurz vor einer Schlacht gesehen hatte. Bald würde sich dies ändern. Baybars hatte schon die kühnsten Kämpfer erbleichen sehen, wenn sie sich einer feindlichen Armee gegenübersahen, die ihrer eigenen in jeder Hinsicht ebenbürtig war. Aber wenn die Zeit gekommen war, würden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen, denn sie waren Soldaten der Mameluckenarmee, der Sklavenkrieger Ägyptens.
»Amir?«
»Was gibt es, Ismail?«
»Wir haben seit dem Morgengrauen nichts mehr von den Kundschaftern gehört. Was, wenn sie gefangen genommen wurden?«
Als Baybars die Stirn runzelte, wünschte Ismail, er hätte den Mund gehalten.
Wie die meisten seiner Männer, so war auch Baybars hochgewachsen, schlank und sehnig; er hatte dunkelbraunes Haar und eine zimtfarbene Haut. Was ihn von der Masse der anderen abhob, war sein Blick, der aufgrund einer Fehlbildung in Form eines weißen Sterns in der Mitte seiner linken Pupille ungewöhnlich stechend wirkte, was ihm den Spitznamen eingetragen hatte, unter dem er bekannt war – die Armbrust. Der junge Offizier Ismail, den diese scharfen blauen Augen jetzt durchbohrten, kam sich vor wie eine Fliege, die in einem Spinnennetz zappelt.
»Ich habe doch eben gesagt, du sollst dich in Geduld fassen.«
»Ja, Amir.«
Baybars’ Blick wurde weicher, als Ismail betreten den Kopf senkte. Jahre zuvor hatte er selbst an vorderster Front seiner ersten Schlacht entgegengefiebert. Damals hatten die Mamelucken auf einer staubigen Ebene in der Nähe eines Dorfes namens Herbiya gegen die Franken gekämpft. Baybars hatte die Kavallerie befehligt, und innerhalb weniger Stunden hatten sie ihre Feinde vernichtend geschlagen, und das Blut der Christen war im Sand versickert. Mit Allahs Hilfe würde er heute einen ähnlich großen Sieg erringen.
In der Ferne stieg eine kleine Staubwolke von der Ebene auf und nahm langsam die von der flirrenden Hitze verzerrten Umrisse von sieben Reitern an. Baybars stieß seinem Pferd die Fersen in die Flanken und löste sich aus den Reihen seiner Krieger. Seine Offiziere folgten ihm.
Der Kundschaftertrupp kam rasch näher, der Anführer lenkte sein Pferd auf Baybars zu, zügelte es scharf und brachte es direkt vor seinem Kommandanten zum Stehen. Das Fell des Tieres glänzte vor Schweiß, Schaumflocken standen vor seinen Nüstern.
»Amir Baybars!« Der Reiter keuchte und rang mühsam nach Atem. »Die Mongolen kommen!«
»Wie groß ist ihre Armee?«
»Sie umfasst zehntausend Mann, Amir.«
»Und wer befehligt sie?«
»Falls wir denn richtig unterrichtet sind, wird sie von General Kitboga angeführt.«
»Haben sie euch gesehen?«
»Dafür haben wir gesorgt. Die Vorhut ist dicht hinter uns, der Hauptteil der Truppen auch gleich dahinter.« Der Kundschafter trieb sein Pferd näher an das von Baybars heran und dämpfte seine Stimme, sodass die anderen Offiziere Mühe hatten, seine Worte zu verstehen. »Sie sind uns zahlenmäßig überlegen, Amir, sie führen viele Kriegsgeräte mit sich, und wir haben in Erfahrung gebracht, dass diese Truppen nur ein Drittel der gesamten mongolischen Armee ausmachen.«
»Wenn du einem Ungeheuer den Kopf abschlägst, wird sein Leib sein Leben aushauchen«, erwiderte Baybars.
Der schrille Klang eines mongolischen Horns zerriss die Luft. Andere fielen ein; ein misstönender Chor, dessen Gesang von den Hügeln zu den Mamelucken hinüberwehte. Die Pferde, die die Anspannung ihrer Reiter spürten, begannen zu schnauben und unruhig mit den Hufen zu scharren. Baybars nickte dem Anführer der Kundschafter zu, dann wandte er sich an seine Offiziere. »Auf mein Zeichen leitet ihr den Rückzug ein.« Er sah Ismail an. »Du wirst an meiner Seite reiten.«
»Zu Befehl, Amir.« Die Augen des jungen Mannes leuchteten vor Stolz auf.
Einen Moment lang war außer dem Jaulen der Hörner in der Ferne und dem leisen Seufzen des Windes, der über die Ebene strich, kein Laut zu hören. Eine Staubwolke verdunkelte den Himmel im Osten, als die ersten Reihen der mongolischen Armee hoch oben auf den Hügeln auftauchten. Die Reiter verharrten kurz auf dem Gipfel, ehe sie sich wie eine dunkle Welle über die Ebene ergossen. Das Sonnenlicht fing sich in ihren Schwertern und ließ die stählernen Klingen hell aufblitzen.
Hinter der Vorhut rückte der Hauptteil der Armee auf den Feind vor, angeführt von mit Speeren und Bogen bewaffneten Reitertruppen, denen Kitboga selbst folgte. Der Mongolenführer wurde von Veteranenkriegern in ledernen Rüstungen und eisernen Helmen flankiert, die jeder zwei zusätzliche Pferde am Zügel führten. Hinter dieser Kolonne rollten Belagerungstürme und Karren voller Beutegut, das aus von den Mongolen überfallenen und ausgeplünderten Dörfern und Städten stammte. Diese Karren wurden von Frauen gelenkt, über deren Rücken große Jagdbogen hingen. Dschingis Khan, der Gründer des Mongolenreiches, war vor dreiunddreißig Jahren gestorben, doch sein Kampfgeist lebte in den Kriegern weiter, die jetzt im Begriff standen, die Mamelucken anzugreifen.
Baybars war seit Monaten auf diese entscheidende Schlacht vorbereitet, doch der glühende Wunsch nach Rache beherrschte ihn allerdings schon viel länger. Vor zwanzig Jahren waren die Mongolen in seine Heimat eingefallen, hatten das Land seines Stammes verwüstet und die Viehherden gestohlen. Zwanzig Jahre waren vergangen, seit seinem Volk keine andere Wahl geblieben war, als vor dem Angriff der Feinde zu fliehen und bei einem benachbarten Stammeshäuptling Schutz zu suchen, der sie dann verraten und an syrische Sklavenhändler verkauft hatte.Aber erst als vor einigen Monaten ein mongolischer Abgesandter in Kairo eingetroffen war, hatte sich Baybars eine Möglichkeit eröffnet, Vergeltung an den Menschen zu üben, die ihn unter das Joch der Sklaverei gezwungen hatten.
Der Abgesandte hatte den Mameluckensultan Kutus im Namen seines Herrn aufgefordert, sich dem mongolischen Herrscher zu unterwerfen, und diese Unverschämtheit hatte – zusammen mit dem letzten verheerenden Angriff der Mongolen auf die muslimisch regierte Stadt Bagdad – den Sultan endlich dazu bewogen, dem Feind die Stirn zu bieten. Die Mamelucken neigten vor keinem anderen als Allah das Haupt. Und während Kutus und seine militärischen Ratgeber, Baybars eingeschlossen, einen Schlachtplan entworfen hatten, war der mongolische Abgesandte vor den Mauern von Kairo bis zum Hals im Sand eingegraben worden, wo er Zeit hatte, über seine Fehler nachzudenken, bis die Bussarde ihr Werk vollendeten. Nun würde Baybars seinen ehemaligen Peinigern eine ähnliche Lektion erteilen.
Er wartete, bis die vordersten Linien der schweren Kavallerie die Ebene zur Hälfte hinter sich gelassen hatten, dann riss er sein Pferd herum, zog einen seiner Säbel aus der Scheide und schwang ihn hoch über seinem Kopf. Die Klinge blitzte im Sonnenlicht.
»Krieger von Ägypten!«, brüllte er. »Für uns ist der Tag der Rache gekommen! Mit Allahs Hilfe werden wir siegen, und der Berg der Leichen unserer Feinde wird höher als diese Hügel sein!«
»Für den Sieg!«, erscholl die Antwort der Soldaten des Bahri-Regiments. »Im Namen Allahs!«
Im nächsten Moment wandten sie sich wie ein Mann von der näher rückenden Armee ab und trieben ihre Pferde auf die Hügel zu. Die Mongolen, die dachten, der Feind würde außer sich vor Angst und Entsetzen die Flucht ergreifen, nahmen unter wüstem Gejohle die Verfolgung auf.
Die im Westen gelegene Hügelkette, die sich am Rand der Ebene entlangzog, war breit und niedrig und wurde von einer weiten Felsschlucht durchschnitten. Baybars und seine Männer sprengten durch diese Lücke, gefolgt von der Vorhut der Mongolen, die sich durch die von den Hufen der Mameluckenpferde aufgewirbelten Staubschwaden kämpften. Hinter ihnen drängte sich der Haupttrupp der feindlichen Armee durch die Schlucht. Der Boden erzitterte unter dem Hufgetrommel, Sand und Geröll lösten sich von den Hängen der Hügel und prasselten auf die Männer nieder. Auf ein Zeichen von Baybars hin zügelten die Krieger des Bahri-Regiments ihre Pferde, drehten sich zum Feind und versperrten ihm den Weg. Plötzlich hallten der Klang zahlreicher Hörner und das Donnern mächtiger Kesselpauken von den Felswänden wider.
Auf dem Hügelkamm oberhalb der Schlucht hob sich eine Gestalt dunkel vom Sonnenlicht ab: Kutus. Er war nicht allein. Auf den Hügeln und der Talsohle waren Tausende von Mameluckensoldaten aufmarschiert. Die Regimenter der Kavallerie, unter denen sich auch zahlreiche Bogenschützen befanden, trugen verschiedene Farben – Violett, Purpurrot, Orange und Schwarz. Sie erweckten den Eindruck, als sei der Hügel in einen bunten Flickenumhang gehüllt, auf dem die in der Sonne schimmernden Helme und Speerspitzen wie Silberstickerei wirkten. Mit Schwertern, Keulen und Bogen bewaffnete Infanteristen bezogen Schlachtaufstellung, und eine kleine, aber todbringende Gruppe aus Beduinen und kurdischen Söldnern, die sieben Fuß lange Speere in den Händen hielten, flankierte die Flügel dieser Armee.
Die Mongolen waren in Baybars’ Falle gefangen. Nun brauchte er die Schlinge nur noch zuzuziehen.
Auf die Hörnerfanfaren folgte der Kriegsruf der Mamelucken, ein vielstimmiges Gebrüll aus Tausenden von Kehlen, das einen Moment lang sogar das Trommelgedröhn übertönte. Dann ging die Mameluckenkavallerie zum Angriff über. Einige Pferde glitten auf den Hängen aus, stürzten zu Boden und warfen ihre Reiter ab, deren Schreie im Donnern der Hufe untergingen. Zwei Mameluckenregimenter jagten über die Ebene von Ayn Jalut, um den Rest der mongolischen Truppen in die Schlucht zu treiben. Baybars wirbelte seinen Säbel über dem Kopf und stieß erneut einen Schlachtruf aus, in den seine Männer einstimmten.
»Allahu akbar! Allahu akbar!«
Die beiden Armeen trafen in einem Gewirr aus Staub, Schreien und Waffengeklirr aufeinander. Innerhalb der ersten Sekunden fielen auf beiden Seiten Hunderte von Männern, der Boden war mit Leichen übersät, über die die Kämpfer, die noch auf den Beinen waren, ständig zu stolpern drohten. Pferde bäumten sich auf, Blutfontänen schossen in die Luft, die von den qualvollen Schreien der Sterbenden erfüllt war. Die Mongolen waren für ihre Reitkünste berühmt, konnten ihr Geschick aber in der schmalen Schlucht nicht optimal zum Einsatz bringen. Während die Mamelucken sie erbarmungslos zurücktrieben, verhinderte ein berittener Beduinentrupp, dass die mongolische Vorhut ihre Flanken umging. Ein Pfeilhagel ergoss sich von den Hängen der Hügel über die Mongolen. Immer wieder loderten orangefarbene Flammenbälle im Kampfgetümmel auf, wenn eines der mit Naphta gefüllten Tongefäße, die die Mamelucken auf ihre Feinde schleuderten, an der Rüstung eines Gegners zerschellte. Die von diesen Wurfgeschossen getroffenen Mongolen gingen schrill kreischend in Flammen auf, ihre Pferde stürmten blindlings mit ihnen davon und lösten Chaos in den Reihen der Soldaten aus.
Baybars holte mit seinem Säbel zu einem gewaltigen Hieb aus, der seinem Gegner den Kopf vom Rumpf trennte. Ein anderer Mongole, dessen Gesicht mit dem Blut seiner gefallenen Kameraden bespritzt war, nahm augenblicklich den Platz des Getöteten ein. Baybars’ Klinge pfiff durch die Luft, sein Pferd begann, nervös unter ihm zu tänzeln, da es von allen Seiten von immer mehr Kriegern bedrängt wurde, die sich unter wüstem Geschrei in den Kampf stürzten. Ismail kämpfte an Baybars’ Seite, seine Kleider waren blutdurchtränkt, und seine Augen glühten triumphierend, als er sein Schwert durch das Visier eines mongolischen Helms stieß. Die Klinge grub sich in den Schädel des Mannes und blieb dort stecken. Ismail riss sie mit einem Ruck heraus, dann wandte er sich dem nächsten Gegner zu.
Baybars’ Säbel schien in seinen Händen zu tanzen. Mit machtvollen Hieben streckte er einen feindlichen Krieger nach dem anderen nieder.
Der mongolische General Kitboga setzte sich erbittert zur Wehr, schwang wild sein Schwert, trennte Gliedmaßen ab und spaltete Köpfe, und obgleich er von Feinden umzingelt war, schien niemand ihm gefährlich werden zu können. Baybars’ Gedanken kreisten um die Belohnung, die denjenigen erwartete, der den gegnerischen Kriegsherrn tötete oder gefangen nahm, aber es gelang ihm nicht, sich zu Kitboga durchzuschlagen, ein Wall aus Leibern und aufblitzenden Schwertern versperrte ihm den Weg. Er duckte sich, als ein junger Mann mit einer Keule auf ihn eindrang, vergaß den General und konzentrierte sich darauf, selbst am Leben zu bleiben.
Nachdem die vorderen Kriegerreihen entweder gefallen oder zurückgetrieben worden waren, oblag es nun den mongolischen Frauen und Kindern, den Männern beizustehen. Obgleich die Mamelucken wussten, dass die Frauen und Töchter der Mongolen zusammen mit den Männern in die Schlacht zu ziehen pflegten, zögerten einige der Soldaten, sie anzugreifen, dabei kämpften die Frauen mit ihren langen, wirren Haarmähnen und den vor Hass verzerrten Gesichtern ebenso tapfer und vielleicht noch ergrimmter als die Krieger. Ein Mameluckenkommandant, der um die Kampfmoral seiner Truppen fürchtete, erhob seine Stimme und stieß einen durchdringenden Schlachtruf aus, in den seine Männer augenblicklich einfielen. Der Name Allahs erfüllte die Luft, wurde von den Hügeln zurückgeworfen, hallte in den Ohren der Mamelucken wider und verlieh ihren Armen neue Kraft. Für die Sklavenkrieger verwandelte sich die Mongolenarmee in ein gesichts-, alters- und geschlechtsloses Untier, das es zu vernichten galt. Mit wieder erwachtem Mut stießen sie ihm ihre Schwerter in den Leib.
Doch allmählich erlahmten ihre Schwertarme; die aus dem Sattel geworfenen und in tödliche Zweikämpfe verstrickten Männer stützten sich gegenseitig, während sie die Hiebe der Gegner parierten. Die Mongolen hatten – in der Hoffnung, eine Bresche in die Reihen der Mamelucken zu schlagen – einen letzten Sturmangriff gegen die Infanterie geführt, aber die Fußsoldaten hatten sich gegen sie behauptet, und nur ein paar vereinzelten Reitern war es gelungen, die Linie der Speerkämpfer zu durchbrechen, woraufhin sie von der Mameluckenkavallerie gestellt und zu Allah geschickt worden waren. Auch Kitboga war gefallen; die siegreichen Mamelucken hatten ihm den Kopf abgeschlagen und stellten ihn nun stolz vor den Resten seiner Truppen zur Schau. Die Mongolen, einst der Schrecken aller Völker, standen im Begriff, die Schlacht zu verlieren, und wichtiger noch – sie wussten es.
Baybars’ Pferd war von einem Pfeil in den Hals getroffen worden und hatte ihn abgeworfen. Er kämpfte nun zu Fuß weiter, seine Stiefel starrten bereits vor Blut. Das Blut war überall, es hing in der Luft, klebte kupfrig in seinem Mund, tropfte aus seinem Bart und verschmierte die Griffe und Klingen seiner Säbel. Er holte aus und drang auf einen neuen Gegner ein. Der Mongole brach mit einem Schrei, der ein abruptes Ende fand, im Sand zusammen, und als keiner seiner Kameraden seinen Platz einnahm, hielt Baybars einen Moment inne.
Staubwolken verdunkelten die Sonne und verliehen der Luft eine trübgelbe Farbe. Ein Windstoß trieb die Wolken auseinander, und da sah Baybars hoch oben an den Belagerungstürmen und an den Karren der Mongolen weiße Fahnen wehen; das Zeichen, dass der Feind bereit war, sich zu ergeben. Er blickte sich um. Überall stapelten sich die Leichen, ein Übelkeit erregender Gestank nach Blut und aufgeschlitzten Eingeweiden hatte sich wie eine Decke über das Schlachtfeld gelegt. Hoch oben am Himmel schwebten bereits die ersten Geier und verliehen ihrer Hoffnung auf ein üppiges Mahl laut krächzend Ausdruck. Zwischen den ledernen Brustpanzern der gefallenen Mongolen leuchteten die bunten Umhänge der Mamelucken auf. Baybars schritt langsam von einem Leichnam zum nächsten.Am Rande des Schlachtfeldes entdeckte er Ismail; der junge Offizier lag rücklings im Schmutz, seine gebrochenen Augen starrten blicklos gen Himmel. Ein mongolisches Schwert ragte aus seiner Brust.
Baybars beugte sich über ihn, schloss seine Lider und murmelte ein leises Gebet, dann richtete er sich auf, als einer seiner anderen Offiziere seinen Namen rief. Der Krieger blutete aus einer tiefen Schnittwunde an der Schläfe, seine Augen flackerten wild. »Amir«, stieß er heiser hervor. »Wie lauten deine Befehle?«
Baybars sog das Bild der Verwüstung, das sich ihm ringsum bot, in tiefen Zügen in sich ein. Innerhalb weniger Stunden hatten sie der mongolischen Armee eine verheerende Niederlage beigebracht und über siebentausend feindliche Krieger getötet. Einige Mamelucken waren auf die Knie gesunken und schluchzten vor Erleichterung, aber die meisten brachen in triumphierenden Jubel aus, während sie auf die Überlebenden des Massakers zustürmten, die sich um die umgestürzten Karren geschart hatten. Baybars wusste, dass er seine Männer zurückhalten musste, sonst würden sie beginnen, die Toten auszuplündern und die noch Lebenden zu töten. Die überlebenden Mongolen, vor allem die Frauen und Kinder, würden auf den Sklavenmärkten einen guten Preis erzielen. Er wandte sich an den Offizier und deutete zu den Karren hinüber. »Sorge dafür, dass kein Gefangener getötet wird. Wir brauchen Sklaven, die wir verkaufen können, keine Toten, die wir verbrennen müssen.«
Der Offizier eilte davon, um den Befehl auszuführen. Baybars schob seinen Säbel in die Scheide zurück und hielt nach einem reiterlosen Pferd Ausschau. Endlich fand er ein verirrtes Tier mit blutbeflecktem Zaumzeug, schwang sich in den Sattel und ritt zu seinen Truppen hinüber. Ringsum erteilten die anderen Mameluckenkommandanten ihren Regimentern knappe Anweisungen. Baybars musterte die erschöpften, aber dennoch grimmig entschlossenen Gesichter seiner Bahri-Soldaten und spürte einen Anflug überschäumender Freude in sich aufsteigen. »Brüder!«, rief er laut, obwohl die Worte in seiner ausgetrockneten Kehle brannten. »Allah hat uns heute einen glorreichen Sieg geschenkt! Gepriesen sei sein Name!« Er hielt inne, als tosender Jubel aufbrandete, dann gebot er seinen Männern mit erhobener Hand Schweigen. »Aber die Siegesfeier muss warten, denn es gibt noch viel zu tun. Versammelt euch jetzt bei euren Offizieren.«
Der Jubel hielt unvermindert an, doch die Truppen begannen, sich neu zu formieren. Baybars winkte zwei seiner Offiziere zu sich. »Ich möchte, dass die Leichen unserer Männer noch vor Sonnenuntergang begraben werden. Verbrennt die gefallenen Mongolen und sucht die Umgebung nach Flüchtigen ab. Schafft die Verwundeten in unser Lager. Ich werde später dort zu euch stoßen.« Sein Blick schweifte suchend über das Schlachtfeld. »Wo ist der Sultan?«
»Er ist vor einer Stunde zum Lager zurückgekehrt, Amir«, erwiderte einer der Offiziere. »Er wurde im Kampf verwundet.«
»Schwer?«
»Nein, Amir, ich glaube, er hat nur ein paar Kratzer davongetragen. Seine Ärzte sind bei ihm.«
Baybars entließ die beiden Männer und lenkte sein Pferd zu den Gefangenen, die gerade zusammengetrieben und gefesselt wurden. Die Mamelucken durchsuchten die Karren und warfen alles, was für sie irgendwie von Wert war, auf einen stetig wachsenden Haufen auf dem blutroten Sand. Ein gellender Schrei ertönte, als zwei Soldaten drei Kinder aus ihrem Versteck unter einem Leiterwagen hervorzerrten. Eine Frau, vermutlich die Mutter, sprang auf und rannte auf sie zu. Obwohl ihre Hände auf dem Rücken gefesselt waren, stürzte sie sich wie eine Wildkatze auf die Soldaten, spuckte sie an und trat mit ihren bloßen Füßen nach ihnen. Einer der Männer versetzte ihr einen Fausthieb gegen die Schläfe und schleifte sie und zwei der Kinder dann an den Haaren zu den anderen Gefangenen hinüber. Baybars hatte die Szene stumm beobachtet. Jetzt ruhte sein Blick auf einem kleinen Jungen, der starr vor Angst und Entsetzen vor ihm kniete. In den weit aufgerissenen Augen des Kindes erkannte er sich selbst vor zwanzig Jahren wieder.
Baybars, als Türke an der Schwarzmeerküste geboren, hatte vor der Invasion keine Ahnung von solchen Dingen wie Krieg und Sklaverei gehabt. Doch dann war er von seiner Familie getrennt und auf einem syrischen Sklavenmarkt verkauft worden und hatte vier verschiedenen Herren gehorchen müssen, ehe er von einem Offizier der ägyptischen Armee erworben und nach Kairo gebracht worden war, um dort als Sklavenkrieger zu dienen. Zusammen mit zahlreichen anderen für die Truppen des Sultans bestimmten Jungen wurde er einem Mameluckenlager am Nil zugeteilt, wo er Kleider und Waffen erhielt und eine strenge militärische Ausbildung absolvierte. Jetzt, im Alter von siebenunddreißig Jahren, befehligte er das angesehene Bahri-Regiment. Doch auch wenn er nun Truhen voller Gold und eigene Sklaven besaß, verging kein Tag, an dem er nicht an jenes erste bittere Jahr in der Knechtschaft zurückdachte.
Baybars wandte sich an einen der Männer, die die Gefangenen bewachten. »Achte darauf, dass die gesamte Beute unangetastet ins Lager geschafft wird. Jeder, der den Sultan bestiehlt, wird es bereuen. Zerschlagt die beschädigten Karren und benutzt das Holz, um Scheiterhaufen zu errichten. Alle anderen nehmt ihr mit.«
»Wie du befiehlst, Amir.«
2
St.-Martins-Tor, Paris
3. September A. D. 1260
Der junge Schreiber hetzte die Gasse entlang. Sein Atem kam in kurzen, abgehackten Zügen, seine Füße glitten in den schleimigen Unratpfützen aus, die den Boden bedeckten; der Gestank menschlicher Exkremente und faulenden Fleisches würgte ihn in der Kehle. Er stolperte, hielt sich an der rauen Wand des Gebäudes neben ihm fest, richtete sich auf und rannte weiter. Zu seiner Linken erhaschte er zwischen den Häusern hindurch einen Blick auf die pechschwarze Seine. Der Himmel im Osten verfärbte sich bereits rötlich, das erste schwache Tageslicht spiegelte sich in den Fenstern des Turms von Notre-Dame wider, doch in dem Labyrinth der Gassen, die zwischen den Lagerhäusern und Wohngebäuden verliefen, war es noch immer stockfinster. Der Schreiber wandte sich vom Fluss ab und lief auf das St.-Martins-Tor zu. Sein Haar klebte ihm schweißnass am Kopf. Immer wieder blickte er verstohlen über die Schulter, aber niemand folgte ihm, und die einzigen Schritte, die er hörte, waren seine eigenen.
Sowie er das Buch übergeben hatte, war er frei. Wenn die Glocken zur Prim läuteten, würde er schon auf dem Weg nach Rouen in ein neues Leben sein. Am Anfang einer Gasse blieb er nach Atem ringend stehen und presste eine Hand auf seine schmerzende Seite. Mit der anderen umklammerte er ein in vellum gebundenes Buch. Aus den Augenwinkeln heraus nahm er eine schattenhafte Bewegung wahr. Ein hochgewachsener Mann in einem grauen Umhang war am anderen Ende der Gasse aufgetaucht und kam nun auf ihn zu. Der junge Schreiber wirbelte herum und ergriff die Flucht.
Er jagte Haken schlagend zwischen den Häusern hindurch, nur darauf bedacht, dem Geräusch der Schritte hinter sich zu entkommen. Doch sein Verfolger zeigte sich hartnäckig, die Distanz zwischen ihnen wurde immer geringer. Vor ihm ragte die Stadtmauer auf. Seine Hand schloss sich fester um das Buch. Wenn man es bei ihm fand, musste er mit harter Strafe, vielleicht sogar dem Todesurteil rechnen, aber ohne Beweise würde man ihn nicht überführen können. Der Schreiber hastete einen schmalen Weg zwischen zwei Reihen von Geschäften hinunter. Vor der Hintertür eines Weinhändlers standen ein paar säuberlich aufgereihte Fässer. Wieder spähte der junge Mann über die Schulter. Er hörte die Schritte seinesVerfolgers, konnte den Mann aber noch nicht sehen. Rasch ließ er das Buch hinter eines der Fässer fallen und rannte weiter. Er konnte es sich ja später wiederholen, wenn ihm jetzt die Flucht gelang.
Sie gelang nicht.
Drei Straßen weiter wurde der Schreiber vor dem Laden eines Fleischers, wo der Boden von den Schlachtungen des Vortages noch immer rot verfärbt war, von dem Mann in dem fadenscheinigen grauen Umhang eingeholt. Er schrie auf, als sein Häscher ihn hart gegen die Wand stieß.
»Gib es mir!« Der Unbekannte sprach mit einem starken Akzent, und obwohl er sich die Kapuze seines Umhangs tief in die Stirn gezogen hatte, konnte er seine dunkle Haut nicht verbergen.
»Seid Ihr des Wahnsinns? Lasst mich gehen!«, keuchte der Schreiber, während er sich aus dem Griff seines Angreifers zu befreien versuchte.
Dieser zückte einen Dolch. »Ich habe keine Zeit für Spielchen. Gib mir das Buch!«
»Tötet mich nicht! Bitte nicht!«
»Wir wissen, dass du es gestohlen hast.« Der andere Mann hob den Dolch drohend.
Der Schreiber rang zitternd nach Atem. »Ich musste es tun! Er sagte, er würde mich sonst… o Gott!« Er ließ den Kopf hängen. Tränen rannen ihm über die Wangen. »Ich will nicht sterben!«
»Wer hat dich beauftragt, es zu stehlen?«
Doch der Schreiber gab keine Antwort, sondern schluchzte nur erstickt auf.
Der Angreifer schnaubte unmutig, trat einen Schritt zurück und schob den Dolch in die Scheide. »Dir wird nichts geschehen, wenn du mir jetzt sagst, was ich wissen will.«
Der junge Mann hob den Kopf und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Ihr seid mir vom Ordenshaus aus gefolgt?«
»So ist es.«
»Der Bruder, den ich … Jean? Ist er…?« Der Schreiber brach ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen.
»Er lebt.«
Der junge Mann stieß erleichtert den Atem aus.
Irgendwo hinter ihnen klirrte etwas. Die Gestalt in Grau fuhr herum und spähte ins Dunkel. Als er nichts Verdächtiges entdecken konnte, wandte er sich wieder an den Schreiber. »Gib mir das Buch, und dann gehen wir gemeinsam zum Ordenshaus zurück. Wenn du mir die Wahrheit sagst, passiert dir nichts. Und jetzt verrate mir, wer dich gezwungen hat, es zu stehlen.«
Der Schreiber zögerte, rang kurz mit sich und setzte dann zu einer Antwort an. Im selben Moment ertönte ein scharfes Klicken, gefolgt von einem sirrenden Geräusch. Der Mann in Grau duckte sich instinktiv. Eine Sekunde später bohrte sich ein Armbrustbolzen in den Hals des Schreibers. Dessen Augen weiteten sich, aber er gab keinen Laut von sich, als er in sich zusammensank und reglos am Boden liegen blieb. Der Mann in Grau drehte sich um und sah gerade noch eine schemenhafte Gestalt über die Dächer über ihnen huschen und im Dunkel verschwinden. Fluchend beugte er sich über den Schreiber. »Wo hast du das Buch versteckt? Wo?«
Der junge Mann öffnete den Mund. Ein Blutstrom quoll zwischen seinen Lippen hervor, dann kippte sein Kopf nach hinten, und er rührte sich nicht mehr. Wieder stieß der Mann in Grau einen unterdrückten Fluch aus, dann begann er, den Toten zu durchsuchen, obwohl dieser offensichtlich nichts bei sich hatte als die Kleider, die er am Leib trug. Als er Stimmen hörte, hielt er inne und hob den Kopf. Drei Männer kamen die Gasse entlang. Sie trugen die scharlachroten Umhänge der Stadtwache.
»Wer ist da?«, brüllte einer, seine Fackel hebend. Die Flammen flackerten im leisen Wind und beleuchteten eine dunkle Gestalt, die sich über etwas am Boden Liegendes beugte. »Du da! Was tust du da?«
Der Mann in Grau sprang auf, missachtete den Befehl, sofort stehen zu bleiben, und ergriff die Flucht.
»Ihm nach!«, wies der Wächter mit der Fackel seine Kameraden an, trat auf das Bündel am Boden zu und fluchte, als das Licht auf die schwarze Tunika des toten Schreibers fiel. Auf der Brust prangte das rote Kreuz der Tempelritter.
Ein paar Straßen entfernt saß ein Weinhändler namens Antoine de Pont-Evêque über seinen Abrechnungen. Er stand auf, als er das Stimmengewirr hörte, öffnete die Hintertür und spähte neugierig hinaus. Die Gasse lag verlassen da, der Himmel über den Dächern nahm bereits eine fahle Farbe an. Die Stimmen verklangen. Antoine gähnte herzhaft, wandte sich ab, um wieder ins Haus zu gehen, blieb aber stehen, als er etwas auf dem Boden entdeckte. Es war halb hinter einer Reihe leerer Fässer verborgen, und vermutlich hätte er es gar nicht bemerkt, wenn sich das Licht nicht schimmernd darin gefangen hätte. Leise grunzend bückte sich Antoine und hob den Gegenstand auf. Es war ein Buch, ziemlich dick und in poliertes vellum gebunden. Auf dem Einband prangte eine in Blattgold eingestanzte Aufschrift. Antoine konnte die Worte nicht lesen, aber das Buch war meisterhaft gearbeitet, und er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand ein so kostbares Besitzstück einfach verloren hatte. Flüchtig erwog er, es an seinen Platz zurückzulegen, doch dann blickte er sich schuldbewusst nach allen Seiten um, griff danach, kehrte mit dem Buch in seinen Laden zurück, schloss die Tür und legte seinen Fund auf ein staubiges Regal hinter seiner Theke. Dann setzte er sich wieder an den Tisch, um mit seiner Buchführung fortzufahren. Er würde seinen Bruder fragen, was ihm da in die Hände gefallen war, wenn der Halunke sich wieder einmal bei ihm blicken ließ.
Neuer Tempel, Ordenshaus London,
3. September A. D. 1260
Im Kapitelsaal des Neuen Tempels hatte sich eine Gruppe Ritter zusammengefunden, um eine Aufnahmezeremonie zu vollziehen. Schweigend saßen sie auf ihren Bänken und blickten auf ein Podest, auf dem ein Altar stand. Vor diesem kniete ein achtzehnjähriger Sergeant, er kehrte den Rittern den Rücken zu und hielt den Kopf gesenkt; die schwarze Tunika hatte er abgelegt. Seine bloße Brust glänzte bernsteinfarben im Kerzenlicht. Die flackernden Flammen vermochten die dunkle Innenkammer nur unzureichend zu erleuchten, der größte Teil der Versammlung blieb in Schatten getaucht. Von zwei schwarz gekleideten Geistlichen gestützt, stieg ein Priester die Stufen zum Podest empor. Er hielt ein in Leder gebundenes Buch in Händen. Seine Helfer begannen, den Altar herzurichten. Nachdem sie die heiligen Gefäße darauf aufgebaut hatten, traten sie hinter den Altar zurück, wo zwei wie alle Templer in weiße Überwürfe mit einem roten Kreuz auf der Brust gekleidete Ritter warteten.
Der Priester räusperte sich, dann wanderte sein Blick über die schweigende Menge hinweg. »Ecce quam bonum et quam jocundum habitare fratres in unum.«
»Amen«, erwiderte ein Stimmenchor.
Der Priester senkte den Kopf. »Im Namen unseres Herrn Jesus Christus und im Namen der Muttergottes heiße ich euch willkommen, meine Brüder. Wir haben uns hier versammelt, um ein heiliges Ritual zu vollziehen, und so lasst uns beginnen.« Er richtete den Blick auf den knienden Sergeanten. »Sage mir nun, was dich hergeführt hat.«
Der Sergeant hatte Mühe, sich an die vorgeschriebenen Worte zu erinnern, die ihm während seiner Nachtwache eingeschärft worden waren. »Ich bin gekommen, um mich mit Leib und Seele dem Templerorden zu verschreiben.«
»In wessen Namen?«
»Im Namen Gottes und im Namen des Hugues de Payns, des Gründers unseres heiligen Ordens, der einem Leben in Sünde und Ausschweifung entsagte …« Der Sergeant hielt inne. Sein Herz hämmerte wie wild. »Und der den Mantel anlegte und sich auf einen Kreuzzug nach Outremer begab, des Landes jenseits des Meeres, um dort die Ungläubigen mit Feuer und Schwert zu bekämpfen, und der dortselbst schwor, fortan dafür Sorge zu tragen, dass keinem christlichen Pilger auf seinem Weg durch das Heilige Land ein Leid geschieht.«
»Bist du bereit, den Mantel zu nehmen, wohl wissend, dass du damit all deinen weltlichen Pflichten entsagst, um ein treuer, demütiger Diener Gottes des Allmächtigen zu werden?«
Nachdem der Sergeant dies bejaht hatte, nahm der Priester einen irdenen Topf vom Altar und gab den Inhalt behutsam in ein goldenes Weihrauchfass. Ein würziger Duft verbreitete sich im Raum, als eine kleine Rauchwolke von dem Gefäß aufstieg. Der Priester wich leise hüstelnd einen Schritt zurück, die beiden hinter ihm wartenden Ritter traten vor.
Einer der beiden zog ein Schwert aus der Scheide und deutete damit auf den Sergeanten. »Bruder, du fragst nach einer großen Sache, denn von unserem Orden siehst du nur die äußere Erscheinung, aber du kennst nicht die harten Gebote, die dahinter stehen. Es ist schmerzvoll für dich, der du dein eigener Herr bist, dich zum Leibeigenen anderer zu machen, denn nur mit großen Schwierigkeiten wirst du jemals tun können, was du wünschst. Sofern du nämlich wünschst, im Land diesseits des Meeres zu sein, dann wirst du auf die andere Seite geschickt; wenn du essen willst, wirst du hungrig bleiben müssen; und wenn du zu schlafen wünschst, dann wirst du geweckt werden. Gelobst du, dich diesen Geboten zu unterwerfen, zum Ruhme Gottes und um deines Seelenheils willen?«
»Ich gelobe es«, erwiderte der Sergeant leise.
»Dann beantworte jetzt wahrheitsgemäß unsere Fragen.«
Die Ritter kehrten zu ihren Plätzen zurück, und der Priester begann, aus dem Buch vorzulesen. Seine Worte hallten von den Wänden des Kapitelsaals wider. »Bist du ein wahrhaftiger Anhänger des christlichen Glaubens und der Lehren der Kirche Roms? Bist du der Sohn eines Ritters, und wurdest du ehelich geboren? Hast du irgendeinem Mitglied dieses Ordens ein Geschenk gemacht, auf dass es sich für deine Aufnahme in den Orden verwende? Bist du gesund an deinem Leibe und leidest an keiner verborgenen Krankheit, die dich daran hindert, dem Orden mit all deiner Kraft zu dienen?«
Der Sergeant gab auf jede Frage eine klare, deutliche Antwort. Endlich neigte der Priester den Kopf. »Nun gut, so sei es.« Er reichte das Buch einem der Geistlichen, der damit zu dem Sergeanten trat und es ihm hinhielt.
»Blicke auf die Regel unseres Ordens, aufgestellt mit der Hilfe des heiligen Bernard de Clairvaux, dessen Geist in uns weiterlebt«, intonierte er. »Schwöre, dich an die hier niedergeschriebenen Gebote zu halten. Schwöre, dem Orden stets treu zu dienen und widerspruchslos jeden Befehl auszuführen, der dir erteilt wird, vorausgesetzt, dieser Befehl kommt direkt von einem Offizial unseres Ordens, als da sind erstens der Großmeister, der von seinem Sitz in der Stadt Akkon über uns wacht; dann der Visitator des Königreiches Frankreich; die Kommandanten unserer westlichen Festungen; der Marschall; der Seneschall und die Ordensmeister aller Königreiche des Ostens und des Westens, in denen wir Ordenshäuser unterhalten. Ferner wirst du deinen Befehlshabern im Kampf sowie den Meistern aller Ordenshäuser gehorchen, in die du geschickt wirst. Vergiss nie, dass deine Loyalität von nun an nur deinen Waffenbrüdern gilt, denn das Band, das dich fortan mit uns verbindet, ist dicker als Blut. Schwöre, dass du ein Leben in Keuschheit führen und keinerlei Besitztümer außer denen, die dir deine Ordensmeister zuteilen, dein Eigen nennen wirst. Schwöre, dass du dich mit Leib und Seele unserem Kampf in Outremer, dem Heiligen Land, verschreibst und alle Festungen und Ordenshäuser der Templer in Jerusalem unter Einsatz deines Lebens gegen unsere Feinde verteidigst. Und zuletzt schwöre, den Orden nie zu verlassen, denn der heilige Eid, den du nun leistest, bindet dich vor dem Angesicht Gottes auf ewig an uns.«
Der Sergeant legte eine Hand auf das Buch und schwor mit fester Stimme, sich an all die ihm auferlegten Gebote zu halten.
Der Geistliche stieg die Stufen zum Altar hinauf, legte das ledergebundene Buch darauf und zog sich wieder zurück. Der Priester griff beinahe ehrfürchtig nach einem kleinen schwarzen, mit Goldintarsien verzierten Kästchen, klappte den Deckel auf und entnahm ihm eine Kristallphiole, in der sich das Kerzenlicht fing.
»Blicke auf das Blut Christi«, murmelte er. »Drei Tropfen davon sind in diesem Gefäß eingeschlossen, das unser Ordensgründer Hugues de Payns vor nunmehr zweihundert Jahren aus der Grabeskirche zu uns gebracht hat. Blicke darauf, gehe in dich und triff dann deine Entscheidung.«
Ein Raunen ging durch die Menge. Der Sergeant erschauerte. Von diesem Teil der Zeremonie hatte ihm niemand etwas gesagt.
»Ich frage dich nun ein letztes Mal. Bist du bereit, in unsere Gemeinschaft einzutreten?«
»Ich bin bereit.«
»Dann neige dein Haupt vor diesem Altar und erflehe den Segen von Gott unserem Herrn, der Jungfrau Maria und allen Heiligen.«
Will Campbell verfolgte, die Wange gegen die Mauer gepresst, wie sich der Sergeant zu Boden warf und die Arme ausbreitete, sodass sie dem Kreuz auf den Mänteln der Ritter glichen. Will, der groß für seine dreizehn Jahre war, spürte, wie seine Beine allmählich taub wurden. Er hockte zusammengekrümmt vor einem Ritz in der Wand, die den Kapitelsaal und den Lagerraum trennte, in dem die Küchenvorräte aufbewahrt wurden, und spähte angestrengt in das Halbdunkel. Ein muffiger Gestank nach Mäusekot und schimmeligem Getreide hing in der Luft. Die zwei großen Säcke, zwischen die er sich gequetscht hatte, boten nur dürftigen Schutz vor der Kälte, die dem Steinboden entströmte, und vor möglicher Entdeckung.
»Hast du jetzt genug gesehen?«
Will löste die Wange von der Wand und sah den stämmigen Jungen an, der gegen einen Sack Mehl gelehnt hinter ihm kauerte. »Wieso fragst du? Sollen wir die Plätze tauschen?«
»Nein«, knurrte der andere, seine Beine massierend. »Ich will endlich hier weg.«
Will schüttelte den Kopf. »Du willst dir diese Gelegenheit entgehen lassen? Noch nicht einmal…« Er brach ab, runzelte die Stirn und suchte fieberhaft nach einem überzeugenden Beispiel. »Noch nicht einmal der Papst ist je Zeuge einer solchen Aufnahmezeremonie gewesen. Sie ist das am besten gehütete Geheimnis dieses Ordens, Simon!«
»Ein Geheimnis, ganz recht.« Simon schnalzte mit der Zunge. »Und dafür gibt es mit Sicherheit einen guten Grund. Niemand darf davon wissen. Nur den Rittern und Priestern ist es gestattet, daran teilzunehmen – dir nicht.« Er stampfte mit dem Fuß auf. »Außerdem schlafen mir gleich die Beine ein.«
Will verdrehte die Augen. »Dann geh doch. Wir sehen uns später.«
»Ja, durch die Gitterstäbe eines Verlieses vermutlich. Hör halt ein einziges Mal auf einen Älteren!«
»Auf einen Älteren?«, höhnte Will. »Du bist doch nur ein Jahr älter als ich.«
»Aber zwanzig Jahre vernünftiger.« Simon tippte sich gegen die Stirn, dann verschränkte er seufzend die Arme vor der Brust. »Nein, ich bleibe. Irgendjemand muss ja auf dich aufpassen.«
Erneut spähte Will durch den Ritz. Der Prister stieg gerade mit einem Schwert in den Händen von dem Podest herunter, der barbrüstige Sergeant erhob sich, hielt aber den Kopf gesenkt.
Will hatte sich im Geiste schon unzählige Male ausgemalt, wie er selbst dieses Schwert in Empfang nahm und es in die Scheide an seinem Gürtel schob, aber am lebhaftesten hatte er sich immer vorgestellt, wie die Hand seines Vaters fest auf seiner Schulter ruhte, während er in die Gemeinschaft der Tempelritter aufgenommen und in den weißen Mantel gekleidet wurde, das Symbol dafür, dass er von all seinen Sünden gereinigt war.
»Ich habe gehört, dass sie in manchen Ordenshäusern Bogenschützen auf den Dächern postieren, wenn diese Zeremonie stattfindet«, fuhr Simon fort; dabei schlug er mit der Faust gegen eine Ausbeulung in dem Sack, die sich in seinen Rücken gebohrt hatte. »Wenn sie uns erwischen, erschießen sie uns wahrscheinlich.«
Will gab keine Antwort.
Simon grunzte unwillig. »Oder sie schließen uns aus.« Wieder hieb er auf den Sack ein. »Vielleicht schicken sie uns sogar nach Merlan.« Bei der Vorstellung wurde er blass. Als er vor einem Jahr in dem Ordenshaus eingetroffen war, hatte ihm ein älterer Sergeant von Merlan erzählt. Das in Frankreich gelegene Templergefängnis war berüchtigt, und die Beschreibung des Sergeanten hatte bei Simon einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
»Nach Merlan kommen nur Verräter und Mörder«, murmelte Will, ohne den Blick von dem Priester abzuwenden.
»Und Spione.«
Mit einem Ruck flog die Küchentür auf, helles Sonnenlicht erfüllte den Nebenraum und drang durch die Risse in Wand und Tür auch in das Lager. Will duckte sich, Simon zwängte sich neben ihm zwischen die Säcke, als sich ihnen schwere Schritte näherten. Ein Klirren ertönte, gefolgt von einem unterdrückten Fluch und einem kratzenden Geräusch. Ohne auf Simon zu achten, der warnend den Kopf schüttelte, kroch Will aus seinem Versteck, schlich zur Tür und blinzelte durch einen Ritz im Holz.
Die Küche war ein langer, rechteckiger, von zwei langen Bankreihen geteilter Raum. In dem riesigen gemauerten Kamin an einem Ende in der Nähe der Türen prasselte ein Feuer. An den Wänden entlang verliefen mit Schalen, Tiegeln und Krügen vollgestopfte Regale, auf dem Boden stapelten sich Alefässer und Körbe mit Gemüse, und an den Deckenbalken waren Haken befestigt, an denen Kaninchen, eingesalzene Schweinskeulen und getrocknete Fische hingen. Vor einer der Bänke stand ein in die braune Tunika eines Dieners gekleideter muskulöser Mann. Will unterdrückte ein Stöhnen. Er erkannte Peter, den Küchenmeister. Peter griff nach einem Korb voll Gemüse, stellte ihn auf die Bank und langte dann nach einem Messer. Will drehte sich um, als Simon sich aufrichtete und sein zottiger brauner Haarschopf über den Säcken auftauchte. Seine Lippen formten eine stumme Frage.
»Wer ist da?«
Will kauerte sich wieder neben ihm nieder. »Peter«, flüsterte er. »Und wie es aussieht, wird er eine Weile hierbleiben.«
Simon verzog das Gesicht.
Will nickte zur Tür hinüber. »Wir müssen hier weg.«
»Bitte?«
»Wir können nicht den ganzen Tag hier vertrödeln. Ich muss noch Sir Oweins Rüstung polieren.«
»Und wie sollen wir an Peter vorbeikommen?«
Ohne auf Simons Einwände zu achten, ging Will zur Tür und öffnete sie.
Peter erstarrte bei seinem Anblick, das Messer, mit dem er hantierte, schien einen Augenblick lang in der Luft zu schweben. »Gott im Himmel!«Aber er erholte sich rasch von seinem Schreck, legte das Messer fort, wischte sich die Hände an seiner Tunika ab und blickte über Wills Schulter hinweg zu Simon hinüber, der gerade die Tür des Vorratslagers hinter sich schloss. »Was habt ihr zwei hier zu suchen?«
»Wir haben ein Geräusch gehört«, erklärte Will ruhig, »und da wollten wir nachschauen …«
Peter schob ihn unsanft zur Seite und riss die Tür wieder auf. »Du wolltest wohl wieder einmal die Vorräte plündern, was?« Er spähte in den dämmrigen Raum, konnte aber nichts entdecken, was seinen Verdacht bestätigt hätte. »Was war es doch gleich beim letzten Mal? Brotdiebstahl?«
»Kuchen«, berichtigte Will. »Und ich habe ihn nicht gestohlen, sondern nur …«
»Und du?« Peter wandte sich an Simon. »Was hat ein Stallbursche in der Küche verloren?«
Simon hakte die Daumen in seinen Gürtel, hob die Schultern und scharrte verlegen mit den Füßen.
»Der Besen im Stall ist zerbrochen«, erklärte Will. »Wir wollten uns hier einen ausleihen.«
»Und den müsst ihr zu zweit tragen?«
Will starrte ihn nur stumm an.
Peter runzelte verdrossen die Stirn. Er diente dem Orden seit über dreißig Jahren und hasste es, sich von diesen beiden neunmalklugen Bengeln für dumm verkaufen zu lassen, aber er verfügte nicht über die notwendige Autorität, um sie zu einem Geständnis zu zwingen. Sein Blick wanderte vom Lagerraum zu Will, dann stieß er einen ärgerlichen Grunzlaut aus. »Na schön. Nehmt euren Besen und verschwindet.« Er ging zu der Bank zurück und griff wieder nach seinem Messer. »Aber wenn ich euch noch ein Mal hier erwische, melde ich euch dem Meister.«
Will lief durch die Küche, nahm einen Besen von der Wand neben der Feuerstelle und rannte damit nach draußen. Dort blinzelte er, weil ihn die grelle Sonne blendete, und grinste, als Simon hinter ihm ins Freie trat. »Hier.«
»Wie nett von dir«, knurrte Simon, als Will ihm den Besen reichte. »Ich hoffe, deine Neugier ist jetzt befriedigt. Wenn uns einer der Ritter ertappt hätte …« Er sog scharf den Atem ein. »Wenn du das nächste Mal jemanden brauchst, der für dich Wache steht, mache ich mich auf den Weg ins Heilige Land. Da bin ich sicherer als in deiner Gesellschaft.« Er schüttelte den Kopf, bedachte Will dann aber mit einem breiten Lächeln, wobei er einen abgebrochenen Schneidezahn entblößte, den ihm ein auskeilendes Pferd ausgeschlagen hatte. »Sehen wir uns vor der Non noch?«
Bei der Erwähnung des Nachmittagsgottesdienstes rümpfte Will die Nase. Der Morgen war schon fast verstrichen, und er hatte noch nicht einmal mit seinen zahlreichen Arbeiten begonnen. Der Tag schien nie genug Stunden zu haben, um all die Dinge zu erledigen, die zu seinen Pflichten zählten, egal wie sehr er sich auch beeilte. Zwischen den Mahlzeiten, den täglichen Schwertübungen auf dem Feld und den Aufträgen, die sein Herr ihm erteilte, blieb kaum Zeit für irgendetwas anderes, geschweige denn die sieben vorgeschriebenen Gottesdienste. Wills Tag begann wie der eines jeden Sergeanten mit der Matutin in der Kapelle, in der es sommers wie winters düster und kalt war. Dann versorgte er das Pferd seines Herrn und nahm dessen Befehle entgegen. Gegen sechs wurde die Prim abgehalten, dann brachen Will und seine Kameraden ihr Fasten und kehrten später zur Terz und zur Sext in die Kapelle zurück. Am Nachmittag besuchte er zwischen dem Mittagessen, seinen Körperübungen und anderen Aufgaben die Non. Bei Anbruch der Dämmerung fand die Vesper statt, gefolgt von der Abendmahlzeit, und der Tag endete schließlich mit der Komplet. Viele Templer waren stolz auf ihren Status als Kriegermönche, doch Will legte wenig Wert darauf, mehr vom Inneren des Gotteshauses zu sehen als sein eigenes Bett. Er machte gerade Anstalten, sich bei Simon, der mit dieser Klagelitanei wohlvertraut war, darüber zu beschweren, als jemand seinen Namen rief.
Ein kleiner, rothaariger Junge kam auf sie zugestürmt, wobei er die im Hof herumscharrenden Hühner aufscheuchte. »Will, ich soll dir von Sir Owein ausrichten, dass er dich sofort zu sehen wünscht!«
»Hat er gesagt, was er von mir will?«
»Nein«, erwiderte der Junge. »Aber er ist ziemlich schlecht gelaunt.«
»Glaubst du, er weiß, was wir gemacht haben?«, raunte Simon Will zu.
»Dazu müsste er schon durch Wände sehen können.«
Will grinste, dann eilte er über den Hof und einen Pfad entlang, der an dem würzig duftenden Kräutergarten vorbeiführte, und gelangte in einen weiteren, von grauen Steingebäuden umschlossenen Innenhof. Hinter den Häusern zu seiner Rechten erhob sich die Kapelle, ein hohes, anmutiges Gebäude mit einem dem der Grabeskirche in Jerusalem nachempfundenen runden Hauptschiff. Will machte sich auf den Weg zu den am Ende des Hofes gelegenen Unterkünften der Ritter. Auf dem Hof herrschte geschäftiges Treiben, Gruppen von Sergeanten schwatzten miteinander, Knappen führten Pferde herum, Diener gingen ihren verschiedenen Tätigkeiten nach. Der Neue Tempel, das Hauptordenshaus in England, war zugleich auch das größte im ganzen Königreich. Neben geräumigen Schlafsälen und Studierzimmern gab es auch noch ein Exerzierfeld, eine Waffenkammer, Ställe und einen privaten Kai an der Themse. Für gewöhnlich beherbergte es ungefähr hundert Ritter sowie einige Hundert Sergeanten und Dienstboten.
Will stieß die Tür des zweistöckigen Gebäudes auf und lief einen Gewölbegang entlang. Seine Schritte hallten hohl von den Wänden wider. Vor einer massiven Eichenholztür blieb er schwer atmend stehen und klopfte zaghaft an. Als er an sich herunterblickte, stellte er fest, dass seine schwarze Tunika mit Staub vom Boden der Vorratskammer verschmiert war. Hastig wischte er mit dem Ärmel darüber. Im nächsten Moment schwang die Tür auf, und er stand der imponierenden Gestalt Oweins ap Gwyn gegenüber.
Der Ritter winkte ihn schroff zu sich. »Komm herein.«
Das Studierzimmer, das sich einige der hochrangigeren Templer teilten, war kühl und dunkel. Eine Wand wurde fast vollständig von einem mächtigen Schrank eingenommen. In einer halb von einem hölzernen Wandschirm verdeckten Ecke standen ein paar Stühle und ein Tisch, und unter dem Fenster, das auf eine sauber gestutzte Rasenfläche hinausging, gab es noch eine gepolsterte Bank. Schriftrollen und Pergamentbögen bedeckten den Tisch. Will hielt den Kopf hoch erhoben und den Blick starr auf das Fenster gerichtet, während die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Er hatte keine Ahnung, weshalb sein Herr ihn zu sich befohlen hatte, hoffte aber, dass er nicht allzu lange aufgehalten werden würde. Wenn er es schaffte, vor der Non Oweins Rüstung zu polieren, konnte er vielleicht noch eine Stunde zum Übungsfeld. Das Turnier rückte immer näher; viel Zeit blieb ihm aber nicht mehr. Owein trat auf ihn zu und blieb vor ihm stehen. Will registrierte die finster zusammengezogenen Brauen und den Ärger, der in den stahlgrauen Augen des Ritters zu lesen stand. Seine Zuversicht schwand. »Ihr wolltet mich sehen, Sir?«
»Ist dir eigentlich klar, wie glücklich du dich schätzen kannst, Sergeant?«, erkundigte sich Sir Owein. Der Akzent seines Geburtsortes Powys schwang unüberhörbar in seiner Stimme mit.
»Glücklich, Sir?«
»Glücklich, dich in einer Position zu befinden, die vielen anderen deines Ranges verwehrt bleibt. Nicht viele Jungen deines Alters werden von einem Ritter in seine Obhut genommen und von ihm persönlich ausgebildet.«
»Ich weiß das zu schätzen, Sir.«
»Und warum missachtest du dann meine Befehle und machst mir und meiner Stellung Schande?«
Will erwiderte nichts darauf.
»Bist du plötzlich stumm geworden?«
»Nein, Sir, aber ich kann Euch keine Antwort geben, weil ich nicht weiß, wodurch ich Euer Missfallen erregt habe.«
»Das weißt du nicht?« Oweins Tonfall wurde noch eine Spur schärfer. »Dann lass mich deinem Gedächtnis nachhelfen. Was ist nach der Matutin deine erste Pflicht, Sergeant?«
»Mich um Euer Pferd zu kümmern, Sir«, erwiderte Will, dem dämmerte, was geschehen sein musste.
»Und warum habe ich dann die Heuraufe leer vorgefunden, als ich am Stall vorbeikam? Ganz zu schweigen davon, dass mein Pferd nicht gestriegelt war.«
Nach der Matutin hatte sich Will in den Lagerraum geschlichen, um durch das Loch in der Wand die Aufnahmezeremonie zu verfolgen, aber er hatte am Abend zuvor einen anderen Sergeanten, mit dem er sich seine Unterkunft teilte, gebeten, Sir Oweins Pferd für ihn zu füttern. Sein Kamerad musste es vergessen haben. »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, entschuldigte er sich zerknirscht. »Ich habe verschlafen.«
Oweins Augen wurden schmal. Er ging um den Tisch herum, ließ sich auf der Bank nieder und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie oft habe ich diese Ausrede nun schon gehört? Und zahllose andere dazu. Du scheinst unfähig zu sein, die einfachsten Regeln zu befolgen. Die Ordensregeln sind nicht dazu da, ständig übertreten zu werden. Ich werde dieses Benehmen nicht länger dulden.«
Will stutzte. Er hatte sich schon schlimmerer Vergehen schuldig gemacht, als das Pferd seines Herrn nicht zu versorgen. Unbehagen stieg in ihm auf, als Owein fortfuhr.
»Ein Templer muss willens sein, viele Opfer zu bringen und sich an zahlreiche Gebote zu halten. Du wirst zu einem Soldaten ausgebildet, Sergeant, zu einem Krieger Gottes! Eines Tages wirst du Waffen führen, und wenn du jetzt nicht im Stande bist, Befehle zu befolgen, weiß ich wirklich nicht, wie es dir gelingen soll, als Ritter auf dem Schlachtfeld die Ordnung aufrechtzuerhalten. Jeder Angehörige des Templerordens muss den Anweisungen seiner Vorgesetzten Folge leisten, sonst würde unser Orden im Chaos versinken. Kannst du dir vorstellen, dass der Visitator in Paris oder Meister de Pairaud hier in London einen Befehl nicht ausführt, der ihm von Großmeister Bérard erteilt wurde? Dass er es zum Beispiel versäumt, eine bestimmte Anzahl Männer und Pferde nach Palästina zu schicken, um eine unserer Festungen zu verteidigen, weil er an dem Morgen, an dem das Schiff ablegen sollte, verschlafen hat?« Oweins graue Augen bohrten sich in die von Will. »Kannst du das?« Als Will keine Antwort gab, schüttelte der Ritter ärgerlich den Kopf. »Das Turnier findet bereits in einem Monat statt. Ich erwäge ernsthaft, dich von der Teilnahme auszuschließen.«
Will starrte Owein einen Moment lang an, dann atmete er erleichtert auf. Owein würde ihn nicht von dem Wettkampf ausschließen. Er wollte ihn siegen sehen. Es war eine leere Drohung, und Owein wusste das.
Owein musterte den hochgewachsenen, drahtigen Jungen, dessen Tunika Staubflecken aufwies und der seinem Blick trotzig standhielt. Ein paar Strähnen seines dunklen Haares fielen ihm in die Stirn. Er sah seinem Vater ungemein ähnlich. Owein wusste, dass er mit Zorn und Drohungen bei Will nichts erreichte; er konnte ihm einfach nicht lange böse sein und sich auch nicht dazu durchringen, zu den drakonischen Strafen zu greifen, die manche anderen Ritter zu verhängen pflegten.
Er blickte zu dem hölzernen Wandschirm hinüber, dann wieder zu Will, dann erhob er sich und sah aus dem Fenster, um einen Moment nachzudenken.
Wills Unbehagen wuchs, je länger Oweins Schweigen andauerte. Er hatte seinen Herrn selten so in Gedanken versunken erlebt. Vielleicht irrte er sich ja, vielleicht würde er wirklich nicht an dem Turnier teilnehmen dürfen. Oder es kam noch schlimmer … das Wort Ordensausschluss schoss ihm durch den Kopf. Nach ein paar Minuten, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen, drehte sich Owein zu ihm um.
»Ich weiß, was in Schottland passiert ist, William.« Er sah, wie sich die grünen Augen des Jungen weiteten und dann zu schmalen Schlitzen verengten, ehe Will den Blick senkte. »Wenn du Wiedergutmachung leisten willst, ist dies der falsche Weg. Was würde dein Vater von deinem Betragen halten? Wenn er aus dem Heiligen Land zurückkehrt, möchte ich mich lobend über dich äußern können und ihm nicht sagen müssen, dass ich von dir enttäuscht bin.«
Will kam sich vor, als habe er einen Schlag in die Magengrube erhalten. Sein Trotz verflog, Übelkeit würgte ihn in der Kehle. »Woher … wie habt Ihr davon erfahren?«
»Dein Vater hat es mir vor seiner Abreise erzählt.«
»Er hat es Euch erzählt«, wiederholte Will tonlos, senkte den Kopf, hob ihn wieder und funkelte Owein an. »Könnt Ihr mir dann jetzt meine Strafe nennen und mich entlassen, Sir?«
Owein schien es, als habe sich eine Maske über Wills Gesicht gelegt. Eine Ader pulsierte an seiner Schläfe, als er die Zähne zusammenbiss. Der Ritter kannte diesen Ausdruck verbissener Entschlossenheit; er hatte ihn auf James Campbells Gesicht gesehen, als er ihm von der Bitte um eine Versetzung in das Ordenshaus von Akkon abgeraten hatte. James hatte keinen Befehl erhalten, an einem Kreuzzug teilzunehmen, er hatte eine junge Frau und Töchter in Schottland, und dann war da noch Will in London, dennoch hatte er Oweins Rat in den Wind geschlagen. Owein fragte sich, ob er überhaupt zu dem Jungen durchdrang. Es war an der Zeit, ganz offen mit ihm zu sprechen, entschied er. »Nein, Sergeant Campbell, du kannst noch nicht gehen. Ich bin noch nicht fertig.«
»Ich möchte nicht über diese Angelegenheit sprechen, Sir«, sagte Will leise, aber bestimmt. »Ich will nicht, und ich werde es auch nicht tun.«
»Das musst du auch nicht«, gab Owein ruhig zurück und nahm wieder auf der Bank Platz. »Wenn du dein Verhalten in Zukunft änderst.« Als er sah, dass der Junge ihm aufmerksam zuhörte, fuhr er fort: »Du hast einen scharfen Verstand, William, und deine Leistungen bei den Kampfübungen sind beachtlich. Aber du weigerst dich, dich den fundamentalen Geboten unseres Ordens zu unterwerfen. Glaubst du, unsere Ordensgründer haben diese Regeln zum Spaß aufgestellt? Wir alle müssen danach trachten, ihren hohen Anforderungen gerecht zu werden, um uns unserer Rolle als Gottes Krieger auf Erden würdig zu erweisen. Sich im Kampf auszuzeichnen, reicht da nicht aus. Bernard de Clairvaux selbst lehrt uns, dass es nichts fruchtet, Feinde von außerhalb zu bekämpfen, wenn wir nicht erst die in uns selbst besiegen. Verstehst du das, William?«
»Ja, Sir«, bestätigte Will bedrückt. Oweins Worte berührten etwas tief in seinem Inneren.
»Du kannst nicht deinen Platz innerhalb des Ordens aufs Spiel setzen, indem du alle Regeln missachtest, die dir nicht zusagen. Du musst lernen, mir zu gehorchen, William, und zwar in jeder Hinsicht und widerspruchslos. Ist das klar?«
»Ja, Sir Owein.«
Owein lehnte sich zufrieden zurück. »Gut.« Er griff nach einer der Schriftrollen auf dem Tisch, entrollte sie und strich das Pergament mit der Handfläche glatt. »Dann wird deine nächste Pflicht darin bestehen, bei einer Verhandlung zwischen König Henry und Meister de Pairaud meinen Schild zu tragen.«
»Der König? Er kommt her, Sir?«
»In zwölf Tagen.« Owein blickte von dem Pergament auf. »Und sein Besuch ist privater Natur, also ist es dir streng verboten, mit irgendjemandem darüber zu sprechen.«
»Ihr habt mein Wort, Sir.«
»In der Zwischenzeit wirst du zur Strafe für deine Nachlässigkeit heute Morgen im Stall arbeiten – und zwar zusätzlich zu deinen sonstigen Aufgaben. Das ist alles, Sergeant. Du kannst gehen.«
Will verneigte sich und wandte sich zur Tür.
»Noch etwas, William.«
»Sir?«
»Meine Drohungen scheinen bei dir bislang auf taube Ohren gestoßen zu sein.Aber wenn du meine Geduld auch weiterhin auf die Probe stellst, werde ich nicht zögern, dich aus dem Orden ausschließen zu lassen. Sieh zu, dass du dich nicht mehr in Schwierigkeiten bringst. Der Himmel weiß, dass sie dir folgen wie ein streunender Hund, aber wenn du diesen Hund das nächste Mal streichelst, könnte es sein, dass er dich in die Hand beißt.«
»Ja, Sir.«
Nachdem Will den Raum verlassen hatte, rieb sich Owein müde über die Stirn.
»Du bist entschieden zu nachsichtig mit dem Jungen, Bruder.« Ein hochgewachsener Ritter mit eisengrauem Haar und einer Lederkappe über dem linken Auge trat hinter dem Wandschirm hervor, hinter dem er während der Unterredung gesessen hatte, und ging mit einem Stapel Pergamentbögen in der Hand auf Owein zu. »Den Schild eines Tempelritters zu tragen, ist eine große Ehre für einen Sergeanten, besonders unter diesen Umständen. Seine Strafe kommt mir eher wie eine Belohnung vor.«
Owein betrachtete die vor ihm liegende Schriftrolle. »Vielleicht hilft ihm diese Verantwortung, in Zukunft sein Temperament zu zügeln, Bruder.«
»Oder verleitet ihn dazu, noch stärker über die Stränge zu schlagen. Ich fürchte, deine Zuneigung zu dem Jungen macht dich blind für seine Fehler. Du bist nicht sein Vater, Owein.«
Owein blickte stirnrunzelnd auf und machte Anstalten, Einwände zu erheben, doch der grauhaarige Ritter sprach weiter.
»Jungen seines Alters und seiner Herkunft sind wie Hunde. Die Peitsche bekommt ihnen besser als freundliche Worte.«