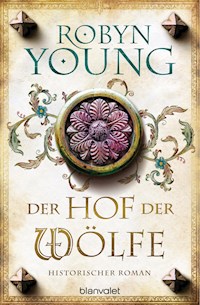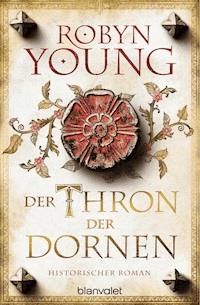8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brethren
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Liebe, Abenteuer und Intrigen!
1275 nach Christus: Das Heilige Land liegt in Ruinen, die Überlebenden des letzten Kreuzzugs sind auf dem Rückweg in ihre Heimat. Unter ihnen befindet sich der junge Ritter Will Campbell, dessen größtes Ziel es ist, Rache zu nehmen an König Edward I., den er für den Tod seiner Geliebten Elwen verantwortlich macht. Doch während Will seine Pläne verfolgt, entgeht ihm eine weit schlimmere Gefahr: Auf dem Thron Frankreichs sitzt ein skrupelloser Mann, der in seinem Streben nach Macht vor nichts zurückschreckt – auch nicht vor Wills Tochter Rose ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1002
Ähnliche
Buch
Im Jahr 1295 nach Christus: Das Heilige Land liegt in Ruinen, die Überlebenden des letzten Kreuzzugs sind auf dem Rückweg in ihre Heimat. Unter ihnen befindet sich der Ritter Will Campbell, von Trauer geplagt ob des Verlustes seiner Geliebten Elwen und voller Sorge um seine Tochter Rose. Er hat nur ein Ziel: Rache zu nehmen an König Edward I. von England, seinem größten Feind, der den Tod Elwens zu verantworten hat. Doch auf dem Kontinent ist die Atmosphäre angespannt. Nicht nur wird der Verlust des Heiligen Landes beklagt, auch stecken England und Frankreich inmitten kriegerischer Auseinandersetzungen. Nach Jahren der politischen Ränkeschmiede hat Edward es nun zudem auf den Nachbarn Schottland abgesehen. Während Will auf Rache sinnt, entgeht ihm, dass längst eine weit größere Gefahr heranwächst. Denn auf dem Thron von Frankreich sitzt ein skrupelloser Mann, der in seinem Streben nach Macht keine Grenzen kennt und auch vor Rose nicht Halt macht, um seine ehrgeizigen Pläne zu verwirklichen …
Autorin
Mit ihrem Debüt »Die Blutschrift« gelang der Britin Robyn Young ein großartiger Durchbruch, der sie auf die Bestsellerlisten schnellen ließ. Geboren 1975 in Oxford, begann sie schon früh, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Aber erst während eines Seminars in Kreativem Schreiben fand sie den Mut, ihre Ideen zu Papier zu bringen. Robyn Young lebt in Brighton und schreibt gerade an ihrem nächsten Roman.
Von Robyn Young bereits erschienen:
Die Blutschrift
Die Blutritter
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die eisige Kälte des Bodens drang durch den dünnen Stoff seiner Hose, als der junge Mann auf die Knie sank. Der Stein unter ihm fühlte sich hart und unnachgiebig an, dennoch zog er fast so etwas wie Trost daraus: Die Fliesen schienen das einzig Solide in dieser Kammer zu sein. Dichter Weihrauchnebel umwaberte ihn; der beißende Geruch erinnerte ihn an brennende Blätter und hatte nichts mit dem süßlichen, vertrauten Duft gemein, der ihn willkommen hieß, wenn er die Kirche betrat. Ringsum tanzten verschwommene Schatten über die Wände, wenn Gestalten an den Kerzen vorbeihuschten, die in so weit voneinander auf dem Boden aufgestellten Haltern steckten, dass das schwache rötliche Licht nur noch stärker zu seiner Disorientierung beitrug. Ein paar Schritte links von ihm waren die steinernen Fliesen mit einer feucht schimmernden Substanz bespritzt. Im Dämmerlicht wirkten die Flecken fast schwarz, doch der junge Mann wusste, dass sie am helllichten Tag in einem abscheulichen Rot leuchten würden. Trotz des schier erstickenden Weihrauchqualms stieg ihm der scharfe metallische Geruch in die Nase, der von ihnen ausging, und er musste mehrmals schlucken, weil ihm sein Mageninhalt in die Kehle zu steigen drohte.
Nichts war so, wie er es erwartet hatte. Ein Teil von ihm war froh darüber – hätte er gewusst, was ihm in dieser Nacht bevorstand, hätte er vielleicht nicht den Mut aufgebracht, sich hier einzufinden. Das Einzige, was ihn davon abhielt, blindlings die Flucht zu ergreifen, statt auszuharren und zu tun, was von ihm verlangt wurde, war die Gegenwart der Männer im Schatten und die Angst vor dem, was geschehen würde, wenn er sich weigerte. Aber er wollte keinerlei Schwäche zeigen. Trotz seines wachsenden Unbehagens wollte er die Zeremonie durchstehen, also starrte er – die bloße, bleiche Brust vorgestreckt, die schweißfeuchten Hände hinter dem Rücken gefaltet – mit unbewegter Miene vor sich hin.
Die Männer waren stehen geblieben, und da in der Kammer jetzt Totenstille herrschte, konnte er das Vogelgezwitscher hören, das durch die mit schweren schwarzen Tüchern verhängten hohen Fenster drang. Die Morgendämmerung musste bald anbrechen.
Links neben ihm regte sich etwas. Er sah eine Gestalt auf sich zukommen. Nagende Furcht breitete sich in seinem Magen aus. Es war ein Mann, dessen Umhang aus Hunderten einander überlappender runder Seidenstücke in allen Schattierungen von Blau und Rot – Kobaltblau, Saphirblau, Rosa und Violett – gefertigt zu sein schien. Hier und da war der Stoff mit Silberfäden durchwirkt, die glitzerten, wenn sich das Kerzenlicht darin fing und den Eindruck erweckte, die unheimliche Gestalt sei in Fischschuppen gekleidet. Der junge Mann wusste, dass es sich um einen Mann handelte, denn er hatte während der Zeremonie oft das Wort ergriffen, hatte seinen Schützling angeleitet und ihm Befehle erteilt, aber bislang war sein Gesicht von einer Kapuze aus demselben Material wie der Umhang verdeckt geblieben. Sie hing ihm fast bis zur Brust herab; es war erstaunlich, dass er nicht ständig stolperte. Unter dieser Kapuze wirkte sein Kopf merkwürdig missgestaltet, und wenn er sprach, klang seine Stimme dumpf und wie erstickt.
»Du hast deinen Weg gewählt und eine weise Wahl getroffen. Du hast dein Gelübde abgelegt und dich im Angesicht von Versuchungen und Furcht als standfest erwiesen. Nun steht dir die letzte und gefährlichste Probe bevor. Gehorche mir, so wie du es geschworen hast, und dir wird nichts geschehen.« Die Gestalt hielt inne. »Wirst du mir gehorchen, jetzt und immerdar?«
»Das werde ich«, gelobte der junge Mann.
»Dann beweise es«, grollte die Gestalt, schlug die Kapuze zurück und kauerte sich vor dem jungen Mann nieder, der vor dem unter dem Stoff zum Vorschein gekommenen grinsenden Totenschädel erschrocken zurückwich. Der Kerzenschein ließ das Gebein noch gelber, die großen, leeren Augenhöhlen noch schwärzer erscheinen.
Obwohl er wusste, dass der Schädel nur eine Maske war; obwohl er hinter den Augenhöhlen dunkle menschliche Augen glitzern sah, wollte sein Entsetzen nicht weichen, und als der Mann ein kleines goldenes Kreuz aus den Falten des Fischschuppenumhangs zog, meinte er, das Herz müsse ihm in der Brust zerspringen.
»Spuck darauf.«
»Was soll ich tun?«
»Befreie dich von seiner Macht über dich. Beweise, dass du nur mir allein ein treuer Diener bist und dass du dich zu deinen Brüdern bekennst.«
Die Augen des jungen Mannes schossen nach rechts und nach links, als die anderen Männer sich aus den Schatten lösten. Auch sie trugen Masken: blutrote, auf denen vorne der Kopf eines weißen Hirsches prangte.
»Spuck darauf!«, erscholl der Befehl von neuem.
Als er spürte, wie sich die anderen Gestalten so eng um ihn scharten, dass er das schwache Kerzenlicht nicht mehr wahrnehmen konnte, beugte sich der junge Mann über das Kreuz. Mühsam sammelte er Speichel im Mund, schloss die Augen und spie aus.
Erster Teil
1
Bordeaux, Königreich Frankreich23. November A.D. 1295
Mathieus Handflächen waren glitschig vor Schweiß. Er packte sein Breitschwert fester und schielte zu seinem Kommandanten hinüber, der rechts von ihm Kampfhaltung angenommen hatte, doch der Blick des Mannes war auf die mächtigen Flügeltüren am Ende der Halle gerichtet. Während Mathieu ihn beobachtete, rann eine ölige Schweißspur über seine Wange. Wieder ertönte das donnernde Krachen, die Tür erzitterte heftig, und die neun in der Halle aufgereihten Wächter zuckten zusammen. In der darauffolgenden kurzen Stille sogen alle scharf den Atem ein. Einen Moment später wurde das Holz von einem neuen dröhnenden Stoß erschüttert. Die Türen zerbarsten, ein Regen von Eichenholzsplittern ergoss sich in die Halle und übersäte die Wandbehänge und Fliesen. Der an der Spitze mit Eisen beschlagene Rammbock wurde knirschend zurückgezogen, dann strömten Soldaten durch die Bresche.
Mathieu überkam eine Welle heißer Angst. Eine Sekunde lang stand er wie gelähmt da. Unzusammenhängende Gebete und Beteuerungen gingen ihm durch den Kopf. Er war erst neunzehn Jahre alt. Mit dem, was sich hier abspielte, hatte er nicht gerechnet, als sein Vater ihm diesen Posten verschafft hatte. Lieber Gott, bitte verschone mich! Doch als er seinen Kommandanten den Befehl zum Angriff bellen hörte und sah, wie seine Kameraden den Soldaten entgegentraten, zwang er sich, zusammen mit ihnen vorzurücken. Viel zu schnell drang ein Soldat auf ihn ein. Mathieu konnte gerade noch einen mit Eisennieten besetzten, blauen und scharlachroten Schild vor sich aufblitzen sehen, der zu dem Überwurf des Mannes passte, dann musste er mit seinem Breitschwert auch schon einen gegen seinen Kopf gerichteten Hieb abfangen. Überall ringsum waren seine Gefährten in erbitterte Zweikämpfe mit den Gegnern verstrickt. Schwerter klirrten, unterdrückte Schreie drangen an seine Ohren, Schilde zerbarsten splitternd unter wuchtigen Angriffen, schwere Stiefel ließen den Boden der Halle erzittern. Im Gegensatz zu den in lange Kettenhemden gekleideten und mit eisernen Helmen bewehrten Soldaten trugen die Wächter nur gefütterte lederne Wämser und gepolsterte Beinschienen, um Rumpf und Schenkel zu schützen.
Mathieu knirschte mit den Zähnen, als sein Gegner erneut auf ihn losging und ihm beinahe das Schwert aus der Hand geschlagen hätte. Er versuchte, sich umzudrehen und zu flüchten, doch der Soldat trieb ihn zurück, bis er gegen die Wand prallte und in der Falle saß. Ein verzweifelter Aufschrei entrang sich seiner Kehle, als es ihm nicht gelang, seinen Widersacher zur Seite zu drängen. Schweiß rann ihm in die Augen und blendete ihn. Ihm fehlte der Raum, um sein Breitschwert zum Einsatz zu bringen. Er wich einem auf seine Seite zielenden Hieb aus, wehrte einen weiteren, gegen seine Brust geführten ab und holte dann ungeschickt zum Gegenangriff aus. Der Soldat duckte sich unter der Klinge hinweg. Scharlachrot und Blau flammte vor Mathieu auf, als der Mann ihm seinen schweren Schild mitten in das Gesicht schmetterte. Ein greller Schmerz durchzuckte ihn, Blut schoss aus seiner Nase und seinem Mund, er taumelte gegen die Wand zurück, und seine Klinge verfehlte ihr Ziel. Im nächsten Moment bohrte sich etwas Weißglühendes hoch oben in seine Seite – das Schwert des Soldaten war in das weiche Fleisch unter seiner Achselhöhle gedrungen, das an dieser Stelle nicht von der ledernen Rüstung geschützt wurde. Mathieu kreischte laut auf, als der Mann mit seiner behandschuhten Hand gegen das Heft hämmerte und ihm die Klinge mit einem angestrengten Grunzlaut tiefer in den Leib trieb.
Er spürte, wie das Breitschwert seinen Fingern entglitt. Auf der anderen Seite der Halle sah er weitere Soldaten, die sich durch die geborstenen Türen drängten, um den anderen zu Hilfe zu kommen. Doch dazu bestand wenig Anlass; Mathieus Kameraden waren in der Unterzahl und den Gegnern hoffnungslos unterlegen. Alles war so schnell gegangen. Vom Haupthaus aus hatten sie mit angesehen, wie die Wachposten am Torhaus niedergemetzelt wurden, dann waren die Soldaten auch schon wie entfesselt über den Hof galoppiert und hatten ihnen kaum Zeit gelassen, die Türen zu verriegeln. Als er zu Boden sank, sah Mathieu einen seiner Kameraden über dem Schwert zusammenbrechen, das seinen Magen durchbohrt hatte. Die anderen wichen zu den Stufen zurück, die zu einer Galerie emporführten. Wie aus weiter Ferne hörte er irgendwo donnerndes Gebrüll, doch bevor er die Quelle davon ausmachen konnte, verlor er das Bewusstsein und sackte schlaff in sich zusammen, wobei er eine rote Spur an der Wand hinter sich zurückließ.
Das Brüllen wurde lauter, übertönte das Getöse in der Halle. Dann kam ein Mann die Treppe herunter. Bei seinem Anblick ließen die Soldaten einer nach dem anderen von ihren Gegnern ab. Der Mann stapfte, noch immer etwas in einem schwer verständlichen Französisch brüllend, die letzten Stufen hinunter. Er hob das Schwert, das er in einer Hand hielt, schwang es über den Kopf, drängte sich an seinen Männern vorbei und stürmte auf die Soldaten zu, die jetzt alle stehen geblieben waren und unter ihren Helmen keuchend nach Atem rangen. Aber sie wichen keinen Schritt vor dem zornigen Neuankömmling zurück. Dieser machte kurz vor ihnen Halt und musterte ihre Überwürfe. Dass er sie sofort erkannte, schien nicht gerade zu seiner Beruhigung beizutragen. »Was hat das alles zu bedeuten?« In seiner Stimme schwang ein Anflug von Furcht mit, doch sein Schwertarm zitterte nicht. »Wie könnt ihr es wagen, hier so rüde einzudringen? Und meine Männer anzugreifen!« Er deutete mit der freien Hand auf die Leichen seiner Wächter. Sein Blick verharrte einen Moment lang auf dem reglosen Körper von Mathieu, dem Jüngsten von ihnen. »Wer ist euer Kommandant? Ich will mit ihm sprechen, und zwar sofort!« Als ihm nur eisiges Schweigen entgegenschlug, herrschte er sie an: »Antwortet mir!«
»Ihr könnt mit mir sprechen, Pierre de Bourg.« Ein weiterer Mann betrat die Halle und sah sich nach allen Seiten um, als er über die Überreste der Tür hinwegstieg. Er musste Anfang dreißig sein, hatte ein längliches Gesicht, braune Augen und einen fahlen Teint, der darauf schließen ließ, dass er schon lange keine Sonne mehr gesehen hatte. Sein Haar wurde von einer weißen Seidenkappe verdeckt, und er trug einen bodenlangen Reitumhang, der ihn größer und breiter erscheinen ließ, als er tatsächlich war. Der Umhang war schlicht, aber offenbar von einem ausgezeichneten Schneider gefertigt, und wurde vor der Brust von einer kostbaren Silberkette zusammengehalten.
»Wer seid Ihr?«, schnarrte Pierre.
Der Mann streifte ein Paar seidene Handschuhe ab und entblößte blau geäderte, spindeldürre Hände. Sein Blick heftete sich auf den Fremden. »Mein Name ist Guillaume de Nogaret.«
Er befleißigte sich der langue d’oïl, doch Pierre hörte einen weichen südlichen Akzent aus der rauen Mundart des Nordens heraus. Die Soldaten traten zur Seite, als Guillaume de Nogaret auf sie zukam, hielten ihre Waffen aber weiterhin auf Pierre gerichtet. Dessen Leibwächter hatten sich schützend hinter ihm aufgebaut.
Nogaret deutete auf ihn. »Lasst Euer Schwert sinken.«
Pierre rang um Fassung. Er wusste, dass er angesichts von Nogarets unerschütterlicher Ruhe nicht seine Autorität einbüßen durfte. »Ich werde nichts dergleichen tun. Ihr seid gewaltsam in mein Haus eingedrungen und habt meine Leute getötet. Wer hat Euch das Recht dazu gegeben?«
»Ich bin Minister König Philipps IV. und handele auf seinen Befehl.«
Pierre schielte zu den Soldaten in ihren scharlachrot und blau gemusterten Überwürfen hinüber: die Farben der unter dem Kommando von Charles de Valois, dem Bruder des Königs, in Bordeaux stationierten königlichen Leibgarde.
»Uns wurde zugetragen«, fuhr Nogaret fort, »dass Ihr unsere Truppen ausspioniert und dann die Engländer in Bayonne informiert habt.«
»Lächerlich! Wer hat so etwas behauptet? Wer beschuldigt mich?«
»Ihr werdet Euer Schwert sinken lassen«, wiederholte Nogaret. »Oder meine Männer werden Euch dazu zwingen.«
Nach einer langen Pause gehorchte Pierre widerstrebend.
»Sagt Euren Männern, sie sollen ihre Waffen auf den Boden legen und zur Wand zurücktreten.«
Pierre wandte sich mit einem knappen Nicken an seine Wächter. Sowie diese ihre Schwerter fallen gelassen hatten, brach hektische Aktivität im Raum aus. Die königlichen Soldaten sammelten die Waffen ein und drängten die geschlagenen, verbitterten Männer an die Wand. Die Leichen von Mathieu und den anderen Gefallenen wurden zu einer Seite der Halle geschleift.
»Wie viele Menschen halten sich in diesem Haus auf?«, fragte Nogaret barsch.
»Nur meine Familie und unsere Dienstboten, aber was immer Ihr von mir wollt, betrifft sie nicht.«
»Durchsucht die oberen Räume.« Nogaret winkte fünf Soldaten zu sich. »Bringt jeden herunter, auf den ihr stoßt. Leisten sie Widerstand, wendet Gewalt an.«
Pierre sah ihnen angsterfüllt nach, als sie die Treppe hinauftrampelten. »Tut ihnen nichts, ich bitte euch!« Er wandte sich an Nogaret. »Meine Frau und meine Kinder haben nichts verbrochen!«
»Führt ihn ab«, befahl Nogaret zwei weiteren Soldaten. Er deutete auf einen düsteren Gang, der von der Eingangshalle abzweigte. »Geht es dort zur Küche?«, fragte er. Als Pierre keine Antwort gab, trat er drohend einen Schritt vor.
Pierre nickte stumm. Die Soldaten packten ihn und schleiften ihn den Gang entlang. Nogaret folgte ihnen etwas langsamer. Der Rest seiner Leute blieb in der Halle zurück.
Die Küchenräume waren weitläufig, die Hauptkammer wurde von einem mächtigen Arbeitstisch beherrscht, auf dem zwei mit gewürfeltem Gemüse gefüllte Töpfe standen. Daneben lag ein Bündel knorriger Karotten neben einem Messer. Über dem Feuer brodelte ein dampfender Kessel. Zwei Fasane hingen an einem Deckenbalken. Ihre bronze- und türkisfarbenen Federn schimmerten im Licht, das durch eine Reihe hoher Fenster fiel. Der Raum war warm und duftete nach Kräutern.
Nogarets Blick blieb auf den Karotten haften. Eine war zur Hälfte gehackt, die Stücke lagen neben dem Messer verstreut. »Wo sind die Köche?«
»Oben. Als der Alarm gegeben wurde, habe ich alle nach oben geschickt. Sie sollten dort warten, bis ich herausgefunden hatte, was hier vor sich geht.« Pierre funkelte Nogaret finster an. »Aber dazu habt Ihr mir ja keine Zeit gelassen, Ihr habt einfach meine Tür eingeschlagen und meine Männer angegriffen.«
»Verräter werden für gewöhnlich nicht vorgewarnt, und es waren Eure Männer, die mir den Zutritt verwehrt und mich somit gezwungen haben, gewaltsam in Euer Haus einzudringen. Eure Wachposten sind auf meine Soldaten losgegangen, ohne ihnen die Gelegenheit zu geben zu erklären, wer sie sind und was sie wollen.«
»Ich bin kein Verräter«, entgegnete Pierre mit fester Stimme.
»Das wird sich zeigen.« Nogaret trat zu dem Tisch und griff nach dem Messer. »Haltet ihn gut fest.«
»Wartet… bitte«, stammelte Pierre, als die Soldaten ihn packten.
Nogaret betrachtete das Messer. Die dünne Klinge war mit Gemüsesaft verklebt. »Wir wissen, dass Ihr mit den englischen Truppen in Bayonne in Verbindung gestanden und ihnen Informationen über unsere Armee in Bordeaux geliefert habt. Die genaue Anzahl unserer Männer. Berichte über ihre Ausrüstung und über die Art unserer Waffen.«
»Ich weiß nicht, von wem diese Behauptungen stammen, aber sie sind falsch, das schwöre ich Euch. Ich habe nie etwas mit englischen Soldaten zu tun gehabt.«
»Und das soll ich Euch glauben?« Nogarets Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. »Während der Zeit, zu der sich König Edward in der Stadt aufgehalten hat, müsst Ihr ja geradezu über sie gestolpert sein.«
»Das ist etwas ganz anderes.«
»Ihr habt Edward als Euren Lehnsherrn anerkannt, als sich das Herzogtum in seinem Besitz befand. Ihr habt ihm sogar Arbeiter zur Verfügung gestellt, um seine befestigten Städte zu bauen.« Nogaret schnaubte verächtlich. »Ihm geholfen, die gesamte Gegend damit zu überziehen… wie ein Hund, der sein Territorium markiert!«
»Wie Ihr ganz richtig bemerkt habt, ist Edward mein Lehnsherr, und ich verwalte mein Land in seinem Namen. Wie hätte ich oder sonst irgendein Edelmann in dem Herzogtum Guyenne es denn vermeiden können, irgendwann einmal mit einem Engländer in Berührung zu kommen?«
»Edward war Euer Lehnsherr«, berichtigte Nogaret ihn scharf. »Dieser Titel steht ihm seit über einem Jahr nicht mehr zu. So lange herrscht König Philipp nämlich wieder über dieses Herzogtum, aber mir scheint, dass Eure Loyalität noch immer Eurem alten Herrn gilt.«
»Das stimmt nicht. Ich bin ein treuer Untertan meines Königs.« Pierre hob den Kopf. »Trotz allem, was er hier angerichtet und uns angetan hat.«
»Was er Euch angetan hat?«, echote Nogaret.
»Ich bin nicht blind; ich weiß, was sich in der gesamten Region abspielt. Königliche Truppen kommen immer noch in Strömen vom Norden hierher und nehmen Städte und Burgen ein – nur dass sie jetzt auch noch die Edelleute vertreiben und ihr Land und ihr Gold beschlagnahmen. Ich habe das alles während der vergangenen Monate mit angesehen und es mit zusammengebissenen Zähnen geduldet. Aber trotz alledem hatte ich keinerlei Kontakt mit Edwards Truppen und habe auch nie beabsichtigt, mit ihnen in Verbindung zu treten.«
»Ihr habt es ›geduldet‹?« Nogarets Stimme klang gefährlich leise. »Ihr sprecht von Eurem König wie von einem ungezogenen Kind, das Euer Missfallen erregt hat. Der rechtmäßige Herrscher dieses Königreiches entreißt sein eigenes Land einem Fremden, der durch seine Taten jeden Anspruch darauf verwirkt hat, und Ihr habt es ›geduldet‹?« Seine braunen Augen wurden schmal. »Bringt ihn her«, wies er die Soldaten an.
Die Männer zerrten Pierre trotz seines Widerstandes zu dem Tisch in der Mitte der Küche hinüber.
»Presst seine Hand flach auf den Tisch und haltet sie fest.« Pierre setzte sich verzweifelt zur Wehr, als einer der Soldaten sein Handgelenk packte. Der andere legte ihm einen Arm um den Hals und schnürte ihm den Atem ab. Sein Kamerad drückte Pierres Hand mit der Handfläche nach unten auf die Tischplatte. Nogaret reichte ihm das Messer. »Wir werden Euren Stolz schon brechen, Pierre de Bourg.«
Draußen im Gang entstand plötzlich ein Tumult. Nogaret fuhr herum, als er eine unbekannte ärgerliche Stimme hörte. Die Tür wurde geöffnet, und ein Mann trat in die Küche. Zorn und Besorgnis spiegelten sich in seinem geröteten Gesicht wider. Er war ungefähr in Nogarets Alter, klein und schlank, hatte eine Hakennase und einen hängenden Mund, der zu einem schwach ausgeprägten Kinn abfiel. Ein königlicher Leibgardist hielt sich unschlüssig hinter ihm. Nogaret achtete nicht auf die gemurmelten Entschuldigungen des Soldaten, sondern musterte den Eindringling mit undurchdringlicher Miene. Er trug einen voluminösen, mit braunem Pelz gesäumten Umhang mit Kapuze und darunter eine bis zum Boden reichende weiße Tunika. Unter den Falten des Gewandes ragten Sandalen hervor. Seine Kleidung ließ darauf schließen, dass er dem geistlichen Stand angehörte.
Sein Blick heftete sich auf das über Pierres Hand schwebende Messer. »Ich befehle Euch, diesen Mann unverzüglich freizugeben!«
»Wie kommt Ihr dazu, mir Befehle erteilen zu wollen?«, bellte Nogaret. »Wer seid Ihr überhaupt?«
»Ich bin Bertrand de Got, Bischof von Comminges.« Der Bischof sah Pierre an, der seinen Widerstand aufgegeben hatte und ihn mit neu erwachter Hoffnung anstarrte.
»Ihr habt Euch weit von Eurer Diözese entfernt.«
»Ich habe einen meiner Neffen besucht, er bekleidet hier in Bordeaux ein Priesteramt. Ich befand mich gerade in seiner Kirche, als ich erfuhr, dass königliche Truppen auf dem Weg zu Lord Bourg sind, um ihn festzunehmen.«
»Was geht Euch das an?«
Bertrand holte tief Atem. »Pierre de Bourg hat die Kirche meines Neffen stets mit großzügigen Spenden bedacht und ist ein angesehenes Mitglied dieser Gemeinde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas getan hat, was eine solche Behandlung rechtfertigt. Ein Bote ist bereits auf dem Weg zum Erzbischof, um ihn von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen«, fügte er viel sagend hinzu.
Nogaret zeigte sich unbeeindruckt. »Dieser ach so angesehene Mann ist ein Verräter. Er und seine Komplizen hier in der Gegend haben Berichte über die Bewegungen unserer Truppen an die Engländer weitergegeben, die, wie wir wissen, nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um uns anzugreifen und das Herzogtum zurückzuerobern.«
»Das kann ich nicht glauben!«
»Es ist bekannt, dass er in engem Kontakt mit Edward von England steht. Was den Schluss nahelegt, dass er seinen ehemaligen Herrn auch weiterhin unterstützt.«
»Aber die meisten Würdenträger hier haben irgendwann einmal mit Lord Edward zu tun gehabt oder gar Geschäfte mit ihm getätigt«, hielt Bertrand ihm entgegen. »Ich bin ihm während seines Aufenthaltes in der Gascogne selbst einige Male begegnet.«
»Ich bin Euch keine Rechenschaft schuldig, Bischof.« Nogaret verlieh dem letzten Wort eine besondere Betonung. Zum ersten Mal schwang eine echte Gefühlsregung in seiner Stimme mit. Er wandte sich an den hinter Bertrand wartenden Soldaten. »Begleite ihn hinaus. Sorg dafür, dass er von hier verschwindet.«
»Das ist unerhört!« Bertrand durchbohrte Nogaret mit einem herausfordernden Blick. »Der Erzbischof wird eine solche Eigenmächtigkeit nicht dulden, nicht in dieser Provinz!«
»Dieses Haus wurde konfisziert und befindet sich jetzt im Besitz des Königs von Frankreich. Macht, dass Ihr fortkommt, sonst werde ich Euch wegen widerrechtlichen Betretens königlichen Eigentums bestrafen lassen!«
»In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.« Bertrand de Got sah den Adeligen kopfschüttelnd an. »Es tut mir leid, Pierre. Ich habe getan, was ich konnte.«
Pierre bäumte sich im Griff der beiden Soldaten auf. Seine Augen waren vor Angst geweitet. »Um der Liebe Gottes willen, Bertrand! So helft mir doch!«
Nogaret trat zu ihm. Um seine Mundwinkel zuckte es höhnisch. »Gott übt in diesem Land keine Macht mehr aus.«
»Bertrand!«, kreischte Pierre schrill, doch der Bischof hatte sich bereits abgewandt. Der königliche Wächter führte ihn aus dem Raum und schlug die Tür hinter sich zu, sodass Bertrand nicht sehen konnte, wie der Soldat das Messer hob, und Pierres Schmerzensschrei, als es herabsauste, nur gedämpft vernahm.
Nach Vollzug dieses Folteraktes kehrte Nogaret in die Halle zurück und überließ es einem der beiden Männer, den halb bewusstlosen Pierre zu bewachen. Der andere folgte ihm in den Gang hinaus, dabei wischte er sich mit einem schmuddeligen Lumpen die Hände ab. In der Halle hatten sich unterdessen weitere Menschen eingefunden: drei Männer und vier junge Mädchen, ihrer Kleidung nach zu urteilen Dienstboten, und eine schlanke, blasse, in ein elegantes Gewand gehüllte Frau, die zwei kleine Jungen an sich drückte. Einer davon presste die Fäuste gegen sein Gesicht und schluchzte leise.
Als Nogaret den Raum betrat, hoben einige von Pierres Wächtern die Köpfe. In ihren Augen loderte ohnmächtige Wut. Die Frauen starrten den blutbespritzten Soldaten benommen an. Einer der Diener, ein älterer Mann, machte Anstalten, auf Nogaret zuzugehen, zog sich aber hastig zurück, als ein Schwert auf ihn gerichtet wurde. Nogaret bemerkte, dass ein weiterer Wächter neben den beiden lag, die zu Anfang des Kampfes getötet worden waren, und dass einer der Soldaten des Königs verwundet zu sein schien. Er trat zu einem Mann, dessen Überwurf mit gelbem Brokat gesäumt war. »Was ist geschehen, Hauptmann?«
Der Hauptmann zog ihn zur Tür, wo sie sich außerhalb der Hörweite der Gefangenen befanden. »Als sie den hohen Herrn schreien hörten, versuchten sie uns anzugreifen. Einem gelang es, einem meiner Männer sein Schwert zu entreißen. Ich hoffe, der verräterische Bastard hat gestanden«, fügte er grollend hinzu.
»Bis jetzt noch nicht.«
Der Hauptmann runzelte die Stirn. »Es klang aber so, als hättet Ihr ihn sehr… eingehend befragt.«
»Habt Ihr getan, was ich Euch aufgetragen habe?«, fragte Nogaret, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
»Der Karren wird just in diesem Moment beladen.« Der Hauptmann zögerte. »Aber sollten wir nicht warten, bis wir hieb- und stichfeste Beweise für seine Schuld haben, bevor wir weitermachen? Vielleicht waren unsere Informationen ja doch falsch …«
»Ganz sicher nicht«, erwiderte Nogaret ungerührt. »Diese Leute müssen unschädlich gemacht werden, bevor sie uns bloßstellen können. Zurzeit behaupten wir uns recht gut gegen die Engländer, aber wir dürfen nicht zulassen, dass irgendetwas den momentanen Status gefährdet. Zu Beginn des Krieges haben sie uns Blaye und Bayonne abgerungen. Wenn sie mit genaueren Informationen versorgt werden, könnten sie noch weitere Gebiete an sich reißen.«
Der Hauptmann nickte zustimmend.
»Sorgt dafür, dass der Hausherr und seine Familie in das Garnisonsgefängnis gebracht werden. Über ihr Schicksal wird zu gegebener Zeit entschieden.« Der Hauptmann erteilte seinen Leuten ein paar knappe Befehle, und Nogaret trat in den hellen Novembernachmittag hinaus.
Vor dem Haus herrschte geschäftiges Treiben. Knappen behielten die Pferde im Auge, während die Soldaten eifrig damit beschäftigt waren, durch eine Seitentür eine Vielzahl kostbarer Gegenstände herbeizutragen und sie auf einen großen Karren zu laden: kunstvoll verzierte Kandelaber, ein Bündel seidener Frauengewänder, wegen der der rotgesichtige Soldat, der sie an sich drückte, von seinen Kameraden gnadenlos verspottet wurde, Stapel silberner Platten, Bücher, zwei Schwerter in bestickten Scheiden, ein Gewürzkästchen aus Rosenholz.
Nogaret trat zu dem Karren und inspizierte die auf der Ladefläche angehäuften Möbel und Kleider. Als er auf den Brettern etwas glitzern sah, bückte er sich und zog eine Glasperlenkette zwischen zwei ledergebundenen Büchern hervor, die er mit einem angewiderten Grunzen wieder fallen ließ. Er konnte nur hoffen, dass sich dieser ganze Tand zusammen mit der Beute früherer ähnlicher Überfälle als wertvoll genug erwies, um die dafür aufgewandte Zeit zu rechtfertigen – vor allem, weil die Plünderungen seine Idee gewesen waren.
»Minister?«
Ein Soldat deutete zum Haupttor hinüber. Nogaret blinzelte in das Sonnenlicht und sah einen Reiter auf sich zukommen. Die Hufe des Pferdes wirbelten feine Staubwolken auf. Einen Moment lang dachte er, der Bischof habe sich anders besonnen und sei zurückgekommen, aber als der Reiter näher kam, sah er, dass er den vertrauten schwarzroten Umhang trug. Es war ein königlicher Bote; Nogaret kannte ihn von Paris her.
»Minister de Nogaret«, grüßte er atemlos, als er sein Pferd zügelte, abstieg, in seinem staubbedeckten Lederbeutel wühlte und eine Schriftrolle zu Tage förderte. »Die Stadtgarnison hat mir gesagt, wo ich Euch finden kann.«
Nogaret erbrach das Wachssiegel, entrollte den Pergamentbogen und überflog die Botschaft.
»Minister?« Der Hauptmann, der das Hufgetrommel gehört hatte, war gleichfalls ins Freie getreten.
Vom Haus her erscholl ein angstvoller Schrei. Zwei Soldaten zerrten die junge Frau, die aus vollem Hals nach ihren Kindern kreischte, durch die aufgebrochene Tür. »Seht zu, dass ihr hier fertig werdet.« Nogaret erhob seine Stimme über den Lärm. »Schafft den Karren auf direktem Weg zu Prinz Charles. Er wird sich darum kümmern, dass die Schätze an König Philipp weitergeleitet werden.«
»Wie Ihr wünscht.« Der Hauptmann warf dem Boten einen fragenden Blick zu. »Verlasst Ihr uns schon, Minister?«
2
Die Ufer der Seine, Paris19. Dezember A.D. 1295
Die Galeere glitt langsam an der Mole entlang. Männer auf dem Kai packten die Seile, die ihnen zugeworfen wurden, und zogen sie durch in den Boden eingelassene Eisenringe, um das Schiff zu vertäuen. Die Planken wurden krachend herabgelassen, und eine Gruppe von Rittern schickte sich an, an Land zu gehen. Ihre Gesichter waren von Sonne und Wind gegerbt, ihre weißen Mäntel feucht von dem Nebel, der träge über den Fluss und um den Mast herumwaberte, von dem ein buntes Banner schlaff herabhing.
Will Campbell trat zur Seite, als die Männer vor ihm zum Kai hinunterstiegen. Seine Lunge füllte sich mit feuchter, kalter Luft, während sein Blick über das Gewirr der Dächer und Türme der Gebäude der Stadt schweifte. Die Reihen der aus Stein und Holz erbauten, mehrere Stockwerke hohen Häuser wirkten in dem Nebel verschwommen, nahezu unwirklich. Fast unmittelbar vor ihnen ragte das Hôtel de Ville, der Verwaltungssitz der Kaufmannsgilde, über der Place de la Grève auf. Das imposante Bauwerk beherrschte das Labyrinth von Werkstätten, Märkten und Häusern, das sich quer über das rechte Ufer der Stadt hinwegzog: das Stadtzentrum von Paris. Will erkannte auch andere Gebäude wieder, aber der Nebel und die seit seinem letzten Aufenthalt hier verstrichene Zeit bewirkten, dass er sich trotzdem seltsam desorientiert vorkam. Es war Jahre her, seit er zum letzten Mal an diesem Ufer gestanden hatte. Er drehte sich um. Hinter ihm erhob sich der höckrige Umriss der Ile de la Cité aus der Seine. Das Herz Frankreichs. Als er einen Blick auf die Palasttürme am Westende der Insel erhaschte, verhärteten sich seine Züge.
»Sieht immer noch genauso aus wie früher, findest du nicht?«
Simon trat neben ihn und stützte die dicken Arme auf die Reling. Während der Reise war sein Bart buschiger geworden, doch sein brauner Haarschopf begann auf dem Scheitel schütter zu werden. Will, der den kräftig gebauten Pferdeknecht um fast einen Fuß überragte, bemerkte eine nicht zu übersehende kahle Stelle.
»Robert und ich versuchen uns zu erinnern, wie lange es her ist. Meiner Schätzung zufolge über dreißig Jahre.«
»Neunundzwanzig.«
Simon lächelte betreten, wobei er einen abgebrochenen Vorderzahn entblößte. »Dann hat Robert mich geschlagen.«
»Habe ich da eben meinen Namen gehört?«
Die beiden Männer drehten sich um. Ein hoch gewachsener, grauäugiger Ritter, dessen zerfurchtes Gesicht noch immer jungenhaft anziehend wirkte, kam zu ihnen hinüber.
»Du hast die Wette gewonnen«, teilte Simon ihm mit.
»Daran habe ich nie gezweifelt.« Robert grinste. »Du könntest noch nicht einmal die Finger eines einarmigen Mannes abzählen.« Er klopfte Simon auf den Rücken, dann sah er Will an, der verstummt war und versonnen über die Stadt hinwegblickte. »Ein merkwürdiges Gefühl, wieder hier zu sein, nicht wahr?« Sein Lächeln erstarb. »So viel ist in der Zwischenzeit geschehen.«
»Du solltest dich um die Pferde kümmern, Simon«, sagte Will abrupt. Er wandte sich ab und ging auf die Planken zu. Die letzten Ritter verließen gerade das Schiff und ließen die Sergeanten und die Besatzung zurück.
Robert wechselte einen Blick mit Simon, dann folgte er Will. »Der Großmeister wünscht, dass wir mit ihm an der Spitze des Trupps gehen. Ich glaube fast, er hat den Weg zum Ordenshaus vergessen.«
Sie schritten die unter ihren Füßen vibrierenden Planken hinab. Als Will die steinerne Mole betrat, überkam ihn plötzlich das Gefühl, etwas Unwiderrufliches getan zu haben. Am liebsten hätte er kehrtgemacht, wäre wieder an Bord gegangen und weitergesegelt.
Gemeinsam stapften die beiden Männer über stinkende, mit Unrat – zerrissene Aalreusen, einem Holzschuh und toten Vögeln – übersäte Schlammbänke hinweg, die bald braunem Sand und hartem Gras und dann einer morastigen Straße wichen. Die Gegend wimmelte von Männern und Frauen, die nach dem Morgengottesdienst zur Arbeit hetzten. Eine Kutsche, in der zwei kostbar gekleidete Edelfrauen saßen, rumpelte vorbei. Eine Schar zerlumpter Kinder rannte in der Hoffnung, ein paar Münzen zu ergattern, hinter dem Gefährt her, doch die Frauen blickten mit einstudierter Gleichgültigkeit in die andere Richtung. Als die Kinder außer Sicht waren, strömte eine Schweineherde aus einer Gasse, gefolgt von einem Hirten, der sie mit Stockhieben zum Wasser hinuntertrieb, auf einen Kai zu, wo Karren mit Holz beladen wurden.
Vor ihnen hatten sich die Ritter zu einer Gruppe zusammengeschlossen, an deren Spitze der Großmeister stand. Jacques de Molay war ein Hüne von einem Mann, Anfang fünfzig, mit struppigem grauem Haar, das ihm in dicken Wellen bis auf die Schultern fiel. Wie alle Tempelritter trug auch er einen Bart, doch statt ihn wie Will und Robert säuberlich zu stutzen, hatte er den seinen wachsen lassen, bis er ihm bis zur Brust reichte. Will hatte einen Ritter einmal behaupten hören, der Großmeister würde ihn zu einem Zopf flechten und ihn in sein Hemd schieben, bevor er in eine Schlacht zog. Jacques wandte sich gerade an einen seiner Männer. Sein Französisch klang barsch und guttural. »Sprich mit dem Hafenmeister, und finde heraus, wo unser Schiff ankern kann, dann weise die Sergeanten an, uns mit unserem Gepäck zu folgen. Hoffentlich ist meine Nachricht rechtzeitig im Ordenshaus eingetroffen, und man erwartet uns.«
»Ja, Monsieur.« Der Mann wartete ab, bis ein Karren an ihm vorbeigerattert war, dann überquerte er die Straße.
Jacques’ Blick fiel auf Will, Robert und die letzten soeben zu ihnen gestoßenen Ritter, er winkte die kleine Gruppe zu sich. »Kommandant Campbell, geht voran.«
Will nahm sich einen Moment Zeit, um sich zu orientieren, dann führte er die sechzig Ritter in Richtung der Kirche St. Gervais, deren hoher Turm im Nebel verborgen lag. Ein paar Leute starrten sie an, als sie in einer geordneten Kolonne die belebte Straße entlangmarschierten, aber die meisten schenkten ihnen keinerlei Beachtung, sondern gingen unbeirrt ihrem Tagewerk nach. In Paris, dem Hauptsitz des Ordens im Westen, gehörten Templer zum alltäglichen Stadtbild, ebenso wie die Professoren und Studenten der Sorbonne am linken Seineufer und die königlichen Würdenträger der Ile de la Cité. Kurz vor der Kirche bog Will in eine schmale Seitenstraße ab, die sich durch ein Gewirr von Gassen und niedrigen Treppen hindurchwand und von sich einander zuneigenden Fachwerkhäusern gesäumt wurde. Die oberen Stockwerke einiger dieser Gebäude lagen so nah beieinander, dass die Bewohner sich über die Straße hinweg die Hände schütteln konnten. Von Wäschestücken, die an zwischen den Häusern gespannten Leinen hingen, fielen schwere Wassertropfen auf die Köpfe der Ritter. Will waren diese düsteren Sträßchen auf schmerzliche Weise vertraut. Hinter jeder Ecke lauerten die Geister der Vergangenheit auf ihn; machten leise in Form von verblassten Schildern und Fensterläden, von denen die Farbe abblätterte, und nachdrücklicher in Gestalt eines mit Wasserspeiern geschmückten Kirchturmes auf sich aufmerksam, der in einer Lücke zwischen den Gebäuden auftauchte. Mit der Vertrautheit kamen die Erinnerungen. Sie hingen körperlos in der Luft und materialisierten sich hier und da in Eingängen von Läden, abbröckelnden Fassaden und den Gesichtern vorübereilender Menschen. Dinge, die er während der endlosen Reise von Zypern hierher erfolgreich verdrängt hatte, drohten ihn nun zu überwältigen.
Zwei Fleischer mit blutbespritzten Schürzen standen müßig in einem Türrahmen. Ein Bäcker schwatzte angeregt mit einer Kundin, der er zwei Brotlaibe reichte. Will starrte sie an. Er fragte sich, ob er nach all dieser Zeit wohl irgendjemanden wiedererkennen würde. Vor ihm glitt eine junge Frau im Schlamm aus und ließ dabei ihren Korb fallen. Als sie sich bückte, um ihn aufzuheben, verrutschte ihr Schleier und gab kupfergoldene Locken frei. Will blieb stehen. Sein Blick ruhte wie gebannt auf ihr, auch noch, als sie sich aufrichtete und er ihr Gesicht sah – das Gesicht einer völlig Fremden. Er schrak zusammen, als Robert ihn am Arm berührte.
»Stimmt etwas nicht?«
Erst jetzt bemerkte Will, dass er einen Moment lang alles um sich herum vergessen hatte. »Nein, nein. Ich musste nur überlegen, wo es langgeht.«
Robert musterte das weiterhastende Mädchen, dann Will, sagte aber nichts. Schweigend setzten sie ihren Weg fort.
Nachdem sie den Fluss hinter sich gelassen hatten, wurde der Nebel dünner, und bald ragten die von Türmen flankierten Stadtmauern aus gelbem Stein vor ihnen auf. In einiger Entfernung hatte sich vor dem Tempeltor eine Menschenmenge versammelt. Als die Ritter näher kamen, vernahmen sie eine weithin hallende Stimme.
»Weint, meine Kinder! Weint um den Verlust von Gottes Königreich auf Erden! Weint um den Fall Jerusalems und den Aufstieg Babylons! Weint um die Männer, deren Sünden uns diese Zeit der Dunkelheit beschert haben!«
Will kniff die Augen zusammen und sah einen Mann mit weit ausgebreiteten Armen auf den Stufen einer Kirche stehen. Seine Stimme klang heiser, als habe er sich schon seit geraumer Zeit so verausgabt. Er war noch jung; seine Tonsur hob sich bleich von seinem dunklen Haar ab. Seine graue Kutte war abgetragen und zerschlissen, die bloßen Füße schlammverkrustet. Er war ein Franziskaner: einer der Anhänger des heiligen Franz von Assisi, die als Bettelmönche in die Welt hinauszogen, um das Evangelium zu predigen, und sich darauf verließen, dass die Gläubigen sie ernährten und kleideten. Will hatte schon lange keinen mehr gesehen.
»Weint um eure Könige und Prinzen, die die Heilige Stadt für Gold verkauft haben, um ihre Taschen zu füllen und ihre Huren mit Geschmeide zu schmücken!«
Einige Zuschauer gingen desinteressiert weiter, aber die meisten blieben stehen, um zu lauschen, als der junge Mönch seine leidenschaftliche Predigt fortsetzte. Ein paar bekundeten sogar mit einem nachdrücklichen Nicken ihre Zustimmung.
»Und vor allem weint um die Ritter, meine Kinder, deren Blutdurst nur erwacht, wenn es ihren Zwecken dient. Ist dies nicht der Fall, so lassen diese Krieger Mütter und Kinder, alte Männer und Blinde gewissenlos im Stich, sodass diese den Schwertern der Ungläubigen allein mit Gebeten entgegentreten müssen!« Er deutete mit einer Hand auf das Tempeltor. »Sie haben die Stadt Gottes in einen Scheiterhaufen und unseren Traum in Asche verwandelt!«
Donnernder Jubel und Beifall brandeten auf.
»Was hat das zu bedeuten?«, wandte sich Jacques mit einem fragenden Stirnrunzeln an Will.
Der Mönch holte tief Atem, um weitere Anschuldigungen folgen zu lassen, hielt aber inne, als sein Blick auf die Ritter fiel. Seine Augen leuchteten auf. »Dies sind jene Männer!« Sein Zeigefinger richtete sich anklagend auf die Templergruppe. »Ihre Gier und ihre Gottlosigkeit haben dieses Unheil über uns gebracht!«
Zahlreiche Köpfe fuhren herum. Einige Zuschauer zogen sich angesichts der näher rückenden Gestalten in den weißen Mänteln mit dem leuchtend roten Kreuz auf der Brust hastig zurück, doch viele andere starrten die Ritter herausfordernd an.
»Dies sind die Männer, die vor den Sarazenen geflohen sind, um ihre eigenen Reichtümer in Sicherheit zu bringen, statt Frauen und Kinder davor zu bewahren, geschändet und niedergemetzelt zu werden!«
»Achtet nicht auf ihn, Monsieur«, riet einer der hochrangigeren Ritter, als Jacques einen Schritt vortrat. »Er weiß nicht, wovon er spricht.«
»Dann wird es Zeit, dass jemand ihn darüber aufklärt«, grollte Jacques, ihn zur Seite schiebend.
»Kommt mit.« Der Ritter bedeutete Will und Robert, ihm zu folgen.
»Bei allem Respekt, Sir«, warf Robert rasch ein, als der Templer sich anschickte, sein Schwert zu ziehen. »Ich denke, das wird nicht nötig sein.« Alle Ritter waren jetzt stehen geblieben. Die im hinteren Teil der Gruppe verrenkten sich die Hälse, um zu sehen, was da vorne vor sich ging. »Diese Menschen sind unbewaffnet«, fuhr Robert fort, als der andere Mann zögerte. »Wir werden nur eine Panik auslösen.«
»Was glaubst du, wer du bist?« Jacques stapfte mit grimmiger Miene auf den Mönch zu. Die Menge teilte sich vor ihm wie Wasser. Er überragte fast alle Männer ringsum; das große rote Kreuz auf seinem Rücken hob sich hell leuchtend von ihren tristen grauen und braunen Tuniken ab. »Warum beleidigst du meine Ritter?«
»Ich bin die Stimme der Wahrheit«, erwiderte der Mönch trotzig, dabei schritt er die Stufen hinab; sichtlich entschlossen, Jacques die Stirn zu bieten. Durch die Menge, die auf eine dramatische Konfrontation hoffte, lief ein Raunen. »Ich komme jeden Tag hierher und verkünde den Bewohnern dieser Stadt alles, was sie nicht wissen.«
»Und was soll das sein?«
»Dass Ihr und Eure Männer das Heilige Land in der Stunde der Entscheidung im Stich gelassen habt.« Der Mönch wandte sich an seine Zuhörer und hob die Stimme. »Zweihundert Jahre lang hat der mächtige Templerorden nicht nur Geld von Königen und Prinzen erhalten, sondern auch Spenden von frommen, großzügigen Bürgern wie euch. Dieses Geld sollte zum Schutz christlicher Pilger im Osten verwendet werden. Aber diese Männer ließen ebenjene Pilger tatenlos in die Hände der Sarazenen fallen, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, ihr eigenes Leben und ihre Reichtümer zu retten.« Er konzentrierte sich wieder auf Jacques. »Vielleicht haben die Templer einst gute Arbeit geleistet und dem Christentum gedient, aber heute heißen Eure Herren Stolz, Gier und Überheblichkeit. Euer Wohlstand fließt in bequeme Unterkünfte, kostbare Kleider und Fleisch und Wein für Eure Tafel. Euer Armutsgelübde hat keinerlei Wert mehr, denn selbst wenn Männer alles aufgeben, was sie besitzen, wenn sie in Euren Orden eintreten, führen sie danach ein Leben im Luxus.«
Einige Ritter traten mit vor Zorn verdunkelten Gesichtern drohend vor.
»Du verbreitest bösartige Gerüchte, sonst nichts«, herrschte Jacques den Franziskaner an. »Tausende Ritter dieses Ordens haben ihr Leben gegeben, um das Heilige Land zu verteidigen.«
Vor Will, der den Großmeister nicht aus den Augen ließ, flammte plötzlich ein Bild auf. Er sah sich selbst in einer Kirche auf einer Plattform neben einem anderen Großmeister stehen, der versuchte, eine aufgebrachte Menge dazu zu bewegen, Frieden mit den Muslimen zu schließen. Die Bewohner Akkons hatten nicht auf ihn gehört, hatten ihn einen Verräter genannt und in dem darauffolgenden Massaker einen hohen Preis dafür bezahlt.
»Wir konnten genauso wenig darauf hoffen, die Sarazenen aufzuhalten, wie wir darauf hoffen können, der einsetzenden Flut Einhalt zu gebieten«, fuhr Jacques fort, dabei richtete er seinen durchdringenden Blick auf die Menge. »Als die ersten Breschen in die Mauern Akkons geschlagen wurden, gewährten wir Tausenden von Christen Zuflucht und brachten so viele wie möglich nach Zypern in Sicherheit.« Seine Stimme klang mit einem Mal gepresst. »Kurz bevor das Ordenshaus eingenommen wurde, setzte unser letztes Schiff mit mehr als hundert Flüchtlingen an Bord die Segel, und viele der Unseren blieben zurück und sahen dem sicheren Tod entgegen.«
Vor Wills geistigem Auge nahm ein anderes Bild Gestalt an. Die Mameluckenarmee strömte durch die Breschen in der Mauer nach Akkon hinein. Der Himmel über den wogenden Menschenmassen war schwarz von Rauch, die Luft von Pfeilhageln erfüllt. Überall rings um ihn herum schrien seine Kameraden vor Schmerz und Entsetzen, als sie erbarmungslos niedergestreckt wurden oder in Flammen aufgingen, wenn sie von explodierenden Naphthageschossen getroffen wurden. Die Straßen waren mit Leichen übersät, es herrschte Chaos, Ströme von Blut wurden vergossen, und überall loderten Feuer auf. Will schloss die Augen. Furchtbare, alles verzehrende Feuer.
»Handeln so selbstsüchtige Männer? Oder Feiglinge?« Als niemand antwortete, donnerte Jacques: »Tun sie das?« Die Menge begann sich aufzulösen; kaum jemand vermochte dem stahlharten Blick des Großmeisters standzuhalten. Jacques fuhr zu dem Mönch herum. »Sollten mir deine Lügen je wieder zu Ohren kommen, lasse ich dich durch diese Straßen peitschen. Meine Männer haben den Traum der Christen jahrzehntelang aufrechterhalten, haben dafür gekämpft und sind dafür gestorben. Du wirst ihnen den Respekt erweisen, der ihnen gebührt!«
Er wandte sich ab und ging davon, doch der Mönch bahnte sich einen Weg durch die Menge und folgte ihm. »Wenn Ihr mehr Mut gezeigt hättet, wäre Akkon nicht gefallen. Während die Sarazenen eine Armee zusammengezogen haben, habt Ihr untereinander belanglose Kämpfe ausgetragen. Es ist allgemein bekannt, dass Eure Zwistigkeiten mit den Hospitalitern unsere Truppen entzweit und geschwächt haben!«
Will schlug die Augen auf, als die krächzende Stimme des Mannes in seinen Ohren widerhallte. Jacques setzte seinen Weg unbeirrt fort, doch der Franziskaner heftete sich an seine Fersen und zeterte weiter, ohne die Warnung in den grimmigen Gesichtern der Ritter zu beherzigen.
»Ihr solltet für all die toten Kinder und Frauen zur Rechenschaft gezogen werden! Ihr solltet Euch schämen! Ihr habt sie schutzlos zurückgelassen, obwohl es Eure Pflicht war, sie notfalls mit Eurem Leben zu verteidigen. Ihr nennt Euch Krieger Christi? Ich sage Euch, dass Christus Euch verdammen wird!«
Will war mit einem Satz an der Seite des Mönches. Alles, was er sah, war der aufgerissene Mund des Mannes; ein dunkles, sich öffnendes und schließendes Loch, dem diese durchdringende Stimme entströmte. Er wurde nur noch von dem Gedanken beherrscht, sie zum Schweigen zu bringen. Hinter ihm rief jemand etwas, doch er war taub für alles außer dem Protestgekreische des Mönches. »Warst du dort?« Er packte den Franziskaner bei seiner Kutte. »Warst du dort?« Als er keine verständliche Antwort erhielt, ballte er eine Faust und schmetterte sie in das Gesicht des Mannes. Das Knirschen von Knochen und der Schmerz, der durch seine Knöchel zuckte, verschaffte ihm eine ebenso tiefe Befriedigung wie das Blut, das aus dem Mund des Mönches strömte, als sein Kopf zur Seite flog und ein gelblicher Zahn zu Boden fiel. Will holte gerade zu einem zweiten Schlag aus, als eine harte Hand ihn packte und von seinem Opfer wegzerrte.
»Schluss jetzt!«
Jacques’ Stimme durchdrang den roten Schleier seiner Wut. Will ließ den Arm sinken und atmete tief durch.
Jacques funkelte ihn finster an. »Beherrscht Euch, Kommandant! Wir prügeln uns nicht wie betrunkene Strauchdiebe auf offener Straße, auch wenn wir noch so sehr provoziert werden.«
»Es tut mir leid, Großmeister«, murmelte Will. Als er sich mit dem Handrücken über den Mund fuhr, stellte er fest, dass sein Bart mit Speichel durchtränkt war.
»Ihr werdet für Euer unziemliches Verhalten Buße tun.«
»Jawohl, Großmeister.«
Die Gruppe wandte sich von dem im Schlamm kauernden Mönch ab und setzte ihren Weg schweigend fort. Am Tempeltor hielten die Stadtwächter jeden zurück, der die Stadt betreten oder verlassen wollte, während die Ritter ihrem Wegerecht gemäß in einer weißen Kolonne das Tor passierten. Will legte seine pochende Hand auf den Griff seines Krummschwertes, ohne auf die verstohlenen Blicke zu achten, die Robert ihm zuwarf. Sie überquerten den Stadtgraben und gelangten auf eine Straße, die an großen Herrenhäusern, einem Hospital für Leprakranke und mehreren Gasthäusern vorbeiführte. Die Stadtmauern von Paris waren vor über einem Jahrhundert erbaut worden, doch schon Jahrzehnte später hatte sich die Stadt über diesen steinernen Ring hinaus ausgebreitet; Abteien, Gebäude und Weingärten waren entstanden und bildeten jetzt überfüllte Vororte. Dahinter lagen von Kornfeldern umgebene Weiler und Dörfer. Hinter den majestätischen Türmen der Kluniazenserpriorei Saint-Martin-des-Champs erhob sich ein noch mächtigerer, von einer hohen Mauer umringter Gebäudekomplex über den winterlich braunen Feldern.
Das Tempelgelände empfing Will wie einen alten, vor langer Zeit verlorenen, aber nie vergessenen Freund. Seit er Akkon verlassen hatte, war er nie lange genug in einer Stadt geblieben, um sich dort heimisch zu fühlen. Hier in diesen feuchten Feldern, Welten von den trockenen Ebenen Palästinas getrennt, stieg das überwältigende Gefühl in ihm auf, nach Hause gekommen zu sein, und verdrängte weniger angenehme Erinnerungen. Er dachte an die anderen Orte, an denen er längere Zeit gelebt hatte – London und den Landsitz bei Edinburgh –, und zum ersten Mal seit Jahren sehnte er sich dorthin zurück.
Das höchste Bauwerk innerhalb der Mauern war der große Donjon, dessen Türmchen sich dunkel vom weißen Himmel abhoben. Darum herum drängten sich zahlreiche andere Gebäude, deren unterschiedlich hohe und winkelige Dächer eine gezackte Silhouette bildeten. Als die Ritter sich dem Torhaus näherten, nahmen die wachhabenden Sergeanten Haltung an. Ihre Augen hefteten sich mit respektvollem Staunen auf die bullige Gestalt von Jacques de Molay, dann schoben sie die Tore auf, die sich knarrend zu einem vom Wachhausturm überschatteten Hof öffneten. Ein Sergeant eilte davon, um die Ankunft des Großmeisters zu melden, und Will betrat den Hof, wo er sofort von Erinnerungen überwältigt wurde.
Dieser Ort war ihm so vertraut; er kannte hier jeden Winkel, jedes Haus, jedes Nebengebäude. Er kannte den beißenden Geruch, der von den Ställen herüberwehte, und die Hitze, die in der von Dienstboten wimmelnden Küche herrschte. Die tröstliche Wärme der nach Hefe duftenden Backstube war ihm ebenso vertraut wie der Gestank der in den Lagerhäusern gärenden Äpfel und die morgendliche Kälte in der von den Gebeten von fünfhundert Männern erfüllten Kapelle. Er wusste, wie es war, Wasser direkt aus dem Brunnen zu trinken; wusste, wie die Fische in den Teichen nahe der Unterkünfte der Sergeanten zur Fütterungszeit ein silbrig zappelndes Meer bildeten, wie das Gehämmer in der Waffenschmiede in den Ohren dröhnte und was es hieß, auf einem mit Raureif überzogenen Übungsfeld sein tägliches Training zu absolvieren. Als störrischer dreizehnjähriger Sergeant, der keine Ahnung hatte, wie sein Leben weitergehen sollte, war er hierhergekommen, nachdem er Zeuge des Mordes an seinem Herrn geworden war. Hier hatte er Owein begraben, hier war er Everard begegnet, hier hatte so vieles seinen Anfang genommen. Er hätte gern die Zeit zurückgedreht, um den von Kummer und Angst erfüllten Jungen davor zu warnen, das Ordenshaus zu verlassen und Everards Befehle zu befolgen. Hätte er das nicht getan, würde er heute nicht hier stehen; ein Mann, der wie ein Geist durch sein eigenes Leben huschte und nur Tod und Verrat hinter sich her zog.
Der Rittertrupp strömte in den Hof, über dem die größten Gebäude des gesamten Komplexes aufragten: der Donjon und die Schatzkammern, die Unterkünfte der Amtsträger, die große Halle und das Domkapitel. Dienstboten hielten mit ihren Tätigkeiten inne, als sie Jacques sahen, und starrten ihn an. Irgendwo erklang eine Glocke. Im nächsten Moment wurde die Tür des Hauses zu ihrer Rechten geöffnet, und eine Gruppe von Menschen trat heraus. Angeführt wurde sie von einem kleinen, untersetzten Mann mit öligem, streng aus dem Gesicht zurückgekämmtem Haar. Er hatte eine aufgeworfene Nase und dünne, von einem drahtigen Bart umrahmte Lippen. Die Veränderung, die mit seinem alten Kameraden vorgegangen war, riss Will aus seiner Versunkenheit. Er hatte Hugues de Pairaud vor über zehn Jahren zum letzten Mal in Akkon gesehen. Damals waren sie beide Ende dreißig gewesen, und seither hatte das Alter Spuren bei dem Visitator des Templerordens hinterlassen. Sein schwarzes Haar war mit grauen Strähnen durchzogen, seine Wangen waren schlaff geworden, und unter seinem Überwurf zeichnete sich ein nicht zu übersehender Schmerbauch ab.
Hugues nickte Will verhalten zu, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Großmeister. »Sire.« Er verneigte sich. »Es ist mir eine Ehre.«
Jacques winkte ungeduldig ab. »Ihr habt meine Botschaft erhalten?«
»Vor zwei Monaten. Wir haben Eurer Ankunft mit großer Freude entgegengesehen. Ich habe auch unsere Ordenshäuser in diesem Königreich und in England von Eurem bevorstehenden Besuch in Kenntnis gesetzt.«
»Schön, dass sich zur Abwechslung jemand freut, uns zu sehen.« Als Hugues verständnislos die Stirn runzelte, berichtete Jacques ihm von dem Zwischenfall mit dem Franziskaner.
»Diesen Unruhestifter kennen wir. Wir haben schon des Öfteren versucht, ihn zu vertreiben.«
»Ihr habt ihn zu vertreiben versucht? Er hätte verhaftet werden sollen, wenn er sich Eurem Befehl widersetzt. Es gab einmal eine Zeit, da war es ein Verbrechen, uns zu beleidigen. Haben sich die Zeiten so geändert, dass ein Mann unbehelligt an einer Straßenecke stehen und uns verleumden kann?«
Ein neben Hugues stehender Templerbeamter antwortete. »Wir wollten seinen Predigten keine übermäßige Bedeutung verleihen, indem wir großes Aufhebens darum machen. Wir fürchteten, man würde glauben, dass seine Worte eine Spur von Wahrheit enthalten, wenn wir ihn in den Kerker geworfen hätten.«
»Ich versichere Euch«, warf Hugues rasch ein, als sich die Augen des Großmeisters verdunkelten, »dass wir uns eingehender mit diesem Franziskaner befassen werden, wenn Ihr es befehlt.«
»Mir macht nicht der Mann als solcher Sorge, sondern der Umstand, dass die Leute ihm so aufmerksam zuhören. Machen sie uns wirklich für den Verlust des Heiligen Landes verantwortlich?«
»Nur eine unzufriedene Minderheit«, erwiderte Hugues nach kurzem Zögern. »Und nicht nur uns, sondern auch noch viele andere: die Hospitaliter, die Deutschordensritter und…« Er lachte geringschätzig auf. »Sogar die Franziskaner, weil sie angeblich nicht inbrünstig genug gebetet haben. Als wir vom Fall Akkons erfuhren, herrschte zuerst allgemeine Panik. Die Menschen waren überzeugt, dass Gott sich von uns abgewandt hatte. Einige sind sogar zum Islam konvertiert und nach Granada geflohen, andere haben nach Gründen für die über uns hereingebrochene Katastrophe gesucht und nach möglichen Sündenböcken Ausschau gehalten. Aber inzwischen hat sich die Lage beruhigt, Akkon ist nicht mehr das Hauptgesprächsthema in der Stadt.« Hugues presste die Lippen zusammen, als habe er dem nichts mehr hinzuzufügen, fuhr dann aber doch fort: »Die Abdankung von Papst Coelestin und natürlich der Krieg beschäftigen die Leute jetzt weit mehr.«
Jacques sog zischend den Atem ein. »In der Tat. Ihr erwähntet das in der letzten Botschaft, die ich auf Zypern erhielt, aber nach unserer Abreise nach Rom erwies es sich als äußerst schwierig, weitere Informationen zu bekommen. Für einen ausführlichen Bericht wäre ich Euch sehr dankbar.«
»Selbstverständlich, Großmeister. Aber wollen wir das nicht in einer angenehmeren Umgebung besprechen? Ich werde die Diener anweisen, Eure Privatgemächer herzurichten. In der Zwischenzeit können wir uns in mein Studierzimmer zurückziehen.«
»Meine Offiziere werden sich uns anschließen. Das erspart uns die Mühe, uns wiederholen zu müssen. Lasst den Rest der Männer zu ihren Unterkünften bringen.«
Hugues nickte zwei in seiner Nähe stehenden Rittern zu, die die erschöpften Neuankömmlinge über den Hof auf ein niedriges Gebäude zuführten.
Jacques deutete auf sechs Templer, die sich um ihn geschart hatten. »Und Ihr kommt auch mit, Campbell.« Er winkte Will zu sich. »Ein Kommandant sollte bei dieser Besprechung anwesend sein. Ihr könnt hinterher die restlichen Männer über die wichtigsten Punkte informieren.«
Robert schloss sich der Rittergruppe an, Simon führte zusammen mit den Sergeanten die Pferde, die sich gleichfalls an Bord befunden hatten, zu den Ställen hinüber, und Will trottete müde hinter dem Visitator und dem Großmeister her.
»Die Nachricht, dass Großmeister Gaudin so kurz nach seiner Wahl verstorben ist, war ein schwerer Schlag für uns«, sagte Hugues gerade. »Und dann hat sich diese Tragödie auch noch so bald nach Guillaume de Beaujeus Tod in Akkon ereignet. Aber«, fügte er rasch hinzu, »wir sind über Eure schnelle Ernennung alle sehr froh.«
Jacques maß ihn mit einem schwer zu deutenden Blick. »Ich bin der Erste, der zugibt, dass meine Wahl zum Großmeister sehr überraschend kam, Visitator de Pairaud. Immerhin bin ich ein Militärkommandant und kein Diplomat, wie es einige meiner Vorgänger waren.«
»Aber Ihr dient dem Orden weit länger als die meisten von uns. Wenn ich mich recht erinnere, führte mein Onkel Humbert Eure Initiation durch, als er der Meister von England war, oder täusche ich mich da?«
»Nein, das tut Ihr nicht.«
Als Jacques nicht weiter darauf einging, wechselte Hugues das Thema. »Eure Reise von Italien hierher verlief ohne Zwischenfälle?«
»Ja. Wir sind, so wie es uns empfohlen wurde, von Genua nach Montpellier gesegelt, obwohl ich gerne unser Ordenshaus in Colliure besucht hätte.«
»Die östliche Route war die sicherste. Seit die Engländer Bayonne und Blaye eingenommen haben, sind die unter Charles de Valois in Guyenne stationierten königlichen Truppen immer unberechenbarer geworden. Die Gewaltbereitschaft wächst, vor allem gegen die Barone der Gascogne und des Umlands. Gerüchten zufolge hat König Philipp die Konfiskation des gesamten Besitzes aller Edelleute angeordnet, denen eine Verbindung zum König von England nachgewiesen werden kann, aber da fast der ganze Adel Lord Edward während seiner Herrschaft über die Grafschaft als Regenten anerkannt hat, wurde so gut wie jeder Großgrundbesitzer südlich der Garonne verhaftet.«
Jacques duckte sich unter der niedrigen Tür eines großen Gebäudes hinweg. »Soweit mir bekannt ist, wurde diese ganze Krise durch die Versenkung einiger Handelsschiffe ausgelöst. Hätte man dem Problem nicht auf andere Weise beikommen können?«
»Leider ist die Sachlage sehr viel komplizierter, Großmeister«, entgegnete Hugues. Er führte die Männer eine Treppe aus poliertem Holz empor, die in einem von Fackeln erleuchteten Gang endete. Ritter und Schreiber gingen geschäftig ihrem Tagewerk nach. Alle gaben dem Großmeister und seinem Gefolge respektvoll den Weg frei. Ihre Augen blieben auf dem vorbeirauschenden Jacques haften. Die Goldstickerei, die das rote Kreuz auf seinem Mantel säumte, schien im Fackelschein zu glühen. »Es ist über dreißig Jahre her, seit König Louis den Vertrag von Paris mit Henry III. von England unterzeichnet und ihm zugesagt hat, Guyenne an ihn und seine Erben abzutreten. Im Süden dieses Herzogtums liegt die Gascogne, eine der reichsten Regionen Frankreichs. Unser König teilt seine Macht nicht gerne mit anderen, und es war eine schwere Bürde für ihn, dass ein anderer Monarch über einen Teil seines Reichs herrscht – noch dazu über einen für ihn so wichtigen Teil. Edward mag ja nur ein Vasall sein, aber er verfügt über eine beträchtliche Macht. König Philipp war nie wirklich gewillt, den Vertrag von Paris anzuerkennen, ihm war jedes Mittel, ob nun legal oder nicht, recht, um zu verhindern, dass Edward die Gesamtherrschaft an sich reißt.« Hugues stieß eine Flügeltür auf und betrat eine geräumige Kammer. Neben dem Fenster stand ein mit Schriftrollen und Karten übersäter Tisch, dahinter ein hochlehniger Stuhl. Über dem Kamin hing das Templerbanner, aber außer dem Schreibtisch und einem mächtigen Schrank an der Wand war der Raum fast leer.
Jacques blickte sich flüchtig um. Die kahle Schlichtheit der Kammer schien ihm zuzusagen. Er wandte sich wieder an Hugues. »Ihr klingt, als hätte Philipp diesen Krieg ganz allein zu verantworten, Pairaud, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es die Engländer waren, die die französischen Kaufleute angegriffen und ihre Schiffe versenkt haben.«
Hugues, dem diese unverblümte Offenheit missfiel, verzog ärgerlich das Gesicht. »Das ist richtig, und wie Ihr schon sagtet, hätte das Problem mittels einer Entschädigung aus der Welt geschafft werden können. Philipp hat den Vorfall allerdings zum Anlass genommen, die Herrschaft über das Herzogtum wieder an sich zu reißen.«
Will rückte näher an den Kamin heran und lauschte gebannt. Seine Aufmerksamkeit galt insbesondere einem bestimmten Namen.
»Anfang letzten Jahres«, fuhr Hugues fort, »bestellte Philipp König Edward nach Paris, um sich für den Angriff zu rechtfertigen. Edward ließ sich von seinem Bruder vertreten, der sich schließlich bereit erklärte, vorübergehend auf einige Städte zu verzichten und der Stationierung einer kleinen Anzahl französischer Truppen in Bordeaux zuzustimmen. Als Geste des Friedens bot Philipp Edward die Hand seiner Schwester an und versprach, auf das Herzogtum auch weiterhin zu verzichten, wenn Edward auf diese Bedingungen einging, was dieser auch tat. Aber Philipps Vorstellungen von einer kleinen Anzahl von Truppen wichen erheblich von denen Edwards ab. Er postierte eine ganze Armee in Guyenne, und als Edward protestierte, annektierte er das Herzogtum.«
»Woraufhin Edward ihm den Krieg erklärte.«
»Er konnte nichts anderes tun, wenn er seine französischen Herrschaftsgebiete zurückgewinnen wollte.«
Jacques trat zum Fenster.
»Und wie verläuft der Krieg?«, fragte einer der anderen Ritter den Visitator.
»Beide Seiten haben sich in eine Sackgasse manövriert. Den Engländern ist es gelungen, einige Städte zurückzuerobern, aber Bordeaux und die umliegenden Gebiete verbleiben fest in französischer Hand. Seit einiger Zeit rührt sich in beiden Lagern nur wenig, obwohl die königlichen Truppen vor kurzem begonnen haben, Angehörige des lokalen Adels zu verhaften.« Hugues sah Jacques an, der über die Mauern des Tempelkomplexes hinwegblickte. Nebelschwaden zogen über die Felder hinweg. Die Krähen in den Bäumen bildeten einen krächzenden Chor. »Aber mit dieser Angelegenheit können wir uns eingehender befassen, wenn Ihr Euch ausgeruht habt. Ich brenne darauf, Eure Neuigkeiten zu hören. Ihr wart bei der Amtseinführung des neuen Pontifex in Rom zugegen?«
Jacques drehte sich zu ihm um. »Ich denke, Papst Bonifaz wird sich in diesen Zeiten als standfestes Oberhaupt der Kirche erweisen.«
»Ist es Euch gelungen, im Westen Unterstützung für die Pläne des Ordens zu finden?«
Will entging der zögernde Unterton in der Stimme des Visitators nicht.