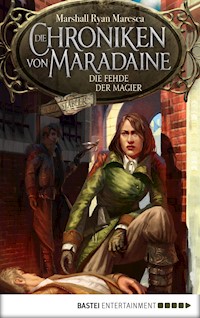9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geschichten aus Maradaine
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Veranix Calbert führt ein aufregendes Doppelleben: Tagsüber ist er ein Student der Magie an der Universität von Maradaine, nachts klettert er über die Dächer der Stadt als heimlicher Rächer. Eines Nachts stört Veranix die Übergabe einer geheimnisvollen Lieferung und entkommt mit dem Diebesgut. Doch nicht nur der Unterweltboss Fenton will seine kostbare Ware zurückhaben. Bald machen auch diverse Straßengangs, mächtige Magier und gedungene Meuchelmörder Jagd auf Veranix ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Danksagungen
Über das Buch
Veranix Calbert führt ein aufregendes Doppelleben: Tagsüber ist er ein Student der Magie an der Universität von Maradaine, nachts klettert er über die Dächer der Stadt als heimlicher Rächer. Eines Nachts stört Veranix die Übergabe einer geheimnisvollen Lieferung und entkommt mit dem Diebesgut. Doch nicht nur der Unterweltboss Fenmere will seine kostbare Ware zurückhaben. Bald machen auch diverse Straßengangs, mächtige Magier und gedungene Meuchelmörder Jagd auf Veranix …
Band 1 der fantastischen Reihe »Die Chroniken von Maradaine«
Über den Autor
Marshall Ryan Maresca wuchs im Staat New York auf und studierte Film und Videoproduktion an der Penn State Universität. Er hat bereits als Stückeschreiber, Bühnenschauspieler, Theaterintendant und Amateurkoch gearbeitet. DIE CHRONIKEN VON MARADAINE – DER ZIRKEL DER BLAUEN HAND ist sein Debütroman. Heute lebt Maresca mit seiner Frau und seinem Sohn in Austin, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website unter www.mrmaresca.com.
Marshall Ryan Maresca
DIE CHRONIKENVON MARADAINE
DER ZIRKEL DERBLAUEN HAND
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Lohmann
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Marshall Ryan MarescaTitel der Amerikanischen Originalausgabe: »The Thorn of Dentonhill«Originalverlag: DAW Books, New YorkBy Arrangement with DAW Books, New York.Dieses Werk wurde vermittelt durch Interpill Media GmbH, Hamburg
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Diana Menschig, ViersenKarte: Markus Weber, Guter Punkt, München nach einer Vorlage von Marshall Ryan MarescTitelillustration: © Christof GrobelskiUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5614-4
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
1. Kapitel
»Dieb!«, rief jemand von der Tür her.
Das will was heißen, dachte Veranix Calbert. So einer nennt mich einen Dieb! Dabei war er gerade erst eingestiegen und hatte gar keine Gelegenheit gehabt, irgendetwas zu stehlen.
Der Kerl an der Tür war einen Fuß größer als Veranix, ein muskelbepackter Berg. Die Weste aus grauer Wolle, weiße Hemdsärmel und ein dünnes Rapier am Gürtel sollten ihm offenbar ein wohlhabendes Aussehen verleihen. Veranix grinste frech. »Wenn du glaubst, dass hier ein Dieb ist, ruf mal besser die Wache.«
»Nein, Kleiner. Das wird nicht nötig sein.« Der Mann zog seine Waffe und kam auf Veranix zu.
Eigentlich hätte niemand hier sein sollen. Veranix hatte den Ort drei Tage lang beobachtet. Dieses Kontor über einer Fischkonservenfabrik diente nur zur Übergabe. Keiner hielt sich darin auf, keiner bewachte den Raum. Genau darum ging es ja dabei – jede Aufmerksamkeit zu vermeiden.
»Meinst du wirklich?« Veranix spannte die Muskeln an. »Ich hab gehört, die Konstabler wären sehr hilfsbereit.«
Der Mann stürzte sich auf ihn und schwang die Klinge. »Ich wird dir gleich helfen!«
Veranix sprang zur Seite, rollte sich ab und landete wieder auf den Füßen, gleich neben dem Schreibtisch in der Ecke. Zu seinem Glück hatte der Bursche zwar ein Rapier, aber keine Ahnung, wie man damit umging. Jede Menge Kraft, keine Raffinesse. Wer immer der Kerl sein mochte, ein Wachposten war er nicht. Veranix würde mit ihm fertig werden.
Er wünschte sich nur, er hätte seine Waffen nicht zurückgelassen. Ein anderer Vorteil blieb ihm aber …
»Also ehrlich, Kumpel. Das find ich überhaupt nicht hilfreich«, erklärte Veranix. Sein Blick flog über die Tischplatte, über die Papiere und Pergamente, die dort verstreut lagen. Das Zimmer war zu dunkel, um zu erkennen, ob die gesuchte Information darunter war.
»Nicht hilfreich für dich«, sagte der Mann und wandte sich wieder Veranix zu. »Aber für meine Freunde. Los, Leute!«
Drei weitere Männer, gekleidet und bewaffnet wie ihr Kumpan, erschienen an der Tür.
»Das ist wirklich unsportlich«, sagte Veranix. Ohne hinzuschauen, raffte er eine Handvoll Papiere zusammen und stopfte sie in die Manteltasche.
»Glaubst du ernsthaft, dass du damit hier rauskommst?«, fragte der erste Angreifer. Alle vier Männer umringten Veranix und blickten sehr selbstzufrieden drein.
Sie hatten allen Grund dazu. Sie blockierten die Tür und das Fenster und sie waren muskulöse Männer mit Schwertern. Vor sich sahen sie einen unbewaffneten und dürren jungen Burschen, der kaum den Kinderschuhen entwachsen zu sein schien. Er saß in der Falle – glaubten sie.
»Wenn’s euch nicht allzu viel ausmacht …«, sagte Veranix.
»Das tut es, Kumpel. Also leg alles wieder zurück, sonst helfen wir nach.«
»Ein verlockendes Angebot«, erwiderte Veranix. Er wirkte so wenig bedrohlich auf sie, dass sie immer noch nicht ihre Waffen zogen, die Hände ruhten locker auf den Griffen. Sie wollten eindeutig einen Kampf vermeiden. Das gab ihm einen Vorteil. Trotzdem war klar, dass er einen ehrlichen Kampf unmöglich gewinnen konnte – nicht mal gegen einen von ihnen, geschweige denn gegen vier dieser Gestalten.
Zum Glück hatte er nicht vor, ehrlich zu kämpfen.
In den verstreichenden Sekunden nahm Veranix so viel Numina auf, wie er nur konnte. Er formte es nicht lange aus. Er hatte keine Zeit, und er wollte sich den anderen gegenüber nicht verraten. Mit einem raschen, harten Stoß schleuderte er die magische Energie von sich. Die rohe Kraft dieses Angriffs reichte nicht, um einen der Gegner ernsthaft zu verletzen. Darum ging es gar nicht! Die Papiere auf dem Schreibtisch wirbelten auf und flatterten in einer dichten Wolke durch die Luft. Erschrocken sprangen die Männer zurück, und Veranix schoss auf die Tür zu.
Hastig sog er mehr Numina ein und entließ es wieder. Schon war der Boden unter den Schlägern mit einem dünnen, schmierigen Schimmer überzogen. Veranix spannte sich an und prallte frontal gegen den Mann in der Mitte. Der verlor den Halt und fiel um. Veranix schlitterte auf eine Empore hinaus, die oberhalb der Fabrikhalle entlangführte. Ohne langsamer zu werden, schwang er sich übers Geländer.
Gleich unterhalb des Geländers stand eine Wanne mit totem Fisch und halb geschmolzenem Eis, zu groß, um ihr auszuweichen. Veranix stürzte mitten hinein, und die Kälte traf ihn härter als der Aufprall. Es war keine optimale Landung, doch es reichte zur Flucht.
»Schnappt ihn«, rief eine Stimme von oben. Veranix war erschöpft und benommen nach zwei ungestümen Zaubern so rasch nacheinander. Ihm blieb keine Zeit, um sich zu erholen. Er rollte sich vornüber und landete auf dem Boden der Halle. Die Männer erreichten das obere Ende der Treppe, immer noch über den glitschigen Boden schlitternd und unsicher auf den Füßen. Veranix versuchte, die Eiswanne umzukippen um den Weg zu blockieren, doch der Behälter war zu schwer für ihn. Mit einem Achselzucken und einem Grinsen sprang er über die Arbeitsplatten in Richtung Tür.
»Lass nie deine Ausrüstung zurück, egal wie klein das Fenster ist«, murmelte er bei sich und stürmte hinaus auf die Straße. Hätte er seine Waffen nicht auf dem Dach gegenüber gelassen, dann hätte er ohne Magie entkommen können.
Keine Zeit für Feinheiten. In wilder Verzweiflung nahm er so viel Numina wie möglich in sich auf und leitete es in seine Beine.
Er sprang von den staubigen Pflastersteinen bis hinauf auf das Dach des Gebäudes auf der anderen Straßenseite. Es reichte fast, und er landete mit der Brust auf der Traufe. Hastig zog er sich über den Rand und ließ sich flach auf die Ziegel fallen. Sein ganzer Leib zitterte vor Erschöpfung, er konnte sich kaum noch bewegen.
Er verfluchte seine Nachlässigkeit, die schlampige Magie. Der Sprung war schludrig gewesen, genau wie jeder Zauber, den er gerade gewirkt hatte. Er hatte viel mehr Numina reingesteckt als nötig. So viel in so kurzer Zeit war mehr, als sein Körper aushielt. Und solche Zauber hinterließen Wellen im Numina, die andere Magier leicht bemerken, leicht verfolgen konnten. Wenn jemand aufmerksam wurde, herumschnüffelte, wenn man die Spuren zurückverfolgte zu ihm – noch ohne Zirkel, noch im Studium … fast hätte er es vorgezogen, sein Glück mit Fenmeres Schlägern zu versuchen.
»Wo zum Henker ist er?«, hörte er eine Stimme auf der Straße.
»Weit kann er nicht sein«, sagte ein anderer.
»Hat sich jemand gemerkt, wie er aussieht?«
»Dürrer Bursche, kastanienbrauner Mantel. Das ist alles.«
»Was hat er eingesteckt?«
»Keine Ahnung. Aber Fenmere zieht uns das Fell über die Ohren, wenn wir ihn entkommen lassen.«
Rasche Schritte entfernten sich in verschiedene Richtungen. Keiner der Männer betrat das Gebäude. Vermutlich würden sie nicht zu ihm heraufkommen. Veranix hob seinen Bogen, Pfeile, Kampfstab und Tasche auf, wo er sie zurückgelassen hatte. In seinem Kopf drehte sich noch alles von der Magie. Er spähte über die Straße hinweg zum Fenster des Kontors. Von hier aus wirkte es zu klein, als dass er sich mit all seiner Ausrüstung hätte hindurchzwängen können. Doch im Nachhinein sah das durchaus machbar aus. Er schüttelte den Kopf und beschloss, nie wieder etwas zurückzulassen, wenn es nicht unvermeidbar war.
Immerhin genoss er vom Dach aus einen atemberaubenden Ausblick. Der Weiße Mond war beinahe voll und hing tief am Horizont. Maradaine erstreckte sich vor ihm in die Ferne: die grauen Ziegelbauten von Dentonhill; dahinter die eng bebauten Straßen von Inemar und als breites, dunkles Band der Fluss. Lichter sprenkelten das finstere Wasser, die Lampen von Segelschiffen und die Beleuchtung der Brücken, die zum nördlichen Ufer der Stadt hinüberführten. Weit jenseits des Flusses schimmerten die Marmortürme der Stadtviertel von Nord-Maradaine und die glänzende Kuppel des Parlaments im Mondlicht.
Veranix sah sich auf dem Dach um. Trocknende Kleidung hing an einer Wäscheleine, ein paar Stühle standen neben einem Tisch, eine Tür führte ins Gebäude hinein. Sie war unverschlossen, ein dunkles Treppenhaus schraubte sich dahinter nach unten. Es sah wie ein Hausflur aus, nicht wie der Zugang zu einer Wohnung. Mit einem Seufzer schlich er ins Innere. Unter normalen Umständen hätte er seine Magie genutzt, um direkt hinab zur Straße zu springen, oder von einem Dach zum nächsten. Aber im Augenblick fehlte ihm die Kraft, um auch nur ein Insekt anzuheben.
Er wickelte den Bogen in seinen Mantel und versteckte ihn zusammen mit den Pfeilen und den gestohlenen Papieren in seiner Tasche. Er wollte keine Aufmerksamkeit erregen, indem er bewaffnet durch die Straßen spazierte. Den Stab allerdings konnte er unmöglich verstecken – das Risiko würde er eingehen müssen. Vielleicht würde er ihn tatsächlich als Stütze gebrauchen, so weh tat ihm alles. Zum Glück hatten die Schläger ihn vorher nicht mit Ausrüstung gesehen.
Er nahm Treppe nach unten bis zu einem feuchten Absatz voller Stockflecken, von dem aus Türen in vier Wohnungen abgingen. Gerade hatte er den Fuß auf die nächste Stufe gesetzt, als eine der Türen aufging.
Veranix erstarrte.
Ein junger Mann mit ungepflegtem Haar und trübem Blick schob den Kopf durch den Türspalt. Es dauerte einen Moment, bis er Veranix richtig wahrnahm, aber dann lächelte er und nickte.
»He«, sagte er, ruhig und freundlich.
»He.« Veranix trat zurück auf den Treppenabsatz.
»Wer ist da?«, zischte ein anderer Mann aus dem Inneren der Wohnung.
»Nur so’n Kerl«, erwiderte der Mann an der Tür.
»Will er kaufen?«
Der Mann an der Tür wandte sich Veranix zu. »Willst du ’fi kaufen?«
Die Frage kam ganz beiläufig, aber sie traf Veranix wie ein Schlag. Sie verkauften Effitte!
Er wusste, dass er einfach »nein« sagen sollte. Er war erledigt, ihm war schwindelig, er musste dringend heim. Er sollte einfach weitergehen.
»Sag ihm, er soll sich verpissen, wenn er nicht kaufen will!«
Veranix trat einen Schritt von den Stufen fort und weiter in den Hausflur hinein. »Ihr habt was für mich?«
»Wenn du die Kohle dafür hast«, rief der Mann aus der Wohnung zurück.
Veranix zog eine Münze aus der Tasche und zeigte sie dem Burschen an der Tür.
»Bist kein Knüttel, hm?«
»Seh ich aus wie einer?«
Der dürre Bursche an der Tür gluckste. »Nee. Überhaupt, als würden die hier raufkommen … außer, um selbst zu kaufen.«
Er ließ Veranix in die verwahrloste Wohnung. Es sah genau so aus, wie man sich eine Drogenhöhle vorstellte. Eine Handvoll heruntergedrehter Lampen glühte matt auf rissigen Holztischen. Hingeworfene Kleidungsstücke, Dreck und Abfälle lagen am Boden. In der Mitte des Zimmers stand ein gusseiserner Ofen, um den sich ein paar Schlafstätten reihten. Der faulige Geruch aus der Fischfabrik hing in der Luft. Veranix rümpfte die Nase, bis ihm klar wurde, dass der Gestank von ihm ausging und vermutlich seit dem Sturz in die Eiswanne an ihm klebte.
Ein älterer Mann, nur mit einer fleckigen Weste und zerrissenen Hosen bekleidet, kauerte neben dem Ofen und rieb die geschwärzten Hände vor der offen stehenden Herdklappe.
»Willst du kaufen, Junge?« Ganz offensichtlich hatte er hier das Sagen. Eine weitere Person saß in eine Decke gehüllt an der gegenüberliegenden Wand, ein junges Mädchen, vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Es starrte ausdruckslos ins Leere.
Veranix hielt die Münze in die Höhe. »Wenn du was anzubieten hast.«
»Halbe Krone das Fläschchen.«
Veranix nickte. Er griff in seine Tasche, lenkte ein klein wenig Magie durch seine Finger und brachte einen Klang wie von klimpernden Münzen hervor. »Wie viel für den ganzen Vorrat?«
»Mein ganzer Vorrat?« Der Mann lachte, trocken und ohne jede Heiterkeit. »Bist ein lustiger Bursche.«
»Ich zahl einen guten Preis dafür.«
Der Mann kniff die Augen zusammen und musterte Veranix. »Warum nimmst du nicht eins und kommst morgen früh für mehr zurück?«
»Geht klar.« Veranix holte ein paar Münzen aus der Tasche heraus und knallte sie alle auf einmal auf einen der Tische. Das Mädchen zuckte bei dem Laut zusammen, aber sein Blick wurde sofort wieder ausdruckslos.
Der ältere Mann schlug seine Weste auf und zog ein dünnes Fläschchen aus einer Innentasche. Veranix konnte mindestens zehn weitere in den Taschen erkennen. Der Mann reichte ihm das Fläschchen und beugte sich vor, um die Münzen aufzuklauben.
Veranix hielt das Effitte nur einen Augenblick in der Hand. Länger ertrug er es nicht. Wut loderte durch jeden einzelnen seiner Muskeln und fegte die Erschöpfung, die Benommenheit hinweg. Er schleuderte das Fläschchen in den Ofen.
»Hä?« Der Verkäufer wandte sich um, immer noch über den Tisch gebeugt. Veranix schwang den Stab, das Holz krachte hart auf den Schädel des Mannes. Der Bursche kippte nach vorn, seine Hände landeten auf dem heißen Ofen. Er schrie.
Die beiden anderen starrten Veranix verwirrt an.
»He, was tust du?«, setzte der jüngere Mann an und streckte den Arm nach Veranix aus. Veranix wirbelte herum und schlug mit dem Stab zu, zweimal dreimal, bis sein Gegner zu Boden ging. Der Mann war halb betäubt vom Effitte, er wehrte sich kaum.
Veranix wandte sich dem Mädchen zu. Das fuchtelte nur mit den Fingern in der Luft herum.
Er richtete all seine Aufmerksamkeit auf den Verkäufer, zerrte ihn zurück auf die Füße und riss ihm die Weste vom Leib.
»Ist das alles?«, fuhr er ihn an.
»Wie alles?« Der Mann war benommen und schluchzte. Er blickte im Zimmer umher, als suche er einen Sinn in dem, was gerade geschah.
»Das ganze Effitte?«
»Ja, ja.«
Veranix schob die Weste ins Feuer.
»Ihr habt nirgendwo noch mehr versteckt? Was ist mit der Kasse?«
»Das Geld steckt zwischen den Decken.« Tränen liefen ihm das Gesicht hinab. Dabei hatte er vorher so knallhart geklungen – Veranix hätte am liebsten laut aufgelacht. Doch dann dachte er an das ganze Effitte, dass der Bursche verschachert hatte. Er packte ihn an den Haaren, stieß seinen Kopf gegen den Ofen, und ließ ihn fallen. Der Mann stand nicht wieder auf.
»Bist du der Boss?«, fragte das Mädchen undeutlich.
»Du solltest von hier verschwinden.« Veranix durchwühlte das Deckenlager und fand einen Beutel Münzen. Er steckte ihn ein und stürmte aus der Wohnung.
Er kam zwei Treppenabsätze weit, bevor sein Zorn nachließ. In seinem Kopf drehte sich alles. So wenig Magie er auch benutzt hatte, er war immer noch geschwächt.
Veranix hockte sich auf die Stufen, lachte leise in sich hinein. Die Nacht war wohl doch kein völliger Reinfall gewesen. Er hatte einiges an Effitte vernichtet und ein paar Verkäufer aus dem Verkehr gezogen. Das war schon etwas.
Er zog die geklauten Papiere heraus. So erschöpft er auch war, er musste einfach wissen, ob er die Information bekommen hatte, die er brauchte, irgendwelche Hinweise auf Fenmeres Effitte-Lieferungen. Damit könnte er den Zufluss der Droge an der Quelle unterbinden und musste sich nicht länger mit den Straßenhändlern herumschlagen. Dann konnte er wirklich etwas ausrichten.
Im Treppenhaus war es zu dunkel zum Lesen. Verärgert schob Veranix die Papiere in die Tasche zurück.
Er schloss die Augen, nur für einen Augenblick.
In der Ferne läuteten die Glocken einer Kirche. Sieben Schläge? Wie lang hatte er auf der Stiege gesessen? Ein Streifen Sonnenlicht schimmerte unter der Tür hervor. War er eingeschlafen und hatte es nicht einmal bemerkt? Die Panik trieb ihn auf die Füße, und er zwang sich voran. Er durfte keine Zeit mehr vergeuden.
Veranix verließ das Gebäude und folgte der Necker Street nach Westen. Es war eine Hauptstraße, dicht gesäumt von grauen, schmutzigen Steingebäuden, die fünf oder sechs Stockwerke hoch aufragten, schwarze Eisengittervor den Fenstern. Trotz der frühen Morgenstunde war die Straße bereits belebt. Ladeninhaber öffneten ihre vergitterten Türen. Pferdekarren rollten langsam des Weges. Lampenputzer löschten die Straßenlaternen, die während der Nacht nicht heruntergebrannt waren.
Veranix mischte sich unter einige Männer, die in schwere, braune Schürzen gekleidet auf den nahen Schlachthof zuhielten. Der Geruch von Blut und das Geschrei hunderter todgeweihter Vögel erfüllte die Luft. Veranix war froh, dass er diese Gruppe gefunden hatte, um darin unterzutauchen. Selbst wenn Fenmeres Schläger ihn jetzt entdeckten und erkannten, würden sie ihn hier, unter Zeugen, vermutlich in Ruhe lassen.
Möglicherweise.
Andererseits war das Dentonhill. Fenmeres Viertel. Hier gab es keine Zeugen, die Fenmere nicht kaufen oder einschüchtern konnte. Alle Konstabler in der Gegend standen wahrscheinlich längst auf seiner Gehaltsliste.
Veranix musste nur drei Häuserblocks weit bis zur Waterpath Road schaffen, dann wäre er aus Dentonhill heraus und ein wenig sicherer. Zumindest verließ er damit Fenmeres unmittelbaren Einflussbereich.
*
Die Sonne spähte bereits über die Hausdächer und warf lange Schatten auf die Straße, als Veranix die Waterpath erreichte. Die Waterpath Road war eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, breit genug für vier Kutschen nebeneinander, und zu dieser Stunde gab es eine Menge Fahrzeuge, die den Platz ausfüllten. Es wimmelte von Fuhrwerken und Pferdekutschen, während dreirädrige, pedalgetriebene Tretwagen durch die Lücken sausten. Veranix überquerte die Straße, und Dentonhill blieb wie eine große graue Felswand hinter ihm zurück. Er schlängelte sich zwischen den Karren und Kutschen hindurch, bis er die helle, grüne Baumreihe vor der Universität von Maradaine erreichte.
Eine Menge Menschen waren auf der Straße unterwegs, aber niemand schien zu bemerken, wie er hinter einem dicht belaubten Baum verschwand und ein paar Äste hinaufkletterte. Er war wieder halbwegs zu Kräften gekommen, obwohl er sich noch immer erschöpft fühlte. Von seiner erhöhten Position aus konnte er auf die rückwärtige Mauer der Universität springen – das niedrige Bollwerk markierte eher die Grenze des Campus’ und hielt niemanden ernsthaft auf. Veranix kletterte über das grobe Mauerwerk und ließ sich auf der anderen Seite ins weiche Gras fallen.
Er entspannte sich ein wenig, als er den Campus betrat. Der Unterschied zu Dentonhill konnte größer kaum sein: der freie Blick auf den Himmel, der grüne Rasen des Universitätsgeländes, die hellen weißen Gebäude, die gepflasterten Fußwege, die überall von Fahnen, Statuen und duftend blühenden Bäumen gesäumt waren.
Es war niemand zu sehen, und kein Ausruf deutete darauf hin, dass man ihn entdeckt hatte. Veranix schickte ein hastiges Dankgebet an Sankt Senea. Jetzt musste er nur noch zurück ins Wohnheim gelangen. Das war eine weitere Herausforderung. Die Hintertüren zum Haus Almer waren abgeschlossen, und die Vertrauensschüler behielten die Haupteingänge im Auge. Wenn sie ihn jetzt außerhalb der Unterkünfte erwischten, mit einer Tasche und einem Stab in der Hand, müsste er eine Menge Fragen beantworten. Womöglich gäbe es sogar eine offizielle Untersuchung. Das hätte Tadel und Maßregelungen zur Folge, wenn nicht gar den Verweis von der Universität. Das war kaum besser, als hätten ihn die Schläger erwischt.
Im zweiten Stock hatte er ein Fenster offen gelassen, aber inzwischen war es viel zu hell, um dort hinaufzuklettern. Er konnte zu leicht gesehen werden. Wahrscheinlich würde man ihn ohnehin bald bemerken. Mit einem raschen Spurt erreichte er das Kutscherhaus.
Veranix schlich zu einem entlegenen Fenster des Gebäudes und klopfte gegen das Glas.
»Kai«, flüsterte er. »Kai« Einen Moment später schwang das Fenster auf.
»Erzähl mir nicht, dass du gerade erst wiederkommst!« Kaiana musterte ihn finster. Ihre dunklen, mandelförmigen Augen wirkten groß und äußerst wach. Sie war bereits aufgestanden und für den Tag gekleidet, trug ihren weiten Oberteil aus grobem Drillich und die Arbeitshose. Veranix verfluchte sich stumm dafür, dass er derart die Zeit vergessen hatte. Kaiana trat zurück und ließ ihn durchs Fenster steigen.
»Es ist beinahe acht!«
»Sie haben mich fast erwischt. Ich hab mich vollkommen ausgebrannt, um noch wegzukommen. Und dann bin ich in diese Drogenhöhle gestolpert …«
»Du stinkst nach Fisch«, stellte sie fest und rümpfte angewidert die flache Nase. Kaiana Nell war ein Mädchen mit brauner Haut und dunklen Haaren. Unhöfliche Leute hätten sie eine Napa genannt: zur Hälfte Druth, zur Hälfte Napolisch. Sie war die Tochter eines Soldaten, auf den tropischen Inseln während des fünfzigjährigen Krieges zur Welt gekommen.
Dieselben unhöflichen Leute hätten Veranix als »dreckigen Quin« bezeichnet, wäre seine Herkunft von den Racquin genauso deutlich an seinem Gesicht zu erkennen gewesen. Tatsächlich waren Racquin nur wenig dunkler als »normale« Druthalier. Sie zogen umher und blieben meist unter sich. Veranix stammte allerdings, genau wie Kaiana, nur zur Hälfte vom anderen Volk ab. Sein Vater war ein »gewöhnlicher« Druthalier, geboren und aufgewachsen hier in Maradaine, gleich vor den Toren der Universität. Veranix hatte die helle Haut und die grünen Augen seines Vaters geerbt und beherrschte den Slang des Aventil-Viertels. Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen, dass er kein Einheimischer sein könnte.
»Ich bin in einer Wanne mit toten Fischen gelandet«, sagte er. »Das war nicht spaßig.«
»Du bist leichtsinnig geworden da draußen, hab ich recht?«
»Nein.«
»Du bist zufällig in einen Drogenschuppen gestolpert?«
»Echt, genau so war es! Jedenfalls kam ich zufällig an einer Drogenhöhle vorbei, und da konnte ich nicht einfach weitergehen …«
»Ich versteh schon.« Ihre Augen wurden schmal. »Hast du ihren Vorrat vernichtet?«
»Fünfzehn, vielleicht zwanzig Fläschchen.«
»Nicht gerade viel.«
Er holte den Beutel mit den Münzen heraus. »Und das hier. Das sollte sie davon abhalten, einfach Nachschub zu kaufen.«
»Hast du es gezählt?«
»Natürlich nicht.« Er warf ihr den Beutel zu. »Kannst du das bei Sankt Julian abgeben?«
»Ja.« Sie schob den Beutel unter ihr Bett.
In einer einzigen Bewegung streifte er die Lederweste und sein Leinenhemd ab. »Ich muss meine Sachen hier verstecken.«
»Deine Ausrüstung, ja. Nicht diese Kleidung.«
»Kai, wenn ich in diesen Klamotten erwischt werde …«
»Wenn dieser Fischgeruch Meister Jolen herlockt und er herumschnüffelt, wird er all deine Sachen finden. Und ich stehe auf der Straße.« Meister Jolen war der oberste Hausmeister auf dem Außengelände der Universität. Veranix wusste genau, dass er Kaianas Anwesenheit unter seinem Personal bestenfalls duldete, und wahrscheinlich war ihm jeder Vorwand recht, um sie rauszuschmeißen.
»Hast du meine Ersatzuniform?«, fragte er.
»Nein, Veranix«, erwiderte sie. »Ich hab’s dir schon mal gesagt, sie ist in der Spinnenpassage versteckt.«
»Warum hast du das getan?«
»Wieder wegen Meister Jolen. Wenn er die Uniform eines Studenten hier findet, wirft er mich raus. Nachdem er mich verprügelt hat, weil ich so eine ›lüsterne Schlampe‹ bin.«
»Das würde er nicht wagen.«
»Oh, das würde er, denke ich«, gab sie zurück. »Ich glaub, es würde ihm gefallen.« Kaiana war die einzige Frau unter den Gärtnern, und so ließ Jolen sie im Kutscherhaus schlafen, während die Übrigen in den Personalunterkünften wohnten. Jolen drohte ihr ständig Prügel an, falls sie aus der Reihe tanzen sollte, doch soweit Veranix wusste, hatte er diesen Drohungen niemals Taten folgen lassen.
»Also gut.« Veranix wühlte in seiner Tasche und holte die gestohlenen Papiere heraus.
»Sind das die, die du haben wolltest?«, fragte Kaiana.
»Keine Ahnung. Ich hatte keine Gelegenheit, sie mir anzusehen.« Er blickte auf die Blätter in seiner Hand.
»Jetzt hast du auch keine Zeit dafür!«
»Schon fast acht?«
»Wenn nicht später.«
»Schon gut, schon gut.« Widerwillig steckte Veranix die Papiere in den Hosenbund.
»Lächerlich«, murmelte sie und schob seine Tasche und den Stab unters Bett. »Und jetzt los!« Sie öffnete die Tür einen Spalt. Niemand war draußen zu sehen. Er zwinkerte ihr noch einmal zu und lief aus ihrem Zimmer in Richtung der Ställe.
Die Spinnenpassage war ein seit Langem ungenutzter unterirdischer Gang, der von einem der Pferdeverschläge zur Holtmann-Halle führte, dem Speisesaal der Studenten. Veranix hatte keine Ahnung, warum er ursprünglich gebaut worden war, doch soweit er wusste, waren außer Kaiana und ihm nur noch Ratten und Spinnen darin unterwegs.
Er öffnete die Falltür und sprang in den Tunnel. Es war vollkommen dunkel darin, aber das war egal. Veranix fühlte sich inzwischen wieder kräftig genug, um einen kleinen glühenden Ball erscheinen zu lassen. Die leuchtende Kugel schwebte in der Luft und lieferte so viel Licht, dass er die Stelle in der Mauer erkennen konnte, an der man dicht über dem Lehmboden die Ziegel aus dem Mörtel geschlagen hatte. Er fasste hinein und holte seine Ersatzschuluniform heraus. Er entledigte sich der dunklen Wollhose und schob die stinkenden Kleidungsstücke in die Öffnung. Später würde er sich darum kümmern müssen.
Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch blieb, und so schlüpfte er hastig in die Uniform. Er trug sie nie gerne. Die Wolle der dunkelblauen Hose und der Jacke fühlte sich steif an und kratzte. Er konnte sich darin kaum bewegen, sich nicht richtig strecken. Aber das Schlimmste waren die Mütze und der Schal. Er kam sich albern vor, wann immer er sie anlegte, obwohl jeder andere Student dasselbe trug. Seine waren rot und schwarz gestreift, was ihn als Studenten der Magie auszeichnete.
Er faltete die geklauten Papiere zusammen und verstaute sie in der Jackentasche. Dann wischte er sich ein paar Krümel Mörtel von der Jacke, stürmte den Gang entlang und hatte in weniger als einer Minute das andere Ende erreicht. Die übrigen Studenten seines Hauses würden bald zum Frühstück in der Holtmann-Halle eintreffen. Wenn er Glück hatte, bemerkte niemand, dass er nicht direkt vom Haus Almer kam.
Er kletterte durch die Falltür nach oben und stand in einem der Vorratsräume der Holtmann-Halle. Wie üblich war niemand dort. Er stahl sich aus dem Zimmer hinaus, ging den Flur entlang und mischte sich unter die uniformierten Studenten von Almers, die in Richtung Speisesaal unterwegs waren.
Da spürte er eine Hand auf der Schulter.
»Wo kommst du her?«
»Vom Klo«, antwortete er. Er drehte sich um und sah Delmin Sarren, mit dem er im Haus Almer das Zimmer teilte. Delmin war groß und spindeldürr, mit strähnigem hellen Haar, das nie unter der Mütze bleiben wollte.
Delmin lachte leise. »Behandel mich nicht wie einen Dummkopf. Dein Bett war unberührt.«
»Natürlich hab ich darin geschlafen!«
»Bitte. Ich erzähl auch nichts den Vertrauensschülern oder irgendjemandem. Aber wenn du erwischt wirst, kriegst du Probleme.«
»Erwischt?«, fragte Veranix so harmlos, wie er nur konnte.
Delmin legte ihm einen Arm um die Schulter und flüsterte verschwörerisch: »Schau, Kumpel. Dieses dunkelhäutige Mädchen ist schon hübsch. Ich kann es dir also nicht vorwerfen, dass du die Nacht lieber in ihrem Bett verbringst. Aber so schön es ist, du kannst nicht bis zum Morgengrauen bei ihr bleiben.«
»Du hast recht«, gab Veranix zurück. »Danke.«
Delmin schnüffelte. »Und du musst dir genug Zeit nehmen, um dich zu waschen. Du riechst wie eine frisch gevögelte Dirne.«
»Ich werd dran denken.« Veranix biss sich auf die Lippen, um nicht loszuprusten. »Was steht heute auf dem Plan?«
»Wir haben eine Vorlesung bei Alimen.«
Veranix seufzte. Alimen ohne Schlaf war eine Herausforderung. Er betrat den Speisesaal und hoffte, dass ein sehr starker Tee auf ihn wartete.
2. Kapitel
Nach drei Tassen Tee und zwei Schüsseln Haferbrei stolperte Veranix hinter Delmin drein zu den westlichen Hörsälen. Die Glocken im großen Turm der Universität schlugen zur vollen Stunde. Es war schon neun Uhr. Delmin fing an zu rennen. Veranix erkannte, dass sie zu spät zur Vorlesung waren, und lief hinterher. Mit dem letzten Glockenschlag schlitterten sie in den Saal.
»Nun, die Herren Calbert und Sarren. Gerade noch pünktlich.« Professor Alimen stand an der Tafel und sah sehr würdevoll aus in seinem blauen Talar. Er war ein älterer Mann, jedoch schlank und körperlich gut in Form. Sein graues Haar und den grauen Bart trug er kurz geschnitten, und er hatte nur wenige Falten um die grünen Augen. Die Ärmel des Talars hatte er hochgeschlagen, wodurch die starken Unterarme und eine Tätowierung am linken Arm zum Vorschein kamen. Die Tätowierung, die von Flammen umringten Buchstaben G und P, wies ihn als Mitglied des Magierzirkels von Graf Preston aus.
»Wir wollen keine Minute Ihres Vortrags versäumen, Professor«, gab Veranix zurück.
»Davon bin ich überzeugt«, sagte Alimen. »Auf die Galerie, meine Herren.«
Veranix und Delmin stiegen die schmale Wendeltreppe zu der Galerie empor und schlossen sich den Studenten an, die bereits oben standen. Viele waren wie Veranix und Delmin Magiestudenten im dritten Jahr, aber es waren auch Angehörige anderer Fakultäten darunter, die Alimens Vorlesung in fortgeschrittener Magietheorie besuchten, um ihre Ausbildung abzurunden. Der Senat der Universität bestand darauf, dass alle Studenten einige Veranstaltungen außerhalb des eigenen Fachgebietes belegten.
»Also gut«, setzte Professor Alimen an. »Da wir nun alle versammelt sind, lassen Sie uns beginnen. Wir fangen heute ein neues Thema an, wie Sie den Texten entnehmen können, und wollen die mystische Natur der …«
Veranix musterte die bunte Schar, die auf der Galerie versammelt war, die Vielzahl unterschiedlicher Mützen und Schals. Es verblüffte ihn immer wieder, wie viele Studenten etwas über Magietheorie erfahren wollten, obwohl sie selbst niemals Magie würden wirken können. Er selbst sah die Theorie als bloße Zeitverschwendung, und Alimens Vorlesungen waren trocken und langweilig. Trotzdem besuchte Veranix pflichtbewusst jede einzelne. Er schuldete Professor Alimen viel zu viel, um es nicht zu tun.
Er schob die Hände in die Jackentasche und tastete nach den gestohlenen Papieren. Er hätte zu gern gewusst, was er da mitgenommen hatte. Als seine Finger die Blätter berührten, raschelte es leise. Delmin blickte kurz zu ihm herüber.
»Was machst du da?«, flüsterte er.
»Nichts«, erwiderte Veranix und zog seine Hand heraus. »Ich hab mich nur gekratzt.«
»Dann kratz dich später«, zischte jemand ihn von der anderen Seite an.
Veranix seufzte. Er würde warten müssen.
Professor Alimen monologisierte weiter.
Noch zwei Stunden. Veranix lehnte sich gegen einen Stützpfeiler und gab sich alle Mühe, dem Vortrag zu folgen.
*
»Veranix Calbert!«
Veranix fuhr aus seinem Nickerchen auf. Sein Gesicht war sehr unbequem gegen den Pfeiler gesunken. Er konnte kaum abstreiten, dass er eingeschlafen war.
»Ja, Professor Alimen?« Veranix blinzelte, um seinen Blick zu klären, und schaute hinab in den Hörsaal.
Alimen funkelte zu ihm empor und hielt einen kleinen Stein in seiner Hand. Dachte der Professor etwa darüber nach, ihm den Kiesel an den Kopf zu werfen?
»Vielleicht wollen Sie mir bei einer kleinen Demonstration zur Hand gehen?«
»Ja … natürlich, Professor.«
»Dann kommen Sie mal hier herunter, Calbert.«
Veranix bahnte sich seinen Weg durch die übrigen Studenten auf die Treppe zu. Die Stufen quietschten und ächzten, als er hinunterschritt. Plötzlich empfand er den wilden Drang, einfach von der Galerie hinabzuspringen. Er hätte es leicht tun können, mit einem doppelten oder gar dreifachen Salto, bevor er perfekt unten landete, während die Menge überrascht nach Luft schnappte und donnernd applaudierte. Mitunter vermisste er diese Kulisse. Doch rasch erstickte er den Drang.
Es war am besten, wenn niemand wusste, dass er zu so etwas imstande war. Sonst kam gewiss bald die Frage auf, wo er es gelernt hatte.
Veranix zermarterte sich das Gehirn über die Frage, bei was für einer konkreten Demonstration er assistieren sollte. Worum ging es noch einmal bei der Vorlesung? Irgendetwas über Mineralien und deren mystische Eigenschaften. Er kam unten an und war sich nur allzu bewusst, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren.
Professor Alimens Lächeln war viel zu breit, und Veranix wurde unbehaglich. »Ausgezeichnet, Calbert. Wenn Sie jetzt dieses Dalmatium nehmen könnten …«
Veranix griff nach dem Stein. Er war schwerer als erwartet und fühlte sich kühl an. Es war ein Stück Metall, kein Stein.
»Nun, werter Herr Calbert, dürfen Sie sich den Wunschtraum so vieler Studenten erfüllen, die vor Ihnen durch diese Hallen gewandelt sind. Sie haben die Erlaubnis, mich hinwegzufegen.«
»Professor?«, fragte Veranix.
»Was auch immer Sie für einen magischen Angriff oder Fluch bevorzugen, Calbert. Greifen Sie mich damit an, so kraftvoll Sie es nur zuwege bringen.«
Veranix fühlte sich immer noch müde und ausgelaugt, sogar noch mehr als zuvor. Er war unsicher, wie viel Kraft er überhaupt aufbringen konnte.
»Sind Sie sicher, Professor?«, fragte er. »Ich möchte Sie nicht verletzen.«
»Jetzt!«
Die Studenten auf der Galerie kicherten nervös. Bestimmt war jeder von ihnen froh, dass er in diesem Augenblick nicht hier unten stand.
»Also gut, Professor.« Veranix zog das Numina aus der Umgebung an sich. Er hob die Hand, um die Energie wieder abzugeben, aber sie war bereits verschwunden. Nichts geschah. Er versuchte es erneut, aber das Numina war fort. Er konnte keinerlei Zauber wirken.
Professor Alimen nickte und schaute zu der Menge auf. »Wie Sie sehen können, nimmt das Dalmatium zuverlässig jede Form numinatischer Energie in sich auf, was sämtliche Magie unmöglich macht.« Er nahm Veranix den Stein wieder weg und stellte ihn zurück auf den Tisch. »Ich danke Ihnen, Calbert. Jetzt wieder nach oben mit Ihnen, und versuchen Sie, wach zu bleiben.«
Veranix schlich die Stufen hinauf, während Alimen seinen Vortrag fortsetzte.
»Im Gegensatz zu Napranium ist Dalmatium ein festes Metall, und es verliert seine Eigenschaften nicht, wenn es mit Eisen verbunden wird. Es gab eine Zeit, vor den Reformen der Wiedervereinigung, als Fesseln für Magier aus Dalmatium hergestellt wurden. Ihr Kollege Calbert hat jetzt eine gewisse Vorstellung davon, wie man sich damit fühlen würde.«
Veranix nahm seinen Platz neben Delmin wieder ein. Jeder Student in Rot und Schwarz musterte ihn schaudernd und voller Mitgefühl.
»Wie fühlt es sich an?«, flüsterte ihm Delmin zu.
»Merkwürdig. Als ob ich undicht wäre.«
»Das wird dich lehren, bei der Vorlesung einzuschlafen.«
»Pst«, entgegnete Veranix. »Ich will nicht noch mehr verpassen.«
»In der nächsten Veranstaltung werden wir über Kristalle reden«, fuhr Alimen fort. Er legte den Stein in ein Kästchen und verriegelte es. »Dann werde ich weitere Proben mitbringen. Einen guten Tag, die Herren.«
»Mehr Proben?«, fragte Veranix Delmin. »Was soll das heißen?«
»Oh – das Dalmatium war das Einzige, was er heute zeigen konnte«, antwortete Delmin und sammelte seine Notizen ein, während andere Studenten bereits den Saal verließen. »Die übrigen Metalle – Napranium, Theralium und so weiter – sind viel zu selten, als das er da rankommen könnte.«
»Herr Calbert!«, hallte Alimens Stimme durch den Hörsaal. Veranix und Delmin hielten abrupt inne. Veranix drehte sich um und sah den Professor auf sie zukommen, die Arme voller Kästen und zusammengerollter Schaubilder.
»Ja, Professor?« Veranix streckte die Arme aus, um ihm einen Teil seiner Last abzunehmen.
Alimen lehnte die Hilfe kopfschüttelnd ab. »Denken Sie bitte daran, dass Sie morgen um neun eine praktische Übung bei mir haben. Ich erwarte sowohl Pünktlichkeit wie auch Ihre volle Aufmerksamkeit.« Trotz des strengen Tons blickte Alimen gut gelaunt drein. »Herr Sarren, Ihr Termin ist um elf. Obwohl ich weiß, dass ich Sie nicht eigens erinnern muss.«
»Wir könnten tauschen, Professor«, schlug Veranix vor.
»Auf keinen Fall, Calbert.« Alimen schnaubte belustigt und schüttelte erneut den Kopf. »Ich will das mit Ihnen hinter mich bringen, damit ich den Rest meines Tages genießen kann.« Er zwinkerte und verließ den Saal.
Delmin knuffte Veranix gegen den Arm, während sie folgten. »Wir könnten tauschen? Nein, mein Freund, der Neun-Uhr-Termin gehört ganz dir. Jetzt komm! Ich will beim Mittagessen sein, bevor das Gedränge losgeht.«
»Das wollte ich auslassen«, sagte Veranix. »Ich brauche wirklich ein wenig Schlaf.«
»Deine Entscheidung.« Delmin rannte über den Rasen auf das Holtmann-Gebäude zu und ließ Veranix allein zurück nach Almers trotten.
Das Haus Almer war mehrere hundert Jahre alt und bereits gebaut worden, als die Universität von Maradaine noch die Hohe Akademie zu Maradaine gewesen war. Veranix war überzeugt davon, dass in all dieser Zeit nur sehr wenig verändert worden war. Das Gebäude bestand aus Stein – gemörteltes Mauerwerk, verputzt und weiß gestrichen –, und in den Räumen war die Farbe zu einem stumpfen Grau verblasst; der Putz bröckelte und der Mörtel war brüchig. Es war ein trostloser Bau, zugig und von schimmliger Feuchte erfüllt. In den letzten drei Jahren hatte Veranix es trotzdem gern als Zuhause betrachtet, das einzige Zuhause ohne Räder, das er jemals gehabt hatte.
»Hab gehört, du bist heute bei der Vorlesung eingeschlafen, Calbert«, sprach ihn jemand von hinten an. Veranix spürte die massige Gegenwart, volle anderthalb Köpfe größer als er. Das konnte nur Rellings sein, einer von Almers Vertrauensschülern.
»Hat sich das schon rumgesprochen?«
»Neuigkeiten verbreiten sich rasch.« Rellings spähte seine Habichtsnase hinab auf Veranix. »Und? Warum warst du so müde, Fux?«
Veranix blickte finster. Er hasste es, wenn jemand ihn als ›Fux‹ bezeichnete. Das war ein Spitzname, den Studenten im Abschlussjahr – und ganz besonders die Vertrauensschüler! – für die jüngeren Jahrgänge benutzten. Er gehörte zur Umgangssprache auf dem Campus und war so alt, dass niemand genau wusste, wo er herkam. Dennoch wurde der Ausdruck weiterhin verwendet. Veranix schwor, dass er ihn gewiss nie brauchen würde, wenn er das letzte Jahr erreichte. Nicht dass es einen Unterschied machte. Die Kerle, die so redeten, waren genau die Art Studenten, die auch Vertrauensschüler wurden.
»Ach, es ist so ein Morgen …« Veranix trat auf den Eingang von Haus Almer zu. Rellings stellte sich zwischen ihn und die Tür.
»So ein Morgen, nachdem du die ganze Nacht nicht geschlafen hast?«
»Albträume haben mich wachgehalten«, erwiderte Veranix und starrte Rellings an. »Magiern passiert so was öfter, weißt du.«
Rellings wich zurück. Veranix wusste, dass er sich leicht durch Zauberei einschüchtern ließ, sogar durch die beiläufige Androhung.
»So. Ich hab dich heute Morgen nicht gesehen, aber Sarren sagte mir, dass du da warst. Glaub nicht, dass ich nicht auf dich achte.«
»Schön, das zu hören«, entgegnete Veranix. Delmin hielt ihm also den Rücken frei. Veranix war ihm dankbar dafür, allerdings fragte er sich, ob Delmin sich auch diese Mühe machen würde, wenn er die Wahrheit wüsste. »Ich geh jetzt rein.«
Rellings schnaubte, ließ ihn aber vorbei. Veranix stieg zum Aufenthaltsraum im dritten Stock hinauf.
Die Einrichtung im Gemeinschaftsraum bestand aus einem wirren Durcheinander von abgewetzten Stühlen und rissigen Holztischen, die um den Kamin in der Mitte herumstanden. Die Winter in Almers waren gnadenlos. Selbst jetzt noch, da der Frühling seinen Höhepunkt erreichte, hing ein eisiger Hauch in den Wänden. Der kahle Steinboden trug auch nicht zur Behaglichkeit bei. Mehrere Studenten saßen dicht vor dem Kamin beieinander, lasen, schrieben oder diskutierten. Veranix schlüpfte zwischen den Stühlen hindurch. Er wollte nur in sein Zimmer, die erbeuteten Aufzeichnungen durchsehen und ein Nickerchen halten.
»Veranix!«, rief jemand. Es war ein Student im ersten oder zweiten Jahr, an dessen Namen sich Veranix gar nicht erinnern konnte. »Dem heiligen Hespin sei Dank, du bist da!«
»Prens!«, fuhr sein Begleiter ihn an. »Keine Lästerungen!« Er berührte mit dem Handgelenk seine Stirn und küsste es dann segnend. Sein Akzent und die andachtsvolle Geste verrieten ihn: Er stammte aus dem südlichen Erzherzogtum von Scaloi. Auf dem ganzen Campus gab es vermutlich keine zehn Studenten aus dieser Gegend. Trotzdem erinnerte sich Veranix ebenfalls nicht an seinen Namen.
»Das ist keine Läster… Ach, egal«, sagte Prens. »Veranix, lieber heiliger Veran, bitte. Du musst uns aus der Klemme helfen.«
Veranix blieb stehen. Sie riefen seinen Namenspatron an. Das musste etwas Ernstes sein. Er hoffte nur, dass es schnell zu lösen wäre. »Was habt ihr für ein Problem?«
»Heute Nachmittag haben wir Prüfung: Einführung in die Magietheorie«, erklärte Prens. »Und wir gehen dabei gerade zugrunde.«
Prens und sein frommer Freund trugen braune und grüne Schals. Sie waren keine Magiestudenten. Wofür stand noch mal braun und grün? Theologie? Genau! Veranix erinnerte sich. Die beiden waren Priesteranwärter im Grundstudium und wohnten am Ende des Flurs.
Veranix schüttelte den Kopf. »Da habt ihr den Falschen erwischt. Wenn ihr über Magietheorie reden wollt, fragt Delmin.«
»Das haben wir gestern Abend getan«, sagte Prens. »Wir haben nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was er uns erklärt hat.«
»Du hast den Einführungskurs Magietheorie bestanden, nicht wahr?«, fragte sein Freund. Veranix grübelte immer noch über seinen Namen nach. Owens? Oads? Oaks, das war es.
»Ich hab bestanden, ja«, entgegnete Veranix. »Ich hab nur … Schaut, ich bin müde, ich bin gerade zurückgekommen, um mich noch mal hinzulegen, und …« Er erkannte die blanke Panik in ihren Augen. Er setzte sich. »Also gut, was versteht ihr nicht?«
»Alles«, jammerte Prens.
»Könnt ihr das ein wenig einengen auf etwas, das ich in fünf Minuten beantworten kann?«
»Die Regel der Fünfhundert und Fünf«, sagte Oaks.
Veranix nickte. Das war eines der wenigen Dinge, die er tatsächlich begriffen hatte. »Nur einer von fünfhundert Menschen wird mit der grundlegenden Fähigkeit geboren, Numina zu lenken.«
»Also Magie zu wirken«, warf Prens ein.
»Nicht ganz. Numina ist nur die Kraft, mit der Zauberei möglich ist. Diese Kraft zu lenken ist bedeutungslos, wenn man nichts damit anfangen kann. Das wäre der andere Teil. Von diesen einen aus fünfhundert hat wiederum nur einer von fünfen auch die Fähigkeit, Numina in irgendeiner nutzbaren Form zu gestalten.«
»Warum ist das wichtig?«
»Nun, genau das macht die Zauberei aus. Lenk das Numina durch dich hindurch und form es so, wie du es haben willst.«
»Aber wenn man es lenken kann, dann …« Oaks verstummte und sah verwirrter aus als vorher.
»Ich hab es so verstanden«, setzte Veranix an. »Stellt euch das Numina wie Wasser vor, das unter der Erde fließt. Zaubern, ist, wie einen Brunnen zu graben.«
»Ich hab mal beim Bau eines Brunnens mitgeholfen«, bemerkte Prens.
»Also, der eine aus fünfhundert ist wie ein Stück Land, unter dem das Wasser hoch genug steht, dass sich ein Brunnenbau lohnt.«
Prens nickte. »Wo man an das Wasser herankommen kann.«
»Aber das nutzt dir gar nichts, solange du keinen Eimer oder eine Pumpe oder etwas in dieser Art hast, um das Wasser nach oben zu holen.«
»Und das ist der eine von fünfen«, stellte Oaks fest.
Prens wirkte verwirrt. »Warum kann nur Einer unter Zweieinhalbtausend tatsächlich Magie wirken? Warum haben nur so wenige Leute diese Fähigkeit?«
»Das ist Gottes Wille«, befand Oaks.
Prens ignorierte ihn. »Woher kommt das Numina überhaupt?«
»Es kommt von Gott.«
»Das ist deine Erklärung für alles, was du nicht verstehst!« Prens massierte sich die Schläfen. »Das wäre nicht mal im Theologiekurs die richtige Antwort.«
»Es gibt viele Theorien, zu beiden Fragen«, sagte Veranix. »Die Wahrheit ist: Niemand weiß es wirklich. Zumindest glaub ich das. Das sind Fragen, die ihr Delmin stellen solltet. Wie auch immer, Numina ist einfach da.« Er nahm ein wenig davon in sich auf und formte es zu funkelnden Lichtern, die er von einer Hand in die andere springen ließ. »Es ist überall, und es fließt, genau wie der Wind. Ich kann es spüren, aber ich kann es nicht erklären.«
»Siehst du, ich hatte recht«, stellte Oaks fest. »Gott macht es.«
»Das heißt nicht …«
»Dann sag mir …«
»Ich muss dir keine andere …«
»Schon gut, schon gut.« Veranix erhob sich von seinem Stuhl. »Die fünf Minuten sind vorbei. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Delmin ist im Speisesaal. Ich verschwinde jetzt.«
Die beiden diskutierten immer noch, als er sich in den Schlafraum zurückzog. Die Kammer war schmal und vollgestopft. Zwei Betten gab es darin, zwei winzige Schreibpulte und einen Schrank, alles aus rohem, unbehandeltem Holz, ausgebleicht und rissig vom Alter. Auf jedem der Pulte standen Kerzen neben Büchern und losen Blättern. Zwei Öllampen hingen über den Betten. Durch ein kleines Fenster an einer Seite des Raums drang ein wenig Sonnenlicht herein. Das Fenster ließ sich nur einen Spaltbreit öffnen, und war mit einem Eisengitter versperrt. Veranix hatte viel Zeit damit verbracht, an den Stäben herumzufummeln und mit Magie nachzuhelfen, bis er dort hinausgelangen konnte, ohne dass man einen Schaden sah.
Er zog Jacke und Stiefel aus und ließ sich aufs Bett fallen. Einen Moment lang blieb er liegen, bevor er sich wieder aufsetzte. Er zog die gestohlenen Papiere hervor. So sehr er sich nach Schlaf sehnte, er war einfach zu neugierig, was er mitgehen lassen hatte und ob er etwas damit anfangen konnte.
Das meiste waren Dokumente aus der Konservenfabrik: Gehaltslisten, Inventarverzeichnisse und Geld, das die Firma Fenmere schuldete. Schulden aus rein seriösen Geschäften. Kein Wort über Effitte oder andere illegale Aktivitäten. Veranix grummelte vor sich hin. Alles nur Zeitverschwendung. Da hätte er besser ein paar Drogenhändler verdroschen.
Veranix blätterte noch einmal jede Seite durch. Auf einer Quittung fand er etwas mit einem Kohlestift an den Rand gekritzelt. Es war verwischt, aber gerade noch lesbar.
Pellistar-Dock 12, 8. Maritan, zwei Schlag nach Mitternacht.
Interessant. Alles, was zu so einer Zeit am Hafen ankam, musste illegal sein. Vermutlich eine Lieferung Effitte. Das war etwas, was sich zu überprüfen lohnte.
Heute Abend war der 8. Maritan. Ihm stand wieder eine lange Nacht bevor. Am liebsten hätte Veranix bis zum Abend durchgeschlafen, aber mehr als zwei Stunden konnte er sich nicht erlauben. Es gab noch Veranstaltungen am Nachmittag, die er besuchen musste.
3. Kapitel
Die Sonne hing bereits tief am Himmel, als Veranix aus dem Hörsaal trat. Das Nickerchen hatte ihm gutgetan, aber eine Vorlesung in klassischer Philosophie machte alles wieder zunichte und ließ ihn müde und ausgelaugt zurück. Außerdem war er halb verhungert nach dem versäumten Mittagessen. Es würde noch eine weitere Stunde dauern, bis der Gong zum Abendessen rief.
Ein Paar Hände fasste Veranix an den Schultern. Sein gesamter Körper spannte sich an. Schon wollte er blindlings um sich schlagen, da erkannte er die schlaksige Gestalt hinter seinem Rücken.
»Immer noch wach nach diesem Kurs?«, fragte Delmin.
»Gerade eben.« Veranix entspannte sich und drehte sich zu seinem Freund um.
»Hast du Hunger?«
»Immer.«
»Ich weiß es aus sicherer Quelle, in Holtmanns gibt’s heute Fischeintopf.«
Das letzte Wort klang unheilvoll, und Veranix erschauderte. »Nein, das geht ganz und gar nicht.«
Der Fischeintopf der Holtmann-Halle war berüchtigt. Alle Studenten glaubten fest daran, dass dieses widerliche Gebräu von der Küche genutzt wurde, um verdorbene Lebensmittel zu entsorgen. Und Veranix hatte erst einmal genug von Fisch.
»Ich weiß nicht, wie’s bei dir aussieht«, sagte Delmin, »aber ich kann ein paar Münzen für ein anständiges Abendessen entbehren.«
»Bin dabei«, erwiderte Veranix. »Verdammt, ich würde eine halbe Krone bezahlen, nur um dem Fischeintopf zu entkommen.«
Sie spazierten über das Universitätsgelände auf das Südtor zu.
Der weitläufige Rasen auf dem südlichen Campus war ein üppiges Grün. Bäume beschatteten die Fußwege zwischen den Gebäuden. Mehrere Studenten hatten ihre Mäntel ausgezogen und die Ärmel hochgekrempelt, um eine lebhafte Partie Tetchball zu spielen. Ein paar Mädchen vom Damenkolleg auf der nördlichen Seite des Campus sahen ihnen zu. Ihre Uniformen glichen denen der Jungen, mit langen Wollröcken und hochgeschlossenen Blusen, wobei die meisten nicht so sittsam zugeknöpft waren, wie ihre Rektorin es vermutlich gern gesehen hätte.
»He, Calbert!«, rief ein Tetch-Spieler, blond und kräftig gebaut. »Komm doch rüber!«
»Heute nicht«, rief Veranix zurück. »Beim nächsten Mal!«
Er erkannte den Spieler. Tosler war der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Lacanjan, der an der Uni seine Zeit totschlug, bis sein Vater zu der Überzeugung gelangte, er wäre für den Einstieg ins Geschäft bereit.
Tosler trat auf Veranix und Delmin zu. Er sprach mit dem schleppenden Tonfall der Küstenregion.
»Hör zu, Calbert. Wir stellen eine Tetch-Mannschaft auf …«
»Ich kann keiner Mannschaft beitreten, Toss«, wandte Veranix ein.
»Keiner von uns«, fügte Delmin hinzu. In seinem Fall war das wahrscheinlich ein Segen, denn er spielte furchtbar.
»Weil Zauberer immer schummeln!«, brüllte ein Spieler aus dem Hintergrund.
»Halt doch die Klappe!«, schrie Delmin zurück.
»Entspann dich«, sagte Tosler. »Nein, schau, wir stellen eine Truppe zusammen, weil die Universität im Sommer die Meisterschaft ausrichtet.«
Veranix nickte. Die Hochschulmeisterschaften von Druthal sollten in Maradaine ausgetragen werden, und die meisten sportinteressierten Studenten sprachen von nichts anderem mehr. »Weiß ich, aber trotzdem darf ich nicht in einer Mannschaft mitspielen, und ganz besonders nicht bei der Meisterschaft.«
»Nicht als Spieler«, sagte Tosler. »Aber vielleicht als Berater, oder so? Gib uns ein paar Tipps. Niemand schlägt den Dreifachen so wie du.«
»Weil Zauberer immer betrügen!«, schrie der Spieler aus dem Hintergrund erneut.
»Ach, lass es doch einfach!«, fuhr ihn eins der Mädchen an.
Veranix dachte darüber nach. Es gab keine Regel, die dagegensprach. Wenn er bis zum Sommer überlebte, konnte er vielleicht ein wenig Spaß haben. »Ich überleg’s mir, Toss. Jetzt müssen wir weiter.«
»Klar, klar.« Tosler rannte zurück aufs Spielfeld.
»Die Meisterschaft im Sommer«, bemerkte Delmin, sobald sie wieder auf das Tor zuhielten. »Alle machen so einen Wirbel deswegen.«
»Ist noch eine Ewigkeit hin«, erwiderte Veranix.
Ein hoher steinerner Torbogen kennzeichnete den südlichen Ausgang des Campus. Der Weg dorthin war von Fahnenstangen und lebensgroßen Statuen gesäumt. Je Fünf Fahnen flatterten auf jeder Seite, eine für jedes Erzherzogtum von Druthal. In der Mitte vor dem Torbogen stand eine weitere Statue, ein zwölf Fuß hoher Bronzekoloss. Die Fahnenstange daneben überragte alle anderen. Diese Statue stellte König Maradaine XI. dar, der im Jahr 1009 die zehn Erzherzogtümer vereinigt hatte. Über ihm wehte die Fahne von Druthal, dunkelblau mit zwei gekreuzten Spießen in goldenem Rund, wobei der Kreis von zehn farbigen Segmenten eingefasst war.
Zwei Kadetten in grauen Heeresuniformen mit gegürteten Säbeln standen am Tor. Veranix kannte keinen der beiden, aber sie gehörten zum Offizierslehrgang der Universität. Der Wachdienst auf dem Campus war Teil ihrer Ausbildung, und zum Glück nahmen die meisten ihn nicht allzu ernst. Üblicherweise nickten sie nur beiläufig, wenn Studenten das Gelände verließen oder betraten.
Jenseits des Torbogens verlief die Lilac Street und begann das hektische Treiben des Aventil-Stadtviertels. Direkt gegenüber der Campusmauer lag eine Reihe Geschäftshäuser, aus grobem Stein gemauert und mit abgeplatztem Verputz. Jeder Laden stellte Waren auf Holztischen an der Straße aus, und Karren mit weiteren Waren zwängten sich in jeden winzigen Zwischenraum. Das machte es fast unmöglich zu bestimmen, wo ein Laden aufhörte und der nächste begann. Pferdekutschen, Tretwagen und Handkarren füllten die Straße, und Menschen flitzten dazwischen hindurch, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. Zeitungsjungen standen mitten auf dem Bürgersteig, priesen ihre Blätter an und warben mit reißerischen Geschichten.
»Skandal auf den Parlamentsfluren!«, schrie der eine. »Zwei Groschen für die Maradaine Gazette!«
»Die Geliebte des Stadtrats packt aus!«, rief ein anderer zurück. »Nur ein Groschen für die Freie Presse Aventil! Die Nachrichten, die euch wirklich interessieren!«
Sobald Veranix und Delmin aus dem Tor traten, eilte ein junger Bursche auf sie zu. Ganz offensichtlich hatte er auf Studenten gelauert. Er war abenteuerlich gekleidet, mit Hose, Weste und Jacke, die allesamt von verschiedenen Anzügen stammten und abgetragen und fadenscheinig wirkten. Er trug einen grauen Hut auf dem Kopf, mit breiter, runder Krempe und flacher Oberseite.
»Meine Herren, meine Herren, meine Herren«, stieß er in wildem Überschwang hervor. Er stand mit weit ausgebreiteten Armen vor ihnen, als wollte er sie im nächsten Augenblick umarmen. »Was könnten so feine junge Herrschaften wie ihr heute Abend wohl erstreben? Ein wenig Spaß oder irgendeine andere Zerstreuung?«
Veranix behielt die Hände des Burschen im Auge. Er wusste nur zu gut, wie schnell sie in fremde Taschen und Geldbörsen schlüpfen konnten. »Was immer es ist, wir finden es selbst, vielen Dank.« Er machte einen möglichst weiten Bogen um ihn herum.
Der Junge rannte rückwärts, um vor ihnen zu bleiben.
»Aber, aber, meine Herren, das ist doch keine Art. Ganz und gar nicht! Ihr jungen Herrschaften solltet doch wissen, dass die Jungs aus dem Viertel gern zu Diensten sind.« Er lächelte sie an.
»Das wissen wir nur zu gut.« Delmin wich seinem Blick aus.
»Recht so«, erwiderte der Junge. »Was darf es also sein? Ich weiß aus erstklassiger Quelle, dass der Golmans Klub gleich hier um die Ecke das beste dunkle Bier in Aventil ausschenkt …«
Veranix lachte bei diesen Worten laut auf, er konnte sich einfach nicht zurückhalten. Der Junge sprach weiter und funkelte ihn finster an.
»Außerdem gibt’s da heute Abend mindestens fünf Faustkämpfe. Ein großartiger Sport zum Zusehen, meine Freunde.«
»In Golmans Klub?«, fragte Veranix. »Der liegt sechs Häuserblocks entfernt auf der Violet Street.«
»Genau, ganz genau«, sagte der Junge. »Und wenn ihr die Strecke nicht laufen wollt, dann steht mein Vetter gleich dort drüben mit seinem Tretwagen bereit. Er bringt euch im Handumdrehen dorthin.« Er wies auf die Straße, wo ein weiterer junger Mann mit flachem Zylinder auf dem pedalgetriebenen Gefährt saß, jederzeit abfahrbereit. Wenn man bedachte, dass die beiden weit abseits des eigenen Reviers unterwegs waren, war das zumindest eine kluge Vorsichtsmaßnahme.
»Gut«, sagte Veranix. »Für wie viel?«
»Ich sag dir was, sag dir was«, erklärte der Junge. »Weil ihr zwei so schlaue Herren von der Uni seid, will ich gar nicht erst versuchen, euch abzuziehen. Vier Groschen für die Fahrt, für jeden.«
»Vier Groschen?«, entfuhr es Delmin. »Das ist … das ist nicht unangemessen.«
»Das ist die richtige Einstellung, mein Bester!« Er klopfte Delmin auf die Schulter. Der zuckte zusammen. Veranix trat dazwischen und baute sich vor dem Jungen auf.
»Wir sind zur Rose Street unterwegs, Kumpel«
»Rose Street«, wiederholte der Junge mit einem Nicken. »Einen vollen Bauch und einen willigen Schoß sucht ihr also.«
»Nur das Essen«, erwiderte Veranix. Er ging weiter und zog Delmin mit sich.
»Ach, kommt schon!« Der Junge lief weiter hinter ihnen her. »Junge Kerle wie ihr seid doch immer auf der Suche nach ’ner sauberen Dirne für ’nen kleinen Ritt. Drüben auf der Violet haben wir mehr als genug von der Sorte.«
»Das glaub ich gern.« Veranix musterte den Jungen von oben bis unten und nahm jede Kleinigkeit auf. »Du bist ziemlich scharf darauf, uns zur Violet Street zu bringen. Die wenigsten Studenten gehen weiter ins Viertel hinein als bis zur Rose oder zur Orchid Street.«
»Ich will einfach nur …«
»… ein bisschen Schotter von der Uni in deine Straßen locken«, vollendete Veranix.
»He!« Der Junge richtete sich auf und versuchte sich größer als Veranix zu machen. »Die meisten von euch Uni-Jungs wissen gar nicht, was sie drüben in der Violet Street alles finden können.«
»Davon bin ich überzeugt«, sagte Veranix. »Aber die eigentliche Frage ist doch: Wissen die Prinzen von der Rose Street oder Hallarans Jungs, dass du versuchst, in ihrem Revier zu wildern?«
»Was verstehst du davon?« Der Junge kniff die Augen zusammen und packte Veranix bei der Schulter.
Veranix schlug die Hand instinktiv weg. »Nur das, was ich so sehe und mitbekomme. Ich bin oft genug in Aventil unterwegs, um die üblichen Gesichter zu kennen, die hier Studenten abgreifen. Keiner von denen bringt jemals einen zur Violet Street. Ich weiß ja nicht, zu welcher Bande du und dein Vetter gehören …«
»Die Ritter von Sankt Julian«, verkündete der Junge stolz. Seine Hände wanderten in die Manteltaschen, während er die beiden Studenten finster betrachtete. »Bald genug haben wir an den Uni-Toren das Sagen, also lernt besser ein wenig Respekt.«
Veranix ging davon aus, dass der Junge jeden Moment ein Messer ziehen würde. Das wäre ausgesprochen dämlich, aber die Jungs aus den Straßenbanden taten ständig dumme Dinge.
»Veranix«, warf Delmin nervös ein, »lass uns einfach …« Er verstummte, während sein Blick über die Umgebung wanderte. Niemand auf der Straße beachtete sie.
»Wir gehen jetzt zur Rose Street rüber.« Veranix zeigte die Häuserzeile hinab. »Wenn du uns nachkommen willst, in die ›Kehre‹ vielleicht, kannst du jedem erzählen, wie viel Respekt sie den Rittern von Sankt Justin schulden.«
»Sankt Julian, Kumpel«, erwiderte der Junge und kniff wütend die Augen zusammen.
»Meinetwegen«, sagte Veranix. »Erzähl das ruhig in der Rose Street herum.« Er fasste Delmin am Mantel und zog ihn mit sich um die nächste Ecke.
»Bei allen verdammten Heiligen!«, fluchte Delmin.
Veranix stellte fest, dass sein Freund bleich und schweißgebadet war.
»Was zum Henker hast du dir gedacht? Wolltest du uns von einem Straßenjungen niederstechen lassen?«
»Nur die Ruhe.« Veranix blickte sich um und versicherte sich, dass der Bursche ihnen nicht folgte. »Der Junge war weit weg vom heimatlichen Revier. Er wollte gewiss nicht am helllichten Tag und auf offener Straße Studenten abstechen. Die Prinzen und Hallarans Jungs hätten hart zurückgeschlagen, und zwar im Gebiet von Sankt Julian.«
»Woher … woher weißt du so was?« Delmin musterte ihn eindringlich. »Ich bin in Maradaine aufgewachsen, und ich weiß nicht, was eine Bande irgendjemandem antun würde, und warum.«
»Du bist nördlich vom Fluss aufgewachsen«, erwiderte Veranix, während sie die Rose Street entlangschlenderten. »Prachtvolle Häuser und begrünte Alleen rings um das Parlamentsgebäude.«
»Es sieht nicht überall dort so aus«, sagte Delmin. »Und du bist in einer Handelskarawane aufgewachsen, noch weiter weg von hier.«
»Das ist wahr«, bestätigte Veranix rasch und erinnerte sich daran, was Delmin über seine Vergangenheit glaubte. Unwillkürlich schaute er zum Fenster der Wohnung über der Poststelle hinauf; die Wohnung, in der seine Eltern nur eine Woche lang gelebt hatten. Er fragte sich, wer heute darin wohnte. Dann schüttelte er den Gedanken ab und wandte sich Delmin zu. »Jetzt leben wir gleich neben Aventil, und ich achte darauf, was in meiner Nachbarschaft los ist.«
»Seh nur ich das so, oder wird die Gegend immer gefährlicher?«, fragte Delmin.
»Das meinst du nur.« Veranix blickte die Rose Street hinab, wo Klubs und Kneipen sich aneinanderreihten. Die Straße war schmal, eine Handvoll Wagen drängten sich in einer einzelnen Reihe Richtung Osten auf die Waterpath zu. Alle Geschäfte und Häuser bestanden aus Ziegel, Stein und Verputz, kein einziges Gebäude hatte mehr als drei Stockwerke. Im Gegensatz zu Dentonhill gelangte das Sonnenlicht in diesem Viertel bis aufs Straßenpflaster hinab, und das Licht und die Wärme prägten auch die Bewohner. Notdürftig zusammengezimmerte Verkaufsstände reihten sich auf dem Bürgersteig, und Einheimische grillten dort Fleisch auf kleinen Ziegelöfen oder verkauften Suppe für ein paar Groschen. Sie begrüßten alle Passanten mit einem Winken und einem Lächeln.
Aventil war eine anständige Gegend. Die Straßenbanden des Viertels waren ohne gemeinsame Führung und stimmten untereinander nur darin überein, dass Fenmeres Handlanger hier nichts verloren hatten. Sie waren auch nicht besonders gefährlich. Taschendiebstahl, ein paar Passanten auf der Straße ausnehmen, ein gelegentlicher Einbruch … Manchmal mischten sie sich nachdrücklich in die Geschäfte des Viertels ein, drängten die Leute, in ganz bestimmte Läden zu gehen, und nötigten dann die entsprechenden Kaufleute, einen Anteil am Gewinn an sie auszuzahlen. Trotz allem vermieden sie es meist, unmissverständlich zu schikanieren oder offen zu erpressen. Sie nahmen Einfluss auf die Brauereien, um den Verkauf von Bier und Most zu kontrollieren, aber sie rührten nichts Gefährlicheres an, wie Hassper oder Effitte, das Zeug, das die Menschen zugrunde richtete oder ihr Leben ruinierte. Nur Bosse wie Fenmere verschoben solchen Dreck.
Aventil war ein Stadtviertel, in dem die Menschen ihr Leben lebten, und das die Banden als ihre Heimat ansahen. Sie zollten ihren Nachbarn einen gewissen Respekt, das schloss die Universität mit ein. Es war allgemein bekannt, dass ein Student, der zu viel gebechert hatte, zurück zum Campus torkeln konnte, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, dass man ihm den Schädel einschlug.
»Also, gehen wir in die ›Kehre‹?«, fragte Delmin.
»Pfff«, erwiderte Veranix. »Da würden wir bis zum Hals unter den Rosenprinzen stecken.«
»Es macht ihnen aber nichts aus, wenn ein paar Unis da abhängen, hab ich recht?«, fragte Delmin.
»Versuch bitte nicht, wie ein Straßenjunge zu sprechen, Del«, sagte Veranix. »Das klingt wirklich erbärmlich, wenn es aus deinem Mund kommt.«
»Sei kein Arschloch, Vee.« Delmin kicherte. Er hatte wieder Farbe im Gesicht und wirkte entspannt.
»Außerdem, wenn du nicht grad Feuerzipfel oder Bier willst, gibt’s wirklich keinen Grund, um in die ›Kehre‹ zu gehen.«
»Ist schon wahr.« Delmin schmunzelte. »Du hast also das B&R im Sinn.«
»Unbedingt.«