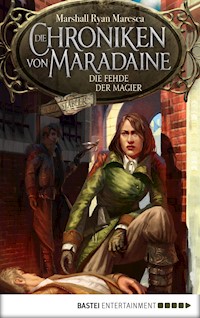
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Geschichten aus Maradaine
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Satrine Rainey - ehemaliges Straßenkind und Ex-Spionin - muss die Familie allein über Wasser halten, seit ihr Mann verunglückt ist. Mithilfe von gefälschten Dokumenten erschleicht sie sich einen Job als Konstabler. Als Partner wird ihr der Magier Minox Welling, genannt Jinx, zugeteilt. Ihr erster Fall - der rituelle Mord an einem Zirkelmagier - zwingt Satrine dazu, in die Straßen ihrer Kindheit zurückzukehren. Schafft sie es, den Mörder zu entlarven, bevor ihre eigenen Geheimnisse ans Tageslicht kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Stadtkarte
Detailkarte
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Danksagungen
Über das Buch
Satrine Rainey – ehemaliges Straßenkind und Ex-Spionin – muss die Familie allein über Wasser halten, seit ihr Mann verunglückt ist. Mithilfe von gefälschten Dokumenten erschleicht sie sich einen Job als Konstabler. Als Partner wird ihr der Magier Minox Welling, genannt Jinx, zugeteilt. Ihr erster Fall – der rituelle Mord an einem Zirkelmagier – zwingt Satrine dazu, in die Straßen ihrer Kindheit zurückzukehren. Schafft sie es, den Mörder zu entlarven, bevor ihre eigenen Geheimnisse ans Tageslicht kommen?
Über den Autor
Marshall Ryan Maresca wuchs im Staat New York auf und studierte Film und Videoproduktion an der Penn State Universität. Er hat bereits als Stückeschreiber, Bühnenschauspieler, Theaterintendant und Amateurkoch gearbeitet. Heute lebt Maresca mit seiner Frau und seinem Sohn in Austin, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website unter www.mrmaresca.com.
Marshall Ryan Maresca
Die Chronikenvon Maradaine
DIE FEHDE DER MAGIER
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Linda Budinger
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Marshall Ryan MarescaTitel der Amerikanischen Originalausgabe: »A Murder of Mages«Originalverlag: DAW Books, New YorkBy Arrangement with DAW Books, New York.
Dieses Werk wurde vermittelt durch Interpill Media GmbH, Hamburg
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Diana Menschig, ViersenKarte: Markus Weber, Guter Punkt, Münchennach einer Vorlage von Marshall Ryan MarescaTitelillustration: © Christof GrobelskiUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5615-1
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
1. Kapitel
Satrine Rainey trug eine Lüge zur Wache von Inemar. Es nagte an ihr, bei jedem Schritt über die Brücken in den Südteil der Stadt. Sobald sie den Fluss überquert hatte, würde es leichter, mit der Lüge durchzukommen. Die einzige Person, die die Wahrheit kannte, befand sich in Nord-Maradaine und kam fast nie auf diese Seite. Die Konstablerwache von Inemar lag am südlichen Ufer, doch sie hätte genauso gut in einer anderen Stadt sein können. Die Lüge würde bestehen. Es steckte genug Wahrheit darin, um sie glaubwürdig zu machen.
Kalt und feucht fegte ein Windstoß an Satrine vorüber. Sie zog den Mantel enger um sich und beschleunigte ihre Schritte, überholte einen Tretwagen, der am Straßenrand entlangrollte. An einer kleinen Felsnadel, die in der Flussmitte aufragte, teilte sich der Weg. Das Wasser unter der Brücke wimmelte von Segeln und Kähnen. Satrine bog auf die Obere Brücke ab, die in das Stadtviertel Inemar führte, das Herz von Süd-Maradaine.
Satrine hasste Inemar. Sie hasste alles, was südlich des Flusses lag. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielte. Sie musste dorthin. Und wenn alles gut ging, würde sie morgen wieder zurückkommen und jeden weiteren Tag danach.
Die Stufen am Ende der Brücke waren überfüllt, die Luft hallte von lauten Rufen wider, während die Menschen zur Straße hinuntergingen. Dutzende Stimmen, die billigen Schmuck anpriesen, von Heiligen salbaderten oder um Münzen bettelten. Zwei Zeitungsjungen konkurrierender Blätter überboten sich gegenseitig mit reißerischen Schlagzeilen.
Satrine schob sich durch die Menschenmenge und bahnte sich den Weg hinab zur Straße. Dort wich sie Pferdekutschen und Tretwagen aus, ohne auch nur einmal innezuhalten. Ihre Beine erinnerten sich von selbst an jeden Schritt.
Grauer Stein dominierte Inemar. Grau und ohne eine Lücke drängten die Gebäude sich aneinander – in diesem Teil der Stadt wurde kein Zoll Raum vergeudet. Keine Spur von Grün war in diesem Viertel zu finden: keine Bäume, die dem Fußgänger Schatten spendeten, Eisenzäune anstelle von Hecken an den Grundstücksgrenzen. Selbst das Unkraut zwischen den Pflastersteinen war plattgetrampelt und welk.
»He, he, Waish-Mädchen! Waish-Mädchen!«
Satrine verzog das Gesicht. Sie wusste, dass sie gemeint war. Die meisten Leute hielten sie für eine Waish. Hier in Maradaine vergaßen die Menschen leicht, dass rotes Haar auch in den nördlichen Erzherzogtümern von Druthal verbreitet war.
»Waish-Mädchen! Ich red mit dir!« Eine Hand griff nach ihrer Schulter.
Keine verdammten Manieren in Inemar!
Satrine wirbelte herum und schlug die unverschämten Finger beiseite. Sie gehörten einem jungen Mann mit scharfem Blick und Rattenzähnen. Er trug einen abgewetzten Mantel und eine Weste und grinste beunruhigend.
»Keine Waish«, sagte Satrine. »Und kein Mädchen.«
Der junge Mann plapperte ungerührt weiter. »Aber Sie sind neu hier unten, kennen sich nicht aus, sind gerade erst über die Brücke gekommen, hab ich Recht? Sie brauchen einen Führer und einen Begleiter, hab ich Recht?«
»Hast du nicht.« Satrine hatte schon mehr Worte ausgesprochen, als sie mit jemandem auf der Straße hatte wechseln wollen. Sie drehte sich um und ging weiter.
»Schon gut, schon gut.« Der junge Mann hielt mit ihr Schritt. »Selbst wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen, ist es doch immer gut für ein Mädchen wie Sie – eine Dame, meine ich –, jemanden dabeizuhaben, nicht wahr? Kann ’ne Menge passieren hier auf den Straßen, wissen Sie?«
»Weiß ich.«
»Eben. Da haben Sie’s, Fräulein!« Der junge Mann hakte bei ihr unter, während er weitersprach. »Also begleite ich Sie …«
Weiter kam er nicht. Satrine drehte ihm den Arm auf den Rücken und hatte ihn im nächsten Moment zu Boden gerungen. Sie drückte sein Gesicht gegen das Pflaster.
»Ich weiß, wohin ich gehe«, knurrte sie in sein Ohr.
Er ächzte nur als Antwort. Satrine ließ ihn los und schritt rasch davon. Nur aus den Augenwinkeln warf sie einen Blick zurück und vergewisserte sich, dass der junge Mann ihr nicht folgte. Wahrscheinlich hatte er sich längst zurück zur Brücke getrollt, um einen anderen Neuankömmling zu belästigen.
Sie schob sich weiter durch die Menge, die in Inemar bunt gemischt war: Die meisten waren Druthalier mit heller Haut und braunem oder blondem Haar, aber es gab auch ein paar Kieraner mit geölten Häuptern, Acserianer mit bronzefarbener Haut sowie eine Handvoll weiterer exotischer Gesichter, die ihre Enklave im Kleinen Osten zeitweilig verlassen hatten.
Das Wachgebäude lag nur zwei Häuserblocks von der Brücke entfernt, eine kleine Festung aus Stein und Metall, welche die Märkte an der Kreuzung überragte. Das Gebäude musste uralt sein. Inemar war voll von Relikten, nicht nur von Bauwerken, sondern auch von menschlichen.
Satrine schritt unter einem steinernen Torbogen hindurch, an dem zwei einfache Konstabler in Habachtstellung Wache hielten. Ihre dunkelgrünen und roten Mäntel waren frisch gebügelt und sauber und standen in scharfem Kontrast zum Grau und Rostbraun ihrer Umgebung.
Die Konstabler nickten nur, als sie vorbeiging. Warum sollten sie nicht? Sie war eine respektabel wirkende Frau, das Haar ordentlich zurückgebunden, das Gesicht sauber. Ihre Kleidung passte zu einer anständigen Bürgerin von Maradaine, obwohl die lange Leinenhose und die dicke Bluse kaum als elegant durchgingen.
Satrine betrat das Gebäude und gelangte in eine kleine Eingangshalle, wo ein hölzerner Empfangstresen sie von der überfüllten Arbeitsfläche der Beamten trennte. Uniformierte Konstabler saßen auf Bänken hinter dicht stehenden Schreibtischen oder drängten sich durch die engen Zwischenräume. Ein paar Männer waren einfache Konstabler, andere von höherem Dienstgrad.
Eine Frau bahnte sich ihren Weg zum Tresen. Sie trug die Jacke eines Konstablers, aber Satrine bemerkte den entscheidenden Unterschied an ihrer Uniform: Sie trug einen Rock, der unterhalb des Knies endete. Das entsprach den Regeln des Anstands, doch es ließ sie eher wie ein Schulmädchen aussehen als wie eine Beamtin.
»Kann ich Ihnen helfen, gnä’ Frau?« Das Haar der Frau war so straff zurückgebunden, dass es zur Anspannung in ihrer Stimme passte.
»Ich suche Hauptmann Cinellan«, erwiderte Satrine.
»Zweiter Stock.« Die Frau wies auf einen schmalen Korridor links von ihr. »Die Abteilung der Inspektoren ist dort oben.« Jemand ließ einen Stapel Papiere vor der Frau auf den Tisch fallen und beanspruchte ihre Aufmerksamkeit.
Satrine ging den Flur entlang und stieg die Stufen einer engen Wendeltreppe hinauf. Dabei ließ sie die Finger an der kühlen Wand entlanggleiten. Ihre Gedanken waren bei dem Brief, der sich so anfühlte, als wollte er ein Loch in ihre Manteltasche brennen.
Sie betrat einen weitläufigen Raum. Helles Sonnenlicht fiel durch die Fenster an der Ostwand. Die gegenüberliegende Wand war von Aktenschränken und Schiefertafeln gesäumt, und Schreibtische standen großzügig im Raum verteilt. Über jedem hing eine Öllampe. Männer in den Westen der Wache arbeiteten an den Tischen, während eine Handvoll junger Burschen im Zimmer umherlief. Zwei Jungen rannten an Satrine vorüber und stürmten die Treppe hinab.
Eine blonde Frau am nächstgelegenen Schreibtisch – die einzige Frau außer ihr selbst auf diesem Stockwerk – lächelte freundlich, als Satrine herankam. »Vor denen muss man sich vorsehen.«
»Schnelle Läufer«, bemerkte Satrine.
»Die schnellsten, die wir haben. Hat man Sie mit einer Anzeige heraufgeschickt?«
»Eine Anzeige?«
»Für einen der Inspektoren?«
»Nein.« Satrine holte tief Luft. Hier wurde die Lüge zu einem Gewicht, das auf ihrem Brustkorb lastete. »Ich bin hier, um Hauptmann Cinellan zu sprechen.«
»In Ordnung«, sagte die Frau – Fräulein Nyla Pyle, ihrem Messingabzeichen und dem fehlenden Ehearmband nach zu schließen. »Ihr Name bitte?«
»Rainey. Satrine Rainey.«
Ein Funke des Wiedererkennens blitzte in Fräulein Pyles Augen auf. Sie nickte knapp und biss sich auf die Unterlippe. »Dort entlang, bitte.«
Sie führte Satrine an verschiedenen Männern vorbei, die über ihre Fälle sprachen. Satrine schnappte nur ein paar Wortfetzen auf, bevor sie die Tür mit dem Messingschild erreichte: HAUPTMANN BRACE CINELLAN.
Fräulein Pyle klopfte an und öffnete die Tür ohne abzuwarten. Das Arbeitszimmer Hauptmann Cinellans war düster, keine Fenster, nur brennende Öllampen und Kerzen auf dem Tisch. Der Mann selbst saß über den Schreibtisch gebeugt. Er hatte den Körperbau eines alten Soldaten, kräftig und ein wenig gekrümmt vom Alter. Nicht, dass er so alt gewesen wäre; er hatte nur wenige Falten im Gesicht und kein einziges graues Haar. Dennoch war seine Haltung die eines betagten Mannes. Eines müden Mannes.
»Ja, Fräulein Pyle?«, fragte er.
»Frau Satrine Rainey wünscht Sie zu sprechen, Hauptmann.« Fräulein Pyle betonte Satrines Nachnamen überdeutlich. Hauptmann Cinellans schwere Augen richteten sich auf Satrine, sein Blick voll Mitgefühl.
»Ja, natürlich« Er erhob sich vom Schreibtisch, kam auf Satrine zu und reichte ihr die Hand. »Frau Rainey, schön, Sie zu sehen.«
Satrine schüttelte seine Hand mit starkem, festem Griff. Sie wollte ihm keinen Grund geben, an ihrer Entschlossenheit zu zweifeln.
Mit einer Geste bot Cinellan ihr den Stuhl vor dem Schreibtisch an, obwohl sich Bücher und Kladden darauf stapelten. Fräulein Pyle räumte sie hastig beiseite, bevor irgendwer etwas sagte.
»Das geht zurück ans Archiv, Hauptmann?«
»Ja, Fräulein Pyle. Und, äh … Tee mit …«
»Honig und Sahne«, führte Fräulein Pyle den Satz zu Ende. »Etwas für Sie, Frau Rainey?«
»Tee, ja«, antwortete Satrine. »Und nur Sahne.«
Fräulein Pyle nickte und verließ das Büro so anmutig, wie es mit einem Stapel Papier im Arm möglich war. Mit einer raschen Fußbewegung schloss sie die Tür.
Hauptmann Cinellan nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz. »So, Frau Rainey, lassen Sie mich nur anmerken … als wir davon hörten, was mit Ihrem Mann geschehen ist … Nun, die meisten hier am Südufer kannten ihn zwar nicht, von seinem exzellenten Ruf abgesehen. Und wenn so etwas …« Er stockte.
»… so etwas Vernichtendes passiert?«, bot Satrine an. Das war das beste Wort, um zu beschreiben, was mit Loren geschehen war.
Cinellan nickte. »Ganz genau. Das bringt einen zum Nachdenken. Vor allem, wenn man Grün und Rot trägt wie wir hier.«
»Was mit meinem Mann geschah, war … ist eine Tragödie, Hauptmann Cinellan. Aber ich muss …«
»Ja, ich weiß«, sagte Cinellan. Er wühlte in den Papieren auf seinem Schreibtisch. »Der Hohe Kommissar Enbrain hat mich wissen lassen, dass Sie vorbeikommen werden.«
Satrines Herz schlug ihr bis zum Hals. Wenn Enbrain auch hierhin einen Brief geschickt hatte, konnte das alles zunichtemachen. Das durfte sie nicht zulassen. Um Lorens willen musste sie Erfolg haben. Um der Mädchen willen.
»Er hat Ihnen die Anweisungen in Bezug auf mich schon zukommen lassen?«
»Anweisungen?« Cinellan wirkte verwirrt. »Nein, er hat nur einen Botenjungen geschickt, der ankündigte, dass Sie heute kommen werden.«
»Sie haben die Anweisungen also noch nicht erhalten?« Das war der entscheidende Augenblick. Sie zwang die Worte heraus, obwohl sie ihr beinahe die Kehle zuschnürten. »Dass Sie mir hier eine Anstellung geben sollen?« Sie zog den Brief aus der Tasche.
Cinellan warf einen kurzen Blick auf den Brief, der mit Embrains Siegel verschlossen war. Oder, richtiger ausgedrückt, mit einer ausgezeichneten Fälschung dieses Siegels, das Satrine in stundenlanger Arbeit nachgemacht hatte. Cinellan schenkte ihm keine zwei Sekunden Beachtung, ehe er es brach und den Brief las.
»Ich soll was?«
Satrine hätte ihm fast geantwortet, doch sie biss sich auf die Zunge, bevor sie offenbarte, dass sie den Inhalt des versiegelten Schreibens kannte.
»Das kann nicht sein Ernst sein!«
»Was?«
»Diesem Brief zufolge soll ich Sie zum Inspektor machen.«
Inspektor dritter Klasse, um genau zu sein. Satrine hatte genug riskiert, indem sie das in den Brief einfügte.
Eine Stunde lang hatte sie vor dem Spiegel ihren Gesichtsausdruck geübt, alte, seit Langem ungenutzte Fähigkeiten wiedererweckt. Sie musste exakt den richtigen Grad erfreuter Überraschung treffen, ohne erschrocken zu wirken. Sie riss die Augen weit auf und schnappte nach Luft. Dabei legte sie die Hand auf die Brust, als ob ihr Herz schneller schlüge, und fragte: »Was wäre das Gehalt?«
»Gehalt!«, fuhr Cinellan auf. »Frau Rainey, haben Sie irgendwelche Erfahrung mit Ermittlungsarbeit?«
»Abgesehen von einem Ehemann, der Inspektor erster Klasse war?«
»Das ist keine Qualifikation, Frau Rainey. Meine Frau spielt ausgezeichnet Flöte, aber ich bringe auf dem Instrument keinen Ton hervor.«
»In Ordnung.« Satrine wusste, dass sie damit nicht weiterkäme. »Vor meiner Ehe war ich Agentin beim druthalischen Geheimdienst.«
Cinellan hob die Brauen. »Für wie lange?«
Satrine wusste, dass sie ihn am Haken hatte, genug jedenfalls, um ihn an Land zu ziehen. »Vier Jahre.« Sie hielt einen Augenblick den Atem an und ließ ein kleines Lächeln über ihre Lippen huschen. »Offiziell.«
»Ich gehe nicht davon aus, dass sich das überprüfen lässt.«
Satrine hatte mit diesem Einwand gerechnet. »Wir kriegen keine Tätowierung wie bei der Armee oder der Marine.«
»Sie verstehen sicher, dass ich mich nicht allein auf Ihr Wort verlassen kann …«
»Selbstverständlich.« Satrine zog einen weiteren Brief aus der Tasche. Dieses Mal einen echten. »Ich weiß, dass ist streng genommen keine …«
Er überflog das Schreiben. »Ich habe oft genug Briefe mit ›bestem Dank für den Dienst an der Krone‹ gelesen, um zu wissen, was das wirklich bedeutet.« Cinellan schnaubte missbilligend. »Die meisten Inspektoren haben jahrelang auf der Straße gedient.«
»Sie wollen meine ganze Geschichte hören, Hauptmann?«
»Ich brauche schon einen guten Grund, wenn ich – ohne Ihnen gegenüber respektlos sein zu wollen, Frau Rainey – irgendeine dahergelaufene Frau über die Köpfe mehrerer verdienter Männer hinweg zum Inspektor machen soll.«
Satrine hatte das erwartet. Die Fälschung allein, so tadellos sie sein mochte, würde nicht ausreichen, um einen Hauptmann, der seinen Sold wert war, zu ihrer Einstellung zu bewegen.
»Lassen wir einmal außer Acht, dass ich nicht ›irgendeine dahergelaufene Frau‹ bin, sondern die Frau eines hingebungsvollen Konstablers, eines Mannes, der für diese Stadt fast sein Leben gegeben hat. Ich habe außerdem alle Fertigkeiten und die erforderliche Ausbildung, um als Inspektor zu dienen.«
»Ich will zugeben, dass man vier Jahre beim Geheimdienst nicht einfach beiseitewischen kann. Trotzdem, keine formale Ausbildung kann die Kenntnis dieser Straßen ersetzen.«
»Der Straßen von Inemar?«, fragte Satrine. Sie machte sich keine Mühe, ihr Grinsen zu verbergen. »Ich wuchs keine drei Blocks entfernt von hier auf.«
Cinellan schmunzelte. »Das können Sie mir nicht erzählen. Sie sind eine Dame aus Nord-Maradaine, wenn ich je eine gesehen habe.«
»Eh, glaubste?« Satrine schlüpfte in ihren alten Jargon wie in einen bequemen Schuh. »Kein Wunder, dass ihr Knüttel uns nie festnageln konntet.«
Cinellan hob die Brauen. »Welche Ecke?«
»Jent und Tannen.«
»Ausgeschlossen! Als ich meinen Mantel bekam, kannte ich jede Straßenratte und jede Schwalbe in diesem Teil des Viertels. Das einzige Mädchen mit waish-roten Haaren zu dieser Zeit war …«
»›Tricky‹ Trini.«
»Genau. Und sie … sie …« Er riss die Augen auf. »Unmöglich!«
Satrine senkte anmutig den Kopf. »Das war ein anderes Leben.«
»Ich weiß genau, dass es unten in den Archiven noch einen Bericht über die Ermittlungen anlässlich ihres … Verschwindens gibt.«
Satrine zuckte die Achseln. »Meine Rekrutierung für den Geheimdienst war … ein wenig unkonventionell. Ich hatte keine Gelegenheit, jemandem zu sagen, wohin ich ging.«
Cinellan lachte laut. Er fand allmählich Gefallen an ihr. Das war stets ihre Gabe gewesen – um auf der Straße zu überleben, um beim Geheimdienst zu bestehen, gewann sie die Sympathien der Menschen. Sie hüllte sich in Lügen, ständig und immerzu. Aber einem solch aufrichtigen Mann eine aufzutischen, einem Mann wie Loren, der nur seine Arbeit tat, bereitete ihr Übelkeit.
»Ich bin fasziniert, Frau Rainey, und der Kommissar merkt an, dass wir mehr Plätze in der Wache an Frauen vergeben sollen.« Beiläufig wedelte er mit dem Brief. Das hatte der Kommissar tatsächlich geschrieben, allerdings als Argument, um Satrine die Stelle einer Schreibkraft anzubieten. Ein Posten, der fünf Kronen die Woche einbrachte. Mit diesem Gehalt würde ihre Familie auf der Straße landen; und Satrine würde niemals zulassen, dass ihren Töchtern so etwas passierte. Ihre Mädchen sollten nie durchmachen, was sie erlitten hatte.
Fräulein Pyle kam mit einem Tablett mit Tee zurück. Cinellan verlor seine Ungezwungenheit, während Fräulein Pyle anwesend war. Er dankte ihr für den Tee und wartete, bis sie wieder gegangen war, bevor er in kleinen Schlucken trank. Eine ganze Zeit lang saß er stumm hinter seinem Schreibtisch, die Teetasse in der Hand. Satrine hob ihre Tasse, trank jedoch nicht. Sie rechnete ohnehin nicht damit, dass der Tee viel taugte.
»Ich will offen sein, Hauptmann«, erklärte sie schließlich. »Ich bin keine Witwe, obwohl ich genauso gut eine sein könnte. Ich habe zwei Töchter, die ich durch die Schule bringen muss, einen Ehemann, der ständiger Pflege bedarf, hinzu kommen Miete, Steuern und andere Ausgaben. Wenn ich keine zwanzig Kronen in der Woche nach Hause bringe, bricht alles zusammen.«
»Der normale Sold für einen Inspektor dritter Klasse liegt bei neunzehn Kronen fünf.«
»Das ginge für den Anfang.« Sie hatten genug gespart – vor allem, wenn man hinzurechnete, was die Jungs von Lorens Revier für ihre Familie gesammelt hatte –, um ein paar Monate lange mit neunzehn-fünf auszukommen. Bis zum Sommer würde sie schon eine Möglichkeit finden, um auch die letzten fünfzehn Groschen aufzutreiben.
»Ehrgeizig, das ist gut«, sagte Cinellan. »Trotzdem finde ich es nicht richtig, selbst wenn der Kommissar es so will.«
»Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf die Probe stellen.«
»Hm.« Cinellan schnaubte. »Wie auf die Probe stellen?«
»Geben Sie mir eine Woche«, schlug Satrine vor. »Wenn irgendein Wachtmeister im Revier murrt, sagen Sie ihm einfach, der Kommissar hätte Sie unter Druck gesetzt.«
Cinellan tippte den Brief auf seinem Schreibtisch an. »Was er getan hat.«
»Wenn Sie am Ende der Woche zu dem Schluss kommen, dass ich den Posten nicht verdiene, schicken Sie mich einfach weg. Sie können dem Kommissar dann berichten, dass Sie es versucht haben, und dass es nicht funktioniert hat.«
Satrines Herz schlug wie ein Hammer, als würde es durch ihren Brustkorb brechen.
»Gut«, sagte Cinellan. »Obwohl ich es vor allem deswegen tue, weil ich dann endlich Ihre alte Akte aus den Archiven holen und darin vermerken kann, dass ich einen zwanzig Jahre alten Fall gelöst habe.«
»Ich danke Ihnen, Hauptmann.« Ein großer Teil der Last fiel von Satrines Schultern. Die restliche Anspannung würde erst vergehen, wenn sie die Stelle sicher hatte. Sie nahm einen Schluck Tee. Er war so, wie sie erwartet hatte – furchtbar.
»Danken Sie mir noch nicht«, antwortete er. »Sie haben Ihren Partner noch nicht getroffen.«
*
Er führte Satrine zu zwei Schreibtischen in einer abgelegenen Ecke in der Abteilung der Inspektoren, weit weg von den Fenstern. Zwei große Schiefertafeln auf Rollen waren vor einem Tisch aneinandergeschoben worden und vermittelten den Anschein von etwas Privatsphäre. Cinellan klopfte an eine der Tafeln.
»Welling? Ihr Partner ist hier.«
»Ich habe keinen Partner«, kam als Antwort.
»Jeder Inspektor dritter Klasse hat einen Partner. So ist das nun mal.«
Satrine konnte nur die obere Kopfhälfte ausmachen, als der Mann hinter den Tafeln sich erhob. »Dann befördern Sie mich zur zweiten Klasse.«
»Steht nicht zur Debatte, Welling.«
»Also gut.« Der Mann trat hinter seinen Tafeln hervor.
Das Erste, was Satrine auffiel, waren seine Augen. Blau und riesig, fast zu groß für seinen Kopf. Er starrte sie an, lange und eindringlich und ohne zu blinzeln. Dabei erkannte sie, dass nicht seine Augen zu groß geraten waren – es lag am Rest seines Gesichts, streng geschnitten und ausgemergelt, obwohl er noch jung aussah. Er trug die frisch gebügelte Weste eines Inspektors, der Rest seiner Kleidung verriet dagegen Desinteresse an seiner Erscheinung. Sein schwerer Ledermantel war schlammverkrustet, genau wie seine Schuhe, und er hatte mehr als ein paar Flecken auf dem dunklen Hemd.
Er musterte sie eindringlich, während er zugleich bedächtig mit den Fingern schnipste, als würde er etwas zählen.
Hauptmann Cinellan wies auf Satrine. »Welling, das ist …«
»Frau Satrine Rainey, Frau des Inspektors erste Klasse Loren Rainey, gegenwärtig infolge schwerwiegender Verletzungen außer Dienst.« Mit forschem Nicken streckte Welling die Hand aus. »Mein Beileid«, fügte er emotionslos hinzu.
Satrine schüttelte seine Hand, wobei er ihr nur ein Minimum an Berührung zugestand, bevor er die Hand wieder zurückzog. »Ihr Name ist Welling?«
»Minox Welling, Inspektor dritter Klasse.« Sein Blick glitt forschend über ihren Körper, aber Satrine spürte deutlich, dass er sie nur ausgiebig musterte und einschätzte, mehr nicht. »Sie hat denselben Rang?«
»Vorläufig«, sagte Cinellan. »Fräulein Pyle wird Ihnen alles bringen, was Sie benötigen, Frau Rainey.«
»Ich danke Ihnen, Hauptmann«, erwiderte sie. »Ich werde Sie nicht …«
»Gut.« Cinellan winkte ab und schritt davon.
Sie wandte sich Welling zu. »Also … Minox, nicht wahr?«
»Inspektor Welling«, gab er zurück. Er ging um die Tafeln herum zurück zu den Schreibtischen. Sie folgte ihm und stellte fest, dass beide Tische mit Papieren, Zeitungsstapeln, benutzten Teetassen, Kreide, Tintenfässchen, einer qualmenden Pfeife, Brotkrumen sowie einer Armbrust in einem Lederholster bedeckt waren. Es blieb eine winzige, vergleichsweise freie Fläche übrig, auf der ein ledergebundenes Notizbuch aufgeschlagen lag.
»Sie haben sich daran gewöhnt, allein zu arbeiten, nicht wahr, Inspektor Welling?«
»Ich arbeite besser alleine.« Er setzte sich an den Schreibtisch, von dem aus er die Schiefertafeln im Blick hatte. Mit einem weiteren Blick aus seinen zu großen Augen beschied er ihr: »Sie haben Hauptmann Cinellan in irgendeiner Sache angelogen.«
Diese offene und leidenschaftslose Feststellung überrumpelte Satrine. Sie gewann ihre Fassung zurück und fragte: »Wie kommen Sie darauf?«
»Es war Ihnen recht deutlich vom Gesicht abzulesen, wann immer er nicht in Ihre Richtung schaute. Sobald er sich Ihnen wieder zuwandte, nahm Ihre Anspannung zu, sichtbar an Ihrem Kiefer und der Haltung Ihres Halses. Ja, genau so, wie in diesem Augenblick.«
»Das heißt nicht …«
»Doch, normalerweise tut es das«, bekräftigte Welling. Er wandte seine Aufmerksamkeit einem Papier auf seinem Schreibtisch zu. »Allerdings ist das kaum von Bedeutung für mich. Für mich zählt nur, ob Sie Ihre Arbeit machen und mir als Partner nützlich sein können, betreffend der uns zugeteilten Investigationen.« Wieder sah er kurz zu ihr auf. »Können Sie das?«
»Absolut.«
Welling nickte. »Das war aufrichtig gemeint. Nehmen Sie Platz, Inspektorin Rainey.«
Ein merkwürdiges Gerät stand auf dem anderen Stuhl, ein kleiner Apparat aus Glas und Metall. Da Welling nichts dazu sagte, nahm Satrine ihn und legte ihn auf dem Schreibtisch ab. »Woran arbeiten wir im Augenblick?«
Welling nahm den Apparat und schob ihn zur Seite. »Gegenwärtig habe ich einen Fall, den ich als ›in Arbeit‹ betrachte, und vierundzwanzig weitere, die ich als ›ungelöst‹ einstufe. Meine Aufzeichnungen … liegen hier alle.«
»Dann bringen Sie mich auf den neusten Stand.«.
»Augenblick!« Welling hob einen Finger.
»Was ist …«
»Pst.« Zwei Inspektoren traten um die Tafeln herum, die – wie Satrine jetzt bemerkte – mit Namen, Orten, Pfeilen und Fragezeichen vollgekritzelt waren. Der ältere Inspektor mit gerötetem und mürrischem Gesicht ergriff zuerst das Wort: »Also gut, Omen, worum geht’s?« Er sprach wie ein Einheimischer aus dem Viertel, und hatte auch die passende Nase dafür; sie musste mindestens ein halbes Dutzend Mal gebrochen gewesen sein.
Welling zuckte sichtlich zusammen, als der Inspektor ihn ansprach, aber er antwortete höflich. »Ich habe einen Durchbruch erzielt, Inspektor Mirrell, was einen Ihrer Fälle angeht, der nämlich mit einem der meinen in Verbindung steht. Bevor ich das allerdings mit Ihnen erörtere, ist wohl eine förmliche Bekanntmachung geboten. Inspektorin Rainey, dies sind zwei unserer Kollegen, die Inspektoren Henfir Mirrell und Darreck Kellman. Meine Herren, darf ich meine neue Partnerin vorstellen, Inspektorin Satrine Rainey.«
Satrine biss sich auf die Unterlippe, um nicht laut aufzulachen. Wellings Vorstellung klang so gestelzt, als hätte er die Formulierungen aus einem Ratgeber für Umgangsformen gelernt und würde nun wie ein aufgezogener Automat das Gelernte wiederholen.
»Inspektorin, wirklich?«, fragte Kellman mit ungläubigem Staunen. Er war ein Bulle von Mann und überragte seinen Partner noch um einen guten Fuß. Sein ausgeprägter Akzent verriet, dass er aus den ärmlichen Westvierteln von Maradaine stammte.
»Seit zehn Minuten.« Satrine erwiderte seinen kräftigen Händedruck.
»Angenehm«, sagte Mirrell und würdigte Satrine kaum eines Blickes. Seine Aufmerksamkeit war ganz auf Welling gerichtet. »Welcher Fall?«
»Die Morde vor dem Oscana-Park.« Die aufgesetzte Förmlichkeit war aus seiner Stimme verschwunden.
Mirrell schnaubte abfällig. »Der Fall? Da gab’s kein Geheimnis zu lösen, Omen.«
Wellings Auge zuckte erneut bei dieser Anrede, und Satrine erkannte, dass Mirrell keinen freundlich gemeinten Spitznamen gebrauchte. Welling reckte seine Finger vor Mirrells Gesicht in die Höhe und führte seine Gedanken weiter aus: »Zwei tote Männer von der Reiterstaffel, gleich südlich des Parks mit Messern in der Brust aufgefunden.«
Kellman schüttelte den Kopf. »Ja, und ein stadtbekannter und für den Umgang mit Messern berüchtigter Meuchelmörder lag tot keine zwanzig Fuß davon entfernt.«
»Fall gelöst«, fügte Mirrell hinzu.
»Das Bild ist unvollständig«, rief Welling aus. »Wie eine Leinwand, bei der gerade mal eine kleine Ecke bemalt wurde.«
Satrine war sogleich fasziniert. »Wer hat den Mörder umgebracht?«
»Genau die entscheidende Frage, die von unseren lieben Kollegen ganz und gar ignoriert wird«, sagte Welling. »Wenn auch kaum die einzige bei diesem Fall.«
Mirrell rieb sich mit der Hand übers Gesicht. »Wir ignorieren die Frage nicht, Omen. Der Mann hat einen Schlag auf den Schädel erhalten, von oben. Ein zerbrochener Stab lag unmittelbar neben ihm.«
»Und wer hatte ihn benutzt?«
»Der Komplize des Mörders.« Kellman blickte zu Satrine hinüber und appellierte eindeutig an ihren gesunden Menschenverstand. »Es ist bekannt, dass dieser Kerl mit einem Partner zusammenarbeitete, der fast sieben Fuß groß und stark wie ein Ochse ist.«
Welling nickte. »Pendall Gurond, ich weiß.«
Kellman hob die Hände. »Einer tötet die Männer von der Reiterstaffel, dann tötet sein Partner ihn.« Er ließ eine Hand auf den Schreibtisch krachen, um die Tat zu verdeutlichen.
»Warum?«, fragte Satrine.
Mirrell zuckte nur die Achseln. »Ein größerer Anteil an der Bezahlung, höchstwahrscheinlich.«
Satrine gab sich damit nicht zufrieden. »Bezahlung wofür?«
»Für den Mord an zwei berittenen Konstablern«, entgegnete Kellman, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt.
Satrine sah Welling an. »Das passt nicht richtig zusammen, oder?«
Welling erwiderte ihren Blick, und für einen winzigen Moment zog ein Lächeln über seine Züge. »Nein, es passt ganz und gar nicht zusammen. Die beiden Reiter waren, wenn ich das so sagen darf, Männer ohne größere Bedeutung. Mitglieder der Wache, ohne Zweifel, und von hervorragender Reputation, aber gewiss keine Männer, auf deren Köpfe irgendwer einen Preis aussetzen würde, und schon gar keinen Preis in der Größenordnung von mehreren Tausend Kronen.«
»Dann haben die beiden berittenen Konstabler die Gauner halt bei etwas anderem gestört.«
»Bei was, das ist hier die Frage.« Welling tippte mit dem Finger auf seinen Schreibtisch.
Kellman und Mirrell traten beide missmutig einen Schritt vom Schreibtisch fort. »Was für eine Rolle spielt das?«, fragte Mirrell.
Kellman wies zustimmend auf seinen Partner. »Vermutlich haben die Reiter die zwei Mörder bei einem Streit gestört, und für die Einmischung mit ihrem Leben bezahlt.«
»Interessant«, sagte Satrine.
»Was soll das heißen?«, fragte Kellman.
»Sie haben immer gleich eine Schlussfolgerung parat und biegen dann die Fakten darum herum, bis sie passen. Ich dachte, es sollte genau andersherum gehen.«
Jetzt lächelte Welling breit, was überhaupt nicht zu seinem Gesicht passen wollte. »Ich komme nicht umhin, Ihrer Art zu denken etwas abzugewinnen, Inspektorin Rainey.«
»Und das ist es, was er unter einem Kompliment versteht«, sagte Mirrell. Er stolzierte davon, und Kellman folgte ihm.
»Es gab drei«, rief Welling ihnen nach.
Mirrell kam zurück. »Drei was?«
»Drei Mörder, die immer zusammenarbeiteten, nicht zwei. Was allerdings nicht von großer Bedeutung wäre, weil Ihre Theorie genauso gut mit zwei Partnern funktioniert, die sich gemeinsam gegen einen dritten wenden, wie mit einem Paar, bei dem einer den anderen erschlägt.«
»Worauf willst du eigentlich hinaus, Omen?«
»Wie ihr euch möglicherweise erinnert, war mir ein Fall zugewiesen worden, bei dem es um vier Tote ging, die einen Tag nach euren toten Reitern auf einem Abfallkahn gefunden wurden.«
»Beim Heiligen Jasper, Omen!«, fuhr Kellman ihn an. »Red nicht länger um den heißen Brei herum und komm endlich zur Sache!«
Welling wirkte von der Zurechtweisung gekränkt. Er nickte und fuhr fort: »Einen der vier habe ich als den dritten Auftragsmörder identifiziert. Die drei anderen waren Magier, alles Mitglieder desselben Zirkels, der Blauen Hand.«
»Magier«, murmelten Kellman und Mirrell im Gleichklang. Wieder bekam Welling dieses Zucken im Auge, das er schon gezeigt hatte, als sie ihn Omen nannten.
»Allerdings. Und die Verbindungen zwischen den Auftragsmördern und dem Zirkel ist Willem Fenmere.« Dieser Name stand auch in großen Buchstaben auf der Tafel.
Sowohl Kellman als auch Mirrell wurden blass.
»Wer ist Willem Fenmere?«, fragte Satrine. Vermutlich hätte sie es erraten können. Die Namen veränderten sich im Laufe der Jahre, aber die Geschichten blieben stets die gleichen.
»Der Verbrecherkönig in Dentonhill«, sagte Mirrell. »Er hat genug Hände im Viertel geschmiert, dass die Wache ihn einfach nicht zu fassen kriegt, ihm nie etwas nachweisen kann.«
Welling blätterte seine Unterlagen durch. »Aber seine Verbindung zur Blauen Hand ist interessant, denn ich weiß aus sicherer Quelle, dass diese und auch seine Verbindung zu den Auftragsmördern mit einer Reihe von …«
»Nein, Omen!« Mirrell klatschte mit der Handfläche auf die Papiere, in denen Welling gerade wühlte. »Einfache Frage: Kannst du – nicht vermuten, keine Verbindungen ziehen, keine Reihe von irgendwas, die zu irgendwas führt –, kannst du wirklich beweisen, dass Fenmere in den Tod der beiden berittenen Beamten verwickelt ist?«
»Nun, das nicht. Aber es ist doch interessant …«
»Verdammt, Omen!«, brüllte Kellman. »Was für einen Sinn hat das Ganze dann?«
»Mitunter ist es einfach gut, wenn man die Wahrheit kennt«, antwortete Satrine unwillkürlich. Beim Geheimdienst reichte das natürlich schon, um etwas dagegen zu unternehmen. Da kümmerte sich niemand um den ›eindeutigen Beweis der Schuld‹ oder ›die Rechte des Angeklagten‹.
Mirrell schüttelte den Kopf und grinste. »Frau Rainey – bitte entschuldigen Sie mich, Inspektorin Rainey –, lassen Sie sich bloß nicht von seinen Verrücktheiten anstecken, sonst bringt das schlechte Omen ihnen auch noch Unglück.« Dann sah er sie zum ersten Mal richtig an und fügte mit offensichtlichem Hohn hinzu: »Und vielleicht wäre das sogar das Beste für alle.« Mit diesen Worten verschwanden er und Kellman.
Welling murmelte: »Jetzt noch einer offen, fünfundzwanzig ungelöst.« Er zog einen Füllfederhalter aus dem Tintenfass und kritzelte etwas in das ledergebundene Notizbuch.
Satrine fing an, ihren Schreibtisch aufzuräumen. »Warum nennen die Sie eigentlich Omen?«
»Ach, nur so ein dummer Spruch.«
»Aber es gibt einen Grund dafür«, bohrte Satrine weiter.
»Es gibt für alles einen Grund.«
»Liegt es daran, dass Sie ein Magier sind?«
Welling ließ den Stift fallen. Er schaute Satrine mit einer Mischung aus Überraschung und Bewunderung an. »Nein, das ist nicht der Grund. Was hat mich verraten?«
»Sie sind zusammengefahren, als man Sie ›Omen‹ nannte, auch wenn es kaum zu bemerken war. Kaum mehr als Zucken in Wange und Auge. Dasselbe geschah, als sie über Magier schimpften. Hinzu kommt Ihr schmaler Körperbau.«
»Die Hinweise waren unverkennbar für das geübte Auge, wenn besagtes Organ mit einem funktionsfähigen Gehirn verbunden ist.« Er schürzte die Lippen. »Möglicherweise besitzen Sie tatsächlich die erforderlichen Fähigkeiten für einen Inspektor.«
»Das habe ich Ihnen gesagt«, antwortete Satrine. »Aber welchem Zirkel gehören Sie an? Ich hätte nicht gedacht, dass einer von ihnen mit der Wache zusammenarbeitet.«
»Das ist auch nicht der Fall«, gab Welling ruhig zurück.
»Aber das würde bedeuten, dass Sie …« Satrine ließ den Satz unvollendet.
»Sie können es ruhig aussprechen«, sagte er. »Ich bin zirkellos.«
»Aber …«
Fräulein Pyle umrundete die Tafeln, bevor Satrine ihren Gedanken zu Ende führen konnte. Munter lächelnd stellte sie eine kleine Holzkiste auf der leeren Fläche ab, die Satrine soeben auf dem Schreibtisch freigeräumt hatte.
»Es tut mir leid, dass ich eine Weile gebraucht habe, um das zu bringen, Frau … Inspektorin Rainey. Die Verwalterin in der Rüstkammer wollte mir nicht glauben, als ich ihr erklärt habe, dass ich eine Inspektorenuniform für eine Frau brauche. Sie sagte, so etwas gäbe es gar nicht!«
So etwas gab es gar nicht. Genau wie Magier ohne Zirkel im Dienst der Wache.
Satrine zog den Mantel aus und legte ihn über den Stuhl, dann öffnete sie die Kiste. Sie holte die Weste heraus, ein sattes Grün, mit würdevollem dunklem Rot abgesetzt, dieselben Farben, die Loren in all den Jahren getragen hatte. Sie hielt das Kleidungsstück einen Augenblick lang ehrfurchtsvoll in der Hand, bevor sie es anzog. Es passte, ein wenig zu weit vielleicht, aber das ließ sich ändern.
Als Nächstes nahm sie den Gürtel heraus, der dem glich, den Welling so achtlos auf dem Tisch abgelegt hatte. Sie schnallte ihn sich um die Hüften. Er war viel zu groß, und das Holster für die Armbrust hing fast bis zum Oberschenkel herunter. Sie nahm den Gürtel wieder ab und legte ihn auf ihren Schreibtisch.
Dem letzten Stück in der Kiste, einem Rock, wie Fräulein Pyle ihn trug, schenkte sie demonstrativ keine Beachtung. Fräulein Pyle blickte sie jedoch weiterhin erwartungsvoll an, sodass Satrine die Kiste schließlich nahm und auf dem Boden abstellte.
Fräulein Pyle wandte sich Inspektor Welling zu. »Minox, du kannst die gebrauchten Teetassen nicht hier auf deinem Schreibtisch sammeln. Ich habe dir das schon mal gesagt, und ich werde nicht zweimal am Tag hier vorbeikommen, um hinter dir herzuputzen.«
Welling warf ihr einen Blick zu, in dem sich ein Hauch echter Zuneigung verbarg. »Du wirst dich hüten, diesen Schreibtisch aufzuräumen.«
»Und das bedeutet, dass du dich selbst …«
In diesem Augenblick stürmte ein junger Bursche in den Raum, seinem Mantel nach zu urteilen ein Bote der Wache. »Mord!«, schrie er. »Drüben bei Jent und Tannen!«
Satrine schreckte auf, als sie die vertrauten Namen hörte, die Straßen ihrer Kindheit. Sie verspürte eine leichte Übelkeit. Sie wusste, dass sie dorthin würde zurückkehren müssen, aber sie hatte nicht erwartet, dass es so rasch geschehen würde.
Welling war bereits auf den Füßen. Er schnappte sich den Gürtel vom Schreibtisch und legte ihn um, während er losrannte. Satrine warf den eigenen Gürtel über die Schulter, griff nach ihrem Mantel und lief hinterher.
Es war an der Zeit, dass sie sich ihre neunzehn Kronen und fünf verdiente.
2. Kapitel
Satrine hatte die Ecke von Jent und Tannen seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Es war eine andere Zeit gewesen; die Stadt war ausgelaugt von einem fernen Krieg und taumelte am Rande der Hungersnot. Scharen herrenloser Kinder schlugen und schnorrten sich durchs Leben, einsam und elend oder in wilden Banden. Einen Großteil ihrer Kindheit hatte Satrine dieses Schicksal geteilt. Diese Straßenecke war ihr Zuhause gewesen, ihre Familie, ihr Albtraum.
Die Ecke von Jent und Tannen weckte Erinnerungen. Im Kern war es derselbe Ort geblieben – die Gebäude, der Verlauf der Gassen, die Art, wie die Morgensonne in die Straße einfiel. Doch was Satrine als grau und trostlos gekannt hatte, zeigte sich nun als lebendiges und blühendes Geschäftsviertel. Frische Farbe glänzte auf dem Schild der Bäckerei an der Südwestecke. Die Fenster des Mietshauses, in dem sie Unterschlupf gefunden hatte, waren mittlerweile intakt, das Straßenpflaster nicht mehr zerborsten. Die Straßen waren natürlich immer noch viel zu schmal, jetzt, wo sich Dutzende von Kutschen und Tretwagen dort drängten.
Satrine wurde von einem wohligen Gefühl überrascht, als sie etwas Vertrautes erblickte: In Ushmans heißer Kessel hatte sie Kartoffeln, Butter und gesalzenes Schweinefleisch bekommen, was sie in jenen Jahren mehr schlecht als recht ernährt hatte. Das schmiedeeiserne Gatter, in das Heckie Moss mit einem gestohlenen Milchwagen gekracht war, war immer noch verbogen.
Satrine unterdrückte diese Welle Nostalgie. Eine Menschenmenge umlagerte die Einmündung der Gasse zwischen einer Metzgerei – war das einmal die Schenke zum Leeren Krug gewesen? – und einem Barbier. Drei Konstabler auf Streife – junge Anwärter in schäbigen grün-roten Mänteln – schirmten den Zugang ab und ließen niemanden durch.
»Ist das der Ort, an dem unsere Leiche liegt?«, wandte Satrine sich an Welling, der während ihres raschen Marsches zum Tatort nachdrücklich geschwiegen hatte.
»Ich würde es für einen erstaunlichen Zufall halten, wenn dem nicht so wäre«, antwortete er.
»Ich hätte einfach ›wahrscheinlich‹ gesagt.«
»Das hätten die meisten Leute.« Welling zog eine Pfeife aus der Manteltasche. Er ließ ein schrilles Signal ertönen. Die Menge sprang zur Seite, und eine Lücke entstand, durch die sie hindurchgehen konnten. Gehorsam gegenüber der Pfeife eines Knüttels, das war eine neue Erscheinung in diesem Viertel! Die drei Konstabler am Eingang zur Gasse wichen nicht von der Stelle. Sie erinnerten Satrine an das riesige bronzene Standbild vor dem Wachgebäude in Nord-Maradaine: Aufmerksam auf ihrem Posten, einer mit Armbrust, einer mit Laterne, einer mit Schlagstock. Das Einzige, was fehlte, war der Hund.
»Männer«, sagte Welling mit einem Nicken, als er und Satrine auf sie zukamen. »Was haben Sie für uns?«
Fast gleichzeitig warfen alle drei Konstabler Satrine einen unbehaglichen Blick zu, bevor der Beamte in der Mitte seine Aufmerksamkeit ganz auf Welling richtete. »Ja, wir haben einen, äh … Inspektor, wer ist das?«
»Das ist Inspektorin Rainey, Konstabler«, gab Welling kurz angebunden zurück.
»Sie ist …« Der Streifenbeamte wirkte verwirrt, und seine Verwirrung nahm sogar noch zu, als Satrine den Mantel aufschlug und ihre Weste sehen ließ.
»Hier gab es einen Mord, haben wir gehört«, sagte Satrine.
»Nun, ja, den gab es. Allerdings …« Er warf einen Blick über die Schulter zurück in die Gasse und wandte sich dann wieder Welling zu. »Dieser Mord, Inspektor. Er ist, wenn mir die Feststellung gestattet ist, außergewöhnlich grausig anzusehen.«
Satrine war nicht in der Stimmung für so was, also nahm sie dem Konstabler die Laterne ab. »Glauben Sie, dass Sie einen grausigen Anblick verkraften können, Inspektor Welling?«
»Ich habe noch nicht zu Mittag gegessen.« Er schob den Streifenbeamten mit dem Handrücken zur Seite, und der Mann gab den Weg frei. Welling übernahm die Führung; Satrine hob die Laterne und folgte ihm.
Der Konstabler hatte recht gehabt. Der Anblick war tatsächlich außergewöhnlich grausig.
Dem Körper – es war der eines Mannes – fehlte das Herz. Das war das auffälligste Merkmal der bizarren Szenerie, was durchaus bemerkenswert war, denn immerhin gab es einiges, das ins Auge sprang. Aber unwillkürlich heftete Satrines Blick sich auf diese entsetzlichste Einzelheit: die Öffnung im Brustkorb des Toten, hinter der ein Herz hätte liegen sollen.
Der Mann war vollständig entblößt, alle vier Gliedmaßen ausgestreckt. Seine Hände waren am Boden festgenagelt. Zwei erloschene Kerzenstummel standen auf jeder Seite des Kopfes. Eine Blutlache breitete sich unter dem Körper aus und füllte die Ritzen zwischen den Pflastersteinen, aber der Leichnam selbst wirkte vergleichsweise ordentlich.
»Erzählen Sie mir, was Ihnen auffällt«, sagte Welling.
»Er wurde offensichtlich hier getötet«, antwortete Satrine und betrachtete das Blut. Sie ging in die Hocke und musterte die Hände genauer. »Die Nägel wurden hindurchgetrieben, während er noch am Leben war.« Sie wies auf das Blut unter den Wunden.
Welling nickte. »Was sonst?«
»Ein Ritual«, sagte sie. »Die Kerzen. Die Präzision, mit der das Herz entfernt wurde.« Sie zeigte auf die Schnitte im Brustkorb: glatte Kanten, eine scharfe Klinge.
»Mit akribischer Sorgfalt«, bestätigte Welling. »Kein Verbrechen aus Leidenschaft, keine spontane Tat.« Er schaute sich in der Gasse um. »Also, Inspektorin Rainey, was für Fragen wirft das auf?«
»Soll das eine Prüfung sein, Welling?«
»Ja«, antwortete er geradeheraus. »So wie ich jeden meiner Partner vorher auf die Probe gestellt habe.«
»Na gut.« Das war nur angemessen – immerhin kannte er sie weniger als eine Stunde. »Warum wurde er in dieser Gasse getötet? Das scheint ein unnötiges Risiko zu sein.«
Welling betrachtete die Gasse, die kaum mehr als acht Fuß breit war. »Nicht unmittelbar einsehbar, aber auch nicht abgeschieden. Man kann jederzeit gestört werden. Er muss einen speziellen Grund gehabt haben. Eine ausgezeichnete Frage. Was für einen Vorteil bringt es, genau hier einen Ritualmord zu begehen?«
Satrine erkannte, dass Welling nur eine naheliegende Frage formulierte. Das war weder eine rhetorische Einleitung noch eine weitere Prüfung. »Ein Vorteil wäre die Lage zwischen Fleischer und Barbier. Falls Blut bis hinaus auf die Hauptstraße rinnt, wird sich niemand viel dabei denken. Zum Henker, hier kann man mit einem blutverschmierten Kittel rauskommen, ohne dass jemand einen zweiten Blick drauf werfen würde.«
»Weil man einen plausiblen Grund dafür annehmen würde.« Welling nickte. »Was ist mit dem anderen Ende der Gasse?«
»Eine Sackgasse.« Satrine wies mit dem Finger in die Dunkelheit. »Jedenfalls war das früher so.«
»Sie kennen diese Gasse?«
»Ich kannte sie«, antwortete Satrine abwesend. Sie drang tiefer in die Gasse vor, wo das Sonnenlicht kaum noch hinreichte.
Welling sprach weiter: »Selbst wenn der Mörder mit einem blutigen Herz in der Hand hinauskommen konnte, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen, wie ist er hereingekommen? Oder das Opfer? Kam das Opfer aus freien Stücken, oder wurde es dazu gezwungen?«
»Vielleicht bewusstlos?«, fragte Satrine. »Betäubt?« Die Gasse endete immer noch vor einer roten Ziegelmauer, die Rückseite eines Mietshauses auf der anderen Seite des Blocks. Die Fenster an dem Gebäude waren alle mit Eisengittern versehen und lagen hoch über dem Boden.
»Diesen Mann in bewusstlosem Zustand zu tragen, hätte eine beachtliche Kraft erfordert.«
»Genau wie diese Nägel ins Straßenpflaster zu hämmern.«
»Das ist wahr«, räumte Welling ein. »Man sieht keine Beulen oder Verletzungen am Kopf des Opfers. Was verrät Ihnen das?«
»Er wurde nicht niedergeschlagen. Also betäubt. Vielleicht vergiftet. Oder …« Das war eine dumme Idee, und sie verwarf sie sofort.
»Oder – Aaah!« Entsetzt schrie er auf.
»Was ist?« Satrine eilte zu ihrem Partner zurück. Er kniete neben der Leiche, doch seine gesamte Aufmerksamkeit war auf die eigene Hand gerichtet. Langsam öffnete und schloss er die Finger.
»Ich habe einen der Nägel berührt, und … Ich bin nicht sicher.« Er blickte zu ihr auf. »Es war, als würde er jedes Gefühl und alle Stärke aus meiner Hand heraussaugen.«
»Magie?« Vorsichtig berührte sie einen Nagel mit dem Finger, dann legte sie beherzt die Hand darum. »Ich spüre nichts.«
Welling runzelte die Stirn. »Vielleicht war es nur Zufall.« Erneut berührte er den Nagel und riss die Hand zurück. »Nein, eindeutig nicht. Ich glaube nicht, dass es einer weiteren Überprüfung bedarf, um ein Muster auszumachen.«
»Also ist es Magie«, sagte Satrine. »Oder es hängt zumindest damit zusammen.«
»Wahrscheinlich«, bestätigte Welling. »Mein Wissen auf diesem Gebiet ist sehr beschränkt.«
»Aber wie können Sie …«
»Wie ich bereits sagte, Inspektorin Rainey«, gab er unwirsch zurück. »Ich bin ohne Zirkel. Nicht ausgebildet. Ich besitze die Begabung, jedoch nicht die Übung oder die Disziplin.«
»Trotzdem …«
»Was auch immer Sie dazu anmerken wollen, es mag grundsätzlich zutreffen, doch nicht in meinem speziellen Fall. Und die Einzelheiten meines speziellen Falls stehen im Augenblick nicht zur Diskussion.« Welling verlor seine distanzierte Gelassenheit. Er schrie nicht, er wütete nicht, aber jedes Wort war von einer Woge lang gehegtem, verbittertem Groll erfüllt.
»Also gut.« Satrine beließ es dabei, so unglaubwürdig Wellings Behauptung klingen mochte. Selbst ohne formale Ausbildung ergab es keinen Sinn, dass jemand mit seinen deduktiven Fähigkeiten so wenig über seine Kräfte wusste. Doch angesichts der Tatsache, dass Welling ihre eigenen Geheimnisse ganz bewusst nicht weiter verfolgte, wäre es klüger, bei ihm dasselbe zu tun.
Sie wandte sich wieder dem Leichnam zu. »Sie werden mir allerdings zustimmen, dass diese Nägel ungewöhnlich sind, was immer sie darstellen mögen.«
»Das ganz bestimmt«, bestätigte Welling. »So ungewöhnlich, dass sie ganz gewiss einen speziellen Zweck erfüllen.«
Satrine berührte das Stück Haut, das zurückgeklappt worden war, um das Herz zu entnehmen. Dabei unterdrückte sie ein Schaudern. »Einen sehr speziellen Zweck«, sagte sie und hob die Hautfalte an. Die Reste einer hellen Tätowierung waren erkennbar, nur noch etwas Gelb und Orange. »Wenn ich mich nicht täusche, ist dies das Zeichen eines Zirkels.«
»Damit ist das geklärt«, sagte Welling. »Das Opfer war ein Magier.«
3. Kapitel
Minox verließ die Gasse und blinzelte im hellen Sonnenlicht. Es war nicht das erste Mal, dass er im Rahmen seiner Pflichten auf einen toten Magier stieß. Vor ein paar Tagen erst waren drei von ihnen auf einem Abfallkahn aufgefunden worden. Doch etwas am vorliegenden Fall verunsicherte ihn, das über die Gegenwart seiner neuen Partnerin hinausging.
Inspektor Rainey stiefelte auf die Straße und blieb unangenehm nahe neben ihm stehen. »Es ging ganz speziell darum, einen Magier zu töten, nicht wahr?«, flüsterte sie ihm zu. Damit traf sie genau den Punkt, der ihn beunruhigte. Sein Instinkt verriet ihm, dass die Person des Opfers für den Mörder eine geringere Rolle spielte als die Tatsache, was für eine Art von Opfer es war.
Es gab längst nicht genug greifbare Hinweise, um dieses Gefühl zu stützen, abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass die Kleider entfernt worden waren. Doch dafür konnte es eine Vielzahl von Gründen geben.
»Vermutlich.« Er wandte sich an die Konstabler, die immer noch Wache hielten. »Einer von Ihnen kehrt zur Wache zurück und fordert den Leichenwagen an. Ihr anderen sorgt dafür, dass niemand die Gasse betritt, bevor er eintrifft.« Die Streifenbeamten tauschten kurze Blicke untereinander, mit denen sie – der unausgesprochenen Rangfolge von Dienstgrad, Größe und Dienstzeit folgend – denjenigen bestimmten, der zur Wache zurücklaufen musste.
»Wir warten dort drüben in der Teestube«, erklärte Welling den verbliebenen Konstablern. »Holt uns, wenn der Wagen hier ist.« Damit lief er über die Straße auf Madame Rosemonts Teekesselchen zu.
Inspektor Rainey ging wieder dicht neben ihm. »Warum besuchen wir die Teestube?«
»Zwei Gründe«, erklärte er, obwohl es ihm lieber gewesen wäre, wenn er das nicht hätte tun müssen. Dennoch hatte Inspektor Rainey sich bis jetzt als angemessen befähigt erwiesen, sogar als angenehm wissbegierig bei Gelegenheiten, zu denen es angebracht war. Das war gewiss eine Verbesserung gegenüber Inspektor Kellman, der bei jedem Fall, der auf seinen Schreibtisch kam, nur an einer schnellen Lösung interessiert war und jede Art von Komplikation hasste, oder gegenüber Inspektor Mirrell, der sich selten von Fakten beeinflussen ließ, wenn sie nicht zu vorangegangenen Annahmen passten. »Der erste lautet, dass ich im wortwörtlichen Sinne Abstand vom Tatort gewinnen möchte, damit wir von dort aus mit einer gewissen Unauffälligkeit das Umfeld observieren können.«
»Und der zweite?« Sie fragte nach dem Offensichtlichen, doch damit stand sie immer noch drei Stufen über all den Stümpern, die gar nichts hinterfragten.
»Ich brauche etwas zu essen.«
Madame Rosemonts – ein beengter Verschlag aus Holz und Metall, behelfsmäßig zurechtgezimmert und zwischen zwei ziegelroten Mietskasernen eingekeilt – bediente beide Gründe, wenn auch den zweiten nur notdürftig. Minox empfand die Speisen als bestenfalls erträglich, doch das musste hinter den Erfordernissen des ersten Grundes zurückstehen. Minox nahm an einem Metalltisch Platz, der aus dem Inneren des Teehauses hinaus auf den Bürgersteig ragte. Inspektor Rainey wirkte wenig begeistert von seiner Wahl und setzte sich auf den Stuhl gegenüber.
»Wonach genau halten wir Ausschau?«
»Wir warten einfach ab, ob wir nicht aus einer menschlichen Eigenart einen Vorteil ziehen können«, erklärte Minox. »Wer immer dieses Verbrechen begangen hat, dürfte in hohem Maß eine emotionale Beteiligung daran verspüren, meinen Sie nicht?«
»An einem Ritualmord, bei dem das Herz des Opfers entfernt wurde? Glauben Sie wirklich?« Das klang wie ein Scherz, und tatsächlich ließ ihr Blick eine gewisse Verwirrung erkennen.
Minox verstand nicht recht, was daran lustig sein sollte. Aber so erging es ihm oft.
Anscheinend konnte sie ihm vom Gesicht ablesen, wie irritiert er war, denn sogleich wurde sie ernst. »Entschuldigung. Ja, ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Sie glauben, dass der Täter zurückkehrt?«
»Ich glaube, dass sich vorhin nur der sensationsgierige Pöbel den Hals verrenkt hat, obwohl der Mörder durchaus darunter gewesen sein könnte. Sollte ich allerdings mit meinem Verdacht richtigliegen, dann hängt nun, nachdem wir der Leiche offiziell Aufmerksamkeit geschenkt haben – nachdem die Inspektoren sie inspiziert haben, wenn man so will –, der passende Köder an der Leine.«
»Sie meinen das wie beim Angeln, ja?«
»Ja, angeln«, antwortete Minox. Fisch war ein guter Gedanke, auch wenn er sich daran erinnerte, dass es bei Madame Rosemont selten welchen gab. Was merkwürdig war, wo der Fluss doch kaum zwei Häuserblocks entfernt lag … Nun, nicht weiter wichtig. Ein junger Mann trat an ihren Tisch – der Neffe der namensgebenden Madame Rosemont, die unverheiratet war, sofern Minox sich recht entsann.
»Was darf ich Ihnen beiden bringen?«
»Tee und Cresh-Röllchen«, antwortete Minox.
»Dasselbe«, trug Inspektor Rainey dem jungen Mann auf. Belustigt schüttelte sie den Kopf, als er davonging. »Ich habe ewig keine Cresh-Röllchen mehr gegessen.«
»Seitdem Sie in diesem Viertel gelebt haben?« Sie hatte es nicht ausdrücklich erwähnt, doch ihre Kenntnis von der Gasse und die Blicke, mit denen sie die Einzelheiten in der Umgebung musterte – Blicke, die deutlich machten, dass diese Orte eine tiefe Bedeutung für sie hatten –, verrieten sie.
»Vor Ihnen kann man wohl keine Geheimnisse bewahren, was?«
»Ich bin mir sicher, dass einige Leute das durchaus erfolgreich bewerkstelligen«, erwiderte er. »Sie verwahren sie einfach so geschickt, dass ich gar nicht darauf aufmerksam werde.«
»Sie haben übers Angeln geredet.«
»Das habe ich. Der Tatort verriet Hingabe und eine peinlich genaue Sorgfalt, doch da war noch eine andere Eigenschaft, die mindestens ebenso auffällig war.«
Inspektor Rainey nickte. »Kühnheit.«
Das war genau der passende Ausdruck. Sie konnte wirklich stolz auf sich sein, so fähig, wie sie war. »Aus irgendeinem Grund entschied sich unser Mörder zu einer Tat, die kühn, regelrecht tollkühn war.«
»Aufwendige Vorbereitung, kein einfacher Fluchtweg.«
»Ich möchte den Grund dafür darin vermuten, dass der Täter beweisen wollte, wozu er imstande ist.«
»Nur sich selbst beweisen? Oder glauben Sie, dass er den Konstablern eine Botschaft übermitteln wollte?«
»Möglicherweise. Meiner Theorie nach wollte der Mörder uns verblüffen. Und es ergibt keinen Sinn, so einen Aufwand zu betreiben, ohne dass man das Ergebnis mit ansehen kann.«
»Nun, er hat es jetzt gesehen.«
»Aus der Ferne! Ich würde annehmen, dass eine solche Person, nachdem sie die Inspektoren beeindrucken konnte, den nächsten logischen Schritt gehen will.«
»Die Untersuchung ganz genau zu verfolgen, um zu sehen, wie beeindruckt wir sind.«
Minox wurde ganz unruhig. Seine früheren Partner hätten mit dieser Unterhaltung nicht Schritt gehalten, es hätte sie nicht einmal interessiert. Inspektorin Satrine Rainey besaß einen einzigartigen Verstand. Minox schob den Gedanken sofort beiseite – jede Person besaß einen einzigartigen Verstand. Ihrer jedoch verriet eine außerordentliche Klarheit und Persönlichkeit. »Ja, genau. Und welcher Zeitpunkt wäre besser dafür geeignet als dieser, nachdem die Menge sich zerstreut hat, um ein beiläufiges Interesse an der Angelegenheit zu zeigen?«
»Wer auch immer auf die Streifenbeamten zutritt, ist der Mörder?« Ihre Stimme verriet die gebotenen Zweifel.
»Natürlich nicht«, sagte Minox. »Betrachtet man die Sorgfalt, die auf den Mord selbst verwendet wurde, wäre so ein Vorgehen viel zu nachlässig. Ich denke, dass unser Mörder zu schlau dafür ist.«
»Sie wollen also beiläufig beobachten, ob sich jemand auf dem Platz herumtreibt, der beiläufig beobachtet?«
Der Tee und die Cresh-Röllchen wurden aufgetragen, sodass keine Gelegenheit für eine angemessene Antwort blieb. Er hatte Hunger, seit er den Nagel berührt hatte, daher verzehrte er sein Essen so schnell, wie es in Gesellschaft gerade noch höflich war. Er war an Hunger gewöhnt, ein nagendes Bedürfnis, das mit seinen magischen Fähigkeiten einherging, aber dieser plötzlich einsetzende Appetit war eine neue Erfahrung.
Die Cresh-Röllchen – Schweinebratwurst und Kartoffeln, in einen Fladen aus Buchweizenmehl gewickelt – waren hinreichend sättigend. Rainey aß ihre Röllchen in aller Ruhe.
Sie legte das erste auf ihrem Teller ab und nippte am Tee. »Sie haben meine Frage nicht beantwortet.«
»Sie haben mir heute Morgen einige Fragen gestellt. Meinen Sie Ihre letzte?«
»Ganz und gar nicht. Wenn es nicht darum geht, dass Sie ein Magier sind, warum nennen die anderen Inspektoren Sie dann ›Omen‹?«
Minox biss die Zähne zusammen. Es war unvermeidlich. Er hatte deutlich gemacht, dass sein Status als Magier ohne Zirkel nicht zur Debatte stand, also konzentrierte sie sich auf die andere ungemütliche Frage. Auf diese verdiente sie allerdings eine Antwort.
»Ich bin seit acht Monaten im Rang eines Inspektors dritter Klasse. In dieser Zeit sind Sie mein fünfter Partner.«
»Fünf?« Sie kaute hingebungsvoll an ihrem Cresh-Röllchen, als ob ihr das dabei helfen konnte, die Information zu verstehen. »Ich nehme an, die vier anderen wurden nicht durch Beförderung von ihrem Platz berufen?«
»Da vermuten Sie richtig.« Minox hielt einen Moment inne, um Kraft zum Weitersprechen zu finden. »Der erste starb während einer Untersuchung. Nicht in Ausübung seiner dienstlichen Pflichten getötet, sondern zufällig von einer durchgehenden Pferdekutsche überrollt. Niemand schenkte diesem Unfall Beachtung, bis mein zweiter Partner – des morgens, nachdem der erste Schnee gefallen war – auf Glatteis ausrutschte und sich das Genick brach.«
»Während des Dienstes?«
»Bei einem Gefangenentransport. Wie auch immer, zwei Fälle reichen für viele schon, um ein Muster daraus zu formen. Meinem nächsten Partner erzählten die Kollegen während des Mittagessens, er solle achtgeben, weil ich ein ›schlechtes Omen‹ sei. Er lachte darüber und erstickte an seinem Essen.«
Inspektor Rainey riss die Augen auf, und ihr Gesicht zuckte in einer Weise, als wollte sie entweder gleich in Gelächter oder in Tränen ausbrechen.
»Und von da an blieb der Name hängen.«
»Allerdings. Mein letzter Partner war Inspektor Kellman, der ganz offensichtlich keinen tödlichen Unfall hatte.«
»Aber einen fast tödlichen?«
»Wir nahmen gerade eine Gruppe Schmuggler fest, als wir in einen Hinterhalt gerieten. Wir waren übel in der Unterzahl, und da … griff ich auf Magie zurück.«
»Sie sagten, Sie hätten keine Ausbildung.« Inspektor Rainey stellte es ganz nüchtern fest, ohne jeden Anflug von Vorwurf oder Erstaunen.
Minox senkte die Stimme und blickte sich unwillkürlich um, um zu prüfen, ob jemand zuhörte. Auf der Wache war es kein Geheimnis, dass er ein Magier war, aber niemand sprach offiziell darüber, und es war gewiss nichts, was er selbst öffentlich zur Sprache brachte. »Ich gebrauche meine Magie rein instinktiv. Grob. Im vorliegenden Fall entließ ich einen ungezielten Kraftstoß, der jeden im Raum niederstreckte.«
»Einschließlich Kellman.«
»… der kurz nach diesem Vorfall einen anderen Partner verlangte.« Magie beunruhigte die meisten Leute, Minox’ eingeschlossen. Er hatte schon eine Menge gehört, das gegen Magier vorgebracht wurde – wie beispielsweise die klassische Theorie von der ›verdeckten Waffe‹ –, und er hatte sogar selbst so argumentiert. Inspektor Kellmans Vorbehalte kamen nicht unerwartet. Fünf Jahre zuvor, als junger Beamter bei der Reiterstaffel, wäre Minox von dem Mann, der er heute war, genauso beunruhigt gewesen.
Inspektor Rainey saß still da und trank gemächlich ihren Tee. Zum ersten Mal war ihre Miene nicht zu deuten. Schließlich sagte sie: »Wie viel Bedeutung misst der Hauptmann dieser Sache bei?«
»Er hat mich nie bei meinem Spitznamen genannt, jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Doch er kann kaum ignorieren, wie meine bisherigen Partnerschaften verliefen. Und sein Auftreten wirkte schon sonderbar schadenfroh, als er uns bekannt machte.«
Inspektor Rainey lächelte schief. Der Ausdruck kam Minox nur allzu vertraut vor – es war die Art, wie seine Mutter oder seine Schwestern ihm oft begegneten. Eine Mischung von herzlicher Zuneigung und milder, neckischer Herablassung. »Eine Verehrerin haben Sie allerdings auf dem Geschoss der Inspektoren. Ich glaube, Fräulein Pyle ist vernarrt in Sie.«
Deswegen also. Es war eine naheliegende Schlussfolgerung nach der Begegnung, die sie miterlebt hatte. So viel musste Minox Inspektor Rainey zugestehen. Aber die wichtigste Information fehlte ihr.
»Nyla mag mich, was durchaus angemessen ist«, sagte er. »Immerhin ist sie meine Base.«
»Oh!« Rainey errötete. Ein Anflug von Verlegenheit. »Natürlich. Ich weiß nur zu gut Bescheid über Konstabler-Familien.« Sie biss sich kurz auf die Unterlippe. »Wie viele Mitglieder Ihrer Familie tragen Grün und Rot?«
»Ein erheblicher Teil«, erwiderte Minox. »In der Wache von Inemar sind es allerdings nur Nyla und meine Schwester Corrie, die im Nachtdienst tätig ist.« Er hatte keine Lust, seine Familiengeschichte weiter auszubreiten. Das war im Augenblick nicht von Belang.
»Die übrigen sind … über die ganze Stadt verteilt?« Ein Anflug von Schweiß trat auf ihre Stirn. Was für ein Geheimnis sie vor dem Hauptmann bewahrte, die Möglichkeit, seine Familie könne in anderen Vierteln stationiert sein, bereitete ihr Sorgen. Warum sollte es? Es sei denn, sie wollte nicht, dass ihre Anstellung als Inspektor in anderen Teilen der Stadt bekannt wurde.
Auf der anderen Seite des Flusses, beispielsweise, wo ihr Mann Inspektor gewesen war. Es gab eine einfache Möglichkeit, diese Theorie zu testen.
»Die meisten in Keller Cove oder in Ost-Maradaine. Alle im Süden.«
Sie entspannte sich sichtlich. Darum ging es also.
Es gab keinen Grund, weiter zu bohren, jedenfalls nicht im Augenblick. Sie hatte sich als intelligent und fähig erwiesen. Wenn Hauptmann Cinellan darauf bestand, dass er einen Partner brauchte, dann war sie die bei Weitem erträglichste Alternative, die er bisher gehabt hatte.
Inspektor Rainey aß ihre Cresh-Röllchen auf. »Die Schweinswurst ist zu fettig.«
»Das ist sie meistens«, stimmte Minox zu und nahm ihre Bemerkung als Hinweis, das Thema zu wechseln. »Ich habe mehrere Personen ausgemacht, die auf dem Platz herumlungern, aber keiner von ihnen hat mehr als ein flüchtiges Interesse an der Gasse gezeigt.«
»Gibt es jemanden, den Sie genauer in Augenschein nehmen wollen?«
»Möglicherweise«, sagte Minox. »Aber erst einmal, wenn Sie die Direktheit entschuldigen mögen, muss ich austreten.«
Rainey ließ ihn gehen, mit einem Wink und den Worten: »Ich bin überrascht, dass es in dieser Gegend richtige Wasserklosetts gibt.« Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, da veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, als wäre ihr plötzlich ein Einfall gekommen. Sie sprang auf und rannte über die Straße hinweg zurück zur Gasse.
Minox blieb keine Wahl, als ihr zu folgen und seine natürlichen Bedürfnisse erst einmal zurückzustellen. Er ließ ein paar Münzen auf den Tisch fallen und ging hinterher.
»Worum geht es?«, rief er ihr nach, als sie zwischen den beiden Konstablern hindurchlief, über den Körper des Opfers sprang und zur Rückseite der Gasse rannte. Erst als sie dort vor der Mauer stand, drehte sie sich wieder um und nahm seine Gegenwart zur Kenntnis.
»Vor Jahren führte diese Gasse zu ein paar Plumpsklos. Damals gab’s hier noch keine Wasserklosetts.«
»Gut.« Minox nickte.
»Die Klohäuschen sind also fort.« Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Boden, der mit Unrat und Abfall bedeckt wurde, vermutlich aus den Fenstern geworfen. Sie schabte mit dem Fuß herum und legte ein Eisengitter im Pflaster frei. »Der Zugang zu den Abwasserkanälen ist noch da.«
»Wollen Sie andeuten, dass der Mörder durch den Abwasserkanal gekommen ist, oder auf diesem Weg entkommen?«
»Eins davon. Beides.« Sie hob das Gitter an, das sich leicht aus dem Boden lösen ließ. So leicht, dass es ihrer Theorie Glaubwürdigkeit verlieh. Rainey legte das Gitter ab, beschattete ihre Augen und spähte ins Loch. »Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten diese Möglichkeit einfach berücksichtigen.«
Ein berechtigter Gedanke, wie Minox zugeben musste. Tatsächlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn sie den Müll darüber nicht so nachlässig zur Seite geschoben hätte. Eine genauere Untersuchung hätte womöglich enthüllt, ob er absichtlich dort platziert worden war, um den Zugang des Mörders zu verbergen. »Das hilft uns im Augenblick nicht, den Fall zu lösen, aber es ist gewiss ein wichtiger Hinweis.« Ihm wurde bewusst, dass diese Worte herablassender klangen, als beabsichtigt. »Sehr scharfsinnig von Ihnen.«
»Wie weit runter geht das?«
Er bückte sich und spähte in die Dunkelheit. »Zehn Fuß vielleicht. Obwohl ich gehört habe, dass es da unten ein Tunnelsystem über dem nächsten gibt, vor allem in diesem Stadtteil.« Möglicherweise lag es daran, dass dieser Abschnitt der Kanalisation nicht mehr genutzt wurde, aber der Geruch war nicht annähernd so übel wie befürchtet.
»Ich habe ein paar Geschichten darüber gehört.« Sie richtete sich wieder auf.
»Und mehr ist vielleicht auch nicht dran«, räumte Minox ein.
»Was denken Sie?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gern etwas ausprobieren. Wären Sie dazu bereit?«
Sie traten hinaus auf die Straße.





























