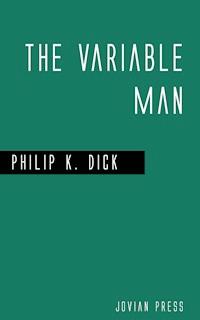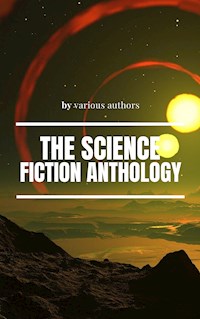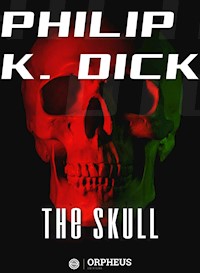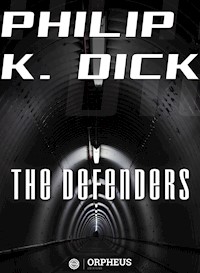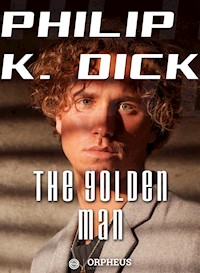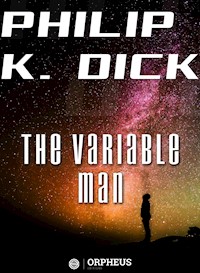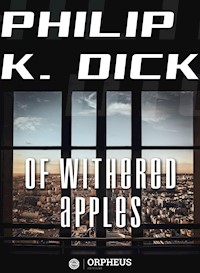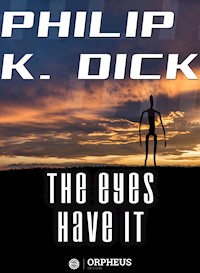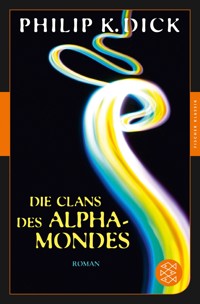
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Fischer Klassik
- Sprache: Deutsch
Nachschub für alle Fans des Science-Fiction-Meisters Philip K. Dick: Die Neuauflage des lange vergriffenen »Die Clans des Alpha-Mondes« ist da! Fünfundzwanzig Jahre ist der interstellare Krieg vorbei. Auf dem Mond eines Alpha-Planeten versucht Gabriel Baines das scheinbar Unmögliche: Die Siedler - nach irdischen Maßstäben alles Psychopathen - sollen sich vereinen, um einer erneuten Zwangstherapie auf der Erde zu entgehen und unabhängig zu bleiben. Wird Beines es schaffen, die rivalisierenden Clans zu einer Einheit formieren und so alle vor der terranischen Expedition zu schützen? »Eine hervorragende Studie der Paranoia einer geschlossenen Gesellschaft« Lexikon der utopisch-phantastischen Literatur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Philip K. Dick
Die Clans des Alpha-Mondes
Roman
Roman
Über dieses Buch
Fünfundzwanzig Jahre ist der interstellare Krieg her. Auf dem Mond eines Alpha-Planeten versucht Gabriel Baines das scheinbar Unmögliche: Die Siedler - nach irdischen Maßstäben alle Psychopathen - sollen sich vereinen, um einer erneuten Zwangstherapie auf der Erde zu entgehen und unabhängig zu bleiben. Wird Baines es schaffen, die rivalisierenden Clans zu einer Einheit zu formieren und so alle vor der terranischen Expedition zu schützen?
»Eine hervorragende Studie der Paranoia einer geschlossenen Gesellschaft.«
Lexikon der utopisch-phantastischen Literatur
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philip K. Dick hat die Science Fiction nicht erfunden, aber aus ihr eine Kunst gemacht. Mit prophetischem Blick und genialischer Phantasie sah er Szenarien voraus, in denen unsere Gegenwart zum Albtraum wird: »Blade Runner«, »Minority Report«, »Total Recall«, »Impostor«, »Paycheck«, »Der dunkle Schirm« – all diese Filme basieren auf seinen Büchern. 1928 in Chicago geboren, rettete er sich aus seiner psychotischen Jugend nach Berkeley. Er nahm so ziemlich alle Aufputschmittel und Drogen, die es gab, hatte Visionen und göttliche Erscheinungen, schrieb bis zu 60 Seiten am Tag und fühlte sich von FBI und KGB verfolgt. 1982 starb er wenige Wochen vor der Filmpremiere von »Blade Runner«.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
1
Bevor er den Sitzungssaal des Hohen Rates betrat, schickte Gabriel Baines sein von den Manis hergestelltes Simulacrum voraus, um festzustellen, ob es angegriffen wurde. Das Simulacrum – man hatte es so sorgfältig konstruiert, dass es Baines in jeder Einzelheit glich – konnte zwar, da der erfindungsreiche Mani-Clan es hergestellt hatte, auch viele andere Dinge tun, doch Baines setzte es nur bei Manövern ein, die der Verteidigung dienten. Die Erhaltung des eigenen Lebens und seine Zugehörigkeit zur im Norden des Mondes gelegenen Para-Enklave Adolfville waren das Wichtigste für ihn.
Natürlich war Baines auch oft außerhalb Adolfvilles gewesen, doch sicher – beziehungsweise relativ sicher – fühlte er sich nur hier, hinter den festen Stadtmauern seiner Heimat, der Para-Stadt. Was bewies, dass seine Zugehörigkeit zum Para-Clan nicht gestellt oder nur ein Lippenbekenntnis war, mit dem er sich Zutritt zum solidesten, stabilsten und urbansten Gemeinwesen überhaupt verschafft hatte. Baines meinte es zweifellos ernst … und er glaubte auch nicht, dass ihn irgendjemand als Person anzweifelte.
Da war zum Beispiel sein Besuch in den unglaublich elenden Hütten der Hebs gewesen. Er hatte kürzlich nach entflohenen Angehörigen einer Arbeitsbrigade gesucht. Da es sich bei ihnen um Hebs gehandelt hatte, hatten sie sich vermutlich nach Ghanditown durchgeschlagen. Das Problem jedoch bestand – zumindest für ihn – darin, dass die Hebs alle gleich aussahen: Wie schmutzige, vornübergebeugte Geschöpfe mit besudelten Kleidern, die ständig kicherten und sich nicht auf komplizierte Verfahren konzentrieren konnten. Man konnte sie nur für einfache handwerkliche Tätigkeiten einsetzen, das war alles. Doch da die Befestigungen Adolfvilles wegen der Mani-Raubzüge ständig erneuert werden mussten, musste man handwerkliche Tätigkeiten gegenwärtig ziemlich teuer bezahlen. Und kein Para wollte sich die Hände schmutzig machen. Jedenfalls hatte Gabriel Baines zwischen den verfallenen Hütten und dürftigen, von Menschenhand erschaffenen Gebilden der Hebs das reine Entsetzen und das Gefühl einer sich nahezu endlos ausbreitenden Bloßstellung empfunden. Die Siedlung war eine bewohnte Müllkippe aus Pappdeckelbehausungen. Die Hebs hatten allerdings nichts dagegen einzuwenden. Sie lebten in friedlichem Gleichgewicht inmitten ihres eigenen Mülls.
Heute, bei der halbjährlich stattfindenden Ratssitzung, würden die Hebs natürlich einen Sprecher schicken. Wenn er, Baines, für die Paras sprach, würde er sich im wahrsten Wortsinne mit einem ekelhaften Heb im gleichen Raum sitzend wiederfinden. Derartiges verlieh seiner Aufgabe wenig Würde. Vielleicht war es in diesem Jahr wieder die dicke Sarah Apostoles, die Frau mit dem widerborstigen Haar.
Doch der Mani-Vertreter war noch bedrohlicher. Weil die Manis ihn, wie jeden Para, entsetzten. Ihre gnadenlose Brutalität schockierte ihn; er konnte sie nicht verstehen, weil sie so ziellos waren. Baines hatte die Manis jahrelang einfach als gefährlich eingestuft – doch das erklärte sie noch nicht. Sie genossen die Gewalt; sie empfanden perverse Freude beim Zerstören von Dingen und beim Einschüchtern anderer, besonders, wenn es sich um Paras wie ihn handelte.
Doch auch sein Wissen um diese Dinge half ihm nicht gänzlich. Er verspürte aufgrund der vorprogrammierten Konfrontation mit dem Mani-Delegierten Howard Straw trotzdem ein ungutes Gefühl.
Baines’ Simulacrum kehrte mit einem asthmatischen Winseln zurück. Auf dem Gesicht der künstlichen, ihm ähnlich sehenden Miene lag ein starres Lächeln. »Alles in Ordnung, Sir. Kein tödliches Gas, keine elektrischen Entladungen gefährlichen Grades, kein Gift im Wasserspender, keine Schießscharten für Laserflinten, keine verborgenen Höllenmaschinen. Ich würde meinen, Sie können sicher eintreten.« Das Simulacrum blieb klackend stehen und verfiel in Schweigen.
»Ist dir niemand begegnet?«, fragte Baines misstrauisch.
»Es ist noch keiner da«, sagte das Simulacrum. »Abgesehen natürlich von dem Heb, der den Saal reinigt.«
Baines, sein Leben lang an Vorsichtsmaßnahmen gewöhnt, öffnete die Tür nur so weit, wie es der Sicherheit dienlich war, und erhaschte einen kurzen Blick auf den Heb.
Der Heb – ein Mann – schrubbte den Boden auf die für seine Klasse typisch langsame, monotone Weise. Außerdem zeigte sein Gesicht den typisch blöden Heb-Ausdruck, als würde seine Tätigkeit ihn erheitern. Möglicherweise konnte er diesen Gesichtsausdruck monatelang aufrechterhalten, ohne sich zu langweilen. Hebs wurden ihrer Aufgaben schon deswegen nicht überdrüssig, weil sie sich nicht mal die Vorstellung einer Ablenkung vorstellen konnten. Natürlich, dachte Baines, hat auch die Einfalt ihren Wert. Ignatz Ledebur, der berühmte Heb-Frömmler, dessen Seele Glanz verbreitete, wenn er von Ort zu Ort wanderte, um die Wärme seiner harmlosen Persönlichkeit zu verbreiten, hatte ihn zum Beispiel beeindruckt. Und der hier sah auch nicht gerade gefährlich aus …
Immerhin unternahmen die Hebs – nicht einmal die Tugendhaftesten von ihnen – nie den Versuch, einen zu ihrem Glauben zu bekehren, wie etwa die Schizo-Mystiker. Die Hebs wollten ausnahmslos nur in Ruhe gelassen werden; sie wollten sich einfach nicht vom Dasein beuteln lassen, deswegen entsagten sie den Verwicklungen des Lebens von Jahr zu Jahr mehr. Sie kehrten wohl, stellte Baines sich vor, in die pure Dummheit zurück, die für einen Heb der Idealzustand war.
Baines überprüfte seine Laserpistole – sie war in Ordnung – und fasste den Entschluss, einzutreten. Also ging er Schritt für Schritt in den Sitzungssaal des Hohen Rates hinein, nahm sich einen Stuhl und wechselte dann abrupt zu einem anderen. Der Erste war zu nah am Fenster gewesen: Dort bot er für jeden, der sich draußen aufhielt, ein zu gutes Ziel.
Um seine Stimmung ein wenig zu heben, während er auf die Ankunft der anderen wartete, entschloss er sich, den Heb auf den Arm zu nehmen. »Wie heißen Sie?«, fragte er.
»J-Jacob Simion«, sagte der Heb. Er schrubbte, ohne sein dämliches Standardgrinsen zu verändern, weiter den Boden. Hebs merkten es nie, wenn man sie aufzog. Und wenn doch, machte es ihnen nichts aus. Sie waren allem gegenüber apathisch eingestellt; so war ihre ganze Art. »Gefällt Ihnen die Arbeit, Jacob?«, fragte Baines und steckte sich eine Zigarette an.
»Klar doch«, sagte der Heb. Dann kicherte er.
»Haben Sie schon immer Böden geschrubbt?«
»Häh?« Der Heb war offenbar nicht in der Lage, die Frage zu verstehen.
Die Tür öffnete sich, und die schwerfällige, hübsche Annette Golding, die Poly-Delegierte, erschien mit einem Täschchen unter dem Arm. Ihr rundes Gesicht war gerötet, und ihre grünen Augen leuchteten, als sie nach Luft schnappte. »Ich dachte schon, ich hätte mich verspätet.«
»Nein«, sagte Baines. Er stand auf, um ihr einen Stuhl anzubieten, und musterte sie mit professionellem Blick. Nichts deutete an, dass sie ihre Waffe mitgebracht hatte. Aber sie konnte eingekapselte wilde Sporen in den Backentaschen versteckt haben. Er dachte sofort darüber nach, als er wieder Platz nahm – und diesmal einen Stuhl am hinteren Tischende wählte. Entfernung … ein nicht zu unterschätzender Faktor.
»Wie warm es hier ist«, sagte Annette, immer noch schwitzend. »Ich bin alle Treppen hochgerannt.« Sie lächelte ihn auf die unkünstliche Weise an, die manche Polys auszeichnete. Sie wirkte anziehend auf ihn. Hätte sie doch nur ein bisschen abnehmen können. Aber Annette gefiel Baines auch so, deswegen nutzte er die Gelegenheit, sie ein bisschen zu necken, wobei durchaus erotische Untertöne mitklangen.
»Annette«, sagte er, »du bist ein sehr erfreulicher und angenehmer Anblick. Es ist eine Schande, dass du nicht heiratest. Wenn du mich heiraten würdest …«
»Ja, Gabe«, sagte Annette lächelnd, »dann hätte ich einen Beschützer. – Lackmuspapier in jeder Zimmerecke; Atmosphären-Analysatoren, die ständig vor sich hinblubbern; eine Erdungsausrüstung, für den Fall, dass irgendwelche Strahlen …«
»Bleib ernst«, unterbrach Baines sie. Er fragte sich, wie alt sie war; bestimmt nicht älter als zwanzig. Und wie alle Polys war sie kindlich. Die Polys wurden nicht erwachsen; sie blieben wankelmütig. Bestand Polyismus aus nichts anderem als den Nachwehen einer ziellosen Kindheit? Schließlich wurden auch die Kinder der anderen Mond-Clans als Polys geboren. Sie gingen als Polys in die zentrale Gemeinschaftsschule und änderten sich erst im zehnten oder elften Lebensjahr. Doch manche, wie Annette, änderten sich nie.
Annette öffnete die Handtasche und entnahm ihr ein Tütchen mit Süßigkeiten. Sie fing rasch an zu essen. »Ich fühle mich nervös«, erklärte sie. »Deswegen muss ich essen.« Sie hielt Baines das Tütchen hin, doch er lehnte ab – man konnte schließlich nie wissen. Er hatte sein Leben jetzt seit fünfunddreißig Jahren bewahrt, und er hatte nicht vor, es wegen eines trivialen Impulses zu verlieren. Wenn man vorhatte, noch einmal fünfunddreißig Jahre zu leben, musste man alles einkalkulieren und im Voraus bedenken.
»Ich nehme an, Louis Manfreti wird den Schizo-Clan in diesem Jahr wieder vertreten«, sagte Annette. »Ich höre ihm immer gern zu. Er erzählt immer so interessante Sachen. Die Visionen, die er von urzeitlichen Dingen hat … Von irdischen und himmlischen Bestien, von Ungeheuern, die sich unterirdische Schlachten liefern …« Sie lutschte nachdenklich auf einem Bonbon herum. »Glaubst du, dass die Visionen, die die Schizos haben, echt sind, Gabe?«
»Nein«, sagte Baines wahrheitsgemäß.
»Warum grübeln und reden sie dann die ganze Zeit darüber? Also müssen sie für sie doch irgendwie real sein.«
»Mystizismus«, sagte Baines verächtlich. Dann zog er die Nase hoch; irgendein unnatürlicher Geruch drang auf ihn ein, irgendetwas Süßes. Er erkannte, dass es der Duft von Annettes Haar war, und er entspannte sich. Oder soll der Duft mich gerade dies denken lassen?, fragte er sich plötzlich und versteifte sich. »Du hast ein hübsches Parfüm«, sagte er listig. »Wie heißt es?«
»Wilde Nacht«, sagte Annette. »Ich habe es von einem Hausierer von Alpha II gekauft. Es hat mich neunzig Lappen gekostet, aber es riecht herrlich, findest du nicht auch? Ein ganzes Monatsgehalt.« Ihre dunklen Augen blickten traurig drein.
»Heirate mich«, fing Baines erneut an, dann brach er ab.
Der Dep-Vertreter war aufgetaucht. Er stand im Eingang, und sein furchtgeplagtes, konkaves Gesicht mit den starrenden Augen schien Baines bis in die Tiefen seines Herzens zu durchdringen. Guter Gott. Baines ächzte, ohne zu wissen, ob er dem armen Dep gegenüber Mitleid oder reine Verachtung empfinden sollte. Schließlich konnte der Mann sich doch zusammennehmen. Alle Deps konnten sich zusammennehmen – vorausgesetzt, sie hatten den Mut dazu. Doch die Dep-Siedlung im Süden zeigte nicht die geringste Courage. Der Dep an der Tür bewies augenfällig, dass es auch ihm an Mut mangelte. Er blieb zögernd im Eingang stehen, weil er Angst hatte einzutreten, aber dennoch war er seinem Schicksal so ergeben, dass er es in Kürze trotzdem tun würde. Er würde exakt das tun, was er am meisten fürchtete … Ein Ob-Kom würde an seiner Stelle einfach in Zweierreihen bis zwanzig zählen, sich umdrehen und flüchten.
»Kommen Sie doch rein, bitte«, redete Annette ihm liebenswürdig zu und deutete auf einen Stuhl.
»Was hat das Gespräch schon für einen Sinn?«, sagte der Dep und trat langsam, vor Hoffnungslosigkeit die Schultern hängen lassend, ein. »Wir nehmen uns doch nur gegenseitig auseinander. Ich sehe gar keinen Sinn darin, diese Spektakel einzuberufen.« Dennoch nahm er ergeben Platz und blieb mit gesenktem Kopf und sinnlos verschränkten Händen sitzen.
»Ich bin Annette Golding«, sagte Annette, »und das ist Gabriel Baines, der Para. Ich bin ein Poly. Du bist ein Dep, nicht wahr? Ich erkenne es daran, wie du auf den Boden starrst.« Sie lachte, aber mit Sympathie.
Der Dep sagte nichts; er nannte nicht einmal seinen Namen. Baines wusste, dass es den Deps schwerfiel, reden zu müssen. Es war schwierig für sie, die Energie aufzubringen. Der Dep war wahrscheinlich deswegen zu früh gekommen, weil er Angst hatte, er könne sich verspäten. Überkompensation, typisch für sie. Baines mochte die Deps nicht. Sie nützten weder sich selbst noch den anderen Clans etwas. Warum starben sie nicht? Und im Gegensatz zu den Hebs taugten sie nicht einmal etwas als Arbeiter. Sie lagen auf dem Boden und starrten, aller Hoffnung bar, blicklos in den Himmel.
Annette beugte sich zu Baines hinüber und sagte leise; »Muntere ihn auf.«
»Den Teufel werde ich«, sagte Baines. »Was geht mich das an? Es ist doch sein Fehler, dass er so ist. Er könnte sich ändern, wenn er wollte. Würde er sich anstrengen, könnte er an etwas Positives glauben. Sein Los ist nicht schlimmer als das, das wir anderen zu tragen haben, vielleicht sogar noch besser. Schließlich arbeiten Deps im Schneckentempo. Ich wäre froh, wenn ich so wenig Arbeit hätte wie ein durchschnittlicher Dep …«
Jetzt kam eine hochgewachsene Frau in den mittleren Jahren und einem langen grauen Mantel durch die Tür. Es war Ingrid Hibbler, die Ob-Kom. Stumm vor sich hin zählend, ging sie immer wieder um den Tisch herum und berührte sämtliche Stühle. Baines und Annette warteten. Der Heb, der den Boden schrubbte, schaute auf und kicherte. Der Dep starrte weiterhin fortwährend blicklos zu Boden. Endlich fand Miss Hibbler einen Stuhl, dessen Numerologie sie befriedigte; sie zog ihn zurück, nahm starr Platz und drückte die Hände eng gegeneinander. Ihre Finger arbeiteten mit hoher Geschwindigkeit, als stricke sie zu ihrem eigenen Schutz irgendein Kleidungsstück.
»Ich habe Straw auf dem Parkplatz getroffen«, sagte sie und zählte lautlos vor sich hin. »Unseren Mani. Puh, er ist eine schreckliche Person. Er hätte mich beinahe mit seinem Wagen überfahren. Ich musste …«
Sie brach ab. »Na, ist ja egal. Aber es ist schwer, sich von seiner Aura zu befreien, wenn sie einen einmal infiziert hat.« Sie schüttelte sich.
Ohne sich an irgendjemanden im besonderen zu wenden, sagte Annette: »Wenn Manfreti dieses Jahr wieder der Schizo ist, kommt er wahrscheinlich durchs Fenster statt durch die Tür.« Sie lachte fröhlich. »Und auf den Heb warten wir natürlich auch noch«, fügte sie hinzu.
»Ich bin der D-delegierte aus Gandhitown«, sagte der Heb Jacob Simion und bewegte auf monotone Weise seinen Schrubber. »Ich d-dachte nur, ich könnte was tun, solange ich w-warte.« Er lächelte die Anwesenden arglos an.
Baines seufzte. Der Vertreter der Heb war ein Putzmann. Aber natürlich – sie waren alle Putzmänner, und wenn nicht in Wirklichkeit, so doch potenziell. Dann fehlten also nur noch der Schizo und der Mani. Howard Straw würde aufkreuzen, sobald er damit fertig war, über den Parkplatz zu rasen, um die restlichen eintreffenden Delegierten zu erschrecken. Er soll es bloß nicht wagen, mich einzuschüchtern, dachte Baines. Seine Laserpistole war nämlich keine Simulation. Und außerdem wartete vor dem Saal immer noch das Simulacrum, das er nur zu rufen brauchte.
»Welches Ziel verfolgt die Sitzung diesmal?«, fragte Miss Hibbler, die Ob-Kom, und zählte rasch, die Augen geschlossen, mit tanzenden Fingern: »Eins, zwei; eins, zwei.«
»Ich habe ein Gerücht gehört«, sagte Annette. »Man hat ein fremdes Schiff gesichtet, das nicht den Händlern von Alpha IIgehört. Wir sind uns dessen ziemlich sicher.« Sie aß weiterhin ihre Bonbons. Baines sah mit grimmiger Erheiterung, dass sie inzwischen fast den ganzen Tüteninhalt verputzt hatte. Annette litt, wie er wusste, an einer doppelten Hirnstörung, einer Überfunktion der Sektion, die den Esstrieb steuerte. Wenn sie verkrampft oder beunruhigt war, wurde es schlimmer.
»Ein Schiff«, sagte der Dep und rührte sich. »Vielleicht kann es uns aus dieser verfahrenen Situation herausholen.«
»Aus welcher verfahrenen Situation?«, fragte Miss Hibbler.
Der Dep rührte sich und sagte: »Das wissen Sie doch.« Mehr brachte er nicht zusammen. Er wurde schweigsam und verfiel wieder in sein düsteres Koma. Für die Deps war grundsätzlich alles eine verfahrene Situation. Aber trotzdem fürchteten natürlich auch sie die Veränderung. Baines’ Verachtung nahm zu, als er darüber nachdachte. Aber … ein Schiff. Seine Verachtung für den Dep verwandelte sich in Alarmiertheit. Stimmte es tatsächlich?
Straw, der Mani, würde es wissen. Die Manis aus Da Vinci Heights verfügten über komplizierte technische Anlagen, mit denen sie den einkommenden Verkehr beobachten konnten. Möglicherweise war die ursprüngliche Meldung aus Da Vinci Heights gekommen … Es sei denn natürlich, ein Schizo-Mystiker hatte das Schiff während einer Vision gesehen.
»Wahrscheinlich ist es ein Trick«, sagte Baines laut.
Alle im Raum Anwesenden – einschließlich des finster blickenden Dep – sahen ihn an. Der Heb hörte sogar zeitweise auf, den Boden zu schrubben.
»Die Manis«, erklärte Baines, »versuchen doch alles. Es entspricht nun mal ihrem Charakter, sich Vorteile über uns andere zu verschaffen, um es uns heimzuzahlen.«
»Wofür?«, fragte Miss Hibbler.
»Sie wissen doch, dass die Manis uns hassen«, sagte Baines. »Weil sie primitive, barbarische Raufbolde sind; übelriechende Sturmtruppler, die sofort zur Waffe greifen, wenn sie das Wort ›Kultur‹ hören. Es steckt in ihrem Metabolismus; sie sind alte Rohlinge.« Aber dennoch war dies nicht die ganze Erklärung. Wenn er ganz ehrlich war, hatte er keine Ahnung, warum die Manis so darauf aus waren, die anderen zu jagen – es sei denn, so lautete seine Theorie, aus reiner Freude, anderen Schmerzen zuzufügen. Nein, dachte er, es muss mehr dahinterstecken. Bosheit und Neid; sie müssen uns hassen, weil wir ihnen kulturell überlegen sind. So mannigfaltig es in Da Vinci Heights auch zugeht, es gibt dort weder Ordnung noch ästhetische Einheit; alles ist eine Mixtur aus unvollkommenen, sogenannten »schöpferischen« Projekten, die zwar angefangen, aber nie beendet werden.
»Straw ist etwas bärbeißig«, sagte Annette langsam, »das gebe ich ja zu. Er gehört eben zur typisch rücksichtslosen Art. Aber warum sollte er ein fremdes Schiff melden, wenn niemand es gesehen hat? Dafür hast du noch keinen klaren Grund genannt.«
»Aber ich weiß«, sagte Baines halsstarrig, »dass die Manis, und besonders Howard Straw, gegen uns sind. Wir sollten gewisse Schritte unternehmen, um uns vor ihnen zu schützen …« Er hielt inne, weil die Tür aufging und Straw schroff den Raum betrat.
Er war rothaarig, groß und kräftig, und er grinste. Das Auftauchen eines fremden Schiffes auf ihrem winzigen Mond schien ihn nicht zu stören.
Jetzt fehlte nur noch der Schizo. Aber der würde wahrscheinlich, wie üblich, eine Stunde zu spät auftauchen. Bestimmt wanderte er in Trance irgendwo umher, verloren in den umwölkten Visionen einer archetypischen Wirklichkeit aus kosmischen Proto-Kräften, die unter dem zeitlichen Universum lagen, vertieft in den pausenlosen Anblick der sogenanten Urwelt.
Dann können wir es uns wohl bequem machen, entschied Baines. Und zwar so bequem wie möglich; jetzt, wo Straw bei uns ist. Und Miss Hibbler. Die beiden waren ihm mehr oder weniger egal. Genau genommen interessierte er sich für keinen der Delegierten, außer vielleicht für Annette und ihren übermäßigen, bemerkenswerten Busen. Aber mit ihr kam er auch nicht weiter. Wie üblich.
Aber es war nicht seine Schuld. Die Polys waren alle so – man wusste nie, welchen Weg sie einschlugen. Hatte man ein Ziel, nahmen sie die Gegenposition ein und stellten sich gegen das Diktat der Logik. Trotzdem waren sie nicht so rückwärtsgewandt wie die Schizos oder so hirnlose Automaten wie die Hebs. Sie waren überaus lebendig. Und das gefiel ihm an Annette so – ihre Quicklebendigkeit und Frische.
Wenn er sie sah, kam er sich wirklich starr und metallisch vor, wie vom dicken Stahl einer arachaischen Waffe aus einem sinnlosen, seit Unzeiten tobenden Krieg umhüllt. Annette war zwanzig, er war fünfunddreißig; vielleicht war das die Erklärung. Aber daran glaubte er nicht. Und dann dachte er: Ich wette, sie will, dass ich mich so fühle. Sie tut es absichtlich, damit ich mich schlecht fühle.
Seine Reaktion bestand darin, dass er urplötzlich den eisigen, sorgfältig abgemessenen Para-Hass für sie verspürte.
Annette, Gedankenlosigkeit simulierend, fuhr damit fort, die restlichen Bonbons aus ihrer Tüte zu verspeisen.
Omar Diamond, der Schizo-Delegierte der halbjährlichen Sitzung in Adolfville, blickte über die Landschaft der Welt und sah unter und über ihr die roten und weißen Zwillingsdrachen, den Tod und das Leben. Die Drachen, die sich im Kampf umklammerten, brachten die Ebene zum Erzittern. Über ihnen teilte sich der Himmel. Die verschrumpelte, sich allmählich auflösende graue Sonne warf – falls man es überhaupt so nennen konnte – nur wenig Behaglichkeit auf die Welt, die rasch ihre geringe Lebenskraft verlor.
»Halt«, sagte Omar, hob eine Hand und wandte sich den Drachen zu.
Ein Mann, der mit einem Mädchen mit welligem Haar über den Bürgersteig des Innenstadtdistrikts von Adolfville ging, blieb stehen. Das Mädchen sagte: »Was ist denn los mit ihm? Er macht irgendetwas.« Widerwille.
»Es ist nur ein Schizo«, sagte der Mann amüsiert, »der sich in seinen Visionen verloren hat.«
»Der ewige Krieg ist wieder ausgebrochen«, sagte Omar. »Die Mächte des Lebens sind im Abnehmen begriffen. Ist denn kein Mensch in der Lage, die fatale Entscheidung zu treffen, sein Leben in einem Opferakt aufzugeben, um sie wiederherzustellen?«
Der Mann zwinkerte seiner Frau zu und sagte: »Du weißt ja, manchmal kann man diesen Typen eine Frage stellen und kriegt eine interessante Antwort. Na los, frag ihn was – etwas Großes und Bedeutendes, so wie: ›Was ist der Sinn des Lebens?‹ Frag ihn bloß nicht so was Simples wie: ›Wo ist die Schere, die ich gestern verlegt habe?‹« Er drängte sich nach vorn.
Vorsichtig sprach die Frau Omar an. »Entschuldigen Sie, aber ich habe mich immer gefragt, ob es ein Leben nach dem Tode gibt.«
»Es gibt keinen Tod«, sagte Omar. Die Frage erstaunte ihn; sie basierte auf großem Unwissen. »Das, was Sie sehen und ›Tod‹ nennen, ist nur das Keimstadium, in dem die neue Lebensform schlummernd auf den Ruf wartet, die nächste Inkarnation anzunehmen.« Er hob die Arme und deutete hinaus. »Verstehen Sie? Der Drache des Lebens kann nicht erschlagen werden. Selbst wenn sein Blut rot über die Wiese rinnt – neue Versionen seines Ichs entstehen auf allen Seiten. Die in die Erde eingegrabene Saat erhebt sich erneut.« Dann ging er weiter und ließ den Mann und die Frau hinter sich.
Ich muss in das sechsstöckige Steingebäude gehen, sagte Omar sich. Dort wartet der Rat. Howard Straw, der Barbar. Miss Hibbler, die Griesgrämige, von Zahlen besessen. Annette Golding, die Verkörperung des Lebens an sich, die sich in alles hineinstürzt, das sie werden lässt. Gabriel Baines, der Mann, der unter dem Zwang leidet, sich Verteidigungsstrategien gegen etwas ausdenken zu müssen, das niemanden angreift. Der Einfältige mit dem Schrubber, der Gott näher ist als jeder von uns. Und der Traurige, der nie aufschaut, der Mann ohne Namen. Wie soll ich ihn nennen? Vielleicht Otto. Nein, ich glaube, ich nenne ihn Dino. Dino Watters. Er wartet auf den Tod, ohne zu wissen, dass er in Erwartung eines nicht existenten Phantoms lebt. Nicht einmal der Tod kann ihn vor seinem eigenen Ich beschützen.
Als er am Fuß des großen, sechsstöckigen Gebäudes stand – dem Größten in der Para-Siedlung Adolfville –, levitierte er. Er bumste gegen das richtige Fenster und kratzte mit den Fingernägeln an der Scheibe, bis endlich jemand kam, um ihn hereinzulassen.
»Kommt Mr. Manfred nicht?«, fragte Annette.
»Er ist in diesem Jahr nicht erreichbar«, erklärte Omar. »Er ist in einen anderen Bereich übergewechselt und sitzt nur da; man muss ihn durch die Nase zwangsernähren.«
»Würg«, sagte Annette und schüttelte sich. »Katatonie.«
»Legt ihn um«, sagte Straw rau, »dann habt ihr ihn vom Hals. Diese falschen Fuffziger sind mehr als nutzlos; sie lassen euch nur ausbluten. Kein Wunder, dass eure Siedlung so arm ist.«
»Materiell arm«, stimmte Omar ihm zu, »aber reich an ewigen Werten.«
Er hielt sich weit von Straw entfernt. Der Mann war ihm völlig gleichgültig. Straw war trotz seines Namens ein Knochenbrecher. Er hatte Spaß am Zerschmettern und Zermahlen. Er war grausam, weil er gern so war, nicht weil die Umstände es erforderten. Straw war freiwillig böse.
Aber da war auch noch Gabe Baines. Auch Baines konnte – wie jeder Para – grausam sein. Er war so darauf versessen, sich vor Schäden zu bewahren, dass er bedenkenlos Gemeinheiten beging. Man konnte ihn, ebenso wenig wie Straw, deswegen tadeln.
Als Omar seinen Platz einnahm, sagte er: »Gesegnet sei diese Versammlung. Und lasst uns Neuigkeiten von lebenspendenden Dingen hören statt die der Aktivitäten des Drachen des Bösen.« Er wandte sich zu Straw um. »Wie sieht die Information aus, Howard?«
»Es geht um ein bewaffnetes Schiff«, sagte Straw mit einem breiten, grimmigen Lächeln. Er weidete sich in ihrer kollektiven Angst. »Es ist kein Händler von Alpha II, sondern stammt aus einem völlig anderen System. Wir haben einen Telepathen eingesetzt, um ihre Gedanken zu lesen. Sie sind nicht in einer Handelsmission unterwegs, sondern kommen, um …« Er brach ganz bewusst ab, ohne den Satz zu beenden. Er wollte sehen, wie sie sich krümmten.
»Wir müssen uns verteidigen«, sagte Baines. Miss Hibbler nickte und Annette – nach kurzem Zögern – ebenso. Sogar der Heb hatte sein Gekicher eingestellt und zeigte nun eine unbehagliche Miene. »Wir in Adolfville«, sagte Baines, »werden natürlich die Verteidigung organisieren. Wir gehen davon aus, Straw, dass Ihre Leute für die technische Ausrüstung sorgen. Wir erwarten eine Menge von Ihnen. In Zeiten wie diesen erwarten wir, dass Sie sich für das Allgemeinwohl einsetzen.«
»Das ›Allgemeinwohl‹«, höhnte Straw. »Sie meinen unser Wohl.«
»Mein Gott«, sagte Annette, »müssen Sie denn immer so verantwortungslos sein, Straw? Können Sie nicht einmal an die Konsequenzen denken? Denken Sie doch wenigstens an unsere Kinder. Wir müssen wenigstens sie beschützen.«
Omar Diamond sprach ein Gebet vor sich hin. »Lass die Kräfte des Lebens sich erheben und auf dem Schlachtfeld triumphieren. Lass den weißen Drachen dem roten Fleck des Scheintodes entgehen; stülpe deinen schützenden Schoß über dieses kleine Land und bewahre es vor jenen, die im Lager des Unheiligen stehen.« Und dann fiel ihm plötzlich wieder ein, was er auf dem Weg zu Fuß hierher geschaut hatte: einen Vorboten der Ankunft des Feindes. Ein Strom aus Wasser hatte sich in Blut verwandelt, als er über ihn hinweggegangen war. Jetzt wusste er, was das Zeichen bedeutete. Krieg und Tod und vielleicht die Vernichtung der sieben Clans und der sieben Städte – sechs, wenn man die Müllkippe nicht mitzählte, die den Lebensraum der Hebs darstellte.
Dino Watters, der Dep, murmelte heiser: »Wir sind dem Untergang geweiht.«
Alle sahen ihn an, sogar Jacob Simion, der Heb. Es war typisch für einen Dep.
»Vergib ihm«, flüsterte Omar. Und irgendwo im Reich des Unsichtbaren hörte der Geist des Lebens zu, reagierte und vergab dem fast sterbenden Geschöpf, das Dino Watters – aus der Dep-Siedlung Cotton Mather Estates – war.
2
Ohne dem alten Wohnsilo mit seinen porösen Rigipswänden, dem schwachen, wahrscheinlich beschädigten Beleuchtungssystem, dem archaischen Bildfenster und den schäbigen, altmodisch gefliesten Böden mehr als einen kurzen Blick zu widmen, sagte Chuck Rittersdorf: »Für mich wird’s reichen.« Er zückte sein Scheckheft und krümmte sich beim Anblick der schmiedeeisernen Zentralheizung. Er hatte dergleichen seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen.
Doch die Besitzerin des heruntergekommenen Gebäudes runzelte misstrauisch die Stirn, als sie seine Ausweispapiere entgegennahm. »Laut dieser Unterlagen sind Sie verheiratet, Mr. Rittersdorf – und haben Kinder. Es ist nicht gestattet, eine Frau und Kinder mit in diese Wohnung zu bringen. Wir haben sie in der Anzeige ›für einen nicht trinkenden Junggesellen mit Arbeitsplatz‹ ausgeschrieben, und …«
Chuck sagte müde: »Es trifft genau auf mich zu.« Die dicke Hausbesitzerin – sie war in den mittleren Jahren und trug ein Kleid aus venusischer Pfeifgrillenhaut und Wobfellschuhe – ging ihm auf die Nerven. Schon jetzt war es eine miese Erfahrung. »Ich lebe von meiner Gattin getrennt. Die Kinder sind bei ihr. Deswegen brauche ich diese Wohnung.«
»Aber sie wird Sie besuchen kommen.« Die Frau hob die purpur getönten Brauen.
»Da kennen Sie meine Frau aber schlecht«, sagte Chuck.
»Erzählen Sie mir doch nichts. Ich kenne die Bundesscheidungsgesetze. Sie sind nicht mehr wie früher, als die Bundesstaaten noch allein zu bestimmen hatten. Sie waren schon vor Gericht, wie? Haben Sie zum ersten Mal die Papiere gekriegt?«
»Nein«, gab Chuck zu. Für ihn fing es erst an. Gestern Abend war er zu später Stunde ins Hotel gegangen. Die Nacht davor war seine letzte Kampfnacht gewesen, um das Unmögliche zu erreichen – nämlich weiterhin mit Mary zusammenzuleben.
Er gab der Hausbesitzerin den Scheck. Sie gab ihm seine Papiere zurück und ging. Sobald sie die Tür geschlossen hatte, ging Chuck zum Fenster und warf einen Blick auf die Straße, die sich unter ihm ausbreitete. Er sah Autos, Jet-Gleiter, Außenaufzüge und Laufwege für die Fußgänger. Bald würde er Nat Wilder, seinen Anwalt, anrufen müssen. Sehr bald.
Die Ironie des Zusammenbruchs ihrer Ehe hatte ihm den Rest gegeben. Für den Beruf seiner Frau – sie war eine Meisterin ihres Fachs – war die Ehe sozusagen vorgeschrieben. Tatsächlich hatte sie im kalifornischen Marin County, wo sie ihr Büro unterhielt, den Ruf, die Beste ihres Fachs zu sein. Gott allein wusste, wie viele kaputte menschliche Beziehungen sie geheilt hatte. Und doch hatte ausgerechnet ihr diesbezügliches Talent durch einen meisterhaften Schlag der Ungerechtigkeit dazu beigetragen, ihn in dieses abscheuliche Silo zu treiben. Weil Mary sich trotz ihrer Erfolge nicht dem Gefühl widersetzen konnte, Verachtung für ihn zu empfinden. Und ihre Verachtung war in den letzten Jahren immer größer geworden.
Es war eine Tatsache – und er musste sich ihr stellen –, dass er in seinem Beruf nicht annähernd so erfolgreich gewesen war wie sie.
Sein Job, der ihm persönlich eine Menge Spaß machte, war der eines Simulacrum-Programmierers im Geheimdienst der Regierung in Cheyenne. Er war für die endlose Propaganda und Agitation gegen den Ring der kommunistischen Staaten zuständig, die die USA umgaben. Zwar glaubte Chuck persönlich fest an seine Tätigkeit, doch man konnte sie kaum eine hochbezahlte oder edle Berufung nennen. Die Programme, die er austüftelte – um ein anderes Wort zu vermeiden –, waren infantil, verlogen und von Vorurteilen geprägt. Ihr Hauptziel bestand in der Schulung der Kinder der USA, in den kommunistischen Anliegerstaaten und der gewaltigen Masse der Erwachsenen mit niedrigem Bildungsstand. Nahm man es genau, war er ein Zeilenschinder. Das hatte Mary ihm mehr als einmal zu verstehen gegeben.
Ob er nun ein Zeilenschinder war oder nicht, er hatte seinen Job ausgeführt, auch wenn ihm im Verlauf seiner sechsjährigen Ehe andere Unternehmen Angebote gemacht hatten. Vielleicht lag es daran, dass es ihm Spaß machte, menschenähnliche Simulacren reden zu hören. Vielleicht lag es auch daran, dass er seine Tätigkeit für allgemein nützlich hielt: Die Vereinigten Staaten waren politisch und wirtschaftlich in der Defensive und mussten sich schützen. Die Regierung brauchte Menschen, die für – zugegeben – niedrige Gehälter arbeiteten, und zwar in Jobs, denen es an heroischen oder großartigen Qualitäten mangelte. Irgendjemand musste die Propaganda-Simulacren schließlich programmieren, die auf der ganzen Welt verteilt wurden. Die Simulacren mussten schließlich ihren Jobs nachgehen – sie mussten als Vertreter der geheimen Abwehr agitieren, überzeugen und beeinflussen. Aber …
Vor drei Jahren hatte die Krise angefangen. Einer von Marys Klienten – er war in unglaublich komplizierte Eheprobleme verwickelt gewesen und hatte drei Geliebte gleichzeitig gehabt – war Fernsehproduzent. Gerald Feld produzierte die berühmte und einmalige Bunny-Hentman-TV-Show und kontrollierte einen großen Anteil am Unternehmen des populären Komikers. Als kleines Nebengeschäft hatte Mary ihm mehrere Programmskripte gegeben, die Chuck für die örtliche CIA-Zweigstelle in San Francisco geschrieben hatte. Feld hatte sie mit Interesse gelesen, weil sie – und dies erklärte Marys Auswahl – einen ordentlichen humoristischen Teil aufgewiesen hatten. Darin bestand Chucks Talent; er programmierte etwas anderes als das übliche, pompöse, feierliche Zeugs … Man sagte seinen Programmen nach, dass sie voller Witz seien und vor Humor sprühten. Feld war zur gleichen Ansicht gelangt. Er hatte Mary gebeten, ein Treffen zwischen ihm und Chuck zu arrangieren.
Und jetzt, als er am Fenster des kleinen, düsteren, alten Silos stand, in das er noch keinen Fetzen Kleidung gebracht hatte, starrte Chuck auf die Straße hinunter und erinnerte sich an das Gespräch mit Mary, das daraus erwachsen war. Es war ein besonders heißes Gespräch gewesen, ganz bestimmt ein klassisches. Es hatte den Bruch zwischen ihnen auf den Punkt gebracht.
Für Mary war die Sache klar gewesen: Hier war eine Job-Möglichkeit; man musste um jeden Preis am Ball bleiben. Feld würde ihn gut bezahlen, und die Tätigkeit würde gewaltiges Prestige einbringen. Jede Woche würde sein Name zusammen mit denen der anderen Skript-Autoren am Ende der Bunny-Hetman-Show auf dem Bildschirm auftauchen, so dass die ganze Welt ihn lesen konnte. Damit Mary – und das war die Crux – stolz auf seine Arbeit sein konnte, denn sie war nämlich bemerkenswert kreativ. Kreativität war für Mary das Sesam-öffne-Dich zum Leben. Wer für den CIA Propaganda-Simulacren programmierte, die ungebildeten Afrikanern, Lateinamerikanern und Asiaten eine Botschaft vorbrabbelten, war nicht kreativ. Denn solche Botschaften neigten dazu, sich zu wiederholen, und außerdem hatte der CIA in den liberalen, begüterten, hochnäsigen Kreisen, in denen Mary verkehrte, einen schlechten Ruf.
»Du bist wie jemand, der in einem Vorortpark die Blätter zusammenharkt«, hatte Mary erzürnt gesagt. »Als wärst du nur auf eine Verbeamtung aus. Du gehst völlig auf Nummer sicher und drückst dich vor jedem Kampf. Du bist jetzt dreiunddreißig Jahre alt, und schon hast du es aufgegeben, Karriere zu machen. Du hast gar kein Interesse daran, dass etwas aus dir wird.«
»Hör mal«, hatte Chuck barsch gesagt, »bist du eigentlich meine Mutter oder meine Frau? Wieso nimmst du dir das Recht heraus, mich zu gängeln? Muss ich denn überhaupt Karriere machen? Soll ich vielleicht noch TERPLAN-Präsident werden? Ist es das, was du willst?« Abgesehen vom Prestige und vom Geld ging es doch wohl noch um ein bisschen mehr. Mary wollte offensichtlich einen völlig anderen Menschen aus ihm machen. Sie, die ihn von allen Menschen der Welt am besten kannte, schämte sich seiner. Doch wenn er den Job annahm und für Bunny Hentman schrieb, würde er ein anderer werden – so ungefähr ging ihre Logik.
Chuck konnte sich dieser Logik zwar nicht entziehen, aber er hatte sich ihr dennoch widersetzt. Er würde seinen Job nicht kündigen; er würde keinen anderen annehmen. Irgendetwas in seinem Inneren war einfach zu träge dazu, ob es nun dem Guten oder dem Bösen diente. Der Kern eines Menschen wies eine Hysterese auf; diesen Kern legte man nicht einfach ab.
Draußen, auf der Straße, näherte sich ein weißer Chevrolet Deluxe, ein funkelndes neues Sechstürenmodell, dem Bordstein und hielt an. Chuck schaute müßig zu, dann registrierte er mit einem ungläubigen Zusammenzucken, dass es sich – unmöglich – um sein ehemals eigenes handelte. Da war Mary schon. Sie hatte ihn schon gefunden.
Dr. Mary Rittendorf, seine Angetraute, war im Begriff, ihm einen Besuch abzustatten.
Chuck empfand Angst und das zunehmende Gefühl des Versagthabens. Es war ihm nicht einmal gelungen, diese Sache richtig zu handhaben – ein Silo zu finden, in dem er wohnen konnte, ohne dass Mary ihn aufspürte. In ein paar Tagen konnte Nat Wilder für seinen gesetzlichen Schutz sorgen, aber jetzt, in diesem Stadium, war er hilflos; er musste sie hereinlassen.
Es war nicht schwierig zu erkennen, wie sie ihn ausfindig gemacht hatte; einfache Aufspürgeräte waren billig und überall zu haben. Wahrscheinlich war Mary zu einer privaten Robot-Ermittlungsagentur gegangen, hatte die Dienste eines Schnüfflers gemietet und diesem sein Gehirnwellenmuster präsentiert. Das Ding hatte sich an die Arbeit gemacht und war ihm zu jedem Ort gefolgt, an dem er gewesen war, seit er sie verlassen hatte. Das Aufspüren von Menschen war heutzutage eine exakte Wissenschaft.
Also kann eine Frau, die es darauf anlegt, einen aufzuspüren, dies auch tun, sinnierte er. Wahrscheinlich gab es ein Gesetz dafür; vielleicht konnte man es das Rittersdorf-Gesetz nennen. Im Verhältnis zur Größe des Verlangens, sich vor Aufspürgeräten zu verstecken, hat …
Ein Rattern ertönte an der Hohlkerntür der Wohnung.
Als Chuck mit steifen Beinen unwillig zur Tür ging, dachte er: Sie wird mir einen Vortrag halten, der jeden bekannten Vernunftappell enthält. Ich werde natürlich keine Argumente verbringen können, sondem nur das Gefühl, dass es so nicht weitergehen kann; dass die Verachtung, die sie mir gegenüber an den Tag legt, auf ein Versagen zwischen uns hindeutet, das zu grundlegend ist, um irgendeine Art zukünftiger Intimität zuzulassen.
Er öffnete die Tür. Da stand sie, dunkelhaarig und gertenschlank, in ihrem teuersten (und besten) Naturwolle-Mantel, ohne Make-up; eine kühle, kompetente, gebildete Frau, die ihm in unzähligen Dingen überlegen war. »Hör mal, Chuck«, sagte sie, »so läuft es nun nicht. Ich habe eine Spedition beauftragt, deine Sachen abzuholen und in ein Lagerhaus zu bringen. Ich bin nur wegen eines Schecks hier. Ich will das ganze Geld, das auf deinem Konto ist. Ich brauche es, um Rechnungen zu bezahlen.«
Er hatte sich also doch geirrt; sie äußerte keinen süßen Appell an die Vernunft. Ganz im Gegenteil – seine Gattin zog einen Schlussstrich. Er war völlig gelähmt, er konnte sie nur angaffen.
»Ich habe mit Bob Alfson, meinem Anwalt, gesprochen«, sagte Mary. »Ich habe ihn beauftragt, auf einen Prozess um das Haus zu verzichten.«
»Was?«, sagte er. »Wieso?«
»Damit du deine Haushälfte an mich überschreiben kannst.«
»Warum?«
»Damit ich es zum Verkauf anbieten kann. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ein so großes Haus nicht brauche, das Geld dafür aber sehr wohl. Ich melde Debby in dem Internat im Osten an, wie wir’s besprochen haben.« Deborah war ihre Älteste, auch wenn sie erst sechs war; viel zu jung, um von zu Hause fortgeschickt zu werden. Herrjeh.
»Lass mich erst mit Nat Wilder sprechen«, sagte Chuck aufgeregt.
»Ich möchte jetzt den Scheck haben.« Mary machte keine Anstalten, hineinzukommen; sie blieb einfach stehen. Und er fühlte sich verzweifelt und panisch. Es war die Panik des Geschlagenen und Leidenden. Er hatte schon jetzt verloren; sie kriegte ihn dazu, dass er alles tat, was sie wollte.
Als er ging, um sein Scheckheft zu holen, trat Mary ein paar Schritte in die Wohnung hinein. Dass sie ihr missfiel, brauchte sie nicht erst zu sagen, und sie sagte auch nichts. Er fürchtete sich davor, dass sie es aussprach, deswegen schaute er weg und beschäftigte sich mit dem Ausfüllen des Schecks.
»Übrigens«, sagte Mary in beiläufigem Tonfall, »jetzt, wo wir im Guten auseinandergehen, kann ich auch das Regierungsangebot annehmen.«
»Welches Regierungsangebot?«
»Die Regierung braucht beratende Psychologen für ein Interplan-Projekt. Ich habe dir davon erzählt.« Sie schien nicht die Absicht zu haben, sich die Mühe zu machen, ihn aufzuklären.
»Ach ja.« Er hatte eine schwache Erinnerung. »Diese Wohlfahrtsgeschichte.« Ein Resultat des terranisch-alphanischen Zusammenstoßes von vor zehn Jahren. Ein isolierter Mond im Alpha-System. Terraner hatten ihn besiedelt und waren aufgrund des Krieges vor zwei Generationen abgeschnitten worden. Das Alpha-System, das über Dutzende von Monden und zweiundzwanzig Planeten verfügte, war eine Brutstätte solcher Zwerg-Enklaven.
Mary nahm den Scheck und schob ihn zusammengefaltet in die Manteltasche.
»Zahlt die Regierung was dafür?«, fragte Chuck.
»Nein«, sagte Mary distanziert.
Dann würde sie – und das galt auch für die Kinder – also nur von seinem Gehalt leben. Und Chuck begriff: Sie rechnete mit einer gerichtlichen Entscheidung, die ihn zwang, genau das zu tun, was er sich während ihrer sechsjährigen Ehe zu tun geweigert hatte – zu dem, was ihre Ehe überhaupt erst kaputt gemacht hatte. Dank ihres Einflusses auf die Gerichte von Marin County würde sie ein Urteil erwirken, das ihn zwang, seinen Job bei der San-Francisco-Filiale des CIA aufzugeben und sich etwas anderes zu suchen.
»Wie … lange wirst du fort sein?«, fragte Chuck. Es war ganz klar, dass sie die Absicht hatte, diese Pause in der Reorganisation ihres Lebens voll auszunutzen. Sie würde sämtliche Dinge tun, die seine Gegenwart ihr – zumindest theoretisch – verwehrten.
»Ungefähr sechs Monate. Es kommt darauf an. Rechne nicht damit, dass wir in Verbindung bleiben. Alfson wird mich vor Gericht vertreten; ich werde nicht kommen.« Und sie fügte hinzu: »Ich habe einen Prozess wegen der Unterhaltszahlungen angestrengt, damit du es nicht zu tun brauchst.«
Selbst hier hatte sie ihm die Initiative aus den Händen genommen. Er war, wie immer, zu langsam gewesen.
»Du kannst alles haben«, sagte er ganz plötzlich zu Mary.
Ihr Blick sagte: Aber das, was du mir geben kannst, ist nicht genug. »Alles« war im Grunde nichts, wenn es um seine Leistungen ging.
»Was ich nicht habe, kann ich dir nicht geben«, sagte Chuck leise.
»Und ob du es kannst«, sagte Mary, ohne zu lächeln. »Weil der Richter nämlich erkennen wird, was ich von dir schon immer gewusst habe. Wenn du musst, wenn dich jemand zwingt, kannst du dich auch an den Standard anpassen, den man von erwachsenen Männern erwarten kann, die ihrer Gattin und ihren Kindern gegenüber Verpflichtungen haben.«
»Aber … Irgendeine Art Leben muss ich doch auch führen können«, sagte er.
»Zunächst mal bist du uns verpflichtet«, sagte Mary.
Darauf fiel ihm keine Antwort ein; er konnte nur nicken.
Später, nachdem Mary mit dem Scheck gegangen war, suchte Chuck im Einbauschrank der Wohnung nach alten Zeitschriften, die er schließlich auch fand. Er setzte sich im Wohnzimmer auf das uralte dänische Sofa und blätterte sie nach Berichten über das Interplan-Projekt durch, an dem Mary sich zu beteiligen gedachte. Ihr neues Leben, sagte er sich, um das einer Ehefrau zu ersetzen.
In einer Zeitung, die eine Woche alt war, fand er einen mehr oder weniger vollständigen Bericht. Chuck steckte sich eine Zigarette an und las ihn sorgfältig durch.
Das Interplanetarische Gesundheits- und Wohlfahrtsamt der USA nahm an, dass man deswegen Psychologen brauchen würde, weil der fragliche alphanische Mond ursprünglich eine Hospitalwelt gewesen war – ein psychiatrisches Pflegezentrum für terranische Emigranten, die unter dem unnormal hohen Druck der Intersystem-Kolonisation zusammengebrochen waren. Die Alphaner hatten den Satelliten – wenn man von ihren Kaufleuten absah – sich selbst überlassen.
Was man über die momentanen Gegebenheiten auf dem Mond wusste, wusste man von den alphanischen Händlern. Laut ihren Aussagen hatte sich dort im Lauf der Jahrzehnte, während das Hospital von den terranischen Behörden abgeschnitten gewesen war, eine Art Kultur entwickelt, die sie jedoch nicht bewerten konnten, da ihr Wissen über die terranischen Standards nicht ausreichte. Jedenfalls stellte man auf diesem Mond eigene Waren her und betrieb Handel. Es gab also einheimische Industrien. Chuck fragte sich, wieso die terranische Regierung es für notwendig hielt, sich dort einzumischen. Er konnte sich Mary sehr gut dort vorstellen; sie war genau der Typ, den die internationale TERPLAN-Behörde brauchte. Menschen von Marys Art waren immer erfolgreich.